
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Eine Akazie beschattete mit ihren mächtigen Zweigen das Grab mitten in der Wildnis. Nicht mehr ein einfacher Erdhügel bedeckte die irdischen Reste von John Davids, fleißige Hände hatten ein bleibendes Zeichen schaffen müssen, dem Wanderer bemerkbar zu machen, daß hier die Gebeine eines edlen Mannes ruhten, der fern von der Heimat sein Leben für seine Freunde gelassen.
Von einem kunstvoll geschmiedeten Eisengitter eingefaßt, erhob sich ein quadratischer Marmorblock, an welchem auf der einen Seite mit vergoldeten Buchstaben die Worte zu lesen waren:
»
Francis John Davids, Honorable.
Zweiter Sohn des Lords von Dumfries.
Gestorben während der Weltumseglung des ›Amor‹ und
der ›Vesta‹.«
Dieser Seite gegenüber standen die Worte:
»Er ging freiwillig in den Tod, um das Leben
derer zu erhalten, welche er liebte.«
Die beiden anderen Seiten des Steines enthielten die Namen der Besatzung des ›Amor‹ und der ›Vesta‹, so wie aller derer, welche bei dem Ueberfall der Indianer, wobei Davids seinen Tod fand, zugegen gewesen, mit dem Versprechen, den edlen Toten in dankbarer Erinnerung zu behalten.

Die kleine Blockhütte, in welcher einst Ellen und Harrlington den mißgestalteten Flexan zuerst wiedersahen, in welcher einst Davids verschieden war, stand noch, aber sie war erweitert und wohnlicher gemacht worden. Charly, der Waldläufer, und einige seiner Freunde hausten jetzt darin, führten von hier aus Jagdausflüge in die Umgegend aus und waren zugleich die Beschützer und Pfleger des Grabes, Ihr Patron war Felix Hoffmann, welcher überhaupt alles, ohne Wissen seiner Freunde, hatte arrangieren lassen; die Trapper hatten nicht nötig, wegen Mangels an Wildbret ihre Behausung zu verlassen, er sorgte für sie, damit sie hierbleiben und jedem Fremden, der das Grab besuchte, die Geschichte des Toten erzählen konnten.
Der Steinblock und das Gitter waren mit Kränzen und mit Sträußen bedeckt, nicht mit kostbaren Blumenbuketts, in den Läden gekauft, sondern sie bestanden aus Blumen des Waldes und der Prärie.
Jeder der das Grab Umstehenden hatte ein Sträußchen niedergelegt, mancher mit einem Abschiedsspruch, aber auch gar mancher stumm, weil der Schmerz nichts anderes als Tränen hervorbringen konnte.
Zu letzteren gehörte auch Ellen.
Weinend legte sie ihr Sträußchen auf den Stein nieder und stürzte dann an die Brust des Geliebten, ihr Gesicht daran verbergend. Niemand ahnte, wie nahe sie dem Toten gestanden. Jeder wußte zwar, daß Davids für sie gestorben war, er sprang ja in das auf Ellens Herz gezückte Messer, aber was Davids in seiner Sterbestunde verraten, hatte niemand außer Ellen und Harrlington erfahren.
»Er ging freiwillig in den Tod, um das Leben
derer zu erhalten, welche er liebte,«
las Ellen nochmals mit tränenden Augen.
Auch Hoffmann wußte nicht, wie gut er diesen Satz gesetzt hatte. Unter ›derer‹ und ›welche‹ meinte er alle Freunde und Freundinnen des Gestorbenen, Ellen aber bezog diese Worte nur auf sich, aus der Mehrzahl machte sie die Einzahl, und der Spruch paßte nur auf sie.
Selbst Marquis Chaushilm befand sich unter den Versammelten. Er stützte sich auf den Arm Miß Sargents, seiner Braut, zwar noch bleich und elend aussehend, aber in seinem ganzen Aeußeren, besonders in seiner aufrechten Haltung die baldige Genesung verratend. Selbst daß man am Grabe des teuren Freundes stand, konnte den Zug des Glückes nicht verwischen, der in beider Antlitz zu lesen war.
Endlich riß man sich gewaltsam von dem Grabe los und begab sich nach der Blockhütte zu den Waldläufern, um auch ihnen ein Lebewohl zu sagen.
Charly und Joe, die beiden Waldläufer, sowie der alte Fallensteller, welcher nur unter dem Namen ›Biberratte‹ bekannt war, bewohnten die Blockhütte. Letzterer wurde schon zu alt, um von früh bis abends nach den Fallen sehen zu können, er spielte von jetzt ab die Hausmagd – wie er selbst scherzhaft sagte – der beiden Jäger, sorgte für ihre Bequemlichkeit und bereitete den ermüdet Heimkehrenden das Mahl.
Die Biberratte saß auf einer Bank, mit einer Arbeit beschäftigt, neben ihm standen Charly und einige der Herren und Damen.
Zum Abschiednehmen war noch Zeit, man sprach über die baldige Abreise, und Charly ließ sich ganz genau beschreiben, wie so eine Seereise eigentlich wäre.
Die Biberratte hörte kopfschüttelnd zu; die Augen seines jüngeren Gefährten dagegen leuchteten.
»Donner und Doria, da möchte ich dabei sein,« rief er jetzt, »aber ich glaube, viel zu gebrauchen wäre ich nicht, ich bin nämlich noch nie auf dem Meere gewesen. Doch wenn Ihr es gelernt habt, so auf den Schiffen herumzuklettern, da würde ich's wohl auch noch lernen.«
»Du würdest es nicht lange aushalten,« brummte die Biberratte, »auf dem Meere gibt es keinen Wald, Wasser, Wasser, nichts weiter als Wasser, und das kann man nicht einmal trinken – es brennt wie Feuer in der Kehle, so salzig ist es.«
»Und dennoch möchte ich es einmal versuchen.«
»Dir verdenke ich schließlich den Wunsch gar nicht, du hast nichts weiter zu verlieren, als dich selbst,« entgegnete die Biberratte mit hochgezogenen Augenbrauen, »aber daß diese wieder auf dem Meere herumfahren wollen, das wundert mich doch sehr.«
Er meinte damit natürlich die Herren und Damen.
»Warum wundert Ihr Euch darüber?« fragte Ellen.
»Nun, ich dachte doch, Ihr solltet zufrieden sein, daß Ihr nun mit heilen Knochen davongekommen seid, und hübsch machen, daß Ihr zu Hause anlangt. Der Mensch ist doch keine Lerche, die ziellos in der Luft herumschwärmt.«
»Potztausend,« platzte Charly jetzt heraus, »seit du dich zur Küchenmagd verdungen hast, bist du auch ein richtiges, altes Weib geworden. Du schwatzt da einen Unsinn zusammen, daß man sich schämen muß. Was hast du denn bis vor einigen Wochen gemacht, he? Bist du nicht auch ziellos im Walde herumgestrolcht?«
Der Alte schmunzelte.
»Na ja, aber wenn man älter wird, bekommt man Verstand.«
»Dann hast du ihn wohl mit einem Male über Nacht bekommen?«
»Ich habe ihn auf alle Fälle,« beharrte der Alte, »und ich sehe ein, daß es besser ist, man gibt ein wildes Leben auf, wenn man ein ruhiges haben kann.«
»Dann behalte deine Gedanken wenigstens für dich und mach' nicht noch unternehmungslustige Leute zu alten Waschweibern.«
»Die Jugend soll auf den Rat des Alters hören.«
Hoffmann, welcher dieser Unterredung ebenfalls mit beigewohnt hatte, nahm Johannas Arm und ging stillschweigend fort, über Ellens Gesicht flog eine leichte Röte, und die Herren blickten sehr ernst.
»So geht Ihr wirklich wieder zur See?« fragte die Biberratte Ellen.
»Ja.«
»Wieder allein?«
»Jeder auf seinem eigenen Schiff?«
»So wie früher.«
»Und was sagen denn die dazu?« schmunzelte der Alte, auf die Herren deutend.
»Wir müssen damit einverstanden sein,« entgegnete Lord Harrlington für alle.
»Wie kannst du so sprechen?« rief Ellen. »Ihr habt eure Einwilligung sofort gegeben!«
»Nicht sofort; wir mußten lange Reden anhören, ehe dies geschah.«
»Aber unsere Gründe leuchteten euch ein!«
Es hatte wirklich einen harten Kampf gekostet, ehe die Absicht den Damen, auf der ›Vesta‹ nach New-York zurückzukehren, von den Herren, welche jetzt ein gewisses Anrecht auf sie besaßen, gebilligt wurde.
Nicht Ellen war es eigentlich gewesen, welche mit diesem Vorschlage angefangen hatte, es waren andere. Heftig war der Kampf um Ja oder Nein entbrannt, doch die Engländer waren ja Sportsmen, der Sieg war zugunsten der Mädchen ausgefallen. Selbst Williams hatte seine Einwilligung dazu gegeben, daß Miß Thomson auf der ›Vesta‹ die Heimreise antrat.
Nur einer war vom Anfang bis zum Ende dagegen gewesen – Mister Hoffmann. Als er sah, wer zuletzt recht behalten würde, schwieg er, aber Johanna war von den Vestalinnen ausgeschlossen.
Die Mädchen wollten also wirklich noch einmal, zum letzten Male ein Schiff mit eigenen Händen bedienen, nichts, auch gar nichts hatte vermocht, sie von ihrem Entschlusse abzubringen, weder die trüben Erfahrungen, noch die jetzigen Warnungen.
Selbst die Herren sahen ein, daß ihr Verlangen, mit der Eisenbahn oder auf einem Passagierdampfer die Reise nach New-York zu machen, ein unbilliges wäre, um so mehr, als die ›Vesta‹ noch existierte und seetüchtig war.
Die ganze Weltumseglung wäre zwecklos, der Triumph wäre auf jeden Fall verloren gewesen. Nein, die Vestalinnen mußten mit ihrem Schiffe in den Hafen von New-York einsegeln. Dann sollte das Spiel aus sein. Was sich zusammengefunden, sollte für immer gebunden werden, dann steuerte jeder sein eigenes Schiff in den sicheren Hafen, in den Hafen der Ehe.
Die Herren ließen die Mädchen natürlich nicht allein segeln, nach wie vor sollte der ›Amor‹ die ›Vesta‹ begleiten, aber, war unter Lachen ausgemacht worden, diesmal sollte die ›Vesta‹ nicht wieder versuchen, dem ›Amor‹ zu entschlüpfen. Einträchtig wollte man zusammen fahren.
Schließlich war keiner unter den Herren, welcher nur zögernd die Planken des ›Amor‹ wieder betrat, denn – doch lauschen wir noch eine Minute dem Gespräch zwischen dem plötzlich vernünftig gewordenen alten Trapper und Ellen, welche für ihre Freundinnen das Wort führte.
»Ich weiß nicht,« brummte der Alte kopfschüttelnd, »mir will es gar nicht in den Schädel, was Ihr jungen Leute da vorhabt. So dumm bin ich doch nicht, ich kann doch auch sehen, daß Ihr Euch lieb habt ...«
»Wer?«
»Nun, Ihr Männer und Mädchen untereinander.«
»Vielleicht,« lachte Ellen.
»Und zu Hause, in New-York, heiratet Ihr Euch doch?«
»Das ist leicht möglich.«
»Wenn ich also in der Haut eines dieser Männer stäke, dann wäre ich doch ein Narr, wenn ich meine Braut auf einem Schiffe fahren ließe, und ich sollte auf einem anderen hinterherfahren.«
»Das versteht Ihr nicht, Biberratte.«
»Oho, das verstehe ich sehr wohl.«
»Ich glaube kaum. Es ist nun einmal ausgemacht worden, daß an Bord der ›Vesta‹ kein Mann sein darf.«
»Ach, davon spreche ich ja gar nicht. Ich meine, ich würde mich und meine Braut doch nicht dem Meere anvertrauen, wenn ich nach der Heimat will, um sie dort zu heiraten. Das Wasser hat keine Balken.«
»Ja, wie würdet Ihr denn sonst von hier nach New-York kommen wollen?«
»Sehr einfach, auf dem Landweg.«
»Richtig, das fiel mir nicht gleich ein. Ihr würdet also die Eisenbahn benutzen?«
»Um Gottes willen,« rief der alte Trapper erschrocken, »lieber gehe ich direkt in die Hölle, als daß ich mich so einem feuerspeienden und pustenden Ungeheuer anvertraue. Einmal bin ich darin gefahren, aber gleich nach der ersten Minute sprang ich wieder hinaus – brach mir fast den Hals dabei. Brrr, mir schütteln noch jetzt die Gedärme im Leibe, wenn ich nur daran denke.«
»Ja, lieber Mann,« lachte Ellen, »wie wollt Ihr denn sonst nach New-York gelangen? Doch nicht zu Pferd?«
»Zu Pferd ginge es schon eher, das richtige ist es aber auch noch nicht. Nein, zu Fuß, das ist natürlich.«
Die Umstehenden lachten.
»Von hier bis nach New-York sind es etwa 1500 Meilen,« erklärte dann Ellen.
»Mag sein.«
»Wolltet Ihr die laufen?«
»Was ist denn weiter dabei?«
»Oho, das ist eine gewaltige Strecke.«
»Die ein guter Fußgänger in 70 Tagen bequem zurücklegen kann,« war die kaltblütige Antwort, »ich aber wette, daß ich sie in 50 Tagen mache.«
Der Trapper warf einen Blick auf seine geflickten Mokassins, die schon so manche Meile mit Schritten abgemessen haben mochten. Er konnte sich das Lachen der Zuhörer nicht erklären.
»Was gibt's da zu lachen? Wißt Ihr, wo ich geboren bin? Ich bin ein Kanadier, meine Wiege stand an der Hudsonbai, und ich bin als Junge von 15 Jahren den Weg hierher, eine Strecke von 2000 Meilen, gelaufen, ohne mich einmal länger als eben nötig auszuruhen.«
»Wir glauben Euch,« lachte Ellen. »Uns dürfte aber diese Fußreise etwas zu lang werden. Wir ziehen die kürzere Seefahrt vor.«
»Also Ihr wollt lieber schnell und gefährlich als langsam, aber sicher reisen? Da habe ich einen anderen Geschmack, ich ziehe letzteres vor.«
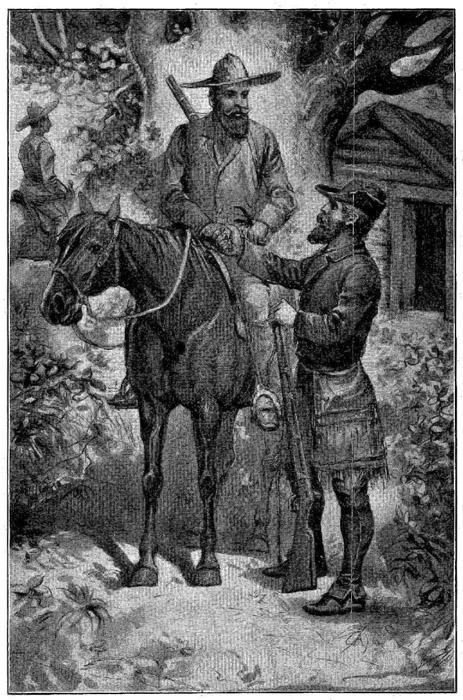
Den Trappern wollte es beim Abschied durchaus nicht in den Kopf, daß ihre Freunde nicht zu Lande reisen wollten.
»Ich auch. Aber, Biberratte, so überlegt doch, was Ihr sprecht! Ist eine Reise von hier nach New-York zu Fuß nicht sehr gefährlich?«
Der Trapper kraute sich in den Haaren.
»Nun ja, man kommt oft in Gefahr, sein Leben zu verlieren.«
»Wie oft war denn Eures in Gefahr?«
»Während meiner Reise nach hier? Du lieber Gott, unzählige Male: Indianer haben mich verfolgt, betrunkene Cow-boys nach mir geschossen, Räuber lauerten überall auf mich, zwei- und vierbeinige. Aber lieber wollte ich doch noch einmal zu Fuß reisen, als mich der Eisenbahn oder dem Schiffe anvertrauen.«
»Das ist wieder Geschmackssache. So viel laßt Euch gesagt sein, daß die Fußreise zehnmal gefährlicher ist als jede andere, der Tod lauert dabei überall auf einen; auf dem Schiffe dagegen droht einem nur dann der Tod, wenn es untergeht, und wenn das häufig vorkäme, dann würde die Schiffahrt wohl nicht in solcher Blüte stehen. Ueberdies, Biberratte, steht man immer in Gottes Hand, gewöhnlich trifft einen da der Tod, wo man ihn am wenigsten erwartet hat.«
Der Trapper schien das einzusehen, er schwieg verlegen.
»Sie vergessen die Landreise per Eisenbahn,« nahm Miß Sargent das Wort, »diese ist nicht nur sicherer als eine Seereise, sondern geht auch bedeutend schneller vor sich.«
»Letzteres gebe ich zu, was die Sicherheit anbetrifft, so sind Sie im Irrtum,« entgegnete Ellen.
»Wie, die Reise zu Schiff wäre sicherer, als die per Eisenbahn? Sie haben sich wohl versprochen?«
»Nein, ich meinte es wirklich so.«
»Können Sie das beweisen?«
»Ja, allerdings nicht hier, es fehlen mir die Statistiken. Glauben Sie vorläufig meinen Worten: auf den Eisenbahnen kommen mehr ums Leben, als auf Schiffen.«
Ellen hatte diesen Vernunftgrund sich aufgespart, um die Herren zur Erlaubnis zu bewegen, auf der ›Vesta‹ die Heimreise anzutreten, doch sie hatte ihn nicht nötig gehabt.
Die Statistiken weisen wirklich nach, daß durch Eisenbahnunglücke mehr Passagiere ihren Tod finden, als durch Schiffsunfälle, und zwar nicht etwa der allgemeinen Anzahl nach, was daraus erklärlich wäre, daß immer mehr Leute zu Land als zu Wasser reisen, sondern der Prozentzahl nach. Man nehme nur eine Zeitung zur Hand: überall wird man von Eisenbahnzusammenstößen, von Entgleisungen, von Einstürzen der Bahnbrücken und so weiter lesen, von Schiffsuntergängen viel weniger. Geht allerdings einmal ein Passagierdampfer mit Mann und Maus zugrunde, so ist die Anzahl der Verunglückten gleich eine sehr große, und man hört und liest die schreckliche Nachricht überall.
Warum aber fuhren die Damen nicht auf einem Passagierdampfer, sondern auf dem im Vergleich zu einem stählernen Dampfer gebrechlichen, hölzernen Segelschiff? Die rücksichtslose Schnelligkeit, mit dem heutzutage die Passagierdampfer durch das Wasser fahren oder vielmehr schießen, um sich nicht von einem Konkurrenten überflügeln zu lassen, ist schuld an den Untergängen der Schiffe, sie rennen in voller Fahrt zusammen. Nicht die Küsten, noch viel weniger die Stürme haben Schiffskatastrophen zu verantworten.
Wie bequem konnte dagegen die ›Vesta‹ segeln! Bei günstigem Winde fuhr sie mit geschwellten Segeln, bei ungünstigem wartete sie auf besseren, und bei, Sturm ließ sie sich mit eingeraffter Leinwand dahintreiben.
O, die noch immer unternehmungslustigen Mädchen hatten tausend Gründe, den Vorteil zu beweisen, den sie hatten, wenn sie die ›Vesta‹ benutzten.
Bei den Herren hatten sie leichtes Spiel; selbst der kranke Chaushilm bestand darauf, die Fahrt auf dem ›Amor‹ mitzumachen, und wirklich war seine Pflege dort eine bessere und liebevollere als irgendwoanders, die frische Seeluft gab ihm sicher seine alte Kraft zurück.
Die Mädchen hatten es sogar so weit gebracht, Hope und Hannes zu bewegen, sie auf der ›Hoffnung‹ zu begleiten. Beide hatten eingewilligt. Die verwundeten und noch nicht genesenen Matrosen konnten entweder auf Hoffmanns Besitzung zurückbleiben oder als Patienten die Reise mitmachen. Die meisten zogen das letztere vor, sie waren zu treue Freunde von Hannes – mit Ausnahme des Bootsmannes Karl, welcher nach längerer Unterredung mit Hoffmann auf einem Passagierdampfer nach Deutschland zurückkehren wollte. Doch davon später mehr!
Die fehlenden Matrosen der ›Hoffnung‹ wollte Hannes in Matagorda selbst anmustern.
Nur in einem Punkte stießen die Vestalinnen wegen ihrer Absicht auf energischen Widerstand bei Hoffmann, und fast schien es, als sollte in dem guten Verhältnis eine Trübung eintreten.
Hoffmann hatte sich bereit erklärt, die Damen und Herren auf dem ›Blitz‹ nach New-York zu bringen, der sicherste Weg, wie er sagte. Niemand konnte dem widersprechen, aber das war es ja nicht, was die Damen wünschten, sie wollten den Triumph erleben, auf der ›Vesta‹ in New-York einzusegeln. Hoffmanns Anerbieten mußte daher ohne Angabe von Gründen abgelehnt werden, und Hoffmann, jetzt erst die wahre Absicht der Damen erkennend, riet davon ab – vergebens. Daraufhin gab sich Hoffmann keine Mühe mehr, die Damen zurückzuhalten, schlug aber auch die Bitte ab, die ›Vesta‹ mit dem ›Blitz‹ zu begleiten. Gern hätte er sie nach New-York gebracht, aber begleiten wollte er sie nicht. Er sagte offen aus, daß er nicht die beschützen dürfe, die trotz seiner Warnung und seines Abratens einen von ihm nicht gebilligten Weg einschlügen.
Daher die Spannung. Doch Hoffmanns Liebenswürdigkeit stellte das gute Einverständnis bald wieder her; überdies war ihre Freundschaft schon zu befestigt, als daß sie durch Aussprechen einer Meinung für längere Zeit oder gar für immer erschüttert werden konnte. –
Noch einen Blick auf das Grab des treuen Davids', noch einen mit den Trappern gewechselten Händedruck, dann bestieg man die Pferde und ritt nach Hoffmanns Besitzung zurück. Auch hier fand eine Abschiedsszene statt. Wer wußte, ob man je einen der Matrosen, welche krank zurückblieben, wiedersah!
In einigen Tagen sollte die Abfahrt von Matagorda aus angetreten werden.
Man sah es dem alten Bootsmann an, wie er nur gar zu gern seine Genesung auf der ›Hoffnung‹ abgewartet hätte, Hoffmann und Hannes, wie auch Hope, ließen es nicht zu.
»Zum Teufel mit der Erbschaft,« rief er ein über das andere Mal, »was mache ich mir daraus? Und muß ich nun einmal nach Deutschland, um die Erbschaft anzutreten, dann soll es wenigstens auf der ›Hoffnung‹ geschehen.«
»Wir fahren möglicherweise erst mit nach New-York, dann erst nach Deutschland.«
»Das schadet ja nichts, ob ich eine Woche eher oder später dorthin komme.«
»Nein, nein, mache es nur so, wie wir beschlossen haben. Du fährst, sobald du einigermaßen wiederhergestellt bist, mit einem Passagierdampfer nach Hamburg und von dort aus nach deiner Heimat, wo dich deine alte Erbtante sehnsüchtig erwartet.«
»Möchte nur wissen, was für ein altes Weib das ist,« brummte Karl verdrießlich, »ich habe überhaupt nie eine Ahnung gehabt, daß ich noch Verwandte besitze. Und wenn sie mich so sehnlichst erwartet, dann kommt es auf ein paar Wochen auch nicht an.«
»Sie könnte unterdes sterben.«
»Wäre mir ganz gleichgültig, wenn sie mir nur ihr Geld vermacht.«
»Pfui, Karl, wie könnt Ihr so sprechen,« mischte sich Hope ein. »Die Tante liebt Euch, sie sehnt sich nach Euch, sie vermacht Euch das Geld, und Ihr sprecht so lieblos!«
»Nichts für ungut, es war nicht so gemeint. Wenn ich nur wenigstens wüßte, was für eine Verwandte das ist. Tag und Nacht grübele ich schon darüber nach.«
»Ja, ich weiß auch nichts weiter, der Brief, der an mich, als an den Kapitän der ›Hoffnung‹ gerichtet, war sehr kurz.
»Müller hieß sie.«
»Ja.«
»Müller, Müller?« murmelte der Bootsmann kopfschüttelnd. »Kenne wohl viele, die Müller heißen – das ist ein sehr gewöhnlicher Name, aber daß ich unter den Müllerinnen auch eine Tante besitze, das ist mir vollständig neu.«
»Freut Euch doch!« sagte Hope.
»Natürlich freue ich mich, daß ich zwanzigtausend Taler erbe. Damit kann man schon eine Zeit lustig leben.«
»Müßt Ihr denn das Geld gleich verjuxen?« fragte Hope.
»Wozu ist es denn auf der Welt?«
»Nun, ich glaube, diesmal werdet Ihr wohl vernünftiger damit umgehen.«
»Ich glaube nicht.«
»Aber ich. Und wenn ich mich in meinen Erwartungen nicht täusche, so werdet Ihr heiraten.«
Karl lachte Hope an.
»Heiraten? Ich? Um Gottes willen, wer wird mich alten Krüppel denn noch heiraten?«
»Eine, die zu Euch paßt.«
»Nein, nein,« seufzte Karl, »das ist vorbei. Wenn ich nicht gerade zum heiraten gezwungen werde, freiwillig gehe ich sicher nicht zum Altar.«
»Dann werdet Ihr eben dazu gezwungen,« entgegnete Hannes und verließ mit Hope den Kranken, der sich stöhnend auf die andere Seite wälzte.
Die Villa diente jetzt nur als Lazarett, nicht mehr als Gefängnis, denn die sieben Verbrecher waren schon vor Wochen von Vertrauensmännern Sharps geschlossen weggeführt worden, wohin, wußte niemand, nicht einmal Hoffmann.
Sharps Bruder, mit dem Beinamen Youngpig, hatte schon lange die Gesellschaft verlassen, ohne die Damen und Herren noch einmal gesehen, ja, ohne überhaupt Abschied genommen zu haben. Der Reporter kennt nun einmal keinen Abschied. Er hat keinen Willen mehr, er ist nur eine Maschine, oder, wie der berühmte Afrikareisende Stanley, früher Reporter des ›New-Dork Herald‹, von sich selbst sagte: der reisende Reporter muß dem Auftrage bedingungslos gehorchen, der ihn seinem Schicksal entgegenführt: ob zum Schlachtfeld, ob zum Festgelage, er lautet immer gleich: »Mache dich bereit und gehe!«
Mister Youngpig hatte sich nach Empfang einer geheimnisvollen Depesche nicht einmal erst bereitgemacht, denn er hatte nichts vorzubereiten, er war stehenden Fußes abgereist. Die Depesche bot ihm einen der Redakteurstühle des ›New-York Herald‹ an, jetzt war er auf dem Wege nach London, um seine dortigen Verbindungen zu lösen und sich mit Weib und Kind in New-York anzusiedeln, wo wir ihm noch einmal begegnen werden.
Schade, daß aus seinem geplanten Auskunftsbureau nichts geworden war, er hätte mit seinen Statistiken die Welt gewiß in Staunen gesetzt.
Während der Anwesenheit der Vestalinnen verabschiedeten sich auch van Guden, dessen wiedergefundener Vater und der Chinese. Letzterer hatte die ihm von den Rebellen geraubte Summe, welche ihm von seinen Landsleuten anvertraut worden war, zurückerhalten. Hoffmann hatte nach Erstürmung der Ruine die vier Millionen Dollar unberührt vorgefunden und sie Wan Li sofort ausgehändigt, ehe sie als Kriegsbeute in Beschlag genommen wurden, wodurch sie zwar dem Chinesen nicht verloren gegangen wären, er aber doch viele Unannehmlichkeiten gehabt hätte.
Der Aufstand gegen die Chinesen war so schnell wieder erloschen, wie er entstanden war. Schon saßen die bezopften Gäste wieder auf ihren alten Plätzen, und so kehrte auch Wan Li nach San Francisco zurück, van Guden und dessen Vater mit sich nehmend. Unter anderem Namen begannen beide ein neues Leben.
Auch von Sonnenstrahl und Waldblüte wurde Abschied genommen. Die beiden roten Kinder der Wildnis waren dazu bestimmt gewesen, ihre geknechteten Brüder der Freiheit zuzuführen, und ihr Vormund, Hoffmann, gab diesen Plan auch nicht auf. Doch nicht mit dem Tomahawk in der Rechten, nicht mit dem Kriegsruf auf den Lippen sollte Sonnenstrahl sein Volk beglücken, Waldblüte sollte es nicht durch wahnsinnige Prophezeiungen begeistern, als Evangelisten und Lehrer sollten sie versuchen, ihr Volk auf die hohe, geistige Stufe zurückzuführen, auf welcher es einst gestanden.
Es ist eine Fabel, wenn gesagt wird, die Indianer müßten untergehen, weil sie einer Zivilisation unfähig sind. Werden sie danach behandelt, so entwickeln sie sich zu einem kultivierten Volke, aber unter einer rücksichtslosen Behandlung sinken sie immer tiefer. Als Beispiel mögen nur die Huronen dienen, jene kriegerische Nation, welche in Coopers ›Lederstrumpf‹ eine große Rolle spielt. Jetzt sind die Huronen ein Ackerbau und Industrie treibendes Volk, sie stellen Advokaten, Richter und Gelehrte, vier Huronen sitzen auf akademischen Hochstühlen, und Mister Nasacki, einer der bedeutendsten Chirurgen von New-York, ist ein Hurone, der als zwölfjähriger Knabe an der Seite seines Vaters noch den Bogen gegen die Blaßgesichter gespannt hat.
Des alten van Gubens Bemühungen waren nicht vergeblich gewesen; er hatte Sonnenstrahl und Waldblüte befähigt, ihre roten Brüder zu belehren, wenn sie nur auf die richtige Bahn gelenkt wurden, und dafür wollte Hoffmann sorgen. – – – – – – – – – –
Dicht nebeneinander lagen im Hafen von Matagorda die vier befreundeten Schiffe: Die ›Vesta‹, der ›Amor‹, die ›Hoffnung‹ und der ›Blitz‹. Die Mädchen waren außer sich vor Freude, ihr geliebtes Schiff wieder betreten zu können.
Hoffmann hatte es von den Riffen entfernen, reparieren und wieder vollkommen seefähig machen lassen. Die Mädchen eilten am Deck umher, jeden Mast, jede Raa, jeden Boller wie einen alten Bekannten nach langer Trennung begrüßend, sie fanden ihre Kabinen unverändert, und Hope fühlte sich in ihrem Museum wieder als Vestalin.
Doch nein, diese Zeit war vorüber, dachte sie gleich lächelnd. Natürlich gestattete ihr Ellen, die Gegenstände, welche sie während der Reise gesammelt und liebgewonnen hatte, an Bord der ›Hoffnung‹ schaffen zu lassen; das Krokodil, die Schlange und alle die hundert Andenken wanderten hinüber.
Es mußte noch Proviant eingenommen werden, und so lange hatten sie Zeit, sich dem Abschied zu widmen, denn jetzt galt es ja die Trennung von einem treuen Freunde und einer treuen Freundin, von Hoffmann und Johanna.
Hoffmann blieb mit Johanna in Texas, wenigstens vorläufig, dann zog er sich auf seine anderen Besitzungen zurück, und Johanna war nicht länger mehr nur seine Braut.
Die letzte Stunde nahte.
Sie standen alle auf der steinernen Einfassung des Hafens. Die Mädchen umarmten noch einmal die weinende Johanna und schüttelten noch einmal Hoffmanns Hand, welche so oft den Tod von ihnen abgewendet hatte. Auch die Herren nahmen Abschied, denn die Schiffe lagen seebereit.
»Wir sehen uns wieder,« sagte Johanna zu Ellen, »wenn nicht in New-York, so doch später. Wo gedenken Sie sich anzusiedeln?«
»In England,« entgegnete Lord Harrlington für Ellen.
Ellen gab lächelnd ihre Beistimmung.
»Und wir in Deutschland,« fügte Hope hinzu. »Erst aber machen wir einen Abstecher nach New-York, um dem Empfange der Vestalinnen beizuwohnen. Ein Schimmer des Glanzes wird wohl auch auf uns fallen.«
Man begab sich auf die Schiffe.
Die Ankerwinde des ›Amor‹ rasselte. Wie früher marschierten die Vestalinnen taktmäßig um das Gangspill, und ihr heller Gesang begleitete die rauhen Stimmen der Matrosen auf der ›Hoffnung‹. Beim Ankerhieven muß gesungen werden, sonst hat das Schiff auf seiner Fahrt kein Glück.
»Fest die Brassen, los die Gitane!« tönte es auf allen drei Schiffen gleichzeitig. Die Segel fielen. Ein frischer Wind schwellte sie, und, ohne geschleppt zu werden, nahmen die Schiffe die Fahrt auf.
Die ›Vesta‹ führte, dann kam die ›Hoffnung‹ und in deren Kielwasser der ›Amor‹. Die Besatzungen waren aufgeentert, nur die Kapitäne und die Offiziere standen auf der Kommandobrücke. Zum letzten Male wollten die aristokratischen Seeleute ihr Schiff mit eigenen Händen über den Ozean lenken.
Auf den Rahen wurden Mützen und Tücher geschwenkt, am Strande wurden die Grüße erwidert.
Arm in Arm standen Hoffmann und Johanna und schauten den verschwisterten Schiffen nach. Jetzt erreichten diese das offene Fahrwasser, es mußte gearbeitet werden; undeutlich trug der Wind die Kommandos noch nach dem Lande, wieder flogen die Rahen herum, die Steuerruder wurden gedreht, die Schiffe schwenkten nach Steuerbord und segelten nun mit dem Winde in voller Fahrt.
Kleiner und kleiner wurden sie. Die beiden vorderen Schiffe hatten vor dem ›Amor‹ schon einen großen Vorsprung, bis man nur eben noch erkennen konnte, wie aus dem Schornstein des ›Amor‹ eine Rauchwolke aufstieg.
»Er dampft,« sagte Hoffmann.
Johanna antwortete nicht. Träumerisch blickte sie den verschwindenden Schiffen nach. Dann fühlte Hoffmann seinen Arm gedrückt.
»Felix,« sagte Johanna leise, »warum bist du so hart und folgst ihnen nicht mit dem ›Blitz‹?«
»Weil sie meinen Vorschlag, sie mit dem ›Blitz‹ nach New-York zu bringen, abgelehnt haben,« entgegnete Hoffmann ernst.
»Das konntest du ihnen nicht verdenken.«
»Und sie können mir nicht verdenken, wenn ich sie nicht begleite. Ueberdies, Johanna, weiß ich sehr wohl, daß ihre Bitte nur eine Höflichkeit war, sie würden mich nicht ernstlich ersuchen, sie zu begleiten, um ihnen beizustehen. Sie sind sehr stolz, diese Damen.«
»Also, wenn sie dich ernstlich gebeten hätten, daß du sie begleiten solltest, so hättest du zugesagt?«
»Vielleicht, ja.«
»Nun, Felix, so bitte ich dich recht herzliche laß den ›Blitz‹ seebereit machen und folge ihnen.«
Hoffmann lächelte.
»Mir fehlen Leute.«
»Du hast mir selbst einmal gesagt, du könntest den ›Blitz‹ mit nur einem Hilfsmanne bedienen.«
Eben wollte Hoffmann antworten, als Ingenieur Anders hinzutrat.
»Kapitän,« meldete er, »die neue Kurbel ist eingesetzt, nur die Drähte brauchen noch gelegt zu werden. In einer Stunde kann der ›Blitz‹ abfahren.«
»Wir wollen noch bis zum Abend warten, Mister Anders.«
» Well, die Segelschiffe haben wir doch bald eingeholt.«
Mit frohem Erstaunen hatte Johanna diese kurze Unterhaltung angehört.
»O, du,« sagte sie dann, Hoffmanns Arm zärtlich an sich pressend, »ich habe noch gar nicht gewußt, daß du dich auch verstellen kannst.«