
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
»Horch, wie die Schakale heulen!«
»Sie freuen sich auf den morgenden Tag.«
»Er wird blutig werden.«
»Ja, das wissen die Tiere auch, sie haben einen feinen Instinkt. Der sagt ihnen das, was uns die Vernunft lehrt.«
»Caracho, daß ich mich in die Sache Estrellas eingelassen habe.«
»Bah, die ist nicht hoffnungslos.«
»Ich glaube doch. Wir werden die Beute der Schakale sein.«
»Fürchtest du dich vor den fünfhundert Blaujacken?«
»Es sind sechshundert.«
»Desto schlimmer.«
»Es gibt ein kleines Gemetzel, weiter nichts.«
»Ja, und einige Leichen.«
»Was macht das?«
»Das macht sehr viel aus, wenn ich unter den Leichen bin.«
»Geh, Kamerad, du bist ein Hasenherz!«
Dieses Gespräch führten zwei Soldaten, welche zwischen den Steinhügeln, am nächsten der Tempelmauer, Posten standen. Es herrschte undurchdringliche Finsternis um sie her. Die beiden Soldaten, obgleich dicht zusammenstehend, konnten sich kaum erkennen. Nur das ferne Geheul der Schakale unterbrach die Stille der Nacht, sonst hörte man nichts, nicht einmal mehr die Schritte der Posten, das Stampfen der Kolben, welches vorhin erklungen war.
»Es ist mir unheimlich,« sagte der besorgte Soldat wieder. »Es ist plötzlich so ruhig geworden.«
»Die Posten sind des Umhergehens müde, sie lehnen sich aufs Gewehr oder haben sich sogar gesetzt.«
»Ich werde es auch gleich so machen.«
»Tu's nicht! Wir stehen zu nahe an der Ruine; die Ronde könnte kommen und uns ertappen.«
»Unsinn, daß wir hier stehen,« brummte der andere, »die Indianer wachen ja draußen.«
»Der Teufel traue den Rothäuten; selbst ist der Mann, denkt Estrella. Ich kann schwören, daß er diese Nacht kein Auge zutut, sondern wacht, wie ein gewöhnlicher Soldat.«
»Es ist viel von uns verlangt, zwei Stunden hier zu stehen.«
»Nach einer Stunde werden wir abgelöst.«
»Ja, dann bricht aber der Morgen an, und wir werden auch nicht ans Schlafen denken können.«
»Das ist der Krieg.«
»Und ich wiederhole aus ganzem Herzen: Caracho, daß ich mich in diese faule Sache eingelassen habe!«
»Pst,« warnte der andere, »ich höre Schritte. Der patrouillierende Offizier wird kommen.«
Die Posten wurden aller zwei Stunden abgelöst. Ein Offizier führte jedesmal die Wachtmannschaft an, aber er kam auch nach jeder Stunde allein, um die Posten zu revidieren.
Jetzt näherten sich Schritte. Diese beiden Posten waren die nächsten, sie wurden stets zuerst geprüft.
»Halt, wer da?«
Die Soldaten entsicherten die Gewehre und schlugen sie nach der Richtung hin an, aus der die Schritte ertönten.
Das Geräusch verstummte. Die Gestalt war stehen geblieben.
»Leutnant der Ronde,« erklang eine Stimme.
»Parole?«
»Wut und Feuer.«
Gleichmäßig setzten die Soldaten die Gewehre ab; die Kolben stampften auf den Boden. Man hörte wieder den Schritt, und in der ersten, schwachen Dämmerung, welche die Finsternis verdrängte, tauchte die Gestalt eines einzelnen Offiziers auf.
Doch konnte man sie auch erst erkennen, wenn sie dicht vor einem stand. Es war etwas nebelig.
»Ist alles ruhig?«
»Alles, Leutnant.«
»Wie haben sich die Indianer verhalten?«
»Wir haben nichts von ihnen gehört.«
Der Leutnant stand unbeweglich, er schien zu lauschen.
»Es ist mir zu ruhig,« sagte er dann, »ich höre die Schritte der Posten gar nicht mehr.«
»Sie sind müde, die armen Kerle.«
»Was soll das heißen?«
»Nun, ich meine nur, sie werden sich auf die Gewehre stützen, ohne ihre Wachsamkeit zu vermindern.«
»Ja, das kenne ich, auf das Gewehr stützen, schlafen und träumen, nennen sie wachen. Wehe dem, den ich schlafend finde!«
Der Leutnant schlug den langen Mantel enger um sich und ging, um die nächsten Posten zu kontrollieren, wozu er nur etwa 20 Meter zu gehen hatte.
Die beiden Soldaten schulterten die Gewehre und schritten wieder auf und ab, möglichst geräuschvoll, um ihre Munterkeit zu beweisen.
Der Offizier hatte sein nächstes Ziel noch nicht erreicht, als er plötzlich stehen blieb und mit der Hand unter den Mantel nach dem Degen fuhr. Vor ihm stand die hohe, dunkle Gestalt eines Indianers.
»Hugh, nicht erschrecken, Geierauge ist treu und wachsam,« flüsterte der Indianer schnell in mangelhaftem Spanisch.
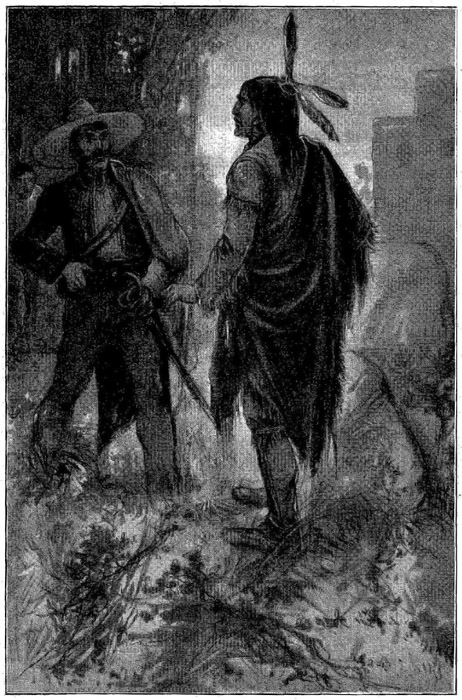
»Hugh, nicht erschrecken! Geierauge ist treu und wachsam,« flüsterte der Indianer dem Offizier zu.
»Wie kommst du hierher?« fragte der Leutnant erschrocken.
Die Indianer sollten diese Steinhügel nicht betreten, die Posten hatten den strengen Befehl, jeden abzuweisen. Etwaige Nachrichten über das Verhalten der Yankees sollten die Indianer den äußeren Posten geben und diese sie in das Quartier bringen.
Der Indianer beantwortete die Frage nicht.
»Deine Feinde liegen nicht still, sie klirren mit den Waffen,« sagte er.
»Wohl! Der Morgen bricht an, sie werden sich zum Kampfe rüsten. Wie kommt aber Geierauge hierher?«
»Auf den Füßen.«
Der Leutnant beherrschte seinen Unmut über diese spöttische Antwort; Indianer sind leicht reizbar.
»Ließen dich die Posten eintreten?« fragte er mißtrauisch.
»Ja.«
»Das ist ja gar nicht möglich, sie haben ...«
Der junge Leutnant konnte nicht weitersprechen, zwei Hände legten sich wie eiserne Klammern von hinten um seinen Hals, er konnte keinen Laut mehr ausstoßen, nicht einmal ein Röcheln. Wohl fuhr seine Hand nach dem Revolver, doch schneller noch blitzte vor ihm Geierauges Messer und grub sich in sein Herz. Der Offizier sank lautlos zu Boden, dennoch ließ der hinter ihm stehende Indianer nicht eher mir dem würgenden Griffe nach als bis ein Zucken durch den Körper des Offiziers ging – er war tot.
Die Morgendämmerung brach an; schon konnte man die Gestalten auf einen Meter Entfernung erkennen.
»Bärenherz war nicht schnell genug,« murrte Geierauge grimmig, »es wird hell.«
»Nur noch zwei.«
»Auch die Bleichgesichter haben Augen.«
»Bärenherz wird sie doch töten.«
»Sie dürfen nicht schreien.«
»Bärenherz wird dafür sorgen, daß sein Messer sie eher trifft, als ihr Mund sprechen kann.«
Die beiden Indianer flüsterten leise zusammen. Sie berieten sich, dann nahm der kleinere, Bärenherz, dem Leutnant den Mantel ab, hing ihn sich um, setzte die Mütze auf die Skalplocke und konnte so wohl für den Leutnant gelten, es war ja sehr nebelig.
»Wenn Geierauge den Arm hebt, legt Bärenherz die Hand ans Messer. Die Soldaten müssen gleichzeitig sterben.«
Mehr zu besprechen, war nicht nötig. Geierauge schlüpfte hinter einen Steinhügel, Bärenherz schritt, als Offizier verkleidet, auf die beiden ahnungslosen Soldaten zu.
Sie schöpften keinen Argwohn, als sie den Leutnant schon wieder auf sich zukommen sahen, er mochte die Ronde schneller beendet haben, als ihm die Pflicht eigentlich vorschrieb.
Bärenherz ging auf den einen Soldaten zu und blieb schweigend vor ihm stehen. Noch brauchte er nicht zu fürchten, erkannt zu werden. Er blickte zu dem anderen Soldaten hinüber, welcher neben einem Steinhügel stand.
Der Soldat wartete auf eine Ansprache des Leutnants, er wunderte sich ebenso wie sein Kamerad über dessen sonderbares Benehmen.
»Leutnant?«
Da erhob sich hinter dem am Hügel stehenden Soldaten eine dunkle Gestalt, und ein Messer grub sich in den Rücken des Ahnungslosen. Er brach zusammen.
»Was war das?« rief der andere und wandte sich um. Doch in demselben Augenblicke fuhr ihm der Stahl des vermeintlichen Leutnants zwischen die Rippen.
»Jesus Maria!« gellte es von den Lippen des tödlich Verwundeten, dann sank auch er leblos zu Boden.
Am Horizont zuckte es blutigrot, auf: die Morgenröte.
»Halloh, was gibt's, wer schreit hier?« ließ sich da eine Stimme vernehmen.
Es war Estrella. Er stand auf der Tempelmauer, welche fast zwei Meter breit war, und spähte, von einigen Soldaten umgeben, in den grauenden Tag.
Er brauchte keine Antwort zu hören, er sah sie. Dort, wo die Posten zwischen den Steinhügeln gestanden, lagen Leichen, so weit sein Auge reichte, wohl dreißig Stück. Eben erblickte er Bärenherz im Mantel des Leutnants, doch Estrella ließ sich nicht täuschen, diese Gestalt schwang triumphierend einen Skalp in der Hand, und dort lag die Leiche des Soldaten ohne Kopfhaut.
»Verrat!« schrie Estrella. Sein Revolver krachte. Bärenherz, der hinter einem Hügel Deckung suchen wollte, machte einen Luftsprung. Er mußte die Verzögerung mit dem Leben büßen. Von allen Seiten eilten bewaffnete Soldaten auf Estrella zu, noch gar nicht wissend, was geschehen war – sie hatten nur den Revolverschuß gehört.
»Verrat! Zu den Waffen!« donnerte Estrella. »Auf die Posten, die Wachen sind überrumpelt!«
Da krachte schon hinter den Hügeln hervor eine Salve, wohl aus fünfhundert Gewehren, die Mauer war plötzlich wie leergefegt. Alle, die eben noch daraufgestanden, wälzten sich in ihrem Blute, nur Estrella war wie durch ein Wunder den Kugeln entgangen.
Salve krachte nun auf Salve. Die Soldaten, welche nicht auf der Verteidigungsstelle waren, fielen im Laufe nach dort. Estrella eilte durch den Kugelregen. Wohl gelang es ihm, die Verteidigung der Ruine zu ordnen, den Matrosen wäre es nicht möglich gewesen, dieselbe im Sturm zu nehmen, die Uebermacht war eine zu starke, aber ehe noch auf Seite der Rebellen ein Schuß gefallen, bedeckten schon Hunderte von ihnen als Leichen den Boden.
Estrella hatte die Situation erkannt.
Die amerikanischen Matrosen lagen hinter den Steinhügeln und überschütteten den vorderen Teil der Ruine mit einem Kugelregen! Wohl hätten sie einen Sturm wagen können, aber er wäre ihnen übel bekommen. Estrella ärgerte sich, daß Macdonald Staunton einsichtsvoll genug war, es nicht zu tun.
Die Ruine bot unzählige Verstecke. Von dort aus wäre gegen die Stürmenden ein vernichtendes Schnellfeuer eröffnet worden.
Das Anschleichen der Yankees hatte einigen hundert Rebellen das Leben gekostet, doch was macht das? Jetzt lagen auch sie hinter den Schutzwehren und erwiderten das Feuer der Yankees. Es gab einen Feuerkampf, der sehr langweilig, aber zum Vorteil für Estrella war. Die Matrosen suchten sich wieder vorwärtszubewegen; sie sprangen von Hügel zu Hügel, und mancher stürzte bei solchem Sprunge getroffen zusammen. Die Rebellen dagegen blieben in ihren Verstecken liegen und suchten die Heranschleichenden zu dezimieren.
Estrella wußte, daß, wenn es den Yankees gelang, in die Ruine zu dringen, Macdonald sofort zum Sturm schreiten ließ. Estrella hätte nur wenige Minuten später zu kommen brauchen, und er hätte die Matrosen schon innerhalb der Tempelmauern gefunden; seine Position wäre verloren gewesen.
Die Indianer waren Verräter. Doch wo waren sie jetzt?
Auf der anderen Seite der Ruine ertönte das Kriegsgeschrei der Indianer; dort wütete ebenfalls ein Kampf.
Indianer kämpften gegen Indianer. Estrella atmete auf. Nur die Apachen und Cherokesen waren abgefallen, Staunton hatte sie gegen die übrigen Indianer rücken lassen.
Jetzt durchschaute er den feindlichen Plan vollkommen.
Die Indianer sollten die ihm Ergebenen zu überwältigen suchen und dann die Ruine von der anderen Seite angreifen. Im Schleichkampf waren die Indianer nicht zu unterschätzen, Estrella hatte in ihnen einen gefährlichen Feind. Einstweilen begnügten sich die Matrosen, mit den Rebellen Kugeln zu wechseln; griffen die Indianer aber erst von hinten an, dann ließ Staunton seine Leute ganz sicher zum Sturm vorgehen.
Nun, vorläufig mußte man abwarten, welchen Erfolg die Apachen und Cherokesen erzielen würden. Doch inzwischen versäumte Estrella nichts, um die Verteidigung der Ruine nach allen Seiten hin zu sichern. Er eilte durch den dichtesten Kugelregen, verteilte seine Leute und stellte sie auf. Starben auch viele auf dem Marsch nach der bezeichneten Stelle, seine Macht blieb immer noch doppelt so stark wie die feindliche.
Die Soldaten lagen so, daß sie die Flanken der Ruine bewachten, bei einem etwaigen Sturm der Matrosen diese aber auch beschießen konnten. Jetzt war ein Sturm gar nicht mehr möglich, nun hieß es, die Yankees in Schach halten und den Erfolg der Indianer abwarten.
Estrella lachte höhnisch auf.
Noch blieben ihm die Gefangenen. Ob die feindlichen Offiziere wohl das Karree beschießen ließen, welches die Damen in sich barg? Nein, aber das Karree würde Tod und Verderben in die Reihen derjenigen speien, welche es mit der blanken Waffe auseinanderzusprengen versuchen wollten.
Neben Estrella stürzte ein Mann zusammen, von der Kugel eines Matrosen getroffen, eine andere durchbohrte Estrellas Mütze. Der Kommandeur ergriff des Gefallenen Gewehr und Patronentasche und warf sich hinter einen Felsblock.
»Spart die Munition!« donnerte seine Stimme der Umgebung zu. »Schießt nur, wenn ihr jemanden seht, dann aber trefft ihn sicher!«
Er sandte Schuß auf Schuß nach den Steinhügeln, ohne den Ueberblick über die ganze Situation zu verlieren. Das Kriegsgeheul der Indianer verriet ihm, wie diese standen. Das der Apachen klang schwach, sie konnten nicht im Vorteil sein.
Von dichtem Gebüsch vollkommen versteckt, lagen fast hundert Mann im Wald und beobachteten den Kampf. Sie setzten sich zusammen aus Hoffmann und seiner Schiffsbesatzung, aus den Matrosen der ›Hoffnung‹, an ihrer Spitze Hannes, aus den Engländern und den anderen, welche sich diesen angeschlossen.
Die Trapper waren nicht unter ihnen, Hoffmann hatte sie ausgeschickt, die Umgegend der Ruine abzuspähen. Bekanntlich liefen von derselben unterirdische Gänge ab, und leicht hätten diese von den Gegnern benützt werden können, um in den Rücken oder in die Seite der Yankees zu kommen.
Ein solcher Versuch sollte von den Trappern dem Kapitän Staunton sofort gemeldet werden, damit dieser ihn vereiteln konnte.
Hoffmann und seine Leute schützten die Matrosen vor einem seitlichen Angriff.
Sharp hatte mit ersterem darüber gesprochen, ob es ihnen nicht gelingen könnte, auf einem solchen Schleichwege ins Innere der Ruine zu gelangen, aber Hoffmann hatte den Plan abgelehnt.
Nach der Aussage von Sonnenstrahl waren alle Gange verschüttet worden; die in der Ruine lebenden Indianer würden aber trotzdem an ihren Mündungen gute Wache halten – dafür sorgte ganz sicher schon Estrella.
Wären Hoffmann und seine Leute dennoch in einen solchen geschlichen, und sie wären entdeckt worden, dann hätte es gewiß ihr Leben gekostet.
Dies Wagnis war zu gefährlich. Ein offener Angriff, und wäre er noch so blutig verlaufen, war immer sicherer als dasselbe.
Der Kampf dauerte schon einige Stunden, und noch immer lagen sie untätig in dem Versteck. Viele waren bereits außer sich über die Verzögerung, sie ließen sich kaum noch abhalten, offen vorzudringen.
Unruhig gingen sie auf und ab. Der dichte Busch verbarg sie vollkommen den Augen der Rebellen. Sie dagegen konnten, spähten sie durch die Zweige, die Soldaten sehen, welche hinter Felsblöcken lagen, die ziemlich freie, nur etwas bewaldete Gegend beobachteten und zugleich nach den Matrosen schossen.
»Wir könnten ganz gut die Kerle dort wegputzen,« sagte Marquis Chaushilm ungeduldig. »Der dort liegt gerade so, daß ich ihm eins an den Kopf brennen kann.«
»Nur Geduld!« beschwichtigte ihn Hoffmann, welcher ruhig im Grase lag, im Arm eine kurze, etwas gebogene Toledoklinge. »Noch ist es nicht Zeit, die Rebellen wissen zu lassen, daß auch hier Feinde versteckt liegen.«
»Sie schießen aber die Amerikaner kreuz und lahm.«
»Dafür werden wir nachher wie ein Wetter über sie herfallen und vernichten. Meine Herren, spielen Sie nicht so mit den Waffen, das Blitzen derselben könnte uns verraten und unseren Plan zu nichte machen.«
Unmutig stießen die Herren ihre Degen und Entersäbel in die Scheiden zurück, sie konnten ihre Kampfbegier kaum noch bemeistern.
»Wann soll denn der Angriff beginnen?« fragte Williams.
»Nicht eher, als bis Kapitän Staunton seine Leute zum Sturm vorgehen läßt.«
»Das kann noch lange dauern.«
»Dann warten wir eben.«
»Die Yankees schmelzen immer mehr zusammen.«
»Die Rebellen nicht minder.«
»Aber es ist fürchterlich, so untätig zu warten, während andere ihr Leben aufs Spiel setzen.«
»Das ist Kriegsbrauch,« lächelte Hoffmann. »Wir müssen auf jeden Fall so lange hier warten, bis Sonnenstrahl uns die Nachricht bringt, wie sich die Indianer gegenüberstehen.«
Zwischen den Schüssen hörte man das Kriegsgeheul der Indianer, doch klang es zu entfernt, um zu schließen, welche der Parteien als Sieger aus dem Kampfe hervorgehen würde.
»Sonnenstrahl wird es vorziehen, seinen roten Brüdern zu Hilfe zu kommen.«
»Er kommt hierher zurück.«
Die Büsche teilten sich, und der Jüngling trat in den Kreis.
»Nun, wie stehen die Apachen und Cherokesen?« fragte Hoffmann denselben.
»Wie Männer, ihre Feinde wanken wie Weiber. Nicht lange dauert es, so laufen sie vor den Tomahawks der Apachen davon.«
»Wo stehen unsere Freunde?«
»Vor der Ruine.«
»Bravo, so ist es ihnen bereits gelungen, sich zwischen die Ruine und die feindlichen Indianer zu stellen. Wer führt sie an?«
»Stahlherz die Cherokesen, Adlerfeder die Apachen. Die Feinde wandten sich schon zur Flucht, als Sonnenstrahl sie sah. Der Kriegsruf der Apachen ist zu schrecklich. Wo sich das Gerippe zeigt, flieht alles. Doch Stahlherz ist ein Mensch, er kann nicht überall sein.«
»Meine Herren,« sagte Hoffmann ernst, den Degenriemen enger schnallend, »die Entscheidung naht. Wenn der Kriegsruf der Apachen in den Ruinen gellt, kommandiert Kapitän Staunton zum Sturm, und wir selbst rücken vor. Von drei Seiten angegriffen, müssen die Rebellen weichen.«
Eine wilde Kampfesfreude bemächtigte sich aller. Sie machten sich bereit, im Sturmschritt, trotz allen Gewehrfeuers, auf die Ruine vorzurücken.
Doch den Apachen mußte der Sieg nicht so leicht werden, ihr Kriegsruf ward noch immer von dem der Feinde beantwortet.
»Horch, was ist das?« rief plötzlich Williams, welcher noch auf dem Boden lag. Er näherte sein Ohr der Erde, die übrigen folgten seinem Beispiel.
»Eine unterirdische Erschütterung,« sagte Hoffmann sofort. »Es wird unter Erde gearbeitet, aber etwas entfernt von hier. Sonnenstrahl, ist hier ein Gang?«
»Ja, er mündete nicht weit von hier im Wald, doch jetzt ist er verschüttet.«
»So graben sie ihn wieder auf.«
»Es war mir, als hörte ich eine schwache Explosion,« flüsterte Williams.
»Leicht möglich,« entgegnete Hoffmann, »die Rebellen suchen ihn benutzbar zu machen, um den Yankees in die Seite zu fallen. Dies müssen wir verhindern.«
»Ha,« rief Sharp plötzlich, »seht dort, die Rebellen verlassen ihre Verstecke auf dieser Seite, sie sammeln sich, sie verschwinden.«
»Das sind die, welche durch den Gang ins Freie gelangen sollen,« entgegnete Hoffmann.
»Eine bessere Gelegenheit, einen Sturm zu wagen, haben wir nicht, als gerade jetzt,« meinte Harrlington. »Die zweihundert Meter, welche uns von der Ruine trennen, können wir im Laufschritt durcheilen, ohne ein Menschenleben beklagen zu müssen.«
»Und doch dürfen wir es nicht tun. Einmal ist dies wider die Verabredung. Kapitän Staunton beginnt den Sturm, nicht wir, und dann die Truppen, welche den Yankees in die Seite fallen sollen? Diese müssen wir unbedingt fernhalten.«
»Dann verraten wir unser Versteck.«
»Wir führen zwei Manöver mit einem Male aus. Haben wir die ankommende Truppe zersprengt, dann bleibt uns allerdings nichts anderes übrig, als sofort gegen die Ruine vorzugehen. Sonnenstrahl, wo liegt die Mündung des Ganges?«
Der Indianer beschrieb den Platz; noch war er aber damit nicht fertig, als auf einen Wink Hoffmanns plötzlich alle lautlos und mit angehaltenem Atem dastanden.
Durch den Wald kamen, hinter den Bäumen Deckung suchend, etwa 200 Rebellen. Ihre Aufgabe war es, den Matrosen in die Seite oder in den Rücken zu fallen. Die Stellung der Yankees wäre dann haltlos gewesen.
»Harrlington, Vogel,« flüsterte Hoffmann, die Anführer je einer Truppe zu sich rufend.
»Wenn diese Rebellen zwischen uns und der Ruine sind, geben wir ihnen zwei Salven, nicht mehr. Dann unter Hurra, auf sie los. Die Stehenbleibenden werden niedergemacht, dann gehts im Sturmschritt weiter gegen die Ruine, unterwegs gilt's wieder zu laden und uns der Ruinenmauern zu bemächtigen. Das übrige wollen wir Gott anheimstellen. Hoffen wir, daß bei unserem Vorgehen auch Kapitän Staunton zum Sturm schreiten läßt und die siegreichen Apachen und Cherokesen erscheinen.«
Die Anführer instruierten ihre Leute, Harrlington seine Freunde; die Waffen wurden bereitgemacht.
Die Rebellen hatten keine Ahnung von dem Hinterhalte. Die beiden führenden Offiziere beachteten den Busch nicht. Ihre Augen waren nur auf die Steinhügel gerichtet, hinter welchen die amerikanischen Matrosen lagen und noch immer auf die Rebellen feuerten.
Wehe ihnen, gelang es diesen zweihundert Mann, in ihre Seite zu kommen! Ihre langausgestreckten Körper boten sichere Zielpunkte, sie waren rettungslos verloren.
»Vorsichtig, Leute!« warnte ein Offizier. »Noch diese Baumgruppe passiert, dann tiefer in den Wald.«
»Feuer!« hallte da ganz in der Nähe ein Kommando, und zugleich mit dem Donner der Salve wälzten sich fast hundert Rebellen in ihrem Blute, eine zweite ließ nur noch wenige verwirrt nach den Waffen greifen.
»Hurra, marsch, marsch!«
Wie der Wind stoben die Angegriffenen auseinander, allein zu spät, sie fielen unter den Hieben der blanken Waffen, welche von den aus dem Busch Stürmenden geschwungen wurden. In raschem Laufe, aber geordnet, ging es weiter, gegen die Ruine vor. Sie waren nun doch verraten, sie brauchten nicht mehr still zu sein.

»Hip, hip, hurra!« erklang es von den Lippen der Engländer.
»Hurra!« riefen die deutschen Matrosen nach.
Die Mauer dort war verlassen, kein Schuß fiel, und ehe Estrella die Gefahr überhaupt bemerkte, lagen die kühnen Stürmer schon hinter der Mauer, und ihre Kugeln bestrichen dieselbe.
Estrella erkennt, daß er seine jetzige Stellung aufgeben muß, will er nicht seine Leute aufreiben lassen. Der Trompeter neben ihm erhebt das Horn. Doch das Signal hat keine Wirkung mehr, denn plötzlich schmettern die Klänge des amerikanischen Sturmmarsches, die Matrosen rücken mit aufgepflanztem Bajonett vor, an ihrer Spitze Kapitän Staunton, den Degen in der Faust.
Noch eine Salve kracht ihnen entgegen, die Matrosen lassen sich nicht aufhalten. Im Nu haben sie die vordersten Reihen der Rebellen erreicht, der Stahl des Entersäbels gräbt sich in die Eingeweide, und die Hintenstehenden empfangen Revolverkugeln.
Die Rebellen können jetzt nicht an Widerstand denken, sie sind im Nachteil, weil sie das Bajonett noch nicht aufgepflanzt haben, das Feuern im Nahkampf ist unmöglich.
Estrella muß seine Leute erst sammeln und ihnen Zeit zur Besinnung geben. Er hält sich noch nicht für verloren, noch immer ist die Uebermacht auf seiner Seite.
Da ertönt indianisches Kriegsgeschrei im Rücken der Ueberraschten. Rote Gestalten schwingen sich über die Mauer, voran das weiße Gerippe der Apalachen.
»Hurra!« ertönt es zur Linken. Hoffmann führt seine Truppe an. Die blanken Waffen blitzen in der Sonne.
Sie werden von einer Salve begrüßt, die letzte, welche die Rebellen auf Kommando feuern können.
Vor Hoffmanns Füßen stürzt ein Matrose, ein zweiter, ein dritter, neben Harrlington sinkt Marquis Chaushilm nieder. Der Lord wirft einen bedauernden Blick auf ihn, dann geht es weiter, er muß über Hendricks springen, der sich stöhnend am Boden windet, weiter, immer weiter.
Alle Ordnung ist aufgelöst. Mann kämpft gegen Mann. Das Gewehr ohne Bajonett ist nutzlos; nur der Revolver knallt, der Degen sticht, und der Entersäbel schlägt. Die ganze Ruine ist ein einziger, großer Schlachtplatz. Am nördlichen Flügel ist es den Rebellen gelungen, sich zu sammeln. Ihre Kugeln begrüßen die anstürmenden Indianer. Wie Halme stürzen sie nieder.
Estrella verliert den Mut nicht.
»Zurück nach dem Plateau!« ruft er mit heiserer Stimme.
Hoffmann versucht vergebens, zu ihm zu gelangen. Selbst seiner Toledoklinge, so furchtbar sie auch wütet, ist es nicht möglich, die dichten Reihen der Rebellen zu durchdringen. Estrellas Raufdegen hält die Matrosen ab, jeder Stich wirft einen nieder.
Hoffmann ahnt den Plan des Gegners, er versucht wie ein Wahnsinniger, durch die Reihen der Feinde zu brechen. Immer mehr Rebellen eilen einem Plateau zu, auf welchem Offiziere sie empfangen und aufstellen, Estrella selbst schlägt sich noch mit einigen hundert Mann gegen die Yankees, er will diese nur aufhalten.
Hoffmann sieht Staunton kämpfen.
»Nach dem Plateau,« ruft Hoffmann ihm zu, »ein Karree soll dort gebildet werden. Wir müssen dem zuvorkommen, sonst sind wir verloren.«
Estrella hat diese Worte vernommen, er lacht höhnisch auf. Er kreuzt die Waffe jetzt mit Kapitän Staunton, eine halbe Minute nur, dann fährt die Spitze seines langen Raufdegens durch Stauntons Hand. Dieser läßt den Degen sinken, er erwartet den tödlichen Stoß, aber Estrella kann denselben nicht ausführen, er wird von seinen eigenen Leuten fortgerissen. Hoffmann dringt ihm nach. Neben ihm fällt sein Ingenieur Anders. Dort sieht er den Holländer rasen. Sein Entersäbel mäht Rebellenköpfe ab.
»Nach dem Plateau!« heult Estrella und bricht sich Bahn.
»Kein Schuß mehr!« ruft Hoffmann. »Nach dem Plateau! Braucht nur die Säbel!«
Auf dem Plateau haben sich Rebellen angesammelt, schon werden sie zum Karree formiert. Es liegt neben einer Felswand, also nur drei Seiten müssen gebildet werden.
In dem Gestein ist eine Oeffnung, und eben sieht Hoffmann, wie die gefangenen Damen herausgeführt werden. Man führt sie in die Mitte des Karrees, ihre Gesichter drücken Verzweiflung aus.
Die Yankees und die Freunde Hoffmanns begreifen, warum dieser so gerufen.
»Kein Schuß mehr!« ertönt es überall, die Besitzer von Degen werfen die Gewehre, sogar die Revolver weg.
Auch Estrella wendet sich, wie die übrigen, zur Flucht, er muß das Karree erreichen, dann kann es sein mörderisches Feuer eröffnen, es selbst darf nicht beschossen werden, die Anwesenheit der Damen verbietet dies. Feuert es jetzt schon, treffen die Kugeln die Rebellen, darum zurück.
»Sie dürfen es nicht eher erreichen als wir,« ruft Hoffmann, mit der Kraft der Verzweiflung vorwärts dringend.
Dem Anführer der Rebellen soll dies auch nicht gelingen, Estrella hat sich am Fuße verwundet, er ist in ein Bajonett getreten, er kann nicht mehr fliehen. Wie ein verwundeter Tiger fährt er herum und – steht vor Hoffmann.
»Ah, Estrella, wir sehen uns doch wieder!«
Jener erwidert nichts. Blitzschnell sticht und schlägt der Raufdegen auf den Gegner ein, allein vergebens. Estrella mag ein ausgezeichneter Fechter sein, Hoffmann ist ihm überlegen. Drei Sekunden lang begegnet der Raufdegen, wie er auch geführt wird, der Toledoklinge, bis sich diese wie eine Schlange um den Degen windet. Er fliegt davon, Estrella vermag ihn nicht zu halten.
»Ergebt Euch!«
»Stecht zu!«
Hoffmann braucht nicht zu überlegen, ob er Pardon geben soll, ein aufgepflanzter Entersäbel dringt in die Eingeweide des Anführers der Rebellen, Estrella sinkt nieder.
»Hol' Euch die Pest!« Mit diesem Fluche entflieht seine Seele. Bajonette haben eine furchtbare Wirkung, beim Rückziehen aus der Wunde werden sie umgedreht.
Vorwärts! Weiter, weiter! Das Karree hat sich gebildet.
Hoffmann ist der Verzweiflung nahe. Er sieht es, das Karree kann nicht mehr erreicht werden, die Flüchtlinge sind eher dort. Schon knallen Salven den Indianern entgegen, an ihrer Spitze steht nicht mehr Stahlherz, sondern Sonnenstrahl.
»Tod oder die Freiheit der Gefangenen!« ruft Hoffmann und stürzt vorwärts. In einer halben Minute müssen die Gewehre krachen.
Doch was ist das? Schickt der Himmel Engel herab, welche für die gerechte Sache streiten sollen?
Aus demselben Gange, aus welchem vorhin die gefangenen Mädchen geführt wurden, stürzt ein Offizier, ein Knabe, hervor, ihm folgen etwa zwanzig Mann. Der Knabe hat einen Degen in der Faust, er springt ins Karree hinein. Seine Leute folgen ihm, sie haben die Büchsen umgedreht und lassen die Kolben auf die Köpfe der Rebellen schmettern.
Hoffmann hat sie erkannt: Es sind die fehlenden Matrosen vom ›Blitz‹ und die der ›Hoffnung‹, er erkennt Georg und den Bootsmann, auch den Jüngling an der Spitze, es ist sein Schützling, Leutnant Ramos, den er erzogen hat. Er vergilt jetzt die ihm erwiesenen Wohltaten.
Das Karree gerät in Unordnung, es hat einen inneren Feind zu bekämpfen. Die Rebellen achten nicht auf die anstürmenden Yankees und Engländer, sie wenden sich gegen die Eindringlinge. Sie schießen und töten ihre eigenen Kameraden.
Doch es gelingt ihnen nicht, die Ordnung wiederherzustellen; ihr Offizier fällt vom Degen des jungen Leutnants. Die Kolben der deutschen Matrosen wüten wie Keulen. Jeder Schlag zerschmettert einen Rebellenschädel.
»Drauf und dran!« donnert Hoffmann, er hat zuerst das Karree erreicht, dann prallen die Engländer gegen die erste Reihe, dann kommen die amerikanischen Matrosen.
Die ferne Musik begleitet den letzten Sturm; er bedeutet die Vernichtung des Karrees. Im Nu ist es auseinandergesprengt, alles löst sich in Flucht auf.
»Pardon, Pardon!« heult es überall.
Es gibt keinen. Den Knienden durchsticht der Degen, den Verwundeten das Bajonett, ein Kolbenschlag wirft den noch Auferstehenden nieder.
Auch die Indianer sind herangekommen. Sie finden keine Arbeit mehr, der Tomahawk wird eingesteckt, das Skalpiermesser hervorgezogen, und eine blutige Kopfhaut nach der anderen reiht sich an ihre Gürtel. Sonnenstrahl ist der einzige Indianer, welcher keine Skalpe nimmt; finster schaut er den roten Brüdern zu.
Die Engländer, Hoffmann an der Spitze, haben die Mädchen erreicht. Mit lauten Freudenrufen stürzen sie auf dieselben zu, sie wollen sie von den Fesseln befreien, aber sie kommen zu spät, die von Ramos angeführten Matrosen haben die Stricke, welche die Hände fesselten, bereits durchschnitten.
Hoffmann steht einen Augenblick erstaunt da. Leutnant Ramos lehnt sich an Johanna, ein Arm umschlingt ihren Hals, die andere Hand hält den abgebrochenen Degen. Das Antlitz des Jünglings ist mit Blut bedeckt, es fließt aus tiefen Kopfwunden herab. Aber sein Blick ist heiter, er lächelt, und auch Johanna hat ihn umschlungen. Man glaubt ein Liebespaar vor sich zu haben.
»Mister Hoffmann,« sagt er freudig, »ich habe meinen Schwur gelöst. Sie sind mein Wohltäter, hier ist Ihre Braut.«
Er läßt seinen Arm sinken, Johanna will sich an die Brust des Geliebten werfen, aber sie kann es nicht, denn zwischen beiden stürzt der junge Leutnant lautlos nieder – er hatte keine Stütze mehr.