
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
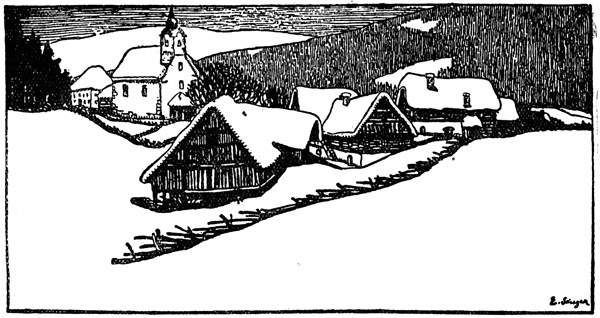
Am Lichtmeßsonntag fuhr ich vor vielen Jahren im Schlitten ins hinterste Gebirgsdorf unter der Alm, um unter dem Landvolk zu werben. Die Zeit war kurz und die nahen Wahlen in die Nationalversammlung hatten die Gemüter aufs tiefste erregt; in den Zeitungen tobte ein erbitterter Kampf der Meinungen und die außerordentliche Wichtigkeit der drohenden Ereignisse hatte auch mein für Politik wenig aufnahmsfähiges Gewissen wachgerüttelt. Den Inhalt meiner Rede hatte ich mir in großen Zügen zurechtgelegt. Meine Aufgabe erschien mir, bei einem angeborenen Blick für das Erreichbare und da ich mich frei wußte von Parteiblindheit und Klassenhaß, nicht allzu schwer.
Tagelang hatte es geschneit. Im frühen Morgen lag das weite Land still und weiß unterm grauen Himmel und noch immer fielen die Flocken sparsam durch die ruhige Luft. Immer tiefer ging's in die winterliche Gebirgswelt hinein, dem Wasser entgegen, immer stiller ward die Natur und immer eindrucksvoller. Noch klangen mir im Ohr die erregten Reden der gestrigen Wählerversammlung, der Kampf der Meinungen, die Sorge um die nächste Zukunft. Aber immer leiser wurde der Nachklang.
Hinter dem vorletzten Dorfe, das von hoher Warte weit ins Land zurückschaut, pflügte der Schlitten nur noch schwer durch die hoch überschneiten Geleise. Die Schellen klangen leise. Fast traumhaft mischten sich geistige Spannung und schweigende Natur. Schlagworte wurden zu Bildern. Da standen mir zur Seite die Straßenschranken, brüderlich verschränkt mit hohen Schneehauben – die Festbesoldeten; da und dort ein Wegpfahl, kümmerlich erhalten, doch in treuer Pflichterfüllung – die Lehrerschaft; hie und da ein behäbiges Häuslein, bis aufs Dach verriegelt, mit schmauchendem Rauchfähnlein im Schornsteine – die Hausbesitzer; eine Brettersäge, eine rußige Schmiede, ein Bauernmühlchen – die Industriellen. Und wo ein Waldweg in ferne Einsamkeit lief, ein Bildstock, ein Marterl an grauer Lärche, darin der Heiland – ach – von seinen ersten Christen träumte. Doch immer mehr tilgten die Schneewuchten und zunehmende Einsamkeit die Erinnerung an die laute Welt und wie aus weiter Ferne nur tönten mir einzelne Sätze meiner Rede im Ohr. Den Kampf um die Wasserkräfte hatte die kleine Bauernmühle längst aufgegeben, die, Rad und Fluder vom Blaueis überschleiert, hilflos und ergeben unterm Schnee hervorsah, und wie ein Hohn auf die freie Selbstbestimmung schien es, wenn die schlanke Esche am Bachrande im wilden Schneetreiben zusammengebrochen war. »Nichts zu machen« – der altösterreichische Wappenspruch riß mich wieder trotzig auf.
Beim Kreuzwirt im Dorfe gab's dampfendes Drängen und Treiben, auch kein Mangel an Buchenlaubtabak und Most, hie und da der scharfe Duft eines Schnäpsleins. Bald zwängte sich alles über die Stiege und stand geduldig wogend oben im Saale, eine festgestopfte Menge im Lodenrock und grünem Hute. Dazwischen die Weiber und Dirndln, geschoben und gedrückt, wie es eben Frauenschicksal ist.
Und ich begann. Sprach eingangs von meinem Leben unter dem Bauernstande, von der Not der Stunde, vom Weltkrieg und was er an Leid und Sorge bis in die letzten Almhütten gebracht. Lautlos lauschte die Menge wie brave Kinder dem Lehrer, als ob ich ihnen Neues sagte. Bald aber tauchten aus dem Kreise der Zuhörer bekannte Züge auf: der Dietmar, der seine beiden Söhne am Duklapasse verloren, die Ebnerin, deren Mann seit drei Jahren aus Sibirien nicht mehr geschrieben, der Jäger Rauchenegger, der nach unendlichen Heilversuchen in Feindesland mit seinem wunden Beinstumpfe von den Grenzen Chinas ins Heimatdorf gekrochen war, die Bachbäuerin, die allein seit drei Jahren einen trostlosen Kampf kämpfte gegen Verordnungen und Betreibungen, um ihre fünf hungrigen Mäuler daheim zu stillen.
Eine leichte Unsicherheit überkam mich.
Was wog meine Schilderung, aus Zeitungsnachrichten und den Berichten von Augenzeugen gebaut, gegen das Schwergewicht ihres eigenen Erlebens? Fast oberflächlich und leer tönten meine Schlüsse hin über ihr langsam mahlendes Verarbeiten eines harten Schicksals.
Ich war froh, vom Wiederaufbau sprechen zu können und wie das deutsche Bürgertum »endlich geeint« (wirklich, so sagte ich!) – sich die Zukunft des neuen Staates vorstelle. Es waren tüchtige offene Wahrheiten, vernünftig überlegt, aus ehrlicher Überzeugung gesagt, ohne Unglimpf auf die anderen Parteien, nur da und dort mit begreiflichem Zweifel gemischt an der Möglichkeit, ihre Weltanschauung dem neuen Aufbau dienstbar zu machen.
Meine Zuhörer blieben aufmerksam und unbewegt.
Aber bei den Anklagen gegen das unheilvolle Eingreifen des Judentums im Kriege wurden sie wärmer. Beim Namen Kerlinger – oder hieß er ähnlich? – zog sich manche Stirne finster und der Wiacherl spie umständlich aus. Die Aufteilung übergroßer Grundbesitze gab ihnen manch frohen Ausblick für die Wirtschaft, bei der Auflassung der Jagdsonderrechte lachte der alte Waldjosl, der verschlagenste Wildschütze in der Gemeinde, pfiffig in sich hinein und beim Wahlrecht der Frauen stieß die frische Güntnerin ihrem verliebten Gatten kräftig in die Seiten.
Ich wurde zuversichtlich. »Auf diesem Wege also wollen wir eine wahre Volkspartei werden, eine –«
»Geldsackpartei! Geldsackpartei!« kam's scharf wie Peitschenhiebe aus der rechten Ecke und ein blasses, verzerrtes Gesicht reckte sich über all die Köpfe und sprudelte in blindem Haß eine Fülle eingelernter Schlagworte aus den Wahlkämpfen der letzten Wochen gegen mich.
Ich war betroffen. So viel an verbissener Wut hatte mir noch nie ins Gesicht geschlagen. Wie ein Steinwurf in ein ruhiges Wehr hatte der Zwischenruf gewirkt. Man drängte nach dem Schreier hin, man rief zurück und hieß ihn grob das Maul halten. Mein Vorschlag, den Gegner nach mir anzuhören, ging spurlos unter. »Der Dokta wird's wul besser wissn als wia so a narrische Schneidergoaß«, lautete mehr überhaps als sachlich das Endurteil. Der Rufer war im Gedränge verlorengegangen.
Die Politik hat ihr Opfer gefordert.
Aber auch an mir.
Denn wie man sich mir wieder zuwandte, und wieder mit dem prüfenden Ernst achtungsvoller Ruhe, nicht zweifelnd gerade, aber doch bedachtsam erwartend, da überkam mich noch im Sprechen die klare Einsicht, daß nur das Wirkliche auf meine Zuhörer wirke. Was sie bewegen sollte, mußte dem Wurzelgrunde ihres Wesens nähe bleiben. Ich fühlte: da stand mir eine Welt gegenüber, nicht fremd, aber so in sich verschlossen, daß ich sie letzten Endes nicht durchdringen könne. Und war fast froh darüber. Als trügen sie auch über der stillen Welt ihres inneren Lebens das steiflodene Gewand, um das meine Worte umsonst nach Einlaß tasteten. Oder wie der feste knappe Rasen ihrer Almweiden sich dem stürzenden Regen nur langsam und zögernd erschließt.
Und was mir seither zur Gewißheit geworden ist, stahl sich fast unbewußt in meine Rede: Es ist zwecklos, unnötig, fast unerlaubt, dem richtigen Almbauern völkisches Empfinden zu predigen. Es lebt tief und unbewußt in seinem uralten Volkstum, in seinem Wesen, in seiner Arbeit, wie der Saft im Holze, das Blut im Körper. Es kommt ihm gottlob nicht als etwas Äußerliches vor, als Kleid, das man ausbürsten, ausbügeln, flicken, wohl gar wenden kann. Er braucht es nicht zu »betätigen« und kann es auch nicht. Wie wenn man ihn aufforderte, die Natur zu bewundern. Er ist sie; ist das letzte ursprüngliche Stück Mensch, eingefügt in den Rahmen der Natur mit all ihrer Selbstverständlichkeit, ihrem Gleichmute, mit ihrer Härte und ihrem unnennbaren Reize. Wir anderen sind längst aus ihrem Kreise getreten und schauen auf sie zurück, manche wie nach einem verlorenen Paradies mit stillbedrücktem Gemüt, die meisten mit dem überklugen Blick des Philisters, wohl auch durch die skeptische Brille des Gelehrten oder die trübe des abgebrühten Politikers. Und ich empfand es wie knabenhaftes Beginnen, diesem stillen und in sich ruhenden Ernst gegenüber mit den Mitteln der Politik von den Pflichten der Stunde zu sprechen, den ruhigen Gleichtakt ihres Wesens durch meine hastigen Worte aus der Bahn zu drängen.
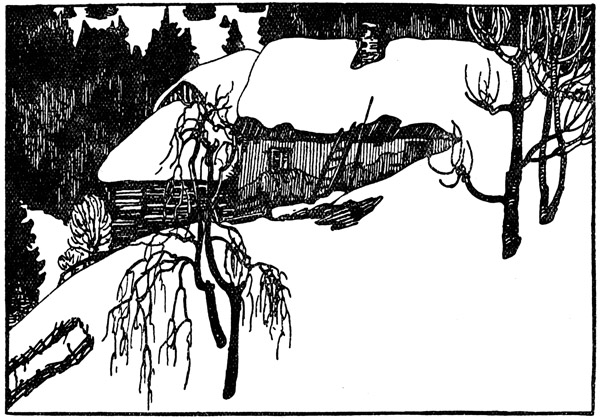
Nach all den bangen Sorgen der letzten Wochen um die Zukunft des Vaterlandes überkam mich ein warm aufquellendes Gefühl sicheren Geborgenseins, das mich nun Worte finden ließ, heiß und eindringlich, die wenig zu tun hatten mit dem ursprünglichen Zweck meines Werbens. Von alter Bauernkraft sprach ich, von ihren Urahnen, die den Wald gerodet und damit erst den Boden bereitet hatten für die steinernen Städte mit Not und Hunger, mit Hast und Haß und Sünde. Fest zusammenstehen hieß ich sie im Ring ihrer Stammesgenossen, daß sie als unbewegter Fels stünden in den Stürmen unserer Tage. Vom Prinzen Johann sprach ich, ihrem bald sagenhaften Freunde, vom alten Schatz ihrer Sagen und Lieder, ihrer Sitten und Gebräuche. Vielleicht bald schon werde die Heimaterde, die durch die langen Jahre des Krieges so still ergeben auf ihre Kinder gewartet habe, wieder langsam zu blühen beginnen und still zu lächeln in ihrer verborgenen herben Schönheit.
Da sah ich da und dort ein frohes Aufleuchten in manchem ausdrucksvollen Bauerngesicht, manches Auge suchte dunkelnd die Lebensgenossin beim Lob ihres schlichten Standes, wie der Quell springt aus wettergrauem Stein, und als ich geendet, ging eine murmelnde Bewegung durch die bis dahin stumm lauschende Menge, ein lächelndes Zustimmen und froh raunende Billigung. Mancher klopfte mir auf die Schulter, nickte mir zu mit der winzigen Geste geheimen Verstehens oder einem bedachtsam lohnenden Worte.
Bald hatte sich die Wirtsstube zu ebener Erde wieder gefüllt. Die ernste Spannung glitt wieder ins Geleise lauter Alltäglichkeit. Man sprach und rauchte, trank und lachte.
Ich saß mit dem Lehrer, dem Förster und einigen alten Bauern am Tische im Winkel.
Da schob sich ein junger Bursche durch die Menge, lachend und heiter, von blühender Gesundheit. Nur die linke Hand war zur Klaue verstümmelt und statt des rechten Unterarmes trug er ein kunstvolles Ersatzglied. Sie winkten ihn her, daß auch ich sein Schicksal erfahre. Und er erzählte einfach und schlicht:
Beim Ausbruch des Krieges sei er Herrschaftsjäger im Obersteirischen gewesen, habe einrücken müssen und sei nach zweijährigen Kämpfen gefangen und nach Konstantinowsk am Don gebracht worden. Dort habe man eines Tages von den Kriegsgefangenen verlangt, sie sollten am nächsten Tage der tschechoslowakischen Legion den Treueid leistens um gegen ihre Brüder ins Feld zu ziehen. Da sei er mit anderen in der Nacht durchgegangen und tagelang im strengsten russischen Winter durch Wald und Wildnis geirrt, bis sie, zu Tode erschöpft, einem Kosakendorfe zugehen mußten. Die Hände waren blau und gefühllos. Vergebens hatte er, der Sprache notdürftig kundig, gebeten, man möge sie ihm mit Schnee reiben. Er hörte vielmehr, wie der Dorfälteste, wohl nur aus Unverstand, riet, man solle sie mit warmem Öl einschlagen. Lange getraute er sich deshalb in seinem Heustadl nicht einzuschlafen, bis ihn endlich die Müdigkeit übermannte. Und in der Nacht haben ihm die Bauern die Hände mit heißem Öl übergossen. Sie begannen schwarz zu werden und abzufaulen. Er wurde ins nächste armselige Spital gebracht, lag dort sechs Wochen unter unendlichen Schmerzen und die brandigen Glieder wurden in wiederholten Schnitten ohne Narkose abgetragen. »Sie habn halt koa Gloriform g'habt«, meinte er fast entschuldigend. Endlich wurde er ausgetauscht und kam nach Wien. Dort wurde der rechte Unterarm endgültig kunstgerecht abgesetzt und an der linken Hand nach Abtragung der letzten Fingerstümpfe durch eine meisterhafte Arbeit eine Klauenhand geschaffen. Nun wartete er auf eine Anstellung als Fabrikstorwart bei seinem Herrn, einem reichen Wiener Industriellen.
Das alles erzählte er ruhig und wie selbstverständlich und wandte sich wieder seinen Kameraden zu.
Ich war bis ins Innerste ergriffen. »I hätt' do um alls in da Welt nöt gegen meine eigenen Leut Kriag führn kinnen«; diese urtümliche Empfindung hatte ihn ohne jedes Schwanken in den tödlichen russischen Winter getrieben, hatte ihn entsetzliche Martern erdulden lassen und endlich als Krüppel zu einem ungewissen Leben in die Heimat geführt. Darauf stolz zu sein, ist ihm wohl gar nie in den Sinn gekommen.
Und da fahren wir ins Gebirge, predigen in Versammlungen in wohlgesetzter Rede über die Pflichten gegen unser Volkstum! Predigen das jenen stillen, ernsten Menschen, denen die Treue zu ihrem Volke so tief in Fleisch und Blut gewachsen ist, daß sie auch nicht mit Stücken von ihrem Körper geschnitten werden kann. Wie der Saft im Holze, wie das unsichtbar rinnende Blut im warmen Leben. Und solcher stiller Helden gab es Tausende in unseren deutschen Alpenländern!
Ich konnte es nicht mehr aushalten in der dampfenden Stube und trat ins Freie, hinaus in die köstliche reine Bergluft des Hochtales.
Schwarz und wuchtig hob sich die alte Dorfkirche ins Dunkel. Ein Heer von Sternen funkelte klar vom schwarzblauen Himmel. Aus weiten Einsamkeiten rauschten die Wasser zu Tal, bald nah, bald ferner, wie der Wind über die nahe Almschneide kam. Aber vom Schmiedwirt drang taktfest die Harmonika; das Volk der Geiger und Tänzer auch hier – das alte Österreich. Was aber diese einsamen Weiten mit ihren schlafenden Einschichthöfen sagten, war langsames, wurzelstarkes Wachsen, bodentreues Aushalten, zähes Biegen und Nichtbrechen auch in den wildesten Stürmen.
Und diese Welt von Kraft und Ruhe und stummer Treue hat den armen Politiker auf der Heimfahrt trostreich geleitet.