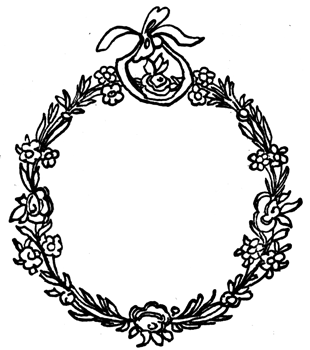|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Das klingt nicht machtvoll hallend wie Maria-Saal oder mittelalterlich zierlich wie Straßengel, klingt nicht wie übersponnen vom purpurnen Rosengerank früher Mystik wie Engelhartszell oder Agatharied. Einfach Lankowitz! Nüchtern und mit einem befremdenden Einschlag ins Slawische, etwa wie der Sitz eines k. k. ärarischen Monturdepots mit einem Hauptmann Kropatschek als tiefsinnigem Leiter. Und weckt doch ein köstliches Wogen schwingender Stimmungen, dieser steirische Wallfahrtsort mit seinen schimmernden Blütengassen und dem finsteren Bergwald im Hintergrunde. Und unter der Oberfläche des Alltagslebens liegen auch hier die Schichten einer alten Kultur, und wer Augen hat, zu sehen, der liest zur guten Stunde ein Goldkörnlein aus dem Schutt vergangener Tage und hört in der Tiefe leise die halbverschütteten Quellen rauschen, die in den Zeitenstrom unserer Tage münden.
Da ragt knapp hinter der altberühmten Gnadenkirche eine Hochwarte, die eckigen Felsglieder weich überhangen vom Wipfelgrün des Hochwaldes, der »Primas«- oder Franziskanerkogel. Der Gipfel trug einst eine der ältesten Burganlagen in Steier, die lang verschollene »Premarespurch«. Schon 1066 wird sie genannt und war damals wohl ein unwirtlicher Steinbau mit ungefügem Bergfried, mit wuchtig lastenden Gewölben und schmalen Fensterluken im klafterdicken Gemäuer.
Im 13. Jahrhundert war sie einem gar feinen Edelherrn zu eigen: »Herrant von Wildonia«! Das klingt wie prunkender Fanfarenruf zum Streit in Lied und Waffen. Und ein Minnesänger war Herr Herrant gewesen Zeit seines Lebens und ein gar streitbarer Mann dazu, gleich seinem Schwiegervater Herrn Ulrich von Liechtenstein, dem steirischen Minnesänger und abenteuerlichen Helden. Und wenn sein Burgmann auf der Primaresburg, brummig über das zugige Bärenloch, vom Zinnenkranz des Bergfrieds nach Osten lugte, wo das Sträßlein vom Kainachboden ins freie Murtal lief, so sah er in blauer Ferne die Buchenkronen des Wildoner Berges, wo sein Herr im blühenden Wurzgärtlein saß und allerlei Märlein in klingende Reime fing, vom »Kaiser im Bade« oder vom »verkehrten Wirt«, die uns die ewige Weise vom betrogenen Ehemann in behaglicher Sinnlichkeit melden. Derweil gab's draußen in der Welt schwere »Irrung und Stöß«. Jäh brach das Lied ab und Herr Herrant führte wieder eine harte Klinge in der waffenklirrenden Interregnumszeit. Im Ringe der steirischen Edelherren, die sich gegen König Ottokar verschworen, stand er neben seinem Bruder Hartnid II. und mußte besiegt es dulden, daß ihm neben seinem festen Schlosse Gleichenberg auch die Primaresburg gebrochen wurde. Das war gewesen im Jahre des Heils 1268! – Und heute können wir nur schwer unter hohem wogenden Gras, unter Haselstauden und blutrotem Brombeergerank dem Band der alten Mauern folgen. Im dürren Laubwerk raschelt die Amsel, vom Grunde des verfallenen Burgbrunnens blinzelt ernst ein Feuermolch empor und hoch im Blau unter den ziehenden Wolken schwimmt der Falke.
Erst 1415 taucht das Dorf Lankowitz auf. Dann war – 1433 – ein altverehrtes Gnadenbild Unserer Lieben Frau aus den Nöten der Türkenkriege auf wundersame Art aus Ungarn gekommen und hatte an der Dorflinde am Fuße der Stubalm ein friedvolles Asyl gefunden. Und so erwuchs aus kleinen Anfängen ein steirischer Wallfahrtsort. Kaiser Friedrich III. gab 1455 den Schirmbrief für Kirche und Kloster, das Ritter Georg der Gradner, aus bodenwüchsigem Kainachtaler Bauernadel, den minderen Brüdern vom Orden Sancti Francisci erbaute. Auf seinen vielen Fahrten soll der Kaiser selbst des öfteren im Kloster geherbergt haben. Noch hängt im Kreuzgang über einer niederen Tür sein Ölbild: unter edelsteinbesetzter schwarzer Samtmütze ein bartloses, faltenschweres Gesicht mit großen, fast traurigen Zügen, die ernsten Augen von den Lidern halb überwölbt. Die Tür führt in eine kleine geteilte Zelle, gegen Mitternacht gelegen, mit kahler Mauerbank und tiefen kleinen Fensternischen, vor denen der nahe Bergwald düstert.
Wie stimmt der Raum zu seinem einstigen Bewohner! Und wenn, wie die Sage geht, der Kaiser hier vom Fenster aus einen Hirschen geschossen haben soll, so schnellte er den Bolzen wohl lange zielend von der Armbrust, ohne rascheres Wallen des schwerflüssigen Geblütes, ein kalter Töter, kein frohbeherzter Weidmann. – Und ward dann wieder im Zwielicht des sinkenden Abends der grübelnde Kaiser, der Mann der zähen, mißtrauischen Bedächtigkeit, der karg gab und schwer verzieh. Und durch die trüben Scheiben bricht's wie ein schwacher blutiger Schein des verscheidenden Mittelalters mit seinen verschlagenen Ränken, seiner nüchternen Treulosigkeit, seiner hausbackenen Grausamkeit. An einen lauen Frühlingsabend 1471 denken wir, wo beim Wimmern des Aveglöckleins auf der Grazer Murbrücke die Tore vor einem verzweifelten Manne zufielen und Andreas Baumkircher, der Recke, unterm Henkerschwerte endete. –
Aus den kühlen Klostergängen treten wir in die Kirche. Ein hochgewölbter Hallenbau, in dämmernder Pracht der Hochaltar. Vor dem braungebeizten gewaltigen Barockaufbau (diese köstlichen Tischlermeister des 17. Jahrhunderts!) mächtige Engel und Heilige in reichbewegtem, goldgleißendem Faltenwurf. Darüber in glitzernder Strahlengloriole das alte Gnadenbild. Die Kanzel ein Kleinod prunkfröhlichen, fast galanten Barocks. Im ganzen weiten Raume andächtige Stille, feiner Weihrauchduft, gedämpfter Farbenklang. Hinter den schwarzen Gitterstäben des Chores tönt sonores Psalmodieren der Mönche und verflattert hallend unten im weiten Raume. Von Zeit zu Zeit schüttert ein dumpfes Dröhnen die Steinfliesen, wie rückendes Heben einer unterirdischen, gefesselten Macht; das sind Sprengschüsse im nahen Kohlenschachte – die neue Zeit!
Ein alter Friedhof umfängt die Kirche, da hält der leuchtende Spätherbst stille Feierstunde. Goldiger Sonnenglanz fällt durch ein weites Tor in einen winkligen Klosterhof, von den Apfelbäumen auf dem Kirchhofrasen lachen prangende Früchte, vom nahen Bergwald, der rot flammt im herbstlichen Laubwerk, klingt helles Geläute jagender Hunde und hie und da ein Schuß, der in den Gräben verhallt. An der Kirchhofmauer steht eine hohe Kapelle, dem heiligen Antonius von Padua geweiht. Kühl schlägt's aus dem dämmernden Raume. An der einen Seitenwand hängt ein gewaltiges Votivbild derer von Herberstein. Zu Füßen des hochragenden Erlöserbildes kniet der Hausherr, Herr Siegmund von Herberstein, ein ausdrucksvoller Kopf mit freundlichen Augen und wallendem Knebelbart. Ihm zur Seite sechs Söhne, die fünf älteren, wie der Vater, umschlossen von der leichten Prunkrüstung des ausgehenden 16. Jahrhunderts, barhäuptig, den Helm zur Seite. Ihnen gegenüber die betende Gemahlin mit milden, vornehmen Zügen, bürgerlich-hausmütterlich auch in der steifen Mühlsteinkrause, mit neun Töchtern. Fünfzehn Kinder! Ein überreicher Segen der langen Ehe eines steirischen Landedelmannes.
1621 ist Herr Siegmund gestorben. Über hundert Jahre hatte sein Geschlecht vordem schon die Pfandherrschaft Lankowitz innegehabt. Und aus dem Hintergrunde jenes Jahrhunderts steigt nun langsam und immer klarer heraus das Bild eines gewaltigen Mannes im wallenden Barte, jenes früheren Siegmund von Herberstein, des großen Staatsmannes, Gelehrten und Weltreisenden. Vier Kaisern hatte er in einem langen Leben gedient, den größten Männern seiner Zeit war er nahegetreten, hatte einen Ulrich von Hutten bezaubert, war mit Luther beisammen gewesen. In den schwierigsten Geschäften kaiserlichen Dienstes hatte er das europäische Festland durchquert, von Polen bis an die Pyrenäen, von den Ufern der Nordsee bis an die blauen Gestade Welschlands. Zweimal war er in wichtigen Staatsgeschäften, durch Eiswüsten und Tauwetterstürme, nach Rußland gezogen an den Hof des weißen Zaren, für die damalige Zeit eine Entdeckungsfahrt von sagenhafter Gefährlichkeit. Und was er gesammelt an Welt- und Menschenkenntnis, an Sitten und Gebräuchen, an geographischen Beobachtungen, seltsamen Naturerscheinungen, an Kriegsabenteuern, und was er mit hellen Augen gesehen vom asiatischen Märchenprunke des Zarenhofes, das hat er im Alter getreulich aufgezeichnet an der Hand seiner Tagebücher, und ward so zum zweiten Entdecker Rußlands. Und wenn er dann, wie dies wenigstens für 1520 und 1532 bezeugt ist, nach langer Fahrt wieder einmal stille Rast hielt zu Lankowitz bei seinem Bruder Georg, dann waren es stillgesegnete Ruhepausen in einem reichbewegten Leben, und das Kleinleben des altsteirischen Dorfes mag ihm geklungen haben wie ein kleines, halbvergessenes Kinderlied.
Wer denkt heute noch daran? – Und doch scheint's, als ob das Bildnis des kinderreichen Herbersteiners der alten Kapelle durch die Jahrhunderte her zu einem stillen Glanze verholfen hätte, von dem man nur unter Eingeweihten raunt: Zu ihr pilgert manch junges Mädchen, um in heißem kurzen Stoßgebetlein zum heiligen Antonius von Padua das Höchste zu erflehen, nach dem ein junges Mädchenherz Sorge trägt: einen Mann. Ob einen Mann kurzweg oder auch den Mann, habe ich heute nicht in Erfahrung bringen können, denn nur ein krummes, trübäugiges Mütterlein im kurzen, flaschengrünen Spenser der Almbäuerin kniet vor dem eisernen Gitter. Und vielleicht drücken die müden Sorgen der Alten mehr als die klopfende Herzensnot der Jungen.
Aus dem abendstillen Kirchhofe treten wir in die Hauptstraße des Marktes, die von Kirche und Kloster zu Häupten langsam talab führt. Samstagabend. Um die Heiligenstatuen am Kirchplatz jagen die letzten Kinder, hie und da blitzt ein traulicher Lichtschein auf in den alten, behaglichen Häusern und hinterm Ort beginnen schon die Haldenhaufen langsam zu erglühen in tausend zuckenden Flämmlein. Auf allen Wegen und Stegen ziehen die Bergknappen heim, im Arbeitskleid, mit schwingenden Grubenlampen. Denn unterm Zeichen der Kohle steht hier die neue Zeit. Ein Fähnlein Wallfahrer ist über die Alm gestiegen, vom Murboden herüber; nun suchen sie Herberge. Und mit ihnen treten wir ein, bei beschaulichem Abendtrunk den genius loci zu begrüßen. Es trinkt sich gut mit den Mannen von Lankowitz!
Wenn um die plaudersame Tischrunde die goldigen Lichter behaglichen Humors aufblitzen und Märlein aus alter und neuer Zeit in lebhafter Umsprache zu klaren Bildern erstehen, dann erscheint vor unseren Augen wieder das alte Dorf Lankowitz der Großväterzeit mit saftigen Wiesen voll weidenden Viehes, wo heute weite Schuttfelder gähnen, mit dem großen Teich am Waldessaum, darin die hohen Wolken schwimmen. Und unweit davon haspeln zwei eisgraue Knappen aus einem kleinen Schächtlein Kohle in Kübeln zu Tag und haben es als bedachtsame Leute zu beträchtlichem Stoizismus gebracht in der Abwehr ungläubiger Sticheleien. Das war die Zeit, da man noch ein Grubenfeld am Zechtisch in übermütiger Laune um eine »gekochte Jausen« losschlug.
Und vom »singenden Kaspar« erzählen sie in der Runde, dem hochgemuten Tiroler, der vor Jahren als Waldläufer in den hintersten Bergwinkeln gehaust, werktags Stiele hieb fürs Gezähe der Bergleute aus Haselnußstämmen und Hagebuchen und dann feiertags beim Trunke im Dorfe saß in der schönen Tracht seiner Heimat, den Schalk im blitzenden Auge und klingende alte Volkslieder in der Brust von einer Kraft und Schönheit, die alle lauschend bannte. Von der heiligen Hemma erzählen sie und wie man »vor Alterszeiten« auf der Rappoltalm nach Gold gegraben und von dem »Heidentempel« im Zigöllerkogel und wie die braven Hirschegger dem Bischof aufwarteten. Und dann die Wälder zu damaliger Zeit und erst die Jagd! Da versinken die Wände der rauchigen Trinkstube und herein grüßt der grüne Wald mit Hirsch und Reh und der seligen Hahnbalzzeit und dahinter schimmern die Almen in Pracht und Herrlichkeit mit dem rodelnden Spielhahn auf der Schneid und den rauschenden Wassern in den Gräben. Und so schwingt über all den fröhlichen, schwirrenden Stimmen in rauchiger Stube wie ein leiser, summender Glockenton die frohe, glückliche Liebe zur steirischen Heimat.
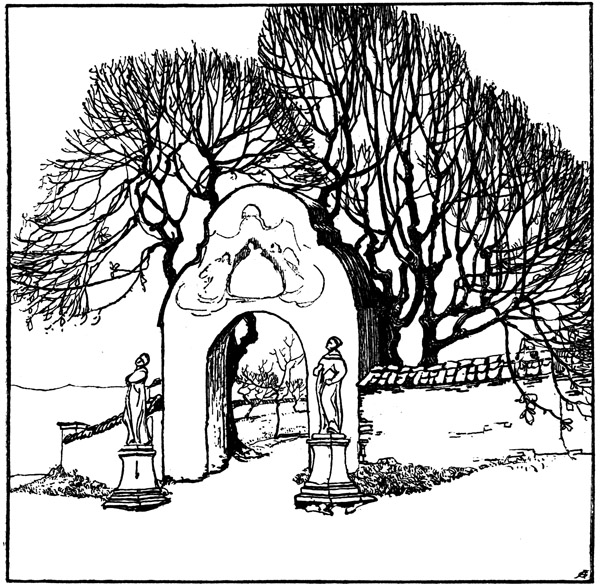
Drum trinkt sich's so gut mit den Mannen von Lankowitz!