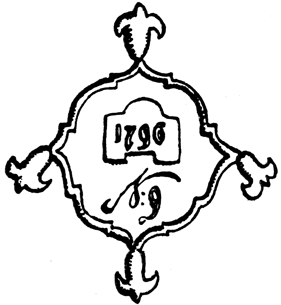|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
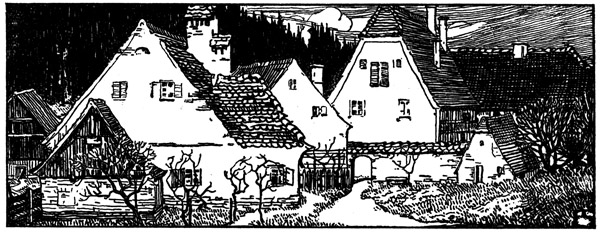
Wir messen die Zeit an unserem eigenen rasch verrinnenden Leben. Und das versickert jeden Tag im harten Boden des Berufes – bei den meisten von uns – und was daneben keimt und reift aus dem Saatgut eines Menschenherzens, es reicht kaum, daß der Nachkomme bis zur eigenen Ernte sich nähre. So geht's Tag für Tag. Doch dann kommt zuzeiten eine Stunde der Rast, von ungefähr, des Hinhorchens und Sinnens über Leben und Sterben. Auf einmal tickt die Uhr so seltsam laut durch die stille Stube, gleichgültig eilend und doch wie drohend. Gleich Tropfen fallen die Minuten ins Meer der Zeit, unwiederbringlich, als ob auf dem geschäftigen Pendel ein Tödlein ritte. Dann schlägt wohl ein kalter Hauch aus der Ewigkeit ans warm klopfende Herz und aus dem Dunst des Alltags irrt zaghaft der Blick in unendliche Fernen und Zeiten, über ein Leichenfeld von Generationen, darunter wie unter einer feinsten Staubschicht der Atem des Universums ruhig weitergeht.
Wir wohnen zur Miete im Leben wie im Hause –
Wohl füllen sich die Stuben mit mancherlei Gerät, das uns lieb geworden und seine eigene Sprache redet, manch Bild schaut von den Wänden, das noch unseren Kindern sagen soll, was einst in unser Leben Licht und stille Freude gebracht. Doch ist's zumeist bewegliche Habe, gerichtet, uns zu begleiten, wenn die Lebensreise weiterführt. Dann werden die Gelasse leer, bis ein neuer Mieter über die Schwelle tritt und seinen Hausrat wie ein weiteres Gewand über die leeren Mauern breitet. Wer die aber aufgebaut, wer einst die Grundfesten des Hauses gegraben und die Kammern gefügt, davon wissen wir zumeist nicht viel.
Darum ist's ein seltenes Glück, wenn ein stiller, berufener Mann die Arbeit langer Jahre daran setzt, festzustellen, wie ein Ort im Laufe von Jahrhunderten entstanden, wie die Häuser zu Gassen sich schlossen, die sich reckten und streckten zum Bilde von heute. So hat Dechant Ludwig Stampfer in seiner »Chronik der Besitzveränderungen für Köflach und Umgebung« ein einzigartiges Werk geschaffen, mit geschultem historischen Sinn, mit strengem kritischen Gewissen, mit unsäglichem Fleiße. Aus den Blättern der beiden prächtigen Folianten – sie liegen nur in der kalligraphischen Handschrift des Verfassers vor – ersteht wieder die Baugeschichte jedes Einzelhauses, und wenn unser Buch, wie schon sein Name sagt, auch vor allem von den Veränderungen des Besitzes seit den ersten urkundlichen Nachweisen erzählt, so lebt doch zwischen den Zeilen die Kleingeschichte vieler Geschlechtsfolgen, und allmählich rundet sich das Bild zu einer Geschichte des ganzen Ortes.
Wir ahnen, wie sich Alt-Köflach aus einem kleinen Bauerndorfe, unter dem milden Krummstabe der Äbte von St. Lambrecht und begünstigt von einer glücklichen geographischen Lage am Zusammenflusse weiter Hinterlandstäler, langsam zum lebhaften Gemeinwesen von heute durchgerungen hat. Nicht ohne oft laute, oft stille Kämpfe mit der nahegelegenen uralten Stadt Voitsberg, der schon eine Handfeste Herzog Friedrichs des Schönen vom Jahre 1307 die gleichen Stadtrechte wie Graz verliehen hatte. Wenn auf den Straßen der Handel lebhaft ging, mit Wein vom Unterlande, mit Salz und Eisen aus Obersteier, so hatten die von Voitsberg ihr altverbrieftes Recht auf Maut- und Fürfahrtgeld, und Richter und Rat mußten scharf zusehen, daß dem Stadtsäckel nicht unbilliger Abbruch geschah oder die Fahrt durch die Stadttore auf Saumwegen durch den Teigitschgraben umgangen wurde. Zu Köflach aber gedieh gerade das Frächter- oder Sämergewerbe von altersher. Man führte die Weine aus dem Unterlande über die Piberer-, heute Stubalm bis zum Stüblergut, nicht ohne ewigen Hader bei der Durchfahrt durch Voitsberg. Manch Stückfaß wurde in der Stadt Fronkeller bis zur Auslösung »verarrestiert« und der Abt von St. Lambrecht hatte oft jahrelange Prozesse zu führen, um die Rechte seiner Untertanen zu wahren. Man sieht sie leibhaftig vor sich, jene Alt-Köflacher »Weinherren«, die feinen Äderchen auf den vollen Wangen durchglüht von Lebenskraft und reschem Schilcher, denen die schwere Faust oft nur allzu leicht aus dem Wams fuhr beim Zank in der Voitsberger Ratsstube.
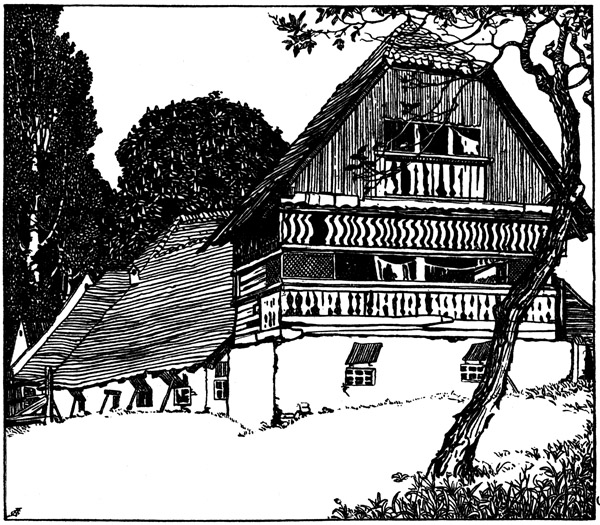
Da steht gleich am Eingange des Ortes der alte Schotthof, mit mächtigen Strebepfeilern und einem Spähfenster im schmalen Erkervorbau. Auf dem Hause ruhte seit alten Zeiten eine »Taverngerechtsame, Weinniederlagsgerechtigkeit«, und die Befugnis, Wein zu führen über die Stubalm ins Oberland und über die Pack nach Kärnten. Von 1640 an saß darauf Hans Gordan, »Fuhrherr, Gastgeber und Weinhändler zu Köflach und Lankowitz«, ein vermögender Mann, der Stifter des Magdalenenaltars in der Kirche zu Hirschegg. Und als er, der stets aus dem Vollen gelebt, heimgegangen, kam noch mancher seines Gewerbes auf das Haus, bis in unseren Tagen die weitgewölbten Stuben durch Wände in Kammern geteilt wurden, zum »Personalhaus« für die Arbeiterschaft der Industriezeit.
Als vornehmster Bau des Ortes galt seit altersher das Steinhaus, wie es in den Schriften des 15. und 16. Jahrhunderts genannt wird und schon im Namen sagt, daß seine feste Bauart unter den Rauchstubenhäusern des damaligen Dorfes auffiel. Anno 1420 hatte es Hans Rumpy inne, der den Ritter Hans den Gradner »seinen lieben Vetter« nennt, also von niederem Adel war und in Anna, der Tochter des Hans Höchenperger aus einem Kärntner Adelsgeschlechte, seine Ehewirtin fand. 1420! Wie klein war damals noch die Welt – Amerika noch nicht bekannt, der Buchdruck noch nicht erfunden und Glasscheiben wohl noch ein unbekannter Luxus im alten Steinhause. 1450 erscheint darauf Konrad Kunigshofer, »obrister Amtmann des Stiftes Sct. Lambrecht im Pibertal«, 1571 Christof Galler, Landesverweser in Steier und Herr auf Lannach, 1628 Herr Georg Veit von Schladming, der zu Beginn des Dreißigjährigen Krieges als Hauptmann im fürstlich Holsteinischen Regimente gedient und kurz vor seiner Ansiedlung in Köflach seinen Abschied genommen hatte. Sein Nachfolger Sylvester von Rhein mußte sich mannhaft wehren, als ihm Wein, den er in Schwanberg erkauft hatte, bei der Durchfahrt durch Voitsberg gepfändet wurde, weil er ihn, wie man sagte, »unterm Reifen« verkauft hatte. Bis er zu seinem Rechte kam, vergingen fünf Jahre, keine allzu lange Zeit für einen Prozeß in jenen Tagen. Seit 1792 bis auf den heutigen Tag ist das Steinhaus das Brauhaus des Ortes und der Name Tunner hat in der ganzen Steiermark einen guten Klang. War doch der Werksherr in der Salla und Hammergewerke am Tunnerhammer der Vater des steirischen Eisenmannes Peter Tunner.
An einer Straßenkreuzung steht im Herzen des Marktes das alte Baderhaus. Wenige Stufen leiten in einen dunklen Flur, von dem eine enge Stiege und niedere Türen in zahlreiche Gelasse führen. Eine schmale, gewölbte Kammer war wohl die Apotheke, das Allerheiligste, in dem all die köstlichen Wundsalben, aqua vitae und Elixiere, die Perlwässer und Gembskugeln entstanden. 1679 zog dort der bürgerliche Bader Johann Georg Fliegner ein, nachdem er die Baderstochter Maria Distalles geehelicht hatte. 1713 meldet er sich als Pestarzt für die Oststeiermark und stirbt als Magister sanitatis für den Distrikt Feldbach schon im nächsten Jahre als Opfer seines Berufes. Durch länger als zweihundert Jahre, fast bis auf unsere Tage, folgte hier ein Jünger Äskulaps dem anderen. Kam als Geselle, heiratete die Tochter oder Witwe des Vorgängers und starb in den Sielen. Waren es schon im vergangenen Jahrhundert angesehene, tüchtig vorgebildete Ärzte, so ließen, wie überall, die ersten Vertreter des Faches in Köflach wohl manches zu wünschen übrig. Keine der dazumal blühenden hohen Schulen hatte zum Beispiel den »ehrenfesten und fürnehmen Herrn Christof Kirchmayr« mit ihrem Diplom gekrönt, der von 1646 bis 1667 beim Dietmeier Mautner (heute Reiter) sein Handwerk trieb. Als Chirurgensohn vom Gebirgsdörflein Preitenegg hatte ihm »das ehrsame Handwerk der Pader, Palbierer und Wundärzte zu Wolfsberg« am 16. August 1628 seinen Lehrbrief ausgestellt. Doch als er in Köflach als Wundarzt – und Gastwirt – die Praxis begann, da beschwerte sich der Voitsberger Arzt bei der Baderzunft zu Graz, und diese verlangte vom Prälaten zu St. Lambrecht, er möge Kirchmayrn »als einem Stimpler und Störer« das Handwerk einstellen, widrigenfalls die Baderzunft bei der hohen Obrigkeit um Einziehung seiner Person bittlich werden würde. Der Abt aber nahm sich kräftig seines Schützlings an und nach vierzehn Jahren – so lange dauerte der Prozeß – wurde Kirchmayr endlich der Klage ledig und müßig erklärt. Christof Kirchmayr blieb als Wundarzt in Köflach und fuhr wacker fort, »die ganze Nachbarschaft mit Aderlässen, Schröpffen, Köpflen, auch mit Binden zu behandeln und andere gefährliche Schäden zu heilen und dadurch dem Bader zu Voitsberg großen Schaden zu verursachen«.
Dem Baderhause schräg gegenüber am Mühlgange lag die alte Friedelmühle (heute Eißner). Von 1706 bis 1714 hatte sie Hans Simon inne, ein wüster Mensch, dessen wildes Eheleben die friedlichen Bürger immer wieder aus der Ruhe schreckte. Er wurde von seinem eigenen Weibe beschuldigt, daß er mit seiner leiblichen Mutter Unzucht treibe, doch lehnte der Marktrichter seine Stellung ins Landgericht Voitsberg ab, weil Simon als Grundhold der Pfarrsgült Köflach dem Abte von St. Lambrecht untertan sei. Das Anwesen verfiel immer mehr und der Ehestreit in der Friedelmühle nahm bald die schlimmsten Formen an. Simon bezichtigte sein Eheweib Barbara der Kindesabtreibung und wiederholte, ein typischer Querulant, den schweren Vorwurf zu Wien bei einer Audienz vor der Kaiserinwitwe, als er über angebliche Robotbedrückung zu klagen kam. Ein scharfer Erlaß kam herab; neun Wochen saß Frau Barbara im Verlies zu Voitsberg in peinlicher Haft unter häufigen Mißhandlungen, ohne Decke, ohne Stroh, so daß ihr die Füße abfroren. Sie wußte endlich zu entkommen und verbarg sich zwei Tage und Nächte lang im Stadel des Baders zu Köflach. Man fing sie aufs neue, trotz des Protestes ihres Mannes, der nun wieder auf ihrer Seite stand. Als sie endlich loskam, ward sie von ihm wieder halb totgeschlagen und mußte im Pfarrhofe Schutz suchen. Endlich wurde der Wüstling unters Militär gesteckt, doch als er nach zwölf Jahren heimkam, begann das schlimme Leben aufs neue.
Von den bescheidenen Gasthäusern des Ortes wurde eines zuzeiten auf der Dauchenkeshube (heute Schabl) betrieben, die 1493 zuerst genannt wird und heute eines der stattlichsten Ackergüter ist. Von 1582 bis 1606 verzapfte dort »der ehrenfeste und fürnehme Herr Sebastian Federl, Großfuhrherr und Gastwirt«, einen guten Tropfen. Als 1589 eine Kommission gelegentlich einer Almbeschau dort nächtigte, da zahlte man für ein Nachtmahl 12 Kreuzer, fürs Frühstück 10, an Stallmiete für ein Pferd 3, für eine Maß Hafer 3 Kreuzer. An Silbergeschirr fanden sich im Inventar 4 Kandeln, 8 Becher und 23 Löffel, kein allzu reicher Schatz, doch lassen die 16 Federbetten annehmen, daß Meister Federl, »der lesen und schreiben konnte«, bisweilen manch besseren Gast in seinem Hause beherbergt hatte. Ein späterer Besitzer des Hauses, Hans Perschler (1677 bis 1726), hatte sich durch dreiunddreißig Jahre als Kirchenprobst sehr verdient gemacht. Von ihm meldet – vielleicht mit Anspielung auf eine Leidenschaft im Spiel – die Grabschrift am alten Kirchhof noch heute:
Sechse in der Wirfl gewinnt,
Wie Rauch das Leben verschwint.
Hier haben die sechse verspielt,
Da der Tod darauf gezielt.
Er hat gelebt durch 76 Jar,
Jez anno 1726 den 26. Jänner
kommen an die Todten Paar.
33 Jar hat er Sct. Magdalena gedient,
Hiermit er den Himmel verdient.
Wohl den gleichen Poeten dürfen wir vermuten hinter der Grabschrift, die, ebenfalls erhalten, im nächsten Jahre 1727 dem tüchtigen Färbermeister Paul Amon Wolf gesetzt ward:
Hier lieget der gestanden
Ins Todes fösten Banden.
Er hat gefärbt was da war Pleich,
Bis er worden zu einer Leich.
Der Erhenvöste Herr Paulus Wolf,
Ratsburger und Förwermeister
Allhier seines Alters 58 Jar
Und in dem Jar 1727 den 15.
Mai begraben worden.
Jetzt waißt, wer er gewesen sey,
Wünsch ihm die ewige Rue darpey.
Als das nachweisbar älteste Haus in Köflach erscheint das »Bäckengregerhaus« (heute Dengg). Schon 1389 bestätigte Barbara als Hausfrau des Ulrich Säffner die Stiftung ihres Vaters Walter von Hanau, durch welche die damalige Valleshube mit dem Duelacherhofe und anderen Gütern als Dotation an die Spitalskapelle zu Voitsberg kam. Später gedieh der Hof an die Greißenegger. Als im Jahre 1542 im Hause Feuer ausbrach, dem auch mehrere Nachbarhöfe zum Opfer fielen, sollte der Besitzer Peter Fleischhacker für den gesamten Schaden aufkommen nach dem alten Rechtsgrundsatze: Bei wem die Brunst zuerst ausgebrochen, der soll auch für allen Schaden haften. Der Pfleger von Greißenegg, Wilhelm von Herberstein, erbot sich, den Fleischhacker zu richten und wollte einstweilen allen geretteten Hausrat aufs Schloß führen lassen. Doch die »armen Verprunnenen« ließen die Truhen mit ihrer geringen Habe bis zur Beilegung des Handels in der Sakristei der Pfarrkirche aufstellen. Sie mochten wohl dem rechten Hergange des Prozesses nicht recht trauen, denn die Wege der Justiz waren auch damals oft kraus und langsam. Im Jahre 1611 drangen sechs Piberische Untertanen gewaltsam ins Haus, erbrachen alle Kammern und durchstießen mit ihren Hellebarden jeden Winkel, um den Bruder des Besitzers Ruep Puecher, namens Wastl, zu greifen, weil er eines Totschlages bezichtigt wurde. Der Pfandinhaber von Greißenegg, Herr Bernhard von Herberstein, schätzte den ihm durch solche »Gewalt« angetanen Unglimpf auf 1000 Dukaten, ohne daß wir wissen, wie die Sache ausgegangen.
Eine knappe Viertelstunde talab von Köflach gegen Voitsberg zu liegt am weidenumsäumten Weiher der heute so stille Tunnerhammer. Dort wurde Eisen geschmiedet schon vor mehr als dreihundert Jahren. Zuerst am kleinen Wasserhammer, bis der Hammerschmied Josef Tunner aus Deutschfeistritz kam und in den Jahren 1779 bis 1798 den Eisensteinbergbau in der Salla am Fuße der Stubalm erschloß, dessen Erze in dem dazu eingerichteten Hammerwerke zu Obergraden, das seither seinen Namen trägt, weiter verarbeitet wurden. Das brauchte zu einer Zeit, da die Großindustrie noch in den Kinderschuhen ging, sicher einen festen Mann mit nimmermüder Arbeitslust von früh bis spät. Und nachts, wenn die vielen Kleinen – reicher Kindersegen war ja so vielen steirischen Hammerherren beschieden – schon längst träumten beim Rauschen der Wehr und Pochen der Hämmer, schlich Frau Sorge still durch die Stuben und hielt den Werksherrn wach. Er ist auch mit 48 Jahren gestorben. Sein ältester Sohn Peter Tunner, »Schmelz-, Rad- und Hammergewerke in der Salla und zu Obergraden«, konnte den ungünstigen Übernahmsbedingungen bei der großen Zahl der Geschwister nicht nachkommen, das Unternehmen fiel 1825 unter den Hammer. Peters Sohn gleichen Namens hat später den Ruf der steirischen Eisenindustrie zu hohen Ehren gebracht. Der Tunner-Hammer aber wuchs in der Folge durch den Zukauf neu erschlossener Kohlengruben zu einem wertvollen Besitze, der 1848 an Erzherzog Johann kam, zugleich mit dem Dillacherhofe und anderen Gütern.
Der Dillacherhof. Heute ist's ein vollbesetztes Arbeiterhaus. Vor sechzig Jahren war's ein stattliches landwirtschaftliches Gut, und manch schneeweiße Bäuerin von heute hat als Schulmädchen durch den Zaun gelugt, um die Gräfin Meran, die Gattin des Erzherzogs, dort walten und schaffen zu sehen. Das Gut ist uralt. Wird als »Hof im Tuellach« schon im steirischen Renten- und Hubbuch des Jahres 1267 genannt und war wohl eines jener Güter, die Herzog Heinrich von Kärnten mit seinen Ministerialen besetzte und die er in einer Urkunde vom Jahre 1103 von der Lehenshoheit des Stiftes St. Lambrecht ausgenommen hat. Seit dem 16. Jahrhundert und vielleicht schon länger saß auf dem Gute das Bauerngeschlecht der Kröpfl, deren einer 1721 den heutigen Zigöllergrund erwarb, auf dem die Sippe noch blüht. Ein Bauerngeschlecht, das seinen Stammbaum über mehr als dreihundert Jahre nachweisen kann, hat wenig seinesgleichen im heutigen Mittelstande. Auch die Schabl, ein Bauernstamm, dem auch der Grazer Stadtpfarrer zugehört, gehen mit ihrem Urahn Michel Schabl von Hambaum sogar auf das Jahr 1498 als früheste nachweisbare urkundliche Marke zurück. Ein halbes Jahrtausend harter Bauernarbeit ist fürwahr kein geringes Zeugnis für die Tüchtigkeit eines Geschlechtes.
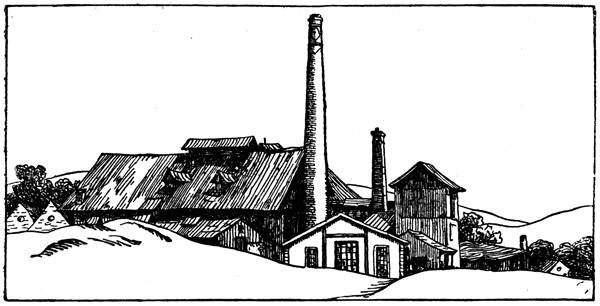
Noch nennt die Chronik manch anderen alten »Freihof«, der keiner Herrschaft zinste und unmittelbar dem Landesfürsten untertan war. Die Preslerhube in Gradenberg erscheint schon vor 1404 als Hof in der Prezzla (Birkenwald?) und reicht wohl bis in die Zeit der ersten Kolonisierung hinauf. Wo auf dem heutigen Krenhofe die Sensenhämmer schlagen, saß schon im 14. Jahrhundert das freie Geschlecht der »Khren«, das 1386 in Niklas dem Khren dem damaligen Pfarrdorfe Köflach seinen Pfarrherrn gab.
Auch zur Geschichte der Eigennamen bringt unsere Chronik manch wertvollen Beleg. Da leuchten aus der alten Zeit Namen auf, darin noch altgermanische Vornamen erklingen: Dietmar, Gansolt, Frowein, Kysolt und andere. Als dann im 15. Jahrhundert eigentliche Schreibnamen auch im Gewerbestande aufkamen, entnahm man sie zuerst dem Berufe des Betreffenden, wie hier Konrad Fleischhacker, Jörg Müllner, Veit Schmied usw. Andere endlich sind wohl aus alten Spitznamen hervorgegangen, in denen der Volkswitz besondere Eigenschaften des Trägers oder seines Ahnen – nicht immer allzu zart – verewigen sollte. Der Schmied Zangenfeind, der um 1480 in der heutigen Grießer-Schmiede hämmerte, saß wohl oft lieber in der Taferne im Steinhaus hinter dem Kruge, als daß er vor dem Amboß stand. Und Hans Springintscheiben, der anno 1577 das ehrsame Hafnergewerbe im heutigen Blumauerhause übte, muß in der Reihe seiner Ahnen einstmals einen recht hurtigen, vielleicht unbedachten Vorfahren gehabt haben. Anton Wentseisen läßt an einen flinken Schmied – der er auch war – denken, Hans Leckenzwirn (1490 bis 1520) an einen fleißigen Schneider, Christian Obenaus an einen windigen Bruder Luftikus, während Christian Wärzenlecker wohl zuzeiten ärgerlich an der steten Erinnerung einer wenig appetitlichen Gewohnheit zu tragen hatte.
Heute sind allerdings all diese Namen längst vergessen. Sie haben anderen Platz gemacht, die auftauchten und wieder verschwanden mit ihren Trägern im Wechsel der Zeit. Die hat einen raschen, mitleidlosen Schritt in einem Orte, der mit der Erschließung weiter Kohlenfelder und mit der Anlage moderner Eisenwerke völlig neue Lebensbedingungen gewann. Die Eisenbahn brachte lautes Leben in den einst so stillen Markt, die Gassen wuchsen, neue Häuser entstanden in den Siebzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts mit fast amerikanischer Schnelligkeit. Zwanzig Neubauten in einem Jahr brauchten Raum. Brachten Geld und Leben in den Ort, weckten rasche Tüchtigkeit, unternehmendes Wagen, ein Aufblühen von Handel und Gewerbe, dessen erfrischendem Reiz sich nur hie und da ein laudator temporis acti grämlich verschloß. Freilich hat die rasche Bauweise, zu der die neue Zeit zwang, manches verdrängt, das ehedem mit breiter Behäbigkeit die Straße sperrte. Das Ortsbild hat dadurch an bodenständiger Schönheit gar viel verloren. Wo ehedem auf breiter Mauerbank ein ehrenaltes Rauchstubenhaus festgezimmert ruhte, da erstand an seiner Stelle ein Ziegelbau oder man bewarf es mit Kalk oder Mörtel, schminkte ihm eine neue »Fassade« ins alte Gesicht, daß keiner mehr dem alten Bau das ehrliche braune Holzgemüt ansah. Und wo ein Kellerhals auf die Straße gähnte, da schlug man ihm grob das Maul zu und setzte ein blechbeschlagenes Viereck ein. Manch stille Weglein, die ehedem durch Gärten und Fluren liefen, wurden geradlinig nachgezogen, mit hohen Hohwänden an den Seiten, daß der Blick nicht mehr fröhlich schweifen konnte in die blühende Umwelt, sondern fest aufs gerade Ziel des täglichen Lebens gerichtet blieb. Wo sich in alten Häusern ehedem bedächtige Wölbungen spannten, da teilte man sie durch Zwischenwände in kleine Stuben, lebhaftes Industrievolk zog ein, mit fremden Zungen, und lugte aus den alten Augen des Hauses auf die neue Zeit, die lärmend ihre Straße zog. Doch das sind gottlob nur vereinzelte Beispiele. Noch schaut aus grünem Obsthain manch altsteirisches Stöckel, nickende Ranken und blühende Gärten legen sich freundlich zwischen Mauern und Giebel, und manch ruhevoller Ausblick in stille Gassen und Plätze gemahnt ans alte liebe Ortsbild. Möge man seine Erhaltung schonend verknüpfen mit den berechtigten Forderungen modernen Verkehrs.
Der Heimatschutz ist eine feine Blüte, deren Duft sich nur dem erschließt, der neben den blassen Bildern aus glücklicher Kinderzeit auch eine Vertiefung seiner eigenen Innenkultur durch das Leben erfahren hat. Wohl schlummert der Sinn dafür wenigstens unbewußt im Empfinden vieler, doch ihn wachzurufen zum Gefühle ernster Verpflichtung gegen die Heimat bedarf es noch langer Jahre nimmermüder Arbeit, eindringlichen Zuspruches und vor allem liebevollen Mitwirkens der Berufenen. Das gilt fürs ganze Land. Damit nicht das böse Scherzwort wahr werde, mit dem unlängst ein lieber Freund unsere Aussprache über diese Fragen schloß:
»… Im Grunde war's doch immer so: Die Kranken sterben an den Ärzten, die Juristen verpfuschen das Recht, und die Baumeister – mein Gott – die Baumeister tun halt auch, was sie können.«