
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
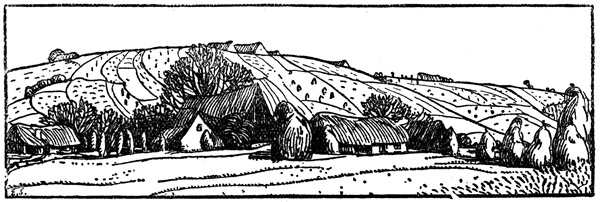
Unter Mundart versteht man die länderweise oder örtliche Abart einer Sprache bei erhaltener Gemeinverständlichkeit. So oder ähnlich liest man wohl in den meisten Arbeiten, die von der Mundart handeln.
Das mag auch im großen und ganzen gelten; aber doch nur für ihre Stellung in der Sprachforschung, für ihre rein sprachlichen, lautlichen Formen. Es trifft nur das äußere schlichte Kleid der Mundart, der oft verspotteten, nicht aber ihr Wesen, ihr reiches inneres Leben. Gottlob sind ja die Zeiten lange vorbei, da man die Mundart als vergröberte, verbauerte Schriftsprache ansah. Man geht ihr heute nach als dem letzten frischen Zweige am Stamme unserer Sprache, dessen sorgloser Wildwuchs neben dem blassen Propfreis der Schriftsprache fröhlich im Safte steht.
Oder in einem anderen Bilde: Die Schriftsprache, vor allem die der Kanzleien, der Zeitungen und des Massenstils, gleicht einer glatten, abgegriffenen Wand, einförmig grau oder farbig übertüncht, darunter der Sprachliebhaber nur mühsam da und dort das alte Gefüge wahrnimmt. Die Mundart dagegen ist wie ein köstliches altes Gemäuer, umwuchert von Blumen und würzigen Kräutlein, aus dessen Wetterfugen der Sprachkenner sich zu guter Stunde manch seltsame Versteinerung, manch blinkenden Kristall, wohl gar ein goldenes Regenbogenschüßlein holt.
Freilich meine ich hier unter Mundart – und ich denke dabei vor allem an die steirische als Zweig der österreichisch-bayrischen – im engeren Sinne nur die Sprache abgelegener Gebirgstäler im Munde ihrer bodenständigen Bewohner. Sie allein führt uns zurück in jene früheren Zeiten, da sie noch überall herrschte, weil es an überragenden Kulturstätten mangelte, an deren Verständigungsbedürfnis sich erst eine gemeinsame Schriftsprache zuschliff.
So reicht denn auch die Mundart mit einzelnen Worten und Formen noch »ruinenhaft« in unsere heutige Schriftsprache und führt in ihrem Geschiebe Sprachbrocken, die noch weit hinten vom gotischen Urgebirge stammen. »Urassen«, verschwenden, abundare, heißt gotisch ufarassan, das grobe Wort »Wampn« für Bauch heißt gotisch vampa. Derlei uralte Formen hat die bäuerliche Sprache auch in der Grammatik bewahrt, z. B. in der Zweizahl für »ihr« und »euch«, in »es« und »enk« oder im »ts« der Mehrzahl, z. B. in »habts«, »suchts«, in dem J. Grimm eine alte gotische Dualform »habaits«, »sokjats« erblickt.
Und so führt sie denn auch in ihrem Wortschatze eine reiche Fülle kostbaren alten Sprachgutes mit. Das ist von Anfang an zu erwarten. Und doch ist man immer wieder überrascht, in jedem mittelhochdeutschen Wörterbuche auf jeder Seite viele und gerade die wunderlichsten alten Bekannten aus der Mundart zu finden. So »Trialerl«, die Kinderlippe (mhd. triel); die »tengge« Hand (mhd. tenke, linke); »gumpen«, hüpfen, springen (mhd. gumpen); »Huf«, Hüfte (mhd. huof); »Nuasch«, der rinnenartige Viehtrog (mhd. nuosch); »mennen«, dem Vieh vorgehen (mhd. mennen); »Wehtam«, schmerzhafte Stelle (mhd. wetuom); »weten«, die Ochsen ins Joch spannen (mhd. weten); »Weinzerl«, der Winzer (mhd. winzürl); »Zockel«, Holzschuh (mhd. zockel); »Assat«, Gefäß (mhd. assach, franz. asiette); »Giali«, Schnabel am Krug (mhd. giel, Maul, Rachen) usw. Dazu kommt die unerschöpfliche Reihe der Iterativa, zum Beispiel »heschazn«, »toggazn«, »juchazn« usw.
Das alles und noch unendlich viel mehr hat die Mundart aus ihrer Kinderstube mitgebracht. Aber hat an deren kleine Fenster nicht auch manch fremder Klang von den Völkerstraßen davor geschlagen, der noch heute in Spuren aus ihr aufklingt? Kann ihr nicht manches angeflogen sein, das sie erwandert hat auf jahrtausendalten Wegen?
Immer war mir der so verschiedene Klang der Mundart in geographisch recht nahe liegenden Tälern oder Gauen – zum Beispiel um Hitzendorf, um Groß-Florian, im Saggautale – ein Rätsel.
Vor allem, wie er zustande kam.
Denn er liegt nur zum geringsten Teile im Wortschatze, im eigentlichen Sprachgut – obwohl auch da manche Worte, wie »mennen«, »weten« oder die »dengge« Hand, vorzüglich dem weststeirischen Gebirgsvolke eignen –, sondern vielmehr im Klang, in der Aussprache des einzelnen Wortes – »Heos«, Hase, um Florian; »arbatn«, um Hitzendorf; »boschtat«, bärtig, im Stubalmgebiet –, vor allem aber doch im Tonfall, im Grundklang der Sprache, die hier rauh, dort verschliffen, hier singend, dort unbetont, heller oder dumpfer klingt. Es webt eben über der Verschiedenheit des Klangbildes im Einzelworte wie ein unfaßbarer Unterton der Zusammenhang, der Tonfall der ganzen Rede. Kann dieser verwehte Nachhall aus Schichten früheren, fremden Volkstums stammen, das, aus den offenen Tälern verdrängt und getilgt, sich in entlegenen Winkeln noch in sparsamen Resten erhalten hat?
Die Spuren der Urbevölkerung unseres Landes – sie wird gemeinhin illyrisch genannt – in Hausbau und Brauch des steirischen Bauerntums harren noch der Nachprüfung. Der keltoromanische Abschnitt unserer Siedlungsgeschichte läßt eine mehr oder minder friedliche Durchdringung der vom Keltentum überschichteten Urbevölkerung mit Einwanderern romanischer Zunge annehmen!, die sich gewiß nicht in den aufgefundenen Steinen erschöpft. Im weiten Bezirke von Solva-Leibnitz, der sich nach Pirchegger im dritten Jahrhundert vielleicht von Frohnleiten bis gegen Marburg und von Hartberg bis an die Höhen der Koralpe erstreckte, war die Bevölkerungsdichte des Sulm- und Saggautales kaum geringer als zur Zeit der ersten Volkszählung im Jahre 1754. Der Bauer im Unterlaufe beider Täler hat das Vulgärlatein mindestens verstanden, oft auch gesprochen. Freilich mag es gegen die Sprache Ciceros geklungen haben wie die Mooskirchner Mundart gegen das Meißner Deutsch seligen Andenkens. Mit diesen bunten Resten hat ja wohl der Einbruch der Slawenflut und noch mehr der Awarendruck im Rücken gründlich aufgeräumt. Wir wissen nicht, was sich darunter, verschreckt und verhohlen, in aufwuchernder Wildnis erhalten hat. Die bajuvarische Landnahme aber breitete bald ein immer dichteres Netz neuer Herrensiedlungen über die kümmerlichen Reste aus früherer Zeit, unter dem aber slawische Bestände bis weit ins Mittelalter hinein bestehen blieben. Und so wäre es immerhin möglich, daß – ich wiederhole – nicht Wortreste, aber Klangfärbungen noch wie ein leises Echo in die von da ab herrschende Mundart hineintönten. Zudem zogen im Bayernheerbann auch vereinzelte Krieger aus anderen germanischen Stämmen. So klingt mir das Hirscheggerische »Pfandli«, »Kindli«, »Büebli« immer leicht alemannisch.
Doch mit diesen im Grunde mehr als gewagten und ziemlich nutzlosen Erwägungen wäre die Verschiedenheit der Mundart nach Gauen und Tälern keineswegs erklärt. Stammt sie aus Zeiten, wo noch die Hundertschaft als erweiterte Sippe ganze Täler füllte, hängt die Klangfärbung mit der loseren oder innigeren Mischung eingesprengter Nachbarsprachen zusammen? Man denke ans Marburger Deutsch, das vielen wie aus slawischer Zunge klingt.
Die einmal herrschende Mundart ist dann an die Scholle gebunden.
Mag auch der wachsende Verkehr ihr viel an Reinheit nehmen, so bleibt doch unter den Wellen von Handel und Wandel eine bodenfeste Grundschicht des Volkes, die der Mundart ihre Eigenart durch Jahrhunderte wahrt.
Doch nicht von all dem wollte ich heute reden und darf es als Laie auch nicht, nicht von den ehrwürdigen Furchen im treuherzigen Gesicht unserer Mundart, sondern von dem, was ihr an Güte, an Schalkheit, an verhaltener, gestillter Kraft aus den alten Augen schaut, oder besser, von den Lippen springt. Das ist mit einem Worte ihr inneres Wesen, das mit dem rein klanglichen Reiz, und mag er sich uns noch so anheimelnd ins Ohr schmeicheln, nur mittelbar zu tun hat.
Da ist sie der klare Waldquell, der noch heute aus den hintersten Gräben und Einschichthöfen herrinnt, den man also möglichst hoch fassen muß, ehe er aus den Zuflüssen des wirtschaftlichen Alltags getrübt ist. Denn das Volk – ich meine das unverbildete reine Gebirgsvolk, das viel mehr Naturvolk ist, als wir gewöhnlich wissen – steht mit seiner Anschauungswelt vielfach noch auf kindlich-treuherziger Stufe. Und das bedingt auch die klare Bildhaftigkeit seiner Sprache. Wie die in der Kinderzeit des Volkes entstanden und mit ihm gewachsen ist, so hat sie sich auch heute noch die gegenständliche Kraft bewährt, die das Abstrakte, »Abgezogene«, noch nicht kennt und sich desto reicher im Konkreten, »Gewachsenen«, umtut. Die »Zucht« ist ein langes Weidenbandgeflecht, das unterm Preßbaum um den Stock gezogen wird. Der gepreßte, gedrosselte Rest heißt das »Drosselt«. Eine »rare Tugend« steigt vom Schlunde auf, wenn der Geschmack einer Speise nicht oder seltsam taugen will. Ein »tapfers Rößl« ist noch ganz im Sinne seiner ursprünglichen althochdeutschen Bedeutung vor allem ein schweres, festes, gedrungenes Fohlen.
So bewahrt denn auch die Mundart auf ihrem eigensten Gebiete, dem gesprochenen Worte, noch einen reichen Schatz knapper Ausdrücke und Wortbilder, die zum Teil noch ihren onomatopoetischen, wortmalerischen Ursprung aufklingen lassen. »Glaggeln«, schlottern, hat Holz als Stoff zur Voraussetzung, »schmoagazn« ist umständlicher zu umschreiben als nachzufühlen, bezeichnet unter anderem das Geräusch, das der kleine Finger beim Zurückziehen aus dem (nicht ganz reinen) Ohre hervorbringt. Bildlich aber ist's, wenn der Bauer seinen Regenschirm, den er irgendwo »verlassen« (verloren) hat, »wieder ankimmt« (findet). Das Vieh, das Pferd, die Schafe treibt der Bauer nicht, er »fahrt« mit ihnen »in« die Alm.
Daneben formt der Volksmund noch immer an farbigen, knappen Wortbildern. Das hängt mit der Umwelt zusammen, mit dem Leben des Bauernvolkes in Feld und Wald. Das genesende Kind schaut die Mutter nach dem Fieberfall »sternliacht« an, das Schneeloch ist »kalvull« (vollgekeilt), der Dirn sind die Röcke nach dem Durchschliefen durchs nasse Gesträuch »kleschkalt«, der gelähmte Schneider wird durch den Mangel an Bewegung »zeckfoast«. Und welch feine Beobachtung steckt nicht in dem Worte »käferliacht anschaun«? Manche der Mundart geläufige Bilder muten geradezu an wie ganz alte Holzschnittbildchen: »Der hat a Freud, wia da Narr mit da Geign.« »Hiaz hätt' i 'n Schelmenrock sullt anlegen« (als Dieb gelten).
Auf diesem reich besaiteten Instrument seiner Mundart spielt nun der Bauer mit eigenartiger Meisterschaft. Schon in der Wortstellung, die oft durch Voransetzung des entscheidenden Wortes ungemein an frischer Lebhaftigkeit gewinnt: » Der wann da kamat«, »g' hört Han i nia davon«, »a Wartl wann da no g'sagt hätt«. Zu anderen Zwecken bedient er sich wieder einer behaglichen Umständlichkeit, etwa wie unser Weinzerl im Sulmtal, der am liebsten in der Formel bejahte: »Se wullt eh frei net dalogn sein.« Zögernd gibt der alte Schmiedjodl eine Möglichkeit zu mit dem Satze: »Ebnsta (ehestens) a weni a so, wia's holt immaramol waar.« Und ein anderer kleidet seine Bejahung vorsichtig in einen Bedingungssatz und sagt auf die Frage, ob er der Moar sei: »I waar sist völli a wen'g a Moar.« Das klingt wie Bauerndiplomatik, die vielleicht noch aus Zeiten stammt, in denen ein bedingungsloses Zugeben nicht in jedem Falle rätlich schien.
Nur nebenher will ich hier die fröhliche Wirrnis volksetymologischer Formen streifen, deren unbewußte Geringschätzung des Fremdwortes oft so humorvoll klingt, wenn sie auch mit der Mundart im engeren Sinne nicht viel zu tun hat. So begrüßt der Roanweber die ersehnte Ankunft des diplomierten Geometers zur Grundvermessung gar wohlwollend: »Af an destillirten Ganameta waar i eh scha long ongwäin.« Den Opodeldok seines Apothekers nennt er gemütlich »Opodelltopf«, weil er im Tiegel verabreicht wird. Aus der Diachylonsalbe wird eine »Oachalsolm«. Besonders leicht nimmt er es mit den Eigennamen. Mich nennt er freundlich »'n Knöpfl«, Doktor Wiskotschil muß sich »Muskatschüll«, Doktor Pendl gar »Pengl« nennen lassen. Zum Teil spricht bei diesen Wortformen schon die Bequemlichkeit der bäuerlichen Sprachwerkzeuge mit, die »gnua« zu »gmua«, Hans zu »Homs«, (Pölfing-)Brunn zu »Brumm« zermahlt.
Daß die Mundart verhältnismäßig rasch aus einer sie auch nur kurz umspülenden fremden Sprache Worte aufnimmt und ihnen, volksetymologisch umgeprägt, dauerndes Gastrecht gewährt, zeigen die Worte »Nummerell« ( ombrelle), »a große Leber« machen ( cause celebre) oder »an rechtn Schagrin« ( chagrin) haben, die noch aus der Franzosenzeit stammen.
Das Gebiet der reinen Mundart hat mit der Zunahme des Verkehrs immer mehr an Boden verloren. Schon die Worte Schriftsprache und Mundart bezeichnen treffend die Verwendungsmöglichkeit beider. Die Mundart hat vor allem dem gesprochenen Worte im täglichen Verkehr zu dienen. Ihr Gebrauch in Schrifttum und Dichtung ist ziemlich enge begrenzt, wenn auch vielleicht nicht so enge, wie J. Grimm folgert, wenn er sagt: »Im Grunde sträubt sich die schämige Mundart wider das rauschende Papier. Wird aber etwas in ihr aufgezeichnet, so kann es durch treuherzige Unschuld gefallen; große und ganze Wirkung vermag sie nie hervorzubringen.«
Der letzte Satz hat heute, wie mir scheint, doch nicht mehr volle Geltung. Im Norden, im Sprachgebiet des Niederdeutschen, hat sich die Mundart in allen Abstufungen des »Platt« in Stadt und Land noch ein weites Feld bewahrt. In ihm sind Fritz Reuters Dichtungen zum köstlichen Hausschatz des deutschen Volkes geworden. Und seinem östlichen Landsmann Klaus Groth hat sie – ich denke an seinen »Quickborn« – Gedichte ins Herz gelegt, voll heißen bangen Lebens, voll klarer Tiefe und schlichter Herzinnigkeit, die in einzelnen Blüten frei im lichten Reiche unvergänglicher Schönheit stehen.
Damit verglichen steht unsere bayrisch-österreichische Mundartdichtung wie ein buntes Bauerngärtlein gegen ein reiches Blütenfeld. In ihr ist viel gesündigt worden. Als ob Franz Stelzhamer, der herb lachende Rhapsode der Landstraße, nie gelebt hätte! So ist die mundartliche Dichtung bei uns von jeher der Tummelplatz des leichtherzigsten Dilettantismus gewesen. Manch grobem Witz, manch läppischer Anekdote, wohl gar einem verstohlenen Zötlein, mußt sie ihr schlichtes Kleid leihen. Und die Sentimentalität, diese Todfeindin aller wahren Kunst, hat es mit billiger Wehmut breit verbrämt.
Denn in Wirklichkeit läßt sich unsere Mundart doch nur zu ganz bestimmten Aufgaben dichterischer Fassung gebrauchen. Und so sollte sie auch nur zu kleinen Kunstwerken verwendet werden, die dem stillen Schönheitsempfinden des Volkes, seinem lächelnden weisen Humor, seinem stummen Leid dienen wollen. Nur leise und mit den sparsamsten Mitteln, nicht versichernd, sondern in schlichter Bildlichkeit soll sie an die letzten Dinge rühren. Dann kann sie auch aus unserem Bauerngärtlein manch feine Blume voll seltenen Duftes ziehen. Das hat uns Karl Stieler gezeigt.
Doch ich möchte mit diesen letzten Sätzen der Mundart nicht das Grabgeläute singen. Nur reinhaben möchte ich ihr liebes Gesicht vom Staub der Straße, vom Schmutz des Alltags. Denn sie ist lange gewandert. Aber Almosen braucht sie darum noch lange nicht. Im Gegenteil: sie hat ihrer vornehmen Schwester, der Schriftsprache, manch blinkendes Hellerlein gegeben und gibt es noch, unauffällig und unbewußt, wenn anders diese etwas müde geworden unterm Drucke toten Ballastes und durstig vom Staube der Kanzleien. »Dialektische Wiedererzeugung« nennt etwas trocken J. Müller die kleinen Anleihen, die die Schriftsprache immer wieder aus dem Schatztrühlein der Mundart nimmt.
Und wenn W. H. Riehl, der klaräugige Wanderer und seßhafte Ergründer deutschen Volkstums, meint, was der Wald für die Volkswirtschaft, sei der Bauer für die Gesellschaft, der getreue Hinterhalt alles sozialen Aufbaues, so ist die Mundart der klare Quell, der immer wieder zuzeiten der Schriftsprache die blassen Wangen gar hold zu röten weiß.