
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
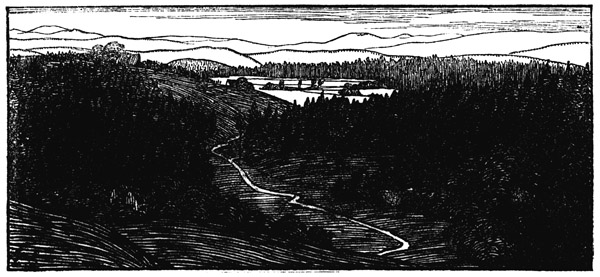
Der Sausal –! Ein sonniges Königreich des Weines (schmeckte er zuzeiten nicht etwas säuerlich?) baut er sich von fernher auf, mit Kirchen und schimmernden Kapellen und Weingartenhäusern, voll Vogelsangs und verhallender Jauchzer. Und wer, etwa mit der Sulmtalbahn, ganz nahe seine Flanken entlang fährt, dem drehen sich im gemächlichen Gleiten stille Täler zur Schau, daraus der Kuckuck im Waldgrund ruft und von sonnigen Hügeln die Windmühlen wie närrisch ins Murtal schnarren. Da läuft man noch barfuß durchs Leben auf warmsandigen Wegen und wird zu Grabe getragen durch winkende Rebgelände nach stillen Kirchhöfen, die wie vergessene Gärten im Fichtenhag träumen.
Und vor tausend Jahren?
Da war das Bild viel sparsamer und doch tiefer an Farben, etwa wie ein alter gestickter Wandteppich, darauf im finsteren Forst allerlei Getier entläuft vor Jägern zu Roß und lechzenden Hunden. Denn anno 970 hatte Kaiser Otto I. dem Erzbistum Salzburg zu anderen Gütern den Wald Sausal geschenkt, »die süßen Täler«, zur Jagd auf Bären und Wildschweine, drei Wochen vor der Herbst-Tag- und Nachtgleiche bis auf Martini. Noch war das deutsche Edelholz, die Eiche, in weiten Beständen mächtig über Hügel und Gründe, und das Aasrecht, die Erlaubnis, Schweine zur Eichelmast in die Forste treiben zu dürfen, eine bescheidene Einnahmsquelle für weltliche und geistliche Grundherren. So befiehlt Erzbischof Ortolf von Salzburg zur Ordnung der Jägerei im Sausal 1356: »Wir wollen auch, wer in den Sausal treibet, daß man den Zehent davon nehme, zu einem Zeichen, daß der Wald unser ist. Einmal im Jahr soll der Jägermeister zu jedem Gjaidhof kommen und wahrnehmen, ob sie ihre Hunde und Spieß und Jägerzeug im Stand haben, auch mag er dann die ›nachtselde‹ (Herberge) bei ihnen nehmen, doch ohne allzu große Beschwernis für den Mann. Auch wollen wir, daß die Jäger zu einemmal mit ihren Hunden und ihrem Zeug hin zum Jägermeister kommen am Sankt Georgentag und wer dahin nicht kommt, oder seinen Zeug nicht mitbrächte, der soll verfallen sein des Wandels – – und da soll man zwischen ihnen richten und verrichten, was sie untereinander zu schaffen haben. Wer aber ohne Urlaub im Sausal jage, den soll der Jägermeister pfänden, und vermöge ers nicht, so soll er ihn dem Vicedom anzeigen oder dem Pfleger auf der Veste Arnvels.«
Herr Ortolf von Weißeneck war sein Lebtag ein streitbarer Mann und der Jagdspieß lag ihm locker in der Faust. Zum Frührot eine Messe im dunklen Münsterlein auf dem Frauenberge, tagsüber ein heißes Gejaid im nahen herbstklaren Sausal und des Abends ein bedächtiger Trunk aus dem tiefsten Keller seiner Bischofpfalz zu Seggau, das gab einen freundlichen Ruhetag in all den Händeln seines fehdereichen Lebens. Als Regal, als Königsrecht, war die hohe Jagd seit uralter Zeit gebannt und nur des niederen oder Reisgejaids durften die Grundherren pflegen. Das stand im harten Gegensatze zum Empfinden des Volkes, dem Wild und Wald seit jeher frei galten. Noch heute leben Nachklänge dieser Meinung im Volke. Der Wildschütz – nicht der Wilddieb – ist ihm vom Schimmer der Romantik umwoben und sein verwegener Kampf mit dem Jäger ist im Volksliede, vor allem der Steiermark, zu hundertmalen verherrlicht.
So ist's ein zwiespältig Lied, wie es durch die Jahrhunderte geht, das Lied vom edlen Weidwerk. Der stolze Waldhornruf zur Reiherbeiz im herbstlichen Brachfeld und nächtliches Scheuchgeschrei und das Holzklappern feldhütender Zinsbauern klingen nicht gut zusammen. Das gab zu allen Zeiten harte Kämpfe mit der fürstlichen Jagdhoheit, die selbst die niedere Jagd, das Reisgejaid, noch bis ins vorige Jahrhundert nur dem Adel zugestehen wollte. Wir brauchen gar nicht an grausige Bilder aus der Jugendzeit zu denken, wo wir in illustrierten Zeitschriften einen Wildfrevler, etwa aus dem schottischen Hochland, an einen fliehenden Hirschen zur Strafe angeschmiedet sahen. Auch in Steiermark bestimmt ein Urbar der Lamprechter Propstei Piber vom Jahre 1493: »Item das rotwild und sweinen wildpret verpeut man auf und ab des gotshaus grünten zu jagen bei verlierung der augen.« Doch ist solche harte Buße wohl kaum geübt worden. Immerhin suchten aber auch die Nachkommen des »großmaechtig Weidmann« und letzten Ritters sich vor frevelhafter Störung ihrer Jagdlust zu schützen. So waren nach Maximilian vor allem Kaiser Ferdinand II. und Karl VI. leidenschaftliche Jäger. Hat doch dieser auf einer vom Landeshauptmann Adam Grafen Breuner ihm zu Ehren auf dem Reiting angestellten Gamsjagd 36, die Kaiserin aber 24 Stück Wild erlegt. Schon 1568 hatte Erzherzog Karl dem Wildern der Bauernhunde durch eine ebenso harte wie zum Teil auch fruchtlose Maßregel zu wehren versucht, wenn er verordnet: »… und nachdem Uns eure Rüdenhunde das Wildprät verjagen, auch beschedigen, und also Uns unsern landesfürstlichen Lust verderben und zerstören, und Uns aber solches lenger zuzusehen oder zu gedulden nit gemeint, so ist Unser ganz ernstlicher Bevelch und wöllen, daß euer Yeder seinen Rüdenhünden den rechten vordern Fueß in dem ersten Glied abhackt, und solches bey Peen fünfzehn Kreuzer von ydem Hund, dem also der Fueß nit abgehackht, nit underlaßt.«
Ein Glück, daß schon damals nicht alles so heiß gegessen wurde, als es gekocht ward, und Bauerntrutz und Bauernlist werden manche Kindertränen um den zottigen Spielgenossen gestillt haben.
Seit langem war das freie Murtal südlich von Graz, das Grazer, Fernitzer und Leibnitzer Feld, der vorzüglichste Tummelplatz herrschaftlicher Jagdlust. Obwohl kaiserlicher Wildbann, von Graz bis Wildon zu beiden Seiten der Mur, war den Herren und Landleuten der angrenzenden Güter gestattet, im Fernitzer und Leibnitzer Feld auf Rebhühner zu beizen und Füchse und Hasen zu hetzen. Unter allen Umständen aber blieb, wie die hohe Jagd überhaupt, auch die Jagd im eigentlichen Grazer Feld im vollen Umfange der kaiserlichen Hofhaltung strenge vorbehalten. Hochgefreit war besonders die Jagd auf Fasanwild, das ohnehin nur aus dem kaiserlichen Fasangarten in der Karlau stammen konnte. Schon dem Kaiser Leopold war es 1666 »frembd anzuhören fürkommen, daß sich ihrer nit wenige unterstanden, Unsere fürstlichen recreationes und Erlustigungen in mehr wenig zu pertubieren indem nit allein ungescheucht sowohl Frühlings, als Herbstzeit, die Hasen mit Windspielen gehetzt und gefangen, sondern auch die Fasanen mit Spörber und Habich gebaist und mit unzuelässigen Instrumenten, Streckh- und Zugnetzen und dergleichen sowohl Sommerszeit im Schnitt, als Winterzeiten im Schnee zu mehrmalen strafmässig abgefangen und geschossen werden«. Das wolle er bei »große Ungnad und Straf« ein für allemal abgestellt wissen.
Das Mandat scheint nicht allzuviel geholfen zu haben oder wohl nur dem Fasanwild und im engeren Wildbann um die Hauptstadt Graz. Immer lauter, beweglicher werden die Eingaben über die Verwüstung von Feld und Fluren durch adeligen Jagdeifer. So klagen die Untertanen des Fernitzer Feldes 1646 an die Hofkammer: »… Wir einfältige arme, ohnedaß bedrangte Leuth khönnen nicht für gut ermessen, was zu jetziger Frielingszeit durch die Päß (Beize) gesuecht wird, das solches dem menschlichen Gebliet zu einer ersprießlichen Delectationsspeiß zu gueten gedeihen können … Nun will uns zwar dieses nit anfechten, welches wir arme Pauersleuth alleinig wegen unserer zuegefüegten Schäden halber alhero anziehen, indeme uns armen Leuthen durch dergleichen Päß bey so unbequemblicher Zeith unsern lieben Getraidt auf den Feldt, weliches anjetzo in der schwächsten Blie aufschießt, mit denen Pferdten also verdorben, daß es möcht ainen Stain, zu geschweigen ein christmitleidens Herz erbarmen. Dann es sich auch oftmalen zuetregt, daß 5, 6, und woll mehr junge Herrn Adelsstandes Personen, ein Jeder mit zween Diener, auch soviel oder mehrer Jagdhundten auf die 10, 12 und mehr Persohnen auff berierte Felder hinein in das liebe Getraidt ohne allen respect und Scheu sötzen und also durch Suechen und Durchreiten verwießten und zertretten, daß es Gott in Himmel zu erbarmen …«
Nun aber kam zu solch gelegentlichem Flurfrevel adeliger Jäger, und zwar schon seit mehr als hundert Jahren, dank einer unbedenklichen Überhegung ein Anwachsen des Wildstandes, daß dadurch alle Früchte bäuerlichen Fleißes aufgezehrt wurden. Schon um 1580 bitten die Pfarrgemeinden von Mooskirchen, St. Stefan, Bartlmä, Stallhofen und Hitzendorf »mit demietigen Fueßfall um Gottes und des jingsten Gerichts willen« den Erzherzog Karl in einer Eingabe: »… so wird uns die Gottesgab, so wir mit unsern harten Schweiß daran streckhen und erpauen, durch das laidige überflüssige Gewildt von Hirschen und Wildschweinen zu Weingartten sowohl als auf andern Gründten alles verwießt und verzehrt, dardurch wir arme Leith sambt unsern armen Weibern und khlainen unerzogenen Kinderlein dermaßen erarmt und aufs Eyßerste getrieben, daß wir das liebe truckhne Prot dabey nit gehaben noch viel weniger darvon die gebuerliche Gehorsamb des Marchfuetters ferner raichen mügen …« Sie bitten in aller Demut wenigstens um eine erträgliche Verringerung des Wildstandes. Wohl nicht mit allzuviel Erfolg. Denn hundert Jahre später wird die alte Klage nur um so dringender wieder erhoben. Und die Gutsherren treten an die Seite ihrer bedrängten Untertanen. So meldet Isabella Gräfin von Saurau auf Ligist namens ihrer Bauern, daß das Gewild schon so vertraut und »trutzig« sei, daß es sich durch keinerlei Lärm oder Geschrei verscheuchen ließe. Zu Attendorf haben schon zwei Untertanen ihre Gründe heimgesagt, weil sie sich darauf vor Wildschaden nicht mehr halten können. Besonders in den Weingärten schaden die Wildschweine durch Umbrechen des Bodens sehr, wenn sie nachts zu 20, 30 Stücken, große und kleine, einbrechen. Das Hochwild zieht zu 40, zu 50 Stücken ins Feld. Und die Bauern im Grazer Feld klagen um die gleiche Zeit, wie sie, todmüde von harter Tagesarbeit und Robot, nachts auf ihren Feldern wachen und wehren müßten. Und wenn sie dann doch einmal der Schlaf überfiele, sei in einer kurzen Viertelstunde die Arbeit mancher Wochen zunichte gemacht. Sie könnten wegen des Wachdienstes oft keine Dienstboten mehr gewinnen, unangesehen, daß dadurch allen möglichen Lastern, wie Ehebruch, Unzucht, wo nicht gar Mord und Totschlag, die Tür geöffnet würde. Und so müßten sie weinenden Auges zusehen, wie sich die Unmutigen oft in grausamem Fluchen und in Gotteslästerungen ergingen, die anzuhören fast nicht möglich sei.
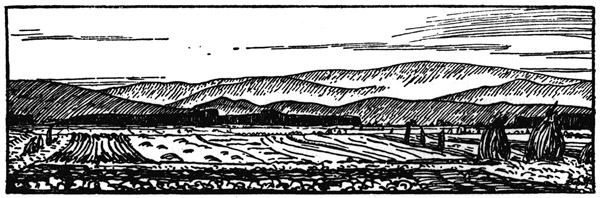
Diese vielfachen Nöte aber wurden noch gesteigert durch die schwere Bedrückung des Landvolkes von Seite der kaiserlichen Forstknechte. Schon 1577 klagte Wilhelm von Gleispach auf Narreneckh (dem heutigen Waldegg bei Kirchbach) im Namen seiner Untertanen: »… waßmaßen sich die umblaufenden Bettlerknecht, so sich Landtsknecht nennen, meine armen Underthanen mit wöhrhafften handt anzufallen und sy zu beschedigen undterstehn, und daran nit ersettigt, sundern ihnen dann noch mit brandt drohen, wie sich auch der Vorstmaister sambt seinen Anhang die armen Leuth einzuziehen Undterfangen …«, habe er schon jüngst fürgebracht, doch keine Antwort zu erhalten vermocht. »Da aber weder mit denen Vorstknechten oder den Landsknechten, die fürwahr denen armen Leuthen große verderbliche Beschwer zuefüegen, khein Aufhören seyn will, sondern der vorstmaister die armen Leuth täglichen bei dem grinndt nimbt, auch die Vorstknecht ihres Bolderns und Muetwillens khein Endt schaffen wollen, sondern je lenger je mehr sich rottieren …«, bittet er dringend um endliche Abhilfe.
Aber von allen weidgerechten Habsburgern war Erzherzog Karl wohl einer der unermüdlichsten. In seinem neu erbauten Jagd- und Lustschlosse Karlau hat er so manchen Abend die schweren Sorgen um Türkennot und Ständewehr im Saitenspiel seiner Hofkapelle verklingen lassen. Und aus der Karlau und dem Gejaidhof zu Tobel stob immer wieder die Jagd aus ins morgenfrische Grazer Feld, das im Kaiserwald und den umliegenden Forsten einen reichen Wildstand hegte. Viel später noch, 1642, hat der Unter-Land-Jägermeister Herr Gottfried Freyherr von Eybiswald den Hochwildstand in den dem Gejaidhof unterstellten Revieren zählen lassen. Es waren 656 Hirsche und insgesamt 912 Stück Hochwild, so zu Tobel 70 Hirsche, zu Ligist 30, zu Söding 40, zu St. Florian 38, zu St. Georgen 64. Das gab neben lästigem Jagdfron ganz gewaltige Wildschäden an Feldern und Fluren, die damals wohl kaum einen willigen Tilger fanden.
So laufen die Klagen erfolglos durch zwei Jahrhunderte: Die Forstknechte greifen über den kaiserlichen Wildbann durch Feld und Flur in jedes Reisgejaid, schießen die Wachthunde auf dem Feld, ja sogar die Hofhunde nieder, brechen in die Stuben ein, verjagen die nächtlichen Wachen, reißen die durch kaiserliches Patent erlaubten Zäune wieder nieder, vorgebens, sie seien zu hoch und zu spitz, so daß sich das Wild daran schädigen könne. So pfänden sie einer armen Wittib die einzige Kuh aus dem Stall, weil ihr Sohn, der Feldhüter, das Wild angeblich zu weit in den tiefen Wald verfolgt habe. Kommissionen, das übliche Mittel damals wie heute, werden abgeordnet. Sie empfehlen strengere Umzäunung der Fruchtfelder. Die Bauern erwidern, wo sie kaum das nötige Brennholz zu kaufen vermöchten, könnten sie um so weniger Zaunstangen gewinnen. Und die Forstknechte rissen ja doch alles wieder nieder. Die Jagdrobot aber vor allem gebe zu den ärgsten Ungerechtigkeiten Anlaß. Denn wer sich gut zu dem Forstmeister zu stellen wüßte, sei es durch Reichung von Geld oder Frucht, der dürfe von der Robot ausbleiben. Die anderen aber werden drangsaliert und bis auf zehn, ja bis auf vierzehn Tage zu den Wolfsjagden auf die Ligisteralpe entboten, wo sie – es handelt sich um Untertanen von St. Martin im Sulmtale, Michlgleinz und Gleinstätten – des Nachts, als den Bauern unbekannt, oft keinen Einlaß fänden und auf freier Weide übernachten müßten, so daß voriges Jahr ihnen zwei arme Buben erfroren wären. Dazu meldet der hochfürstlich salzburgische Pfleger auf Deutschlandsberg, einer seiner Bergholden sei von den Forstknechten derart fürchterlich mit über hundert Stockstreichen geprügelt worden, daß er heute noch daran zu leiden habe.
So war es nun endlich kein Wunder, wenn der lange zurückgedämmte Unmut des Landvolkes da und dort zu verzweifelter Gegenwehr griff, die sich vor allem unter dem kaiserlichen Weidmann Karl VI. in einer gewaltigen Zunahme des Wildererunwesens zeigte. Das machte dann Schule. Erst im Ennstale, um Irdning, dann auch zu Untersteier kam es zu förmlichen Bauernrevolten und planmäßiger Austilgung des überhegten Wildstandes. So wird dem Corbinian Grafen von Saurau von seinem Verwalter zu Schwanberg berichtet: Es hätten den 4. Jänner 1740 die herrschaftlich Arnfelserischen und Eibiswalder Untertanen nebst einigen »dazugeschlagenen« Bergholden, über zweihundert an der Zahl, von den Arnfelser Gejaidern herauf in den sogenannten Kollberg (sw. Arnfels) und Unterreinisch als Schwanbergischen Distrikt ordentlich gejagt und, so viel wissentlich, am selben Tag fünf Tiere gefällt. Andern Tags, als den 5., hätten sie in noch größerer Anzahl zu Greuth bei Thunan, Bischoffegg und Oberhag gejagt, am Donnerstag als dem 7. darin angehalten, über den Pongratzenberg bis auf die Eibiswalder Schweig (Schwoagkroaner) und unter den Radl hinaus. Und weil aus solch hochverbotener Zusammenrottierung und gewalttätigem Eingriff in so vielen Gejaidern nichts Gutes zu vermuten, sondern bei weiterer Vermehrung dieser Rottierung fernere Untaten zu besorgen seien, melde er solches dem Herrn Grafen, damit solcher die nötigen Mittel an die Hand nehme.
Wieder wurde eine Kommission eingesetzt. Sie stellte fest, daß nicht nur die Schönbornschen Untertanen, sondern auch die von Leibnitz, Schmierenberg, Arnfels, Seggau und Deutschlandsberg derart wildern, daß sogar Jagden von Haus zu Haus angesagt und die zu erscheinen sich Weigernden schwer bedroht werden. Außerdem sind sogar fünf Bauern nach Ferlach gegangen und haben dreihundert Gewehre herübergebracht. Die weitere Untersuchung ergab, daß die Ferlacher selbst drei Wagen mit Flinten nach Leutschach gebracht und dort öffentlich verkauft hätten. Es wurde ein Militärkommando in die bezeichneten Gegenden gelegt, um den Aufruhr zu stillen.
Dieser ganz böse Handel und zugleich die harte Not der Zeit findet eine zusammenfassende Darstellung in dem Vormerkbuch des Pfarrers Johann Baptist Zmuegg in St. Martin im Sulmtale, das uns das Landesarchiv aufbewahrt. Er schreibt:
»Vorhin ich das Jahr (1740) schließe, mueß ich nothwendig der Nachwelt desselben Denkhwürdigkeiten hinterlassen. Es war dies Jahr ein sehr mißgeräthiges, da die Frielingskälte sehr lang hinaus gedauert, ad festum Sti. Floriani (4. Mai) Schnee gefallen und die Erdt gleich wie im Winter gefroren, im Sommer der Schauer den Sausall, Gleinstettner Pfarr, also getroffen, daß die Weingärten denen neubauten Aeckhern gleichgesehen, welches gemacht, daß kein Gruebholz geblieben. Der Herbst, circa medium, war dem Friehling gleich, dahero alle Weintrauben so unzeitig gewest und verdorben, daß Viele ihre Weingarten nit gelesen, der Wein mithin der Startin von 24 Fl. auf 50 Fl. gestiegen, welches vom vorigen Jahre war. Die Leinsath ist aehndlich ergangen, aber der türgische Weiz mülchig geblieben, woraus Noth und Armuth entstanden. Am meisten mußten in diesem Jahr die Jäger und Hürschen leiden; Denn (da) die Unterthanen schon sovill wegen Exzeß der Jäger sich bey ihren Herrschafften und sovill Jahr vorhin schon wegen Uiberfluß des Schadengewüldt beclagt, sie ihnen aber nit helffen wollen und khönnen, … auch die Bauern in Obersteyer 1739 aigenmächtig das gewült abgeschossen, welches die dahin geschickte Kommission und Soldathen gedempfft; so haben sie in Sausall und nachgehendts gleich in Remschnigg (sw. Arnfels) ad festum Stae. Margarethae (10. Juni) das Jagen und Schießen unitis viribus angefangen; wegen gemachter Citierung nach Gräz ist dieser Tumult in etwas gestillt worden, indeme die Remedur versprochen worden. Weill aber in der Stückh Pürsch denen Bauern khain geniegen gelaistet worden, ist das Feuer in der ganzen Untersteyer circa ad festum natalitiae (um Weihnacht) auf einmal ausgebrochen, so bis Ostern gedauret, welches auch fast alle Hürschen verzöhrt, wo wir allhier zuweillen 50 Thier in einer Herd gezählt haben, wie ich denn zu dieser Jagdzeith im Fasching vom Pfarrhof aus 40 von Bauern verfolgte und zusammengetriebene Thier auf der Wiesen beim Schwaben Bach gegen Haslach gezählt. Da die Bauren zu hundertweiß sich versamblet, haben sie nit vill ausgerichtet, wohl aber nachgehendts, als sie sich zerthailt, dahero wir anjezo fast khain Hürschen sehen. Die Bauren waren beherzt, sie droheten weltl. und geistl. Obrigkeiten, sie hinderten die Publizierung der damahligen kayserl. Patenten ob hunc eorum veriebten Gewalttetigkeiten undterschiedlich, wie sie den Herrn Verwalter von Eybeswald in marckht angefallen, bey seiner Flucht in ein Bürgerhaus (zum Lederrzunftmeister Schmautz, heute Staudinger) die Thüren eingesprengt, sein Weib mit Priegl traktieret, ihm aber Herr Pfarrer allda errettet; huc usque generositas rusticorum (so weit reicht die Tapferkeit der Bauern). Aber zu Ostern, als das Caraffische Kürassier-Regiment eingerückhet und in alle Märckht verlegt worden, da ist auch Forcht und Zittern einlogiert worden. Alle Tumultuanten seind von Soldathen eingefangen worden, doch fast keiner, so nur allein geschossen, ausgenohmen in wirklichen kays. Forst; man besorgte große exemplarische Bestrafung, welches vielleicht würde geschehen seyn, so nit der Tod Carolum VI. den Kaiser gefischt. Es seynd die meisten Bauren entlassen worden vom Rathhauß zu Gräz, ein und der ander wegen gemachten Aufruehr ist noch da, ja seynd auch etliche ad torturam khommen, an Leben ist bis dato nichts Jemand geschehen, scheint auch nit hinfüro, weill die Königin unser gnedigste Landtsfürstin gahr gnedig auch nach des Kaysers Todt geschwind in Österreich diesen Hürschensturm angegangen, zudem hat die gnedigste Königin der 1721 Jägerordnung eine neue strackhs widrige (entgegengesetzte) zu nutz der Undterthanen herausgegeben, also 1. daß ein Jeder das Gewilt kann abtreiben wie ein andres auch, 2. daß auch ohngehindert Zäun khönnen gemacht werden, so auch ein werl allda, 3. so annoch ein Schaden sich ereignete, soll der Undterthan seine Beschwärden zeigen, 4. so überdies noch ein Schaden geschehte, soll er geschätzt und von Wildtpannherrn bezahlt werden …«
Jedenfalls aber ist nach dem Tode Karls VI. die junge Landesmutter Maria Theresia den bedrückten Untertanen wie ein Stern der Hoffnung erschienen. Und Leben und Wirken dieser seltenen Frau hat diese Hoffnung in der Folge nicht Lügen gestraft.
