
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
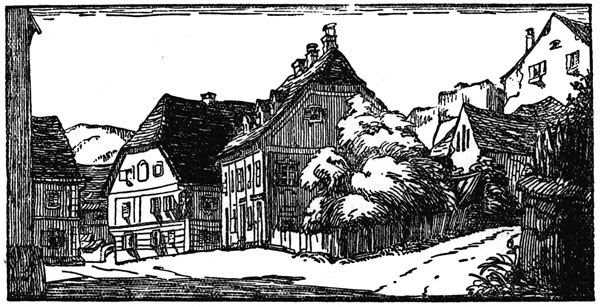
Ein schweigender Zuschauer ist die Zeit. Sieht Menschenwerk aus Wald und Wildnis wachsen, das sich gelegenen Ortes schart, am Fluß, am Saumweg, unterm Wartturm, zum Weiler, zum Dorf, zum Markte. Der wird zum quillenden Brunnen, dem aus hundert kleinen Adern zuströmt, was Wege sucht und Nutzen bringt. So wächst er auf zum festen Gemeinwesen, oft rasch und stolz an den Sonnseiten des jungen Verkehrs, oft karg und bedächtig im Schatten der lauten Welt. Immer ist's ein organisches Wachsen im mählichen Erstarken aus früheren Siedlungskeimen zu langen Erntejahren aus Arbeit und Handel und Wandel. Seine Jahresringe bedeuten Jahrhunderte und was als schwarze Male darin verwachsen an Brünsten, Seuchen und Feindesnot, merkt keiner mehr am glatten Stamm der Gegenwart. Aber auch am Boden modeln die Jahrhunderte; ergraben und verschütten, brechen da einen Turm, füllen dort einen Weiher, ziehen die grüne Samtdecke der Vegetation über versinkenden Schutt. So wird das Gelände »domestiziert«, sein urtümliches Furchengesicht geglättet, eingeebnet. Wo ein wuchtiger Torturm den Zugang sperrte, picken die Tauben auf breiter Straße, die alte »Kircheben« ist zum blumigen Kinderspielplatz geworden und nur der steinerne Radabweiser am Eckhause knirscht noch dickschädlig sein grämliches » anno domini«. –
»Im Sulmtale im weiteren Sinne war Eibiswald der früheste landesfürstliche Ort in vorhabsburgischer Zeit, schon unter den Babenbergern.« Wir müssen es dem Meister steirischer Geschichtsschreibung, Franz Krones, glauben. Schon um 1170 hat er seine eigene Kirche, von Leibnitz her. Vorher – und so weit zurück reicht die Überlieferung des Landvolkes – war St. Johann im unteren Saggautale der nächste Kirchort; und wo beim heutigen Maritschmüller die Forellenwasser übers Wehr rauschen, hauste sein letztes Pfarrkind. Vielleicht waren sie zwischen Wild und Wald nur lässige Christen, die der stundenlange Kirchgang nicht allzu sehr beschwerte. Denen die Furcht vor Herrn Herrands von Wildon »hows Ibanswald« zuzeiten schwerer im Nacken saß als die Sorge um das ewige Seelenheil. Das aber, die Feste Eibiswald, lag in bescheidener Wehrkraft graben- und weiherumsäumt zu Häupten des Hanges, an dem entlang die schüttere Häuserzeile die Kirche suchte. So war der Markt mit Herberge und Schmiede der letzte Rastplatz vor der Fahrt über den Radlpaß, wo aus feuchten Buchenschatten mancherlei Unheil dräute.
Heute sieht der Markt wie viele aus, nicht alt und nicht neu, freundlich, wie die Wortschutzmarke des Fremdenverkehrs lobt. Nach verheerenden Brünsten wuchs längst aus Schutt und Winkelwerk der alten Holzbauten das feste Bürgerhaus, an dem im Laufe der Zeiten der Hausmaurer flickte und mörtelte und strich, bis es die richtige »Fassad« hatte. Zur guten Stunde aber sucht ein weißhaariger Urgroßvater am Faden der Überlieferung zurück in vergessene Zeiten, und in verstaubter Bodentruhe findet sich ein Bündel alter Schriften, daraus unterm trockenen Kanzleistil manch lebendiges Wörtlein schaut. Die Lücken füllen sich, erst spärlich, wie zögernd, aber am Ende steht klar und scharf das Bild des Marktes wieder auf mit all seinen Bürgern und Rücksassen, wie sie handfest an ihrem Leben steuerten, bedächtig oder hitzig, schwerblütig oder leichtlebig, grob oder fein, wie's wohl auch heute ist. Aber mit einem sicheren Sinn fürs gemeine Wohl, der uns längst abhanden gekommen.
Handel und Verkehr auf den Straßen waren sicher lebhafter als heute. Aber die öffentliche Fürsorge für ihn hielt sich auch damals schon in bescheidenen Grenzen. Vor allem war das Reisen recht umständlich und zeitraubend.
Der Stellwagen Klagenfurt–Graz – wir blicken um mehr als hundert Jahre zurück –, der um fünf Uhr morgens von Mahrenberg abfuhr, kam etwa um acht Uhr in Eibiswald an. Man stieg »beim Saitenmacher« am Kirchplatz ab und fuhr dann den ganzen Tag über bis Graz, bei schlechtem Wetter nur bis Premstätten. In Gleinstätten wurde um die alte Mittagsstunde, um elf Uhr, das Mahl eingenommen, »beim krumpen Schneider«, wie der Volksmund sagte. Einem beschränkten Warenverkehr diente außerdem die »Klepperpost«, ein zweirädriger Karren, den ein Mann, zuzeiten war es der Herter-Michl, nach Graz zog. Dahin ging überdies auch wöchentlich ein Fußbote, der Kremser hinterm Schloß, der die Briefe und allerlei Einkäufe besorgte. Die Briefe waren beim Kaufmann Perisutti, »Perischutt«, aufzugeben und in Empfang zu nehmen.
Wer so mit dem Stellwagen über den Radl kam, hatte auf der alten Straße, die ursprünglich über den vulgo Siebernegg zum alten Straßenwirtshaus »beim Baier« herabführte, kaum ein behagliches Fahren. Eine Viertelstunde vor dem Markte lag links abseits am Saggaubache die uralte Sensenschmiede mit ihrer Taberne. An der Burgfriedsgrenze aber mochte manches den Reisenden nachdenklich stimmen. Da stand in den Feldern marktwärts eine Pestsäule zur Erinnerung an die Seuche von 1721. Schon näher dem Markte dräute rechts vor dem Bürgerwald auf niederer Hügelwelle das einsame Hochgericht, von dem das »böse« oder »Galgenbachl« zur Straße lief, an der das Hochgerichtskreuz stand, für den armen Sünder der letzte schwache Trost vor dem bitteren Ende. An der Stelle der alten »Kreuzkirche« steht heute noch die gleichnamige schmucklose Kapelle, die im Volksmunde zuweilen als Rest der einstigen ersten Kirchenanlage im Mittelalter gilt. Vor ihr durften zu Pestzeiten die Gebirgsbauern und ihr Gesinde »in angemessener Entfernung« dem heiligen Meßopfer beiwohnen und den priesterlichen Segen, ohne Vermischung mit der Marktbevölkerung, empfangen.
Von der Kreuzkirche lief gegen das Hammerwerk zu die »Galmeistraße«, auf der die Zinkerze für die k. k. priv. Messingfabrik nach Frauental geführt wurden. Die Hauptstraße aber erreichte das Markttor an der Südseite jener Zeile von kleinen Häusern, deren Insassen als Weber, Schneider und Schuster vom lebhaften Verkehr der Straße ihren bescheidenen Nutzen zogen. An der Kreuzkirche wurde an Markttagen die Maut eingehoben.
Vor dem oberen Markttor – vielleicht war es noch der bescheidene Nachfolger einer einstigen Wehranlage – führte eine Brücke über die Reste eines alten Grabens, an dem linker Hand der »Grabennesner«, ein Schneider und Spielmann, stubenvögelumzwitschert sein Liedel pfiff. Innerhalb des Tores lag rechter Hand der Marktteich, geringen Umfanges wie noch heute. Der Marktrichter hatte ihn gegen ein Bestandgeld jährlicher zwei Gulden zu genießen, mußte aber den Ratsmitgliedern nach dem feierlichen Georgi-Bannteiding daraus ein Fischgericht kredenzen. Neben dem Marktteiche hatte der Torschuster Feysinger seine Behausung, der als magistratlicher »Ansager« mit der Trommel zu verkünden hatte, was zur Kenntnis der Marktrücksassen gelangen sollte.
So fuhr man in den langgestreckten Marktplatz ein, dessen vornehmster Schmuck die in den Jahren nach dem großen Brande von 1711 errichtete Mariensäule mit ihren vom Schloßherrn Josef Grafen von Schrottenpach gestifteten Statuen des heiligen Josef und Karl Borromäus war. Die geschlossene Häuserzeile, die den Platz heute säumt, ist allerdings in dieser Form erst nach dem großen Brande von 1854 entstanden. Früher lagen noch zwischen behäbigen Bürgerhäusern die Keuschen der Kleinhandwerker in bunter Reihe.
Als das vornehmste Bürgerhaus nach Geschichte und Ruf galt wohl das alte Lebzelterhaus am Schloßweg, schon hundert Jahre vorher, 1694, unter dem bürgerlichen Gastgeb und Marktrichter Johann Kacherl die vielbesuchte Herberge der Reisenden und der Sammelplatz der Bürger, nun im Besitze des Brauherrn und Lebzeltermeisters Anton Lerch. In den weitläufigen Stallungen dieser Herberge war in der Nacht vom 18. auf den 19. Mai 1711 jener furchtbare Brand ausgebrochen, der 48 Wohnhäuser in Asche legte. Und als ob ein eigener Unstern über diesem Hause waltete, ging auch die letzte schwere Feuersbrunst des Jahres 1854, der 33 Wohnhäuser und 35 Wirtschaftsgebäude zum Opfer fielen, von den Lerchschen Stallungen aus.
Gegenüber dem Lerchhause stand und steht heute noch das Stammhaus der zweitältesten Bürgerfamilie, Hubmann, die unter ihre Vorfahren jenen Thadäus Hubmann, den langjährigen Marktkämmerer und Marktrichter zählt, dessen ausdrucksvoller Handschrift wir durch Jahrzehnte in den Marktprotokollen jener Zeit begegnen. Sein und seiner Ehewirtin Ölbilder, von Johann von Lederwasch 1817 gemalt, schauen heute noch ernst und gewichtig von der Wand der guten Stube des ehrwürdigen Bürgerheims.
An der unteren Seite des Marktplatzes hatte jüngst, 1802, der ehemalige Handlungsbedienstete Johann Perisutti aus Bleiburg in Kärnten, der Schwiegersohn des weiland Peter Deanino, der noch als »Savojard« im Markte verblieben war, das alte Ledererhaus Schoppinger erworben und darauf als »Materialienhändler und Pulververschleißer« ein Geschäft zur Blüte gebracht, das als Briefaufgabestelle zugleich der Sammelpunkt aller Neuigkeiten aus der weiten Welt war. Noch heute wirkt der Segen dieses alten Bürgerhauses im Eibiswalder Krankenhause fort. Rang und Namen im Munde der Einwohner hatten noch manch stattliche Häuser, des Färbermeisters Herzl, der Fleischhauer Puhr und Pestebner, des Huterers Plenckh und mancher anderen, deren Familiengeschichte nachzugehen eine dankenswerte Aufgabe für einen sinnenden Ruheständler wäre.
Noch bot ein rühriges und geschicktes Meistertum ein anregendes Bild von mancherlei Hantierung. Kunsthandwerker, wie der Bildhauer Franz Heeger oder der Maler Anton Kremer, hatten freilich seit Jahrzehnten keine Nachfolger erhalten. Aber noch übten ihre Gewerbe der Kürschner, der Handschuhmacher, der Saiten- und Betenmacher, der Gürtler, der Eisengschmeidler, der Strumpfwirker, der Wachszieher und Lebzelter neben den Meistern für den alltäglichen Bedarf, den Hafnern, Bindern, Webern und anderen. Daneben versuchte der eine oder andere Vertreter der »ehrsamen Bader- oder Balbiererzunft« seine segensreiche Kunst bei summarischer Therapie. Und konnte es nicht verhindern, wenn wieder einmal ein Feldscher aus den zahlreichen Kriegen des 18. Jahrhunderts Aufnahme fand. Der hatte wohl bei Truppendurchzügen den freundlichen Markt kennengelernt und die Stellung eines bürgerlichen Baders zu Eibiswald dünkte ihn als rechter Ruheposten nach bewegtem Lagerleben.
Freilich: Im täglichen Bilde des Lebens war die bunte Tracht der Männer und Frauen einer bescheidenen Farblosigkeit gewichen. Das »rottüechene Kleid, der blautüechene Leibrock mit flammleten Leibl, die manschesternen Hosen mit seidener Westy, der papperlgrüene Janker, die silbernen Schuhschnallen« wie die Dose und Sackuhr aus dem Nachlasse des 1790 verstorbenen Lebzeltermeisters Franz Reicher mürfelten wohl noch lange im Kleiderschrank der Bodenkammer. Aber das Schillerseidenkleid und die Goldhaube der Bürgersfrau waren als stattlicher Putz für den Kirchgang geblieben.
Wo aber der Marktplatz gegen die Kirche abzufallen beginnt, wurde die Straße querüber durch das Rathaus gesperrt, einen zu allen Zeiten recht nüchternen Bau, der nur durch sein Türmchen mit der Uhr und der Polizeiglocke seine Würde betonte. Über dem Tor lag die Ratsstube, zu der links in der Ecke neben des Torbäckers Josef Klingensteiner Laden eine Stiege emporführte. Zu beiden Seiten des Tores lagen ebenerdig die »Keichen«, finstere Löcher für Vaganten, Nachtschwärmer und Spieler. Rechts vom Tore stand der Pranger, eine etwa zwei Meter hohe Plattform, die eine Steinsäule mit zwei Halsringen in Mannshöhe trug. Über dem Tore war vierzehn Tage nach einem Jahrmarkt die »Freiung« ausgesteckt, ein hölzerner Arm mit einem Schwert in der Faust.
Außerhalb des Tores führte der alte Steinweg steilab zum heutigen Kirchplatze. Die heutige Hauptstraße war noch ein Fußpfad, von dem ein grüner Bühel zum Steinweg abfiel. Um die Kirche lag der alte Friedhof, von einer Mauer umschirmt, die gegen die Straße zu ein Tor hatte und an der gegenüberliegenden Seite über einige Stufen durch ein Pförtlein den Weg zum alten Schulhause freiließ. Das »Chirurgenhaus«, 1802 statt der alten hölzernen Wohnstatt erbaut, und das Gasthaus insgemein Saitenmacher erhoben sich stattlich überm Ring der umgebenden Holzhäuser und Keuschen. Vom Kirchplatz ging's wie heute noch in die »Fadlgassen«. Wenn der »Herter« den Ort herunterblies, ließ man das Vieh aus den Ställen und er trieb es durch die Fadlgassen nach der Gemeindeweide »auf der Tratten« unterm Schloß, über der die beiden Trattenleiche lagen.
Am Steinweg stand die uralte Schmiede und ihr gegenüber eine Barockkapelle in Form einer breiten, zopfigen Nische mit lebensgroßem Bildwerk und unterhalb das kleine Spital, das als ständige Gäste ein paar alte Weiblein beherbergte. An der Stelle der heutigen Pfarrerställe senkte sich ein grüner Hügel gegen den Saggaubach und seine Ledererwerkstätten. Auf ihm standen alte Nußbäume, unter deren Schatten während des Hochamtes alte Leute saßen, die in der stets übervollen Kirche keinen Platz gefunden.
Drüben über dem Saggaubache lag etwas flußaufwärts und schon in der Gemeinde Aibl das alte Hammerwerk, seit zweihundert Jahren in kleinem Umfange betrieben. Noch konnte man nicht wissen, daß aus ihm in den Fünfzigerjahren später die weitberühmte »k. k. privil. Stahlgewerkschaft zu Eibiswald und Krummbach« erwachsen sollte, deren Erzeugnisse bald Weltruf erlangten. Noch in meinen Kinderjahren konnte ich die schlanken Stahlstäbe bewundern, die, in schmale Kisten mit eingebrannter türkischer Aufschrift verpackt, nach dem Orient gingen, um dann als Damaszener Klingen das Entzücken des Kenners zu bilden. Hat doch auch der Kreml zu Moskau noch Spiegel, die von der weltabgelegenen »Spieglhütten« unter der Koralpe stammen und auf Kraxen ins Lavanttal getragen wurden.
Am Marktausgange endlich führte über die Saggau an Stelle der einstigen Furt seit 1778 eine Brücke beim Johanneskreuz, vor der an Markttagen der Schlosser Gritsch die Maut einzunehmen hatte von Vieh und Krämerware, die von der Leutschach – Arnfelser Straße oder von Altenmarkt her zu Markte geführt wurde. Zwischen der Saggau- und Mühlgangbrücke lag wie heute die alte Leinwandbleiche.
Aus dem Orte führte die alte Straße, im Mittelalter Rennstraße genannt, am herrschaftlichen Lampuschteiche, darauf zuzeiten Irrlichter tanzen sollten, und an der Johanneskapelle vorüber auf die Höhen des Wiesberges mit seiner entzückenden Fernsicht nach dem jungen Wies mit seiner eben erst erstandenen Wallfahrtskirche und über Gleinstätten in die weite, weite Welt …
