
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
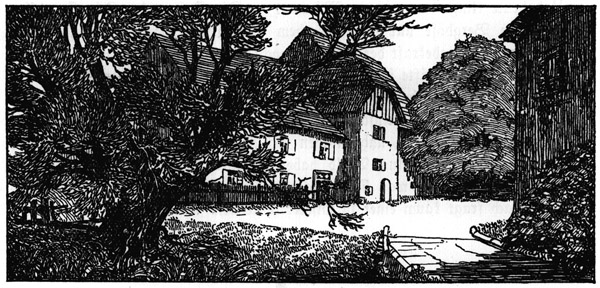
Verregnete Pfingsten –. Ein grauer Sturmhimmel, weit gedehnt und schwer wie gehämmertes Blei, darunter schnelle Wolken brauen und treiben, die nur hie und da im flüchtigen Regenschauer sich lichten. Dann zielen Sonnenpfeile wie aus seliger Höhe durch den Spalt und fernauf leuchtet ein Stück Land in farbigem Prangen, eine weiße Kirche, ein Waldsaum, ein schimmerndes Schlößlein. Und immer neue Wolken steigen auf über dem Almkamm im Westen, weich und weiß geballt vor der blauschwarzen Wetterwand, und lugen vorerst über den Kamm wie ein paar eisgraue Feinde vor dem Einfall ins Tal. Das aber liegt klar und scharf in der feuchten Luft, im Wechsel von Grün und kaltem Blau, ohne warm spielende Lichter, in stiller Eindringlichkeit, und trägt schweren Segen im Wuchern von Halm und Kraut und Gras und schwellende Kraft im saftigen Laubwerk und in den jungen Tannentrieben.
Das ist die rechte Zeit für ein Wandern nach stillen Seitentälern und für Leute, denen die Gedanken nicht mehr sorglos ausfliegen in sonnige Herrgottsweiten, sondern im starken, sicheren Gefühl des Werdens rückwärts gleiten, aus reifer Lebenshöhe zu den Spuren einer uralten Kultur, die heute weltabgeschiedene Gründe einst mit regem Leben füllte.
Dahin führt ein Gang, querfeldein von Köflach ins Södingtal, zum alten Gebirgsdorfe Geisttal.
Ernst und düster steht das Schloß Alt-Kainach auf flachem Wiesenplan, als ob die massigen Ecktürme fast versänken im grünen Grunde. Es hat wüste Tage gesehen im wilden gesellschaftlichen Leben des 17. Jahrhunderts. Heute tönt eine Ziehharmonika beweglich aus der Toreinfahrt, der bunte Kleinkram des Arbeitervolkes füllt die dunklen Bogengänge und davor steht ein grüner Wald von Wildkastanien, bis an die Spitzen besteckt mit weißen Blütenkerzen.
Seitwärts im Södingtale, an einen grünen Waldwinkel gerückt, das freundliche Stallhofen, die römische curtis stabularia, schon im 12. Jahrhundert Klostergut des Stiftes Rein. Alte Inschriftsteine in der Kirchenmauer sprechen schon hier von jener friedlichen Vermischung keltischen und romanischen Blutes, der wir in der Gegend von Geisttal wieder begegnen. Von den Mönchen des Stiftes Rein hat auch der nahe Münichhof seinen Namen, heute ein stattliches Landgut, fast versteckt im Haine grüner Wipfel. Vor etwa hundert Jahren trieb dort ein arger Spuk sein Unwesen, der im ganzen Lande viel besprochen wurde. Josef von Aschauer, damals Verweser des Eisenwerkes zu Kainach, hat darüber »zum ewigen Gedächtnis« einen Bericht verfaßt, der im wesentlichen folgendes meldet: Gegen Mitte Oktober 1817 begann es im Erdgeschoß. Es flogen in der Dämmerung kleine Steinchen durch die Luft, dann größere, bis das Treiben am 24. und den darauffolgenden Tagen ganz unheimliche Formen annahm. »Es warf die Sechtsteine (Steine von 4 bis 10 Pfund Gewicht, die zum Erwärmen des Wassers heiß gemacht wurden), die unter einer Bank lagen, heraus und durch das gerade gegenüberstehende Fenster hinaus. Ein Wurf, den keine Kunst hervorbringt. Es fing aber nun an, alle in der Küche mobilen Gegenstände zu werfen, ohne Unterschied, ob solche aus Metall, Holz, Erde oder was immer waren, mit Wasser volle Schäffer etc., zerschlug oder zerwarf alle Küchenfenster. Viele der geworfenen Gegenstände, die vermöge ihrer Schwere und damit verbundenen unbegreiflichen Geschwindigkeit alles zerschlagen, durchstoßen und erst weit außer den Fensterscheiben hätten niederfallen sollen, blieben in den Fenstern stecken, oder fielen, wie augenblicklich entkräftet, senkrecht zu Boden, ohne das Fenster zu beschädigen, obwohl selbes tüchtig getroffen wurde. Man mußte alles Mobile gleich aus der Küche schaffen, denn es stürzten die gußeisernen Töpfe, welche bei 12 Maß hielten, am Feuer um. Es wurden auch Menschen von den Würfen am Kopfe getroffen, aber ungeachtet der außerordentlichen Wurfgeschwindigkeit empfanden selbe doch auch von größeren Steinen keinen Schmerz, sondern nur eine leise Berührung und die Körper fielen nach dieser senkrecht nieder. Es waren nicht nur ein oder zwei Menschen, sondern fünfzig bis sechzig gegenwärtig –. Am 1. XI. stand ich mit zwei Personen in der Küche, als ein großer eiserner Schöpflöffel mit einem sehr langen Stiele im Gewichte von etwa 12 Lot aus seinem durchlöcherten Brette heraus und dem neben mir stehenden vulgo Kogelbauer zum Kopf flog, von da aber senkrecht herunterfiel. Ich fragte ihn um die Wirkung, die durch Masse und Geschwindigkeit, welche unglaublich groß war, hätte bedeutend sein sollen, aber er beteuerte, nur eine leise Berührung empfunden zu haben. Die ganze Erscheinung war nicht mit dem mindesten Laute oder Geräusche oder Leuchten verbunden, nur das Niederfallen des Löffels auf den Boden hörte man. – Später wurden die Erscheinungen geringer, zwar wurden wieder viele Fenster eingeworfen mit Töpfen und Steinen, aber man konnte doch dadurch, daß man die beim Feuer stehenden Geschirre mit der Hand hielt, kochen, denn bei der früheren größeren Wirkung hatte es auch viele Gegenstände den Menschen aus den Händen geschlagen. Gegen halb 4 Uhr nachmittags stand ich ganz rückwärts in der sechs Klafter langen Küche und auf der mir entgegengesetzten Seite war eine große Schüsselrehm (Schüsselkorb), zwischen mir und dieser Rehm, die ich aber in Augen hatte, war kein Gegenstand. Plötzlich sah ich die größte kupferne, mit einem eisernen Reif umgebene Schüssel für etwa 10 Personen sich bewegen und blitzschnell fast in horizontaler Richtung gegen mich fliegen, so zwar, daß ich nicht Zeit hatte, den neben mir Stehenden darauf aufmerksam zu machen. Sie flog so zwischen unseren Köpfen hindurch, daß unsere Haare vom Winde bewegt wurden, und fiel mit großem Geräusch zu Boden, aber am Anfange und während der Bewegung war nicht der mindeste Laut oder Zischen zu vernehmen, auch kein Leuchten oder eigentümlicher Geruch wurde wahrgenommen.« So ging die Sache fort, doch wurde der Spuk immer seltener und schwächer, bis er nach etwa drei Monaten von selbst aufhörte. – Soweit der Bericht des Verwesers Aschauer. Er galt als ernster, unterrichteter Mann. Doch weder er noch eine später verordnete Kommission vermochten diesen Fall von offenbarer Massensuggestion aufzuhellen.
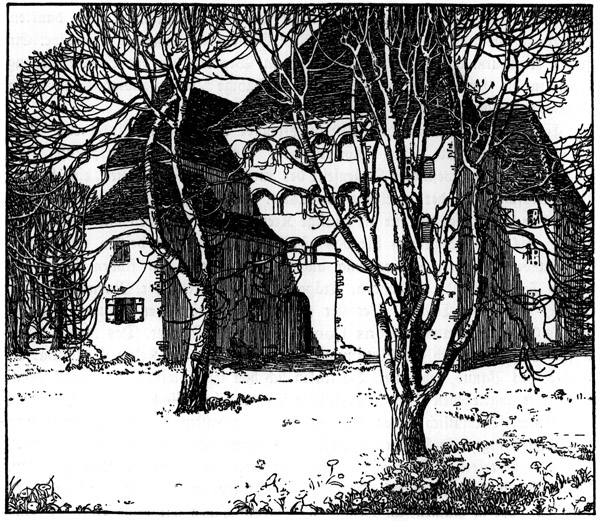
Nun führt die Straße aufwärts durch das Södingtal. Eine köstliche alte Schmiede steht am Wege, die Stirnmauer gekrönt von den spielenden Bogenlinien der Rokokozeit, mit zwei querovalen, gemütlichen Fensteraugen darunter. Dann da und dort eine alte Mühle hinter hohen Lindenkronen, ein Straßenwirtshaus, breit und niedrig, vom gewaltigen Walmdache treu behütet, über dem Stiegenvorbau manch fröhliches Plätzchen unter gemauerten Säulen, davon die Trinkenden behaglich aufs Leben der Straße schauen. So leitet das Sträßlein in langsamer Steigung gemächlich weiter vom offenen saftigen Wiesengrund und von lichtgrünen Laubholzgruppen aufwärts zu steileren Berglehnen und dunklem Nadelwald bis zum uralten Gebirgsdörflein Geisttal am Fuße der Gleinalpe. Ein spitzer Kirchturm vor hohen Bergwänden, ein Wegkreuz an der Straßenbiegung leiten in die Hauptgasse, darin sich alte, behäbige Bodenständigkeit mit neuer Bauweise friedlich mischt.
Eins vor allem macht dem Altertumsfreunde den grünen Winkel von Geisttal seit langem lieb, seine »Römersteine«. Einer dient als Altarstufe, fünf andere sind an der westlichen Außenseite der Kirchenmauer eingelassen, eine freundliche Gepflogenheit der ecclesia militans, mit der man wohl zufrieden sein mag. Sie zeugen deutlich für die häufige Kreuzung der keltischen und romanischen Rasse, wie sie ja allgemein für das römische Noricum des dritten und vierten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung angenommen wird. Da finden sich, durch engste Familienbande verbunden, Träger vornehmer keltischer Namen, wie der Boier, Boniaten, Celaten, Vercaier mit solchen altrömischen Blutes, wie des Lucius Secundinus aus der gens Domitia, oder der Rustier. Des Kelten Dubnissus Sohn hatte sich als Saturninus romanisiert und die Keltin Suaducia, die Tochter des Vanus, geheiratet. So trafen sich hier im hintersten Almwinkel Menschen weit abgelegenen Ursprungs, mischte sich keltisches Almbauernblut mit altem Römertum. Vermutlich haben sich nur die Vornehmsten des Gaues, wie schon die Namen sagen, in Mälern verewigt. Bei einem hat sich sogar der Steinmetz Urvacena unterfertigt. Doch können wir nicht sagen, wo sie ursprünglich gestanden. Vielleicht an hervorragenden Punkten der Straße, wie unsere heutigen Feldkapellen, oder in Hainen, an Gebäuden? Darauf haben wir keine Antwort. Und doch läßt es keine Ruhe. Wie liebkosend fährt die Hand über die noch frischen Meißelrillen der tiefen Schriftzeichen, als müßten sie noch etwas aufnehmen vom warmen Leben derer, die vor anderthalb Jahrtausenden sich den Stein »noch im Leben« setzen ließen. Unbewußt freut es uns, wenn wir ihre Namen an der Kirchenmauer lesen, wie von mittelalterlichen Grundherren, einem Stubenberg, einem Saurau, die friedlich im Schatten ihrer Dorfkirche den ewigen Schlaf träumen. Manche von ihnen waren wohl schon ein Stück in der Welt herumgekommen, denn ein römischer Saumweg führte vom oberen Stübingtal über Geisttal und Oswaldgraben im Kainachtale nach dem Murboden, etwa nach St. Margareten bei Knittelfeld. Und die römischen Marmorbrüche im Oswaldgraben mit ihrer Steinmetz- und Bildhauerwerkstätte lassen sogar auf einen ziemlich regen Verkehr schließen. Natürlich erhielt sich dabei in den abseits gelegenen Waldgräben noch ganz unvermischtes Keltentum, das ein hartes Leben führte im Kampf mit Wild und Wald. Da war noch wenig zu spüren vom Altruismus, jener schönen, kränklichen Pflanze unserer Zeit, die wir in Worten täglich preisen und in Taten dreimal zertreten. Man schlug, wenn es eben nicht anders ging, dem Gegner ruhig den Bronzekelt zwischen die Augen und mußte es mit Gleichmut tragen, wenn ein Stärkerer es wieder vergalt.
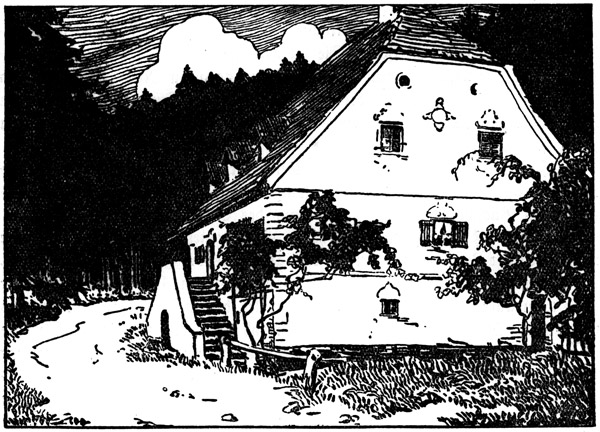
Wenige Schritte von der Kirche steht der alte Karner, eine Rundkapelle, die der Tradition nach vor Erbauung der Kirche (die trägt die Jahreszahl 1539 wohl nur als Marke für einen Umbau des weit älteren Gotteshauses) dem christlichen Kulte gedient haben soll. Im Grundgewölbe des kleinen Beinhauses liegen, säuberlich zu Wänden geschichtet, Schädel- und Schaftknochen, sicherlich nur von Toten der letzten Jahrhunderte. Und doch weisen auch sie in fernste Zeiten. Es sind nämlich – anthropologisch betrachtet – richtige Großschädel von auffallenden Maßen, die da vorherrschen. Sie stammen sicher von Nachkommen der einstigen Urbevölkerung. An den Heerstraßen der norischen Niederungen dagegen bildet der bajuvarische Kurzschädel gut zwei Drittel der Funde. Ob die wenigen Kurzschädel des Karners auf römische oder bajuvarische Ahnen deuten, kann man schwer sagen.
Auf jeden Fall aber ließ sich das Grübeln über keltoromanische Schicksale auch bei einem guten Trunk und Imbiß fortspinnen. Dafür sorgt bestens die alte Taferne beim Buchaus, das einstige Amtshaus des Stiftes Rein.
Da steht auf weitem Platze bei hohen Lindenkronen ein wuchtiger Steinbau mit vorgelegter Turmanlage, deren Giebel gleichfalls die Jahreszahl 1539 trägt, und daran angebaut das heutige Wirtshaus aus dem 18. Jahrhundert. Die gewaltigen äußeren Formen des alten Bauteiles bergen im Innern ein finsteres Gewirr von Stiegen und Plätzchen, Gängen und Kammern, bis hinauf unter den steilen, mächtigen Dachstuhl. Eine Stube des zweiten Stockwerkes trug vor Zeiten reiche Täfelung, die seither als Geisttaler Stube eine Zierde unseres kulturhistorischen Museums in Graz bildet. Doch der Raum, von dem die braunen Holzwände gelöst wurden, trägt in seiner wüsten Verlassenheit auch heute noch einen bedeutsamen Schmuck, das Wahrzeichen des Hauses, das Bildnis der heiligen »Kummernus«. Ein buntbemaltes Holzschnitzwerk, etwa einen Meter hoch, stellt dar eine bärtige Jungfrau, die Hände ans Kreuz genagelt, mit der Königskrone und dem Heiligenschein. Perlenschnüre an Hals und Armen, die reiche Kleidung im knappen Mieder und faltenreichen Untergewand deuten auf fürstlichen Rang. Von den zierlichen gelben Schuhen scheint der des rechten Fußes eben abzugleiten. Ihr zu Füßen soll in früherer Zeit ein kleiner Geiger in einem Käfig gesessen haben, der aber verschleppt wurde. Es ist hier nicht der Platz, die ganze reiche Geschichte von der heiligen Kummernus, an anderen Orten auch Wilgefortis oder Regenflodis genannt, vorzutragen. Ihre Verehrung geht jedenfalls nicht über das 15. Jahrhundert zurück. Bilder von ihr finden sich in. Belgien, in Frankreich, in Tirol, zu Prag usw. Das Geisttaler Bildnis stammt sicher erst aus dem 17. Jahrhundert und ist eine gute, wenngleich künstlerisch nicht sehr bedeutende Arbeit. Die leichte Holztechnik des Bildners war wohl mehr auf den feinen Umriß der magdlichen Formen und den körperlichen Liebreiz als auf den Ausdruck seliger Verklärung bedacht gewesen. Die Legende aber erzählt folgendes:
Die Heilige, ursprünglich von hoher Schönheit, sei als die Tochter eines heidnischen Königs in Portugal (nach anderen auch in Schottland) vom Vater zur Heirat gedrängt worden. Sie aber habe alle Bewerber ausgeschlagen und nur dem Gekreuzigten dienen wollen. Um nun den steten Versuchungen zu entgehen, habe sie Gott gebeten, er möge ihre sündige Leibesschönheit durch dauernde Entstellung tilgen. Und in einer Nacht sei sie bärtig geworden und ungestalt. Sie entlief in die Wälder und verwilderte dort. So fingen sie dann die Kriegsknechte ihres Vaters, der sie dann im Kerker »verkümmern« oder, wie andere erzählen, ans Kreuz schlagen ließ. Ein seliger Tod entführte die Fromme in den Himmel. Und nun erzählt die Legende weiter, wie dereinst ein fahrender Spielmann vor ihrem Bilde sein Saitenspiel ertönen ließ. Zum Lohn warf sie ihm einen von ihren goldenen Schuhen in den Schoß. Als der Geiger bald darauf mit dem Kleinod betroffen wurde, glaubte man seiner Erzählung nicht und er sollte als Kirchendieb gehängt werden. Auf dem Wege zum Hochgericht bat er, noch einmal vor dem Standbilde spielen zu dürfen. Das ward ihm gewährt. Doch als er abermals vor der Heiligen die Saiten rührte, da ließ sie vor vielem Volke auch den zweiten goldenen Schuh vor den Armen gleiten und rettete ihm so das Leben. So meldet die Sage, die später im Geigerlein von Gmünd ihre dichterische Fassung fand. Und wieder blicken wir um in der kalkigen wüsten Stube. Wie mag diese Legende von echt mittelalterlicher Innigkeit auf den Sinnenden gewirkt haben, als noch das braune Getäfel um die Wand lief, wenn das Abendlicht durch kleine Rautenscheiben aufs bunte Holzbild fiel.
Manch grauses Geheimnis webt noch heute um die dunklen Gänge und Winkel des alten Amtshauses zu Geisttal. Noch zeigt man die Reichen, das Gefängnis, darin »Malefizpersonen« bis zur Stellung ins Landesgericht Rein verwahrt blieben. Finstere Schatten steigen auf und blasse Gestalten, verhärmt und verzweifelt. War ja doch das Amt Geisttal des Landesgerichtes Rein jener unglückliche Winkel, aus dem im 17. Jahrhundert so oft nach angeblichen Zauberern und Hexen gegriffen wurde. In den Jahren 1686 bis 1688 wurden über zwanzig Personen, soweit sich das heute noch aktenmäßig belegen läßt, wegen Zauberei gütlich und peinlich verhört und dann dem Freimann überliefert. Und es ist, als ob der Geist finstersten Aberglaubens noch heute über diesen stillen Gründen lastete, wenn man hört, daß noch vor etwa drei Jahren ein Zauberspuk in einem Bauernhause die Bewohner der Gegend in Aufregung hielt und das Eingreifen der Behörde nötig machte.
Spät am Abend fuhr ich heim. Der Mond ging durch die Tannen, im Felde rief der Wachtelkönig und von den Bergen kam süßer Heumahdduft. Aus dunklen Stuben klang harmonisch im Chor das Abendgebet des Landvolkes. Ein Bild des Friedens und der Frömmigkeit. Und doch, ich grüßte aufatmend im starken Frohgefühl unserer heutigen Zeit die elektrischen Lichter des freien Kainachtales.
