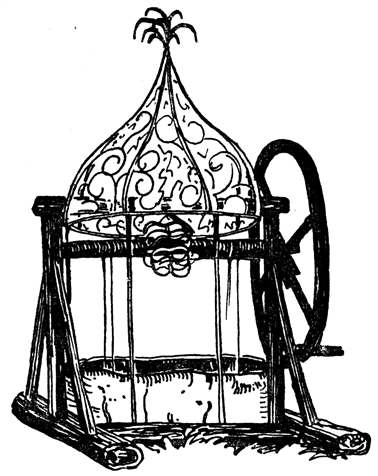|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
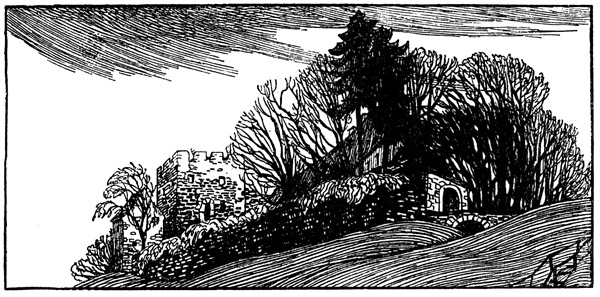
Es liegt wie blanker Sonnenglanz über dem Namen wie über dem alten Markt und jungen Städtlein, das sich so warm im Kranze seiner Rebenhügel breitet. Als ob's vom sorglichen deutschen Bürgerfleiß im tiefsten Frieden gefügt worden wäre zu gedeihlichem Handel und Wandel im schilcherfrohen Sulmgau. Aber in der ältesten Form Lonsperch (1153) steckt wie in der ältesten Schreibweise der Laßnitz (Luonzniza) verlarvt die slawische Wurzel (Lakah und Luh, d. i. feuchte Au), wie in Landscha und Lankowitz. Was von den keltoromanischen Siedlungen auf dem Boden der Weststeiermark in den Stürmen der Völkerwanderung zugrunde gegangen, wissen wir nicht, und nur die Funde sulmaufwärts zeugen für sie. Eine slawische Woge hat sie überschichtet. Über der stolzen Flavia Solva hatte sich das slawische Ziup-Lipnitza, nah dem heutigen Leibnitz, schlecht und recht eingeduckt. Erst im neunten Jahrhundert begann die Kolonisation der Weststeiermark mit Siedlern bajuvarischen Blutes, als ein weiter Wurf aus freigebiger Königshand dem Hochstifte Salzburg den ganzen weiten Gau zwischen den Flüssen Laßnitz und Sulm und dem dicken Walde Sausal zu eigen gab.
Salzburg –! Wer hat nicht schon einen heißen Wandertag zu Füßen der gewaltigen Nagelfluhwand des Peterskellers beim goldklaren Stiftswein verglühen lassen, wenn sich hoch droben mit den Schleiern der Nacht die Schauer der Jahrhunderte um die Feste legten. Es ist für uns kleine Menschen von heute nicht leicht, die Summe von Kraft und Macht, von Kultur und Leben, von strenger Zucht und segnender Fürsorge zu ermessen, die in dem Namen lebt.
So begann die Zeit der Kolonisierung flußaufwärts von Leibnitz aus, im Heidengestrüpp und spärlichsten Christenwuchs. Kirchen erhoben sich, zu Saggau, zu Eibiswald, zu Kappel, feste Blockhäuser des Herrn, wie die Siedlungen der bajuvarischen Bauern, die sich breit in die Slawendorfer zwängten. Und gleichen Schrittes ging die Sorge ums Weltliche, die Urbarmachung des Bodens. Flutendes Sonnenlicht legte sich über bisher walddunkle Täler, um Haus und Straße klang traulich die bayrische Mundart und fröhliches Leben blühte auf unterm Krummstab des heiligen Rupertus.
Den Pflugfrieden des Kolonen zu schirmen, erhoben sich bald feste Türme auf waldigen Warten, Arnfels, Schwanberg und als stattlichste Landsberg, schon in Raum und Wucht des Baues zum Vorort angelegt über die freie, weitsichtige Weststeiermark. Der Turm, der gewaltige Bergfried, und was sich im Laufe der Jahrhunderte an steilgiebeligen Zubauten an ihm in die Höhe reckte, blieb wohl für das ganze Mittelalter der Kern der Feste. Auf ihr walteten als Burggrafen und Ministerialen Salzburgs die Herren von Landsberg, die sich gelegentlich auch des Hochstifts Schenken nennen und zwischen dem 12. und 14. Jahrhundert ausleben.
Seinen für die Landesgeschichte bedeutsamsten Tag aber mag Hohenlandsberg wohl in jenem Winter auf 1292 gesehen haben, als am Ebenweichstage, dem 1. Jänner, die dem zweiten Habsburger Albrecht grollenden Edelherren der Steiermark mit Erzbischof Konrad IV. von Salzburg zusammentraten, um den zu Leibnitz verhandelten Bundesbrief auf der Feste Landsberg feierlich zu siegeln. Die alten, seit den Babenbergern geltenden Freiheiten der Steiermark, die König Albrecht zu bestätigen bisher gezögert hatte, sollte er wahren und dem Gotteshause Salzburg schirmend zur Seite stehen zum Schutze seiner Güter im Lande.
Es waren stolze, trotzige Herren, die sich da zusammengefunden, mächtig an Land und Leuten: Ulrich, der Graf von Heunburg, der Pfannberger, ein Sternberg, der Stubenberger, der Wildonier und ihre Vettern. Noch vor wenigen Wochen hatte Friedrich von Stubenberg den König auf der Grazer Burg an das Schicksal des Böhmenkönigs Ottokar gemahnt und Herr Hartnid von Wildon lebt heute noch im farbigen Bilderbuch jener Zeit, der steirischen Reimchronik, als hochfahrender, verschwenderischer, aber auch harter und ränkesüchtiger Mann.
Von den Schicksalen des Bergschlosses ist, wenn man von unsicheren Überlieferungen absieht, nicht allzuviel bekannt. Ungleich der bedeutsamen, zu diplomatischen Verhandlungen, Synoden und Rechtsaktionen gern benützten Bischofspfalz Seggau kam die alte Bergfeste Hohenlandsberg selten zur Ehre eines fürsterzbischöflichen Besuches. Die Burggrafen lösten einander ab als Gewaltträger des Hochstiftes und teilweise Nutznießer des ausgedehnten Besitzes. Die knappen Inventare des 16. und 17. Jahrhunderts geben kein allzu freundliches Bild von dem langsam zerfallenden Schlosse.
Immer noch bildet der mächtige »viereggete Turn«, zu dem eine schindelüberdachte Bohlenbrücke über den Burggraben führt, den Kern der Feste. Er barg zu ebener Erde über mächtigen Weinkellern die Kanzlei und das Archiv »mit ainer Eysenthür auf die Feuersnoth versehen«. Eine enge Wendeltreppe lief aus der Kanzlei zur Apotheke im ersten Stockwerk. Neben ihr lagen des Burghauptmannes Wohnstube »sambt einem hinausgehenden Studory«, sein Schlaf- und Tafelzimmer, Gesindestube und Jägerkammer und das kleine »Padstübl«. Im dritten Stockwerk war darüber »die Fürstenstuben mit grienen leinbathen Spalieren« – die aber schon anno 1580 arg verblichen waren – mit der Schreibkammer für den Notarius und seinem Wohngelaß, »der geistlichen Kammer«. In der gleichen Flucht kam man in die »Kapellen mit ainer Sakristey und einem von Gips verfertigten Altar auch dergleichen Zieraten versehen«, die also damals in ihrem billigen Prunk nichts mehr aufwies von der stimmungsvollen Traulichkeit alter Burgkapellen.
Man sieht, das enge Hausen – Kanzlei, Wohnstube, Fürstenzimmer, Kapelle und zu unterst der Weinkeller – baute sich aus sicherer Alltäglichkeit und strenger Kameralgewalt steil auf zur Seelenflucht der Kapelle, darüber, frei überm lachenden Talgrund, »die hoche oder Frauenzimmerkammer« lag. Ein letzter Schüttboden führte zum Zinnenkranz des Bergfrieds.
In den letzten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts, als die wachsenden Verwaltungsgeschäfte die Sorge um Feind und Fehde zu überwuchern begannen, führte man unterm Geschlechte derer von Khuenberg, das neben hohen Verwaltungsbeamten des Erzstiftes auch zwei Bischöfe in seinen Reihen zählte, den Neubau des unteren Schlosses auf. Ein luftiger Säulengang aus der Jägerkammer des Hochschlosses leitete zu ihm hinüber. Dieser heute noch als Notwohnung behauste Längsbau diente dem fürstlich salzburgischen Amtsschreiber und seinen Leuten (dem späteren »Controllor« und »Kanzlisten«) mit Stuben und Lauben, mit Kammern und Küche und endete in einem gewaltigen hohen Rundturm. Der trug zu oberst neben der Rüstkammer die Glockenstube und die Turmuhr und zu unterst ein böses Verlies. Und wo zu ebener Erde der winkelige Umgang der Gelasse unter Stiegen und Kammern ein Plätzchen freigelassen, war's fürsorglich zu »Keichen« ausgenützt, deren unsere Quelle mindestens vier erwähnt, niedere Löcher oder Kotter, in denen die »Malefizpersonen« kaum stehen konnten. Sie werden damals zu Ende des 16. Jahrhunderts wohl selten leer gestanden haben, denn die Zeiten waren unruhig und landfahrendes Volk dunkelster Herkunft lief auf Wegen und Stegen durchs Land. Voran die »gartierenden« Landsknechte, die, aus einem Sold entlassen, neuen Herren zuzogen und auf ihrem Reislauf eine schwere Plage für den Bauern in der Einschicht wie für den Marktrücksassen bildeten. In Scharen zu vier, zu zehn, zu vierzehn und zwanzig, ja bis zu fünfzig zogen sie fast täglich durch die Märkte und Richter und Rat konnten froh sein, wenn sie ihrer mit einem Zehrgeld aus gemeinen Marktes Säckel ledig wurden. Davon geben auch die Richteramtsrechnungen des Marktes Deutschlandsberg aus den Jahren 1595 und 1596 ein bedeutsames Bild.
Mit der Säkularisierung des Erzstiftes Salzburg wurden Schloß und Herrschaft im Jahre 1803 vom Staate übernommen und als »Kameralherrschaft« Landsberg und Turn – hier klingt der alte Name noch einmal auf – an den Grafen Moritz von Fries verkauft. Schon 1811 erwarb sie der regierende Fürst Johann von Liechtenstein, in dessen Familie sie bis heute geblieben ist.
Was ist von all dem heute noch zu sehen?
Darnach wollte ich wieder einmal schauen und im stillen Geleit der Jahrhunderte steige ich – wie oft zur Kinderzeit – durch die Klause den Weg zur Burg hinan.
Und wieder umfängt mich wie einst die tiefe Stille des Raumes. Da wölben hohe Buchenkronen ein grüngoldenes Dach über der quellklaren Laßnitz, die rauschend und schäumend und wieder lässig sich hinspielend an moosgrüner Felswand durch die Klamm bricht. Dieser Zusammenklang von stürmender Kraft und starkem Beharren im Wogenschwall und Schweigen, die Weitsicht durchs hohe Gestämme, dazu das graue Trümmergestein, das da und dort sich mauergleich aus dem Laube baut, bis es wie aus sich geboren hoch droben die Grundfesten des alten Turmes über Wassersturz und Buchenschatten in den freien Himmel wachsen läßt, das gibt einen Vorklang historischer Stimmung, der uns aus leichter Erregung schauern läßt.
Da und dort hat der Graf von Fries in Block oder Wand ein Dichterwort eingraben lassen, das auch heute noch im weiten Raume wundersam verklingt. Das war die Zeit der Romantik, da jedes verträumte Plätzchen seine »Eremitage« haben mußte. Und in der Tat: Da schaut hoch von überhängender Felsplatte das Rindenkirchlein des Einsiedlers nieder in die grüne Klause. Steiglein und Geländer leiten fürsorglich zu ihm hinauf. Moritz von Schwind hat uns eine warme Weile lang lächelnd ins Herz geguckt. Bald stehen wir, über Tortrümmer und den äußeren Burghof wandelnd, vor dem mächtigen Hochschlosse.
Wie sich da aus herbstrotem Haselgesträuch die Mauern des gewaltigen Bergfrieds ins Blaue bauen, das ist kein armes, rauhadelig Festlein, das aus verschlafenen Schießscharten ins Land blickt, das ist gesteilte Herrengewalt, aus Quadern getürmt, breit und ohne Schmuck bis zum Zinnenkranz, um den die Falken spielen. Aber im Burggraben beim Rüdenzwinger und dem steinkühlen Schöpfbrunnen im Winkel überm zerbröckelnden Säulengang hat sich ein Stück Mittelalter eingesonnt, so warm und traulich, daß wir das »kalte Eckerl« der Burgbeschreibung heute in Licht und Laune nicht gerne gelten lassen.
Was sonst an weitläufigen Bauteilen aus Schutt und Rasen und dem Wildwuchs der Jahre noch aufrecht steht, ist recht ansehnlich. Das Kleinleben alter Notwohnungen hat sich schlecht und recht da eingeheimt, seit Jahrzehnten schon, und führt gemächlich seinen stillen Kampf gegen den bekannten Zahn der Zeit. Das ist Burgenschicksal und wird so bleiben. Und heute wie seit Menschengedenken füllen landwirtschaftliches Gerät und Holz den weiten Saal gegen die Klause, den wir als Kinder ehrfurchtsvoll den »Rittersaal« nennen hörten. Schon anno 1680 war's »ain gemauerter dreiundvierzig Schritt lang und zehn Schritt praiter Saal von Schintl gedeckht, mit ainem Schwipogen aus Läden zugericht, worauf die Böhaimbischen Schlachten und auf denen Seiten der Gemäuer die Römischen Kayser von Wasserfarb (doch schon ziemblich abgangen) gemalet«. Die römischen Kaiser – von Wasserfarb – und schon ziemlich abgangen – fast will's uns mit einem bösen Ruck in unsere Tage reißen.
Und doch ist noch ein kleiner Gang zu tun nach jenem dicken runden Turm, in dem voreinst bei Pulver und Granaten die Glocken hingen. Mehrmals vom Blitze getroffen, ist er 1876 zum großen Teil abgetragen worden. In diesem hatte zu meiner Kinderzeit ein greises Malerlein seine Zelle aufgeschlagen; Wibmer hat er wohl geheißen. Der malte hoch droben in sonniger Einsamkeit unter Blütengerank und zerfallender Ritterherrlichkeit gar emsig an Fruchtstücken, Pfirsichen, Pflaumen und edlen Trauben mit dem duftigen Hauch morgendlicher Unberührtheit, da und dort auch ein Stück vom lachenden Tal zu seinen Füßen oder Holz, das durch die Klause getriftet wird. Die heutige Zeit lächelt wohl über manche seiner gewiß tüchtigen Arbeiten, die er als Ölgemälde unglaublich billig im Preise hielt. Meine jungen Augen sahen fast unbewußt in diesem ungesuchten Zusammenklang von Naturfreude und bescheidenem Künstlertum, in diesem dienenden Aufgehen von Leben und Wirken einen rührenden Zug, der mich noch heute aus der Erinnerung leise anweht. Das war das erste wahrhaftige Spitzwegidyll meiner Kinderjahre.
An der stillbesonnten Burgleite habe ich mich niedergetan.
Im Abendgold liegt mir zu Füßen das Sulmtal, klar und rein bis an die fernsten Grenzen. Und wie das warme Dämmerlicht langsam vom grauen Gemäuer scheidet, sinkt auch das farbige Gespinst der Zeiten ins Wesenlose. Über Wald und Wildnis, über Robot und Rodung, über Herrenfron und Bauernnot, über Schreiberränken und Bürgertrutz liegen weithin die saftigen Rebgärten, die fruchtschweren Felder, und drunten die offenen Gassen des Städtleins.
Wolf-Dietrich, dem gewaltigen Erzbischofe, dem lebensheißen Manne ward im engen Getäfel der Haft auf Hohensalzburg der stolze Sinn gebrochen, der allzu freigebige Moritz von Fries ist dunkler Kunde nach als armer Handlungsgehilfe im fernen Paris verdorben und unsere Großväter ruhen im Rock von gutem Tuch unterm Kirchhofrasen des Sulmtales. Aber über das Schicksal der Großen und Kleinen wirkt immer wieder die Natur gleichmütig ihr Blütengerank zum Mutterboden für die kommenden Geschlechter. Und ein leuchtender Herbstabend unter der klaren Unendlichkeit des Heimathimmels weitet den Blick ins Große und füllt die Seele mit stiller Kraft und starkem Mute, daß sie nimmer ganz arm werden kann.
Da drunten in den dunkelnden Gassen hat ein Fähnlein der Aufrechten sein mannhaft Panier ausgesteckt und getröstet steige ich zu Tal, es froh und traulich zu grüßen.