
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
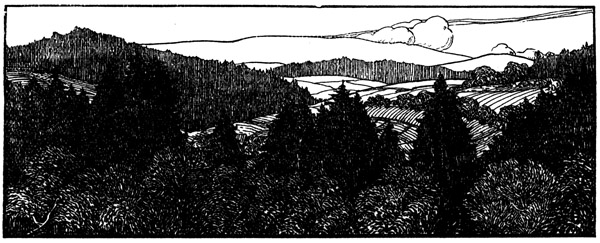
Der Herbst kommt zu sterben.
Das ist ein prunkvolles Totenamt: Im schimmernden Goldbrokat die Almen, die Wälder im dunklen Sammetmantel, drin da und dort flammendes Laubwerk loht, und aus blauenden Tälern der ziehende Weihrauch silbriger Herbstnebel. Und über allem ein leuchtender Himmel, klar und hoch, die ganze Welt wie blankgefegt vom wehenden Winde. Der erst stimmt den Klang zur Farbe, singt lockende Reiselieder hügelauf, hügelab im summenden Telegraphendraht der Landstraßen und läßt im tiefen Grunde die Windmühlen klingend schlagen als trauliche steirische Heimatweise.
Zur sonnigen Warte von Edelschrott war ich aufgestiegen, meinen lieben steirischen Herrgott zu grüßen. Überm kohlendunstigen Kainachtal ein weiter Kranz von Bergen. Ein weißer Taubenschwarm schwenkt im schimmernden Himmelsblau rundum ums Dorf. Weiter draußen am Bildstöckel finde ich freundliches Geleit. Ein rastendes Dirndlein von knapp siebzehn Jahren mit quellklaren Augen, die fröhlich unterm verfilzten Stockhütel schweifen. Wie sie heiße? »Kordula« und – »Breinhuber«. – Lächelnd kommt's von den Lippen, wie wenn sie mit verschämtem Stolze einen selten benützten Feiertagsstaat ausbreite. Und wie eine zu weite Guckerlhaube aus Großmutters Zeiten schmiegt sich der gewichtige Name ums kleine Bauernkind, das auf manche Frage launige Antwort weiß. Wenn wir über die rauschende Teigitsch gehen, lobt sie die »streberne Brucken« (mit Stroh gedeckte Brücke) als altberühmtes Bauwerk, und über Wirtschaftssorgen weiß sie altklugen Bescheid. Durch einen taufrischen Waldgraben steigen wir plaudernd empor, und bald weist sie mich mit einem freundlichen Abschiedswort an mein heutiges Ziel.
Von dunklen Wäldern umsäumt, eine weite, ganz sanft geneigte Almwiese, leuchtend im Goldbraun des späten Herbstes. Hochfliegende Wolken werfen spielende Schatten über den knappen Rasen, drüber hin nicken wehmütig die letzten blauen Glöcklein und tändeln verloren brennrote Blätter der Ahorn- und Kirschbäume, die prangend gegen den finsteren Waldsaum stehen. Feiertagsfriede! – Hie und da ein zögernder klingender Schlag aufs Kirschholzbrett der großen Windmühle, verwehtes Herdengeläut, ein verhallender Jauchzer. Langsam scheidet der Herbsttag in leuchtendem Verglühen, liegt wie flüssiges Feuer auf dem schlafenden Teich drunten am Waldrand und säumt goldig das Wipfelgrün der höchsten Fichten und Lärchen. Und darüber hinaus leuchten im letzten Schein die Almen wie Gefilde der Seligen, die die ewige Sehnsucht wecken mitten im rinnenden Leben.
Im obersten Winkel der Wiese, fast umfangen vom Lärchengeäst, steht ein einfaches Haus mit sturmfestem, eisengrauen Schindeldach. Und unterm Sims des ersten Stockwerkes laufen wie Wappenkleinode des besonderen Weidwerkes, dem der Bau dient, Auerhahnbilder, Kopf, Kragen und Fächer, aus Gußeisen, naturtreu bemalt, kunstlos, aber fest und volkstümlich erfaßt. »Das Hahnenschlößl« heißt im Volksmunde das einfache Jagdhaus, dieser schirmende Ruheplatz im weiten Kranze der Wälder, die ringsum über verfallenen Bauernhöfen aufstehen und ein bedauerliches wirtschaftliches Zeichen unserer Zeit mit grünem Mantel decken. Es ist ein hochgeweihtes Revier des Auerwildes, noch aus den Zeiten des Erzherzogs Johann her, der als »Prinz Johann« unterm Landvolk der Gegend noch heute im Schimmer der Verklärung lebt. Wahrt ja doch das obere Kainachtal noch besondere Erinnerungen an das freundliche Walten des volkstümlichen Prinzen. In Krems pochten seine Eisenhämmer, um Köflach erschloß er reichen Kohlensegen und in den Hochwäldern hinter Edelschrott erfrischte sich sein ernstes Streben in hochgemuter Weidmannslust. Damals war das heutige Hahnenschlößl noch ein altersbraunes steirisches Bauernhaus gewesen, das erst nach einem Brande beiläufig seine heutige Gestalt und noch später seine jetzige Bestimmung fand. Es geht wie ein altes Raunen von Wild und Wald durch diese Hochtäler, die als bescheidene Kernpunkte einer weltabgeschiedenen Kultur die Pfarrdörfer Pack, Modriach und Hirschegg einschließen.
Und doch fuhren die Stürme der Zeitgeschichte bisweilen auch um jene stillen Höhen und brachten für lange mannigfache Wirrsal ins altgewohnte, geruhige Treiben.
So besonders zu Pack, das von freier Warte weit ins blauende Land schaut und neben dem schlichten Gebirgskirchlein und einigen festen Häusern im heutigen Pfarrhof noch den alten »Turm« birgt, der die Straße ins Lavanttal schirmte. Da lebte im vorletzten Jahrzehnt des 15. Jahrhunderts als Pfarrherr ein gelehrter Mann, Herr Erhard Polinger. Lebte und schrieb in seinen vielen einsamen Stunden an einem »Chronikenstrauß der alten Zeiten«, natürlich in handfestem Latein. Im Sommer unterm blühenden Bergkirschenbaum und im Winter, wenn der brausende Schneesturm sein warmes Holzstüberl bis über die kleinen Fenster hinauf verwarf, saß Meister Erhard über seiner Chronik, und als er am 16. Februar 1480 sein » finita est« unters letzte Blatt setzte, da ahnte er wohl nicht, daß nur wenige Monate später die Wogen der blutigen Zeitläufte, denen er von hoher Warte bisher beschaulich gefolgt, auch über seinem stillen Pfarrdorfe zusammenschlagen sollten. Er bemerkt darüber in einem Vorsteckblatte seiner Chronik zum Jahre 1480: »Und war durch ganz Steiermark eine große Pest und die Türken mit einem ungeheuren Heere sind gewesen durch die ganze Steiermark und haben mich, Erharden Polinger, Pfarrer in der Packh, zehn Türken überfallen und verfolgt, und zu Pferde entkam ich in den Freywald, Risenkogelwald, Stainzwald. Mein Kirchlein aber und dessen Schätze haben sie zusammen mit dem Weiler in der Packh am heiligen Laurenziabend (10. August) verbrannt und fast meine ganze Gemeinde erschlagen und weggeführt, und haben meine Haushälterin mit Namen Elisabeth, eine betagte und brave Frau, zusammen mit Hansel, meinem Knecht, umgebracht. Die junge Tochter des Trapl haben sie weggeführt und fast die ganze obere und untere Steiermark mit Feuer und Schwert ganz gottserbärmlich verwüstet.«
Doch scheint Polinger glücklich entkommen zu sein. Später saß er zu Graz und legte seinem Chronikenbuche nur bisweilen ein kurzes Vorsteckblatt ein. So, wenn (am 20. August 1486) ungeheure Wassergüsse, »daß es kein Mensch gedenken mag«, die Stadt Graz und deren Umkreis verheerten, oder wenn anno 1489 zu Steiermark und Graz Schloßen fielen »von Pfundgröße und darüber« (!) oder im selben Jahre ein schweres Gewitter mit Hagelschlag um Leibnitz bösen Schaden tat. »Gott besser's, es ist aus Ursach unserer Sünden«, setzt er trübe an den Schluß.
Und ein halbes Jahrhundert später schreitet der Schatten eines Größeren durch die weiten Wälder von Hirschegg, Pack und Modriach. Es ist Herr Hans von Ungnad-Waißenwolff, Landeshauptmann von Steier und einer der mächtigsten Edelherren des 16. Jahrhunderts in Innerösterreich, von dem ein gleichzeitiger Chronist schreibt: »Gemelten Herrn Hansen Ungnadt haben die Landleuth in Steyr vast lieb gehabt vnd auffgewart nit anders als ihrem Landesfürsten.« Dem hatten es die gewaltigen Hochwälder der Gegend angetan, die, seit dem 12. Jahrhundert kurzweg »im Forst« genannt, vom Eppensteiner Heinrich dem Kloster Rein zu eigen waren. Im nahen Waldenstein war Ungnads Geschlecht seit langem begütert, dort hatte er Eisenhämmer, für deren Holzkohlenbedarf ihm der Waldbesitz der Reiner Mönche gar erstrebenswert schien. Der Verfall des Stiftes kam dem staatsklugen, mächtigen Manne sehr zu Hilfe, und wenn er auch die tatsächliche Innehabung der gesamten Stiftsgüter nur für kurze Zeit und stets angefochten halten konnte, so hatte er doch aus seinen vielen, nicht ganz klaren Händeln mit dem schwachen Kloster das Amt Hirschegg mit seinem großen Waldbesitz an sich gebracht, das erst unter seinen Nachfolgern wieder vom Stifte eingelöst werden konnte.
Ein reger Verkehr ging damals aus dem Kainachtale über den Packer Sattel ins Lavanttal, marterte sich auf jämmerlichen Almstraßen unverdrossen empor, füllte die dämmerigen Herbergen am Wege und führte oft beim Trunk zum hitzigen Streit zwischen bodenständigem Almbauerntum und dem raschen und unruhigen Wesen der Bergleute und Hammerschmiede, der Händler und Fuhrleute. Was die Zeit bewegte und an feinen Fäden von den Großen des Landes gesponnen wurde, es fand oft dröhnenden Widerhall in den rauchigen Zechstuben. Schon war die neue Lehre des Mönches von Wittenberg auf die Almhöhen gestiegen und hatte weite Verbreitung gefunden, oft weniger im Sturm banger Gewissenskämpfe der einzelnen Gemüter als durch die handfeste Art des steirischen Adels. Ohne viel Besinnen hatten auch die Ungnade, Hans und sein Sohn Ludwig, ihre Patronatskirchen mit Prädikanten besetzt, trotz langwierigen Bestreitens ihrer Rechte vom Stifte St. Lambrecht, das dort seit langem reich begütert war.
Davon wußte der Pfarrer auf der Pack, Niklas Siebenhaller, in den Siebzigerjahren des 16. Jahrhunderts auch ein böses Liedlein zu singen. Zwar steht das Bild dieses Seelenhirten nicht ganz rein in der Zeitgeschichte, brachte ihn doch eine Regierungsverordnung in Beziehung zu einem Golddiebstahl an der Gewerkschaft St. Leonhard und Goldeck im Lavanttale, und selbst der Abt von St. Lambrecht mußte in seinem Bericht an die Regierung zugeben: »Es ist nit one, das er was von golt an ainem vergebnen menschen an sich erkauffet, aber mer aus ongefarden, als aus großen Verstand vnd zu sonderm seinen nutz.«
Wie sich auch die Sache verhalten haben mag, immerhin hatte Siebenhaller schwere Zeiten auf seiner Gebirgspfarre zu verleben, besonders, als ihn sein mächtiger Vogtherr Ludwig von Ungnad fangen ließ und zu Waldenstein gar unbillig eintürmte. Zwar, als er dort erkrankte, fand er eine fürsorgliche Pflegerin (»sie hat mir gewaltig eingegeben, Gott dank ihr«), doch als er endlich freikam, mußte er die schmale Atzung in der Haft reichlich bezahlen und wurde »mit einer beschwerlichen Urfehde vnd verschreibung verfangen und sein Getreide verarrestiert« (Loserth). Zu einem ruhigen Besitz seiner Pfründe, auf welche Ungnad mittlerweile einen Prädikanten gesetzt hatte, ist er wohl nicht mehr gekommen.
Doch auch auf der Gegenseite hat es unter den geistlichen Hirten arg gefehlt, soweit die jedenfalls einseitigen Darstellungen aus beiden Lagern eine richtige Einsicht gestatten. Mußten doch bald darauf, anno 1580, die wehrhaften Hirschegger durch den Abt von St. Lambrecht beim Erzherzog Karl Klage führen lassen, daß die Herren von Ungnad ihnen vor achtzehn Jahren einen lutherischen Prädikanten eingesetzt hätten, der es ihnen verwehre, ihrem alten Glauben ruhig nachzuleben, und wie Herr Florian »sich gar nicht wie ein Priester« halte. »Alle Sonn- vnd Feyertags, wan die nachparn ins wierdtshaus zum wein gehen, khumbt er pfarrer auch vnd trünkht sich voll an, alsdan mit vngebüerlichen Schelldtworthen die leuth antastet vnd schlecht macht, auch raufft mit ain jeglichen, wir wollen sagen, daß khainer in vnserer pharr ist, er hat mir ihme gerißen, dartzue tragt er nit ain priesterliche wehr, sondern ain sabl mit vngeheurem vmbfechten, das schier khainer sicher.«
Und heute klingt dies wie ein Märchen! – Die Stürme der Zeit, sie treffen die einsamen Berghöfe nur mit schwachem Wehen und darin ein müdes Geschlecht. Nur die Werbekraft der Industrie pocht lockend ans alte Bauernhaus und entführt die jungen Kräfte ins Tal. Es ist ein stiller, heldenmütiger Kampf, fast mehr ein wortloses Ergeben schon, mit dem treue feste Menschen um ihre Scholle ringen in zunehmender Vereinsamung. Und wem es sich erschlossen, der steht ergriffen vor diesem großen, unheimlichen Schicksal, dessen Ende kein freundlicher Hoffnungsstrahl erhellt. Aus Wald haben sie ihre Heimat gerodet, in Wald versinken sie wieder, und was sie in Jahrhunderten an treuer, harter Arbeit gewirkt, darnach fragt kaum einer in unserer hastenden Zeit.
