
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
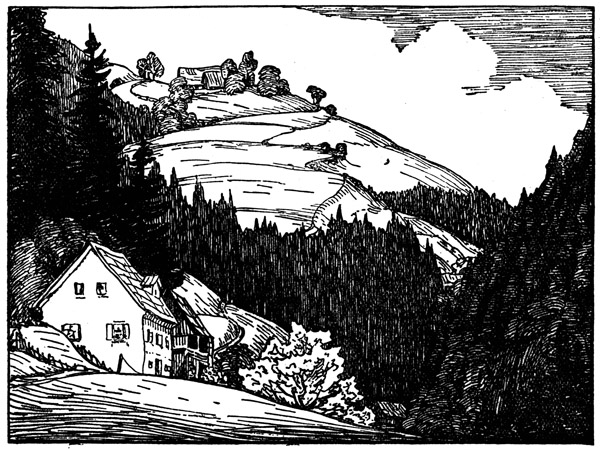
Das ist ein heißer Aufstieg im Hochsommer, wenn drunten aus kühlem Lindenschatten der Sensenhammer so traulich pocht und an der dachsteilen, flirrenden Leitn das plattige Steiglein – es führt seit Jahrzehnten durch ein ungeheures Kornfeld – unter mannshohen Ähren begraben liegt. Aber heute wallt der Bergwind über die saftig glänzende Saat und am Waldrand prangt mailiches Buchengrün. Oben endlich führt ein Höhenweg von Hof zu Hof, entlang der ersten Siedlungskante, wo die waldsteilen Grabenwände aufdachen zu den sonnigen Breiten der Felder und Hochweiden, zum blauen Waldkranz der Vorberge, bis zum schimmernden Schweigen der Almen, deren glückselige Einsamkeiten das wolkenlose Blau weithin überspannt. Die Jahrhunderte haben das bucklige Sträßlein mit Kapellen und Kreuzen geziert und da und dort ein weitschauendes Wirtshäuslein erstehen lassen, so daß frommer Glaube und bescheidene Weltlust sich wieder die Waage halten.
Oben am ersten Hof reitet der alte Pumm überm Dengelstuhl und hämmert an der Sense, ohne aufzusehen. Warum es da hinauf die Wolfleitn hieße und ob es denn einmal da Wölfe gegeben habe? fragen wir.
»Wölf, na glei gnua«, versichert er. »In mein Jungsein, wann i Schouf g'holten han, sand se ban helliachten Tog von Wold füra, hant 'n Schouf ban Brustkern packt, daß die Haxn vornüber g'standn san, und so san sie gang mit eahm. Hat alls Schrei'n und Schiaßn nix g'hulfen.« Das konnte wohl nur sein Vater erlebt haben, denn der letzte Wolf wurde hier in den Vierzigerjahren erlegt. Aber einmal angeregt, erzählt der Alte schmunzelnd weiter. Erwachsene Männer scheinen den Wolf nicht viel mehr als einen bösen Hund gefürchtet zu haben. Man ging eben, besonders zur Winterszeit, nie unbewaffnet über Land und in den Wald und trug, wenn man eine Begegnung mit Wölfen zu fürchten hatte, »a Graßhackl mit langem Help« (langstielige Axt), wohl auch in der anderen Hand eine große »Graßtatschn« (Fichtenzweig), mit dem man sich die Bestie vom Leibe hielt, bis sie zufuhr und man ihr einen schweren Hieb versetzen konnte. Oder man ging auch mit dem »Heuroacha«, einer Art Harpune, auf den Wolf los – man vergleiche damit die Wolfsangel im Wappen der Stubenberger –, die man wohl auch eigens zu diesem Zwecke anfertigte. »Mit an sölln Roacha hot ma bloß brauchn einhaggln ba da Goschn, aft hot ma kinn foahrn mit eahm«, meint der Alte gemütlich und stopft sein Pfeiflein nach.
Und weiter führt der Weg von Bühel zu Bühel. Beim vulgo Pongrietz steht draußen am Eck über plattigem Fels ein altes Pestkreuz. Verblaßt wie die Erinnerung an jene harten Zeiten schauen die Bilder des heiligen Rochus und Sebastian ins blauende Land.
Einst, vor etwa hundert Jahren, war unsere Straße stärker befahren gewesen. Zu zehn, zu zwölfen hielten die Fuhrleute Rast oben beim Jagerwirt vor der Fahrt über die Alm und durch den Rachauergraben gegen Knittelfeld. Heute sitzt nur der alte Rauchleitner unterm dünnen Ahornschatten beim Mostkrug. Und wir haben Glück. Es ist Hahnfalzzeit. Weitum ist das Jägerblut roglich und so erzählt der Alte, während er uns ein gut Stück Weges begleitet, zu manch kräftigem Jägerlatein auch die Geschichte vom letzten Bären in der Graden:
»In der Klausn drentn im Demmlwinkl woar moani amol a groaßmächtiger Bär g'wäin. Hot's a Jaga, na, a Wildschütz, gegen denselm Bärn wulln wogn. Is einig'stiegn in an groaßn Frattnhaufn (Nadelholzreisig nach Schlägerungen). Wia da Bär vorbei is, hot er zwoamal auf eahm g'schossn. Hot 'n moani a troffn, da Bär oba is net hin g'wäin und hot scha hebm zan Klaubm ba die Frattn. Do hot da Wildschütz – Pulva hot er no g'hab, oba koa Kugel mehr – in Leibltaschl a kloans Stückl vun an Kettngliedl g'fundn. Wann 's Leben scha vaschpillt is, hot a sie denkt – hot's einig'lodn in Lauf und hot losdruckt. Und richti, nocha hat's da Bär wull müan geltn lossn!« Und mit freundlichem Gruß schlürft der Alte waldeinwärts.
Auf heidelbeerüberpelzter Felsplatte halten wir Rast. Tief drunten im Winkel unserer Schleife liegt das winzige Pfarrdorf Graden. Und so hoch sich der Kirchturm reckt, uns scheint er nur eine verschindelte Nadelspitze. Blechmusik prangt herauf. Hochzeitslust schlägt hoch auf über die trübe Gegenwart. Krieg, Pest und Hungersnot, auch wir haben sie reichlich erfahren. Aber was in dämmerigen Rauchstuben davon aus alter Zeit erzählt wird, trägt schon das verschlissene Gewand der Sage und klingt fast versöhnlich in unsere Tage.
Wir können uns nicht trennen von der leuchtenden Höhe, so zügig auch die Musik wirbt. Beim »Schober im Liacht«, dem höchsten Hof unter der Gleinalpe, biegt unser Weg auf die andere Talseite und beim Eckwirt halten wir Mittagsrast. Wieder werden die alten Zeiten beschworen, und einmal erschürft, beginnt der Quell traulich zu rinnen.
»Jo, da Türk«, meint ein alter Pechhacker nachdenklich, »und die Margareta Maultosch« – die Sage von ihr erhält sich trotz Geschichte und Forschung wunderlich zäh im Volke –, »jo, da Türk und die Margareta Maultosch hobm ban uns 'n meistn Schodn g'mocht. Die Maultosch hot die ganze Stod Votschberg vawüst't, dö früaga vüll größa woar wia heut!« Und sinnend fährt er fort: »Die Türkn woarn moani amol übern Schober im Liacht einakumman, selm hätt' moani 's kloani Glöggl am Turm vun selba zan läutn ang'hebt und die Türkn hobm vun selm an net mehr überher möcht. Am Roßbachkogel hant si mit g'fongani Steirer baut (angebaut), hobm g'sogg: ›Wann ma wiederkumman, tuan mar eggn.‹ Hobm die Sabl an die Stoana g'wetzt und g'sogg za die Leut, wann si net orndli ziagn (am Pflug), wern sie durchkarabatscht mit die Sabl. Kennt man heutigstags no an die Stoana, wia sie hobmt die Sabl g'wetzt, und die Furchn von Baun. Selm woar ban Wascher in der Grodn a Bäurin mit zwoa kloani Kinna, dö hat 'n Knecht bittat, doß dar oans nahmat, daß sie leichta fliachn möchtn. Er oba nix! Er hot zwoa lanki Steckn g'noumma, untn oani Hölzer ang'noglt (Stelzen), doß die Spürhund sei G'spur net sulltn schmeckn und is obi in Wold. Sie homan oba bold g'fundn g'hobt. Die Bäurin oba is mit die zwoa Kinna huhlgangen und wia si ban Saurer übern Brechlofn will springen, is sie einbrochen und liegn bliebm. Die Türkn mit die Rössa moani wull scharf nochi; und hobm s' akkrat übersechn.«
Nachdenklich wandern wir heimzu. Und werden immer stiller mit dem Pfad, der auf nadelglatten Wegen stundenlang durch tiefen Waldschatten führt, an abgestifteten Bauernhöfen vorbei, deren Mauern längst unter Moos und Lattich schlafen. Vom verwilderten Birnbaum ruckt die Wildtaube und überm morschen Brunntrog plaudert ein dünner Quell vom verlorenen Leben. Wo einst Kinder gespielt am sonnigen Kellermäuerlein, schlüpft das Wiesel unter die Platte. Still feiert der Mittag über dieser toten Welt. Im tiefen Wald ruft der Kuckuck.
Erst mit den letzten Gliedern schließen wieder sonnige Bauernhöfe den weiten Ring. Der Spannagel und der Hupfauf, der Rust und der Lorder – wie so oft in unseren Bergen haben sich auch hier zwei oder mehr Siedlungen auf freier Rodungsblöße freundnachbarlich verbunden zu Trost und Hilfe in den Nöten der Einschicht. Und beim Lorder in der Graden, gegenüber dem Eckpfeiler unserer Wanderung und wieder hoch über dem unermüdlichen Sensenhammer, finden wir zum guten Ende noch einen Schlußstein für unseren Sagenring, bedeutsamer, als er so leichthin erscheint:
Dort war – es sind wohl schon über hundert Jahre her – der alte Roßknecht gestorben. Steif und zerreckt, hatte er schon lange nicht mehr den steilen Kirchweg ins Dorf herabhumpeln können. Und saß am Sonntagmorgen am liebsten draußen am Eck auf einem alten Steinofen, hat sein Werktagsgewand geflickt, »hot Betbüachl betet und holt so umadumg'schaut«. Und wie er endlich stillzufrieden auf der Bahre lag und die anderen in der Nebenstube Frühmahl hielten, hat er sich langsam erhoben, hat dem Halterbuben mit dem Finger vor dem Munde Stillschweigen geboten und ist heimlich und unbemerkt dem Steinofen zugewandelt und hat sich dort in ein Loch »verschloffn«. Die Totentruhen des Roßknechtes aber hat droben am Dachboden noch jahrzehntelang zum Aufbewahren der »Kleatzn« (getrockneten Birnen) gedient und ist erst vor nicht allzu langer Zeit aufgekloben worden. Wie so oft, reicht auch hier die alte Sage an einem Gerät wunderlich in die jüngste Zeit. Aber darüber hinaus weist sie in ihrem Kern seltsam zurück in die graue Vorzeit und Freund Geramb weiß den Schlüssel. Sie erinnert an den altnordischen Glauben, daß sich die Seelen Abgeschiedener und tote Geister gern unter Steinen, Felsen und Steinöfen aufhalten. Wie ja auch die Totenbestattung zuzeiten unter gewaltigen Felsblöcken, in Megalithgräbern, geübt wurde.
Im hellen Vormittag wandern wir auf belebter Straße talaus. Statt dem Buntspecht im Walde hämmert die Schremmaschine im Steinbruch, die Kleinbahn schlendert schotterbeladen und liederlich pfeifend den Graben entlang. Sirenen schreien die hastende Stunde, in regsamer Arbeit sucht das Leben sein Ziel.
Aber auf den besonnten Höhen dahinter spinnt noch die alte Zeit gemächlich an ihrem Märchenfaden. –
