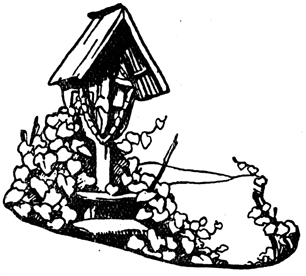|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
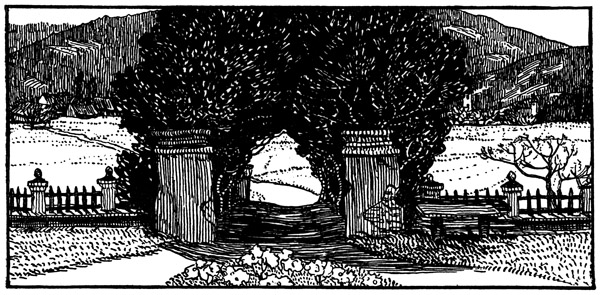
Vier Schlösser liegen im Kainachtal, oder besser, über die sonnige Hügelwelt verstreut, die den flachen Auslauf des Södingtales in den weiten Kainachboden östlich begleitet. In knapp drei Stunden sind sie erwandert, auf fröhlichen Wegen, die von Söding im Ringe ausgehen und dahin zurückführen.
Das bodenständigste ist heute noch Söding, im Hauptstock reizvoll gegliedert, vom Efeu bis übers Dach umwuchert und mit seiner agrarischen Weitläufigkeit, dem alten Garten, dem Turm am tiefen Weiher in die Landschaft hineingewachsen, daß einem das Herz warm wird. Es ist, als müßte der graue Lockenkopf Tante Marlitts – ein Schönbach hat einst freundlich über sie geurteilt! – aus dem Geranke des Turmfensters lächeln oder eine blonde Baroneß an der Seite Meister Detlevs aus dem herbstlichen Buchengang traben. Seit Jahrhunderten ist's den Kellerspergen zu eigen, einem steirischen Edelgeschlecht von jovialer, volkstümlicher Prägung.
Altenberg ward aus dem malerischen Schlössel des 16. Jahrhunderts zum prächtigen Herrensitz ausgebaut, der, bis unters Dach mit köstlichem alten Kulturgut gefüllt, so blitzblank über Wiese und Wald hinaus ins Kainachtal und nach Süden schaut, als könnte er seiner taufrischen Weltabgeschiedenheit nicht genug froh werden.
Das ernste Reiteregg endlich – der gut gemeinte Windsor-Stil der Großväterzeit klingt im Bau deutlich an – birgt vor dem Tore unter mächtiger Linde eines der kostbarsten Barockbildstöckel im Lande und entläßt uns durch lustige Weingartpfade wieder ins breite Tal, wo die Sebastiankirche aus der Pestzeit schwarz gegen den flammenden Abendhimmel steht.
Doch das vierte im Schlösserwinkel? – erinnert »die schöne Leserin«. Richtig, das hätte ich beinahe vergessen. Und bin doch ihm zuliebe ausgezogen.
Tausendlust!
Das klingt so blümerant, so rokokoselig. Etwa wie Monrepos und Sanssouci, nur ins Deutsche, ins Steirische, ins Weststeirische versetzt. Farbige Bilder aus der galanten Zeit spielen wie die Sonnenringel auf dem Waldweg dahin durchs Unterbewußtsein des Chronisten. Von Hetzjagden und Mätressenlaunen, von Robot und Untertanenschweiß, von Schäferspielen und Winzerfreuden wollen sie erzählen. Doch war das Leben hier wohl zu allen Zeiten ganz eng von der urwüchsigen Natur umrankt, bäuerlich einfach, derbkräftig und frisch wie der wehende Weingartwind, wenn er Puder, Parfum und Kuhstallduft aus dem gleichen Arm über die Höhen warf. Und wenn – vor bald dreihundert Jahren – ein Fräulein von Eibiswald, etwa die siebzehnjährige Eusebia Felicitas, nach einem mit dem galanten Vetter Wolf Max aus dem nahen Tobelbad durchtollten Nachmittag abends in dunkler Kammer aus dem Reifrock schlüpfte und mit beiden Füßen ins breite Himmelbett sprang, so mußte sie wohl – huhuhu – noch eine furchtbange Stunde lang dem Knarren der Wetterfahne lauschen oder dem Käuzchenruf im Forst und wie der Jaukwind unterm Hexenlied der Windmühlen über die Wälder fuhr, bis sie nach tiefem Kinderschlafe der taufrische Morgen als kleine Gutsherrin vor den Torbogen rief.
So treten wir aus dem Wald und sind am Ziele. Und schwer enttäuscht. Denn umsonst überläuft unsere historische Witterung die kahlen gelben Mauern. Das ist wirklich ein »gemauertes Stöckel«, ein kleinwinziger Gülthof des ausgehenden 16. Jahrhunderts, der zwischen Weinhecken und Waldrain wohl nie Platz hätte für geschnittene Hecken und weite Esplanaden. Schwer fällt es anfangs, ein Zipfelchen nur zu lüften von der grauen Decke der Vergangenheit, die sich, nur karg durchwirkt vom urkundlichen Gerank, im Laufe der Zeiten über den »lustigen Edelmannsitz« gesenkt hat.
Die Rüdt von Kollenburg haben es im letzten Viertel des 16. Jahrhunderts besessen, vielleicht »vom grünen Wasen« auferbaut. Christoph Rüdt von Kollenburg verkauft die von seinem verstorbenen Vater Alexander vererbte Gült im Februar 1607 dem hochgeehrten Herrn Adam Gabelkhoven, Erzherzog Ferdinands Hof- und Leibmedicus. Der war der Sohn jenes Dr. Christoph Gabelkhoven, der 1577 im Auftrage der steirischen Stände eine gelehrte Instruktion verfaßt hatte, benannt »ein nützliches und tröstliches Regiment wider die Pestilentz und giftigen pestilentzischen Fieber«, und zwanzig Jahre später wohl wegen Alter und Gebrechlichkeit durch Landtagsratsbeschluß vom Einrücken »zum negsten Aufboth und steirischen Feldtzug« gegen den Erbfeind losgezählt wird. Katharina von Gabelkhoven verkauft am 9. Mai 1650 »den Edelmannssitz Tausendlust« an Karl Ludwig von Eibiswald.
Und damit zog ein toller Kauz in die stillen Mauern, wenn anders ihn der Dienst im Felde und sein unruhiges Blut überhaupt lange still liegen ließen. Ein tapferer Haudegen im Türkenkriege – gleich vielen seiner Familie –, hatte er längst das wilde Leben an den Grenzen liebgewonnen, den Tag im Sattel und die Nacht bei Weibern, Wein und Würfelspiel. Nicht mit Unrecht klagt wohl seine Prozeßgegnerin Maria Margaretha von Eibiswald, wie er »mit Haltung vieler Pferde, Diener und Leute, auch Hund, und Gebung stattlicher Livrey, und Haltung kostbarer vielmaliger Mahlzeiten, Spielen usw., während seiner Wirtschaft alles verhaust«, und mit Hinterlassung einer großen Schuldenlast gestorben sei, so daß seine Güter zu Handen der Landschaft eingepfändet werden mußten.
Das war richtig. Denn als ihn 1652 vor Ofen eine türkische Stückkugel zerrissen hatte, konnte sein Kammerdiener auf Ehr und Gewissen nur einen kargen Nachlaß bezeugen: »Ein griens par Hosen, nach seinem Bedünken von paduanisch Tuech, ein Koller von Hirschleder, darzue in einer Truchen etliche türkische Roßdeckhen und unterschidliches Roßzeug, darunter zwei mit Silber beschlagen, samt etlich gezogenen Röhren, Karabiner, Pistolen und Musketen«, so daß seine Gläubiger – es waren bei dreihundert! – leer ausgingen.
Dieweilen er im Feld gelegen, war sein Bruder Christoph Rudolph von Eibiswald nach »Tausendlust« gezogen »und hat dort mit Frau und Kindern sich gar kümmerlich und mühselig aufgehalten und gewißlich gring genueg leben müssen«. Doch zwei Jahre später sehen wir ihn schon wieder hoch zu Roß auf dem Leibnitzer Felde, wie er mit Herrn von Oedt »seine sparber ainpaißt« (auf der Reiherbeize). Dabei stößt er auf einen alten Feind, den Herrn Andrä von Gloiach. Nach kurzem Wortwechsel reißen sie die Pistolen vom Sattel und der Gloiacher bleibt tödlich verwundet auf dem Platze. Des Eibiswalders Eingabe an den Kaiser stellt die Sache als lauterste Notwehr dar. In Wirklichkeit ist sie ein Beleg mehr für die wilde Rauflust und Duellwut jener Zeit, in die auch der früher so bäuerlich gutmütige steirische Landadel geraten war.
Soweit die historischen Nachrichten.
Und was haben die Jahrhunderte vom »lustigen Edelmannsitz Tausendlust« übriggelassen?
Fürs erste betrübend wenig. Einen unansehnlichen, kahlen Kasten von zwei Geschossen mit schlicht überschindeltem Torvorbau, seit 1825 der Blitz das einstige Türmlein darüber heruntergeschlagen. Zu ebener Erde führen niedrige Platzgewölbe aus dem Vorhause in die Küche und in eine tiefe Meierstube, die man sich, mit altem Hausrat gefüllt, recht wohnlich denken kann. Eine enge Holzstiege leitet nach oben in mehrere Gemächer voll nackter, zerbröckelnder Armseligkeit. Und doch! Auf die nüchterne Alltäglichkeit von heute blicken fast seltsam und verwundert von der Riembogendecke und einigen Wänden Reste von Temperamalerei aus dem Formenschatz der Spätrenaissance. In toller Laune und mit geschickter, fast übermütiger Pinselführung sind ins dekorative Rankenwerk der Blumen- und Fruchtfestons verstreut zahlreiche Motive der Tier- und Pflanzenwelt, Pfauen, Affen, Fasane, Reiher, Störche, Schlangen, Molche, Schnecken, Teufelsfratzen, allegorische Frauen- und Mannsgestalten, soweit sie nicht späterer Übertünchung zum Opfer fielen. Ein früherer Besucher, Maler Hans Petschnig aus Graz, meint, daß ein Künstler, der in Rom die Loggien des Vatikans gesehen habe, in dem Besitzer einen Kunstfreund gefunden haben müsse, der – dem Namen »Tausendlust« entsprechend – diese tollen und extravaganten Malereien ausführen ließ, und verlegt sie in die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts. Das würde aus zeitlichen und inneren Gründen für die Gabelkhoven sprechen, für die Zeit, da allegorisierende Dichtkunst und profunde Gelehrsamkeit oft friedlich unter der gleichen Perücke ihr Wesen trieben und die schilcherselige Lust des freien Landlebens den Mäzen wie den fahrenden Meister zu solch launigen Schnurrpfeifereien angeregt haben mochte. Freilich, wenn dann ein frommer Eingeborener des Södingtales durch die Gemächer stieg, so schlug er im stillen wohl sein Kreuz vor all den heidnischen Fabelwesen. Fortuna auf dem Rade, der Vogel der Juno, die Fratzen und Larven, was hatten sie seinem schlichten Untertanenverstande zu sagen? Da war ihm sein heimischer Spuk vertrauter, der Scharbock, die Lahnwaberl …
Noch einmal scheint unsere Gegend auf, etwa hundert Jahre später, im Zwielicht der Aufklärungszeit. Die hatte einen übereifrigen und oft nur äußerlich erfolgreichen Kampf begonnen gegen manche Volksbräuche auf dem freien Lande, besonders wenn sie uralte Überlieferung und religiöse Übung gutmütig und arglos vermengten. Am 30. März 1751 verlangt die Regierung zu Graz von Karl Josef Grafen von Lamberg als Inhaber der Herrschaft Altenberg »die sofortige Abstellung eines in der Pfarre Stallhoffen sowie auch zu Moßkürchen, Hizendorff und etlichen anderen benachbarten Pfarren eingeführten Mißbrauches, wonach in der heiligen Osternacht nach der Auferstehung der Pfarrer und der Kaplan mit angehängten Vesperpeitlen und darinnen befindlichen allerhöchsten Guett auf zwei seithen zertheilter in der Pfarr ausreitheten« und ihnen die »Pfarrmenge« teils beritten, teils zu Fuß mit brennenden Fackeln und Pechstangen folgte. An gewissen Stationen wurden sodann die vier Evangelien » contra omnes ritus« gesungen und mit dem Venerabile die Erdfrüchte gesegnet, hierauf das Fleisch, welches die Pfarrmenge auf die Bäume »auch schon von weithen« aufhängte, von der freien Gegend aus benediziert und dann sofort mit dem Essen begonnen. Dieser Osterbrauch sei gegen die Principia der römisch-katholischen Religion und alle gute Polizei, da dergleichen nächtliche Besegnungen und die daraus entstehenden Schwärmereien leicht zu Feuersgefahr und »andern aergerlichen Inconvenienzien« Anlaß geben könnten.
Wie wundersam berühren sich hier uraltes Heidentum und fromme Christengläubigkeit, die Feier der altgermanischen Göttin Ostara mit der behaglichen Sitte der Fleischweihe, der verhohlene Brauch, böse Geister und Hexen mit Feuerbränden in ihre Schlupfwinkel zu scheuchen, und der stille Glanz der Frofeuer in der Osternacht. Wir freuen uns im stillen, daß sich trotz allen Eifers einer kurzsichtigen Regierungskunst und ängstlicher Polizeigewalt noch so vieles an uraltem Volksbrauch in unserem Bauerntum erhalten hat bis auf unsere Zeit.
Wir treten ins Freie. Aus dem Dämmerdunkel der alten Zeiten ins grelle Licht der Gegenwart. Und doch wird uns heute das Herz nicht leicht wie sonst.
Wohl liegen die stillbesonnten Höhen blitzblank und farbenklar unterm hohen tiefblauen Himmel. Der Frühschnee der Nacht ist in tausend Strähnlein zerronnen. Von der Giebelbrust der Kleinbauernhöfe prunkt der Goldpanzer der Maiskolben. Wie Stückkugeln der Friedenszeit liegen zu Haufen getürmt die Kürbisse vor den Scheunen.
Aber wie vom Ameisenvolk nach einem Regentage ist das weite Hügelland auf Wegen und Steiglein emsig durchlaufen vom armen österreichischen Bettelvolk unserer Zeit. Den müden Füßen wandern traurige Augen voraus, die freundlich und geduldig nach all den Herrlichkeiten spähen, die der Landbau bringt. Denn schwerer noch als der Rucksack drückt sie die Sorge um die hungrigen Mäuler daheim. Was sie dem Kriege zum Opfer gebracht in den Jahren der Angst und Sorge um ihre Lieben in der Ferne, fast haben sie es vergessen. Nur leben wollen sie noch, nicht verhungern mit den Ihrigen in den grauen Tagen – oder sollten es Jahre sein? – der Zukunft. Und tragen zu all dem Krimskrams in der unverbesserlichen Schmuckfreude des Österreichers noch immer ein paar Zweige heim, die der steirische Herbst in leuchtendes Gold gekleidet. Die sollen den Lieben daheim in den kalten, dunklen Stuben der Stadt einen freundlichen Gruß bringen von der weiten freien Welt vor den Toren, von den schimmernden Herbstwundern der Heimat, einen Gruß von »Tausendlust«.