
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
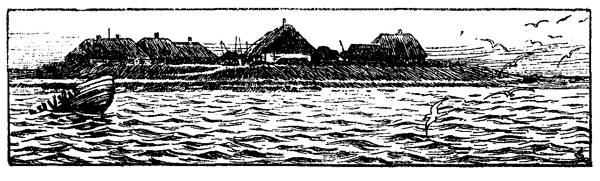
Von Friedrich Paulsen.
Mit unbegrenzter Befriedigung blicke ich auf das Elternhaus zurück, das mich gehegt und gebildet hat, gebildet nicht so sehr durch Reden und Hören als durch unmittelbare Teilnahme an der Fülle von Leben und Wirksamkeit, das es in seinem engen Kreise beschloß. In der Tat, wenn ich ein solches Bauernhaus mit den Großstadthäusern vergleiche, in welchen nun ein immer mehr anschwellender Teil unseres Volkes lebt und aufwächst, dann kann ich nicht umhin, die fortschreitende Verarmung der Jugend zu beklagen, Verarmung an Bildungsmöglichkeiten und Verarmung an Freuden. Dort war die ganze Welt in lebendiger Wirklichkeit gegenwärtig: die Natur mit allem Reichtum ihrer Formen und Erzeugnisse war uns zugänglich und vertraut, Äcker und Felder, Wiesen und Weiden, Heide und Moor, fließende Bäche und stehende Gräben, Wehlen und Teiche, Dünen und Hügel, Deiche und Dämme, Watten und Priele, Flut und Ebbe, wir kannten sie, nicht von einem kurzen Sonntagnachmittagsausflug sondern aus täglichem intimsten Umgang; in jedem Graben haben wir gewatet und Fische gefangen, in jedem Teich und Fluß gebadet, jeden Bach abgedämmt, auf jedem Acker gepflügt, in jeder Fenne gearbeitet, auf jeder Wiese Heu gemacht; über jede Heide sind wir gesprungen und haben Beeren gepflückt oder den Eidechsen zugesehen, auch wohl einmal eine Schlange gescheucht, von jeder Düne haben wir uns im Sommer heruntergewälzt oder im Winter auf Schlitten herabsausen lassen. So haben wir den Himmel bei Tag und bei Nacht gesehen, am Morgen das Erblassen der Sterne und das Aufleuchten des Frührots erlebt, am Abend der untergehenden Sonne ins Angesicht geschaut und die ersten Sterne wetteifernd gesucht und gezählt, das heraufziehende Wetter beobachtet und die sengenden Blitze in fast fühlbarer Nähe niederfahren sehen, den Regen über uns niederrauschen lassen und in der glühenden Sonne nackt im Sande gelegen. Auf Pferden haben wir uns getummelt, ohne Sattel und Zaum manchen wilden Ritt getan, bis der Reiter zur Erde glitt oder auch einmal kopfüber in den Graben geschleudert wurde; mit Kälbern und Lämmern haben wir gespielt, mit Pferden und Kühen auf der Weide gelegen, mit Schafen und Ochsen, die den Weg nicht wollten, den sie sollten, sind wir um die Wette gelaufen; den Fischen haben wir mit Netzen und Schlingen nachgestellt, den Vögeln ihre Nester abgelauscht, den Kibitzen und Rebhühnern die Eier genommen, den Grasmücken und Bachstelzen die Jungen mit Fliegen füttern helfen, ob sie sie schätzten oder nicht. Kurz, die ganze Natur lag innerhalb des Bereichs nicht nur unserer Augen sondern auch unserer Hände und Füße, wir lebten mit ihr als ein Teil ihrer selbst.
Und wie die Natur, so lag das ganze menschliche Dasein in unserem Bereich, nahe, faßlich, verständlich. Alle elementaren Künste der Kultur hatten im Haushalt ihren Ort; das Großstadtkind sieht nur die fertigen Dinge und ihre Verzehrung, wir sahen sie alle entstehen, vom ersten Anfang bis zur Vollendung, das Brot und das Bier, das Hemd und die Jacke, fast nichts kam in unseren Gesichtskreis, von dessen Herstellung wir nicht eine anschauliche Erkenntnis gehabt hätten. Denn auch die Dinge, die das Haus nicht selber herstellte, sahen wir entstehen: der Schneider kam und schnitt auf dem großen, aufgeschlagenen Klapptisch nach großem Papiermuster den Stoff zum Anzug zurecht, dann setzte er sich, ein Wunder zu sehen, mit untergeschlagenen Beinen auf denselben Tisch und nähte die Stücke zusammen. Im Frühjahr und Herbst kam der Zimmermann auf einige Tage ins Haus, besserte aus und fertigte Neues, hobelte und sägte, natürlich wir immer dabei zusehend und wohl auch einmal Hand anlegend. Und was nicht ins Haus kam, das suchten wir auf; bei dem alten Schuhmacher waren wir häufige Gäste: man wartete eine Stunde, um das zum Ausbessern gebrachte Schuhwerk gleich wieder mitnehmen zu können und sahen ihm inzwischen zu, wie er mit Leder und Leisten, mit Ahle und Pechdraht, mit Schusterhammer und Messer hantierte oder am Abend durch eine gefüllte Wasserkugel das Licht des dürftigen Öllämpchens auf einen Punkt sammelte.
Und nicht minder kehrten wir gern beim Schmied ein: es war ein fröhlicher Mann, und er hatte uns gern, wenn wir im Winter aus der Schule kommend vorsprachen und zusahen, wie er das weißglühende Eisen mit der Zange aus der Kohlenglut zog und mit dem Hammer bearbeitete, daß die Funken in alle Ecken der dunklen Werkstatt stoben und die Mädchen laut aufschrien.
Wie abstrakt und oberflächlich und dürftig bleibt hiergegen die Vorstellungswelt des Großstadtkindes. Die Natur sieht es nur auf dem Papier, das Bilderbuch und das Lesebuch geben blasse Vorstellungen von Feld und Wald, von Tieren und Pflanzen, höchstens daß es noch einmal am Sommernachmittag die Dinge selbst sieht, aber wieder nur von weitem und ohne an sie heranzukommen: alles ist vor ihm verschlossen und vergittert. Dagegen hat es täglich um sich eine Welt künstlicher Dinge und Vorgänge, in deren Inneres es nicht hineinzusehen vermag: die elektrische Lampe und die Straßenbahn, das Telephon und das Automobil, das Warenhaus mit seinen tausend die Begierde aber nicht die Erkenntnis herausfordernden Dingen, das Museum mit seinen unverstanden angestarrten Kunstwerken oder Resten einer nur dem Gelehrten erreichbaren Vergangenheit. So wächst es auf unter lauter Dingen, die ihm stumm bleiben, und endlich gewöhnt es sich, nicht mehr zu fragen sondern mit der Oberfläche und der unverstandenen Benutzung sich zufrieden zu geben.
Und nicht viel anders steht es mit den menschlichen Verhältnissen, den privaten und den öffentlichen. Die Großstadtmenschen sehen sich nur von weitem und kennen sich von der Oberfläche, sie wissen voneinander Namen und Titel, Stellung und Parteirichtung und derlei Äußerliches, aber die Wurzeln des Daseins des andern, die erreichen sie nicht, und darum wissen sie auch von dem Innersten des persönlichen Lebens so wenig. Ich bin oft erstaunt gewesen, nach dem Tode eines Mannes, den ich jahrelang gekannt, den ich täglich gesehen hatte, aus seiner Biographie zu erfahren, wie wenig ich im Grunde von ihm gewußt hatte. Dagegen im Dorf weiß jeder vom andern, nicht bloß von gestern und vorgestern sondern von Eltern und Großeltern her; man sieht die Verhältnisse, unter denen er geworden ist, in denen er lebt, seine Frau und Kinder, seine Heimstätte und seine Arbeit, sein Gedeihen und Mißlingen. Was weiß von allen diesen Dingen in der Großstadt der Kollege vom Kollegen? Sie sehen sich täglich, sie tauschen Gedanken und Meinungen über alle Dinge aus, aber von ihrem eigentlichen Erleben sehen sie meist so gut wie nichts; es bleibt eine schattenhafte Kenntnis von dem Reden, Meinen und Sichgeben des andern.
Und ähnlich mit den öffentlichen Angelegenheiten. Man liest davon in der Zeitung und redet davon am Biertisch und vielleicht in der Volksversammlung. Aber wie am letzten Ende »der Staat« und »die Gesellschaft« aussieht und wirkt, davon gewinnt der Junge, der auf dem Lande aufwächst, viel eher eine lebendige Anschauung. Ich kannte den Landvogt und den Aktuar in Bredstedt, ich wußte, zu wem man geht, wenn man dies oder jenes Geschäft hat, ich kannte die Gemeindebeamten und die Kirchspielsversammlung und wußte, wie es darin hergeht, ich wußte, was der und jener zu tun hatte, der Vater hatte das Geschäft selbst jahrelang gehabt, und ich hatte ihm Handlanger- und Botendienste dabei verrichtet. Ich wußte von den Rechtsgeschäften, von Hypotheken und Stempelpapieren, von Kaufbriefen und Mietsverträgen, sie gingen früh durch meine Hände. Ebenso von Steuern und Abgaben, die »Quittungsbücher« über bezahlte Grundsteuern und Koogssteuern, Kirchen- und Schullasten lagen in der Schatulle des Vaters, und er verwehrte mir nicht, sie durchzusehen. So hab' ich auch von Einnahmen und Ausgaben des Haushalts früh konkrete Einsicht gehabt: was die Ochsen und Schafe, der Roggen und Hafer, das Heu und Stroh kosteten und also einbrachten, war das tägliche Gespräch. Und wie mit den Preisen der Erzeugnisse die Landpreise stiegen und fielen, wie die Art des Anbaus des Landes mit dem Wechsel der Konjunktur sich änderte, wie der Kornbau zurückging, als der Fettviehexport nach England in den fünfziger Jahren begann, wie bei steigenden Wollpreisen die Aufzucht von Schafen sich rasch vermehrte und wieder nachließ, als der große Import von Australien einsetzte: alles dies lag vor den Augen schon des aufmerkenden und aufhorchenden Knaben.
Und nicht bloß die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gegenwart, auch ihre Einordnung in den geschichtlichen Zusammenhang wurde ihm sichtbar. Meine Jugendjahre fielen in die Zeit mächtig aufsteigenden Gedeihens der Landwirtschaft; sie begann langsam in den vierziger Jahren, ging dann stoßweise aufwärts in den fünfziger Jahren; man führte das Steigen aller Preise, der Pferde, des Hafers, des Fleisches, auf den Krimkrieg zurück, der die Nachfrage für den Militärbedarf rasch in die Höhe trieb. Dann kamen die sechziger Jahre mit der wachsenden Industrie, die Jahre des Aufschnellens nach dem Krieg von 1870, in denen das Land unbegrenzten Wert zu erhalten schien. Vorher war aber eine Zeit der Not gegangen, die den Eltern noch lebendig vor der Seele stand und oft in den Gesprächen vorkam: in den zwanziger, dreißiger Jahren waren die Erzeugnisse der Landwirtschaft fast wertlos und unabsetzbar gewesen; für einen dreijährigen Ochsen wurden 10-12 Taler Hamburgisch, für eine Tonne Hafer 2 Mark Lübsch, für ein Pfund Butter 2 Schilling (15 Pfennig) bezahlt. Kein Wunder, daß die Geldknappheit aufs äußerste stieg und daß die schönsten Bauernstellen in Masse für nichts im Konkurs verkauft werden mußten; wer Schulden hatte aus früherer besserer Zeit, oder wer ein wenig leichter das Geld ausgab, der kam alsbald von Haus und Hof.
Von allen diesen Dingen hatte ich eine lebendige Anschauung, ehe ich die Namen von »Staat« und »Gesellschaft« gehört haben mochte: in der friesischen Sprache gibt es keine Wörter dafür. Was will gegen solche konkrete Belehrung der Unterricht besagen, den das Stadtkind, so Gott will, in der Schule über die »Verdienste der Hohenzollern um die Bürger und Bauern« oder über die »Verderblichkeit der sozialdemokratischen Lehren« erhält? oder den es sich selber aus Zeitungen oder Gesprächen gewinnt? Ich habe nachher zeitweilig mit Leidenschaft Nationalökonomie studiert; es war die Freude, das, was ich aus der Anschauung kannte, nun in der großen Theorie wiederzufinden; vor allem hat es mir aus diesem Grund Roschers Nationalökonomie des Ackerbaus angetan; ich hab' sogar den Vater dahin gebracht, von mir Vorträge darüber sich halten zu lassen, natürlich nicht Kathedervorträge.
Nicht minder lag auch die soziale Struktur in einfacher und durchsichtiger Gestalt vor Augen. Das Dorf bildete eine übersehbare Lebensgemeinschaft. Das tragende Grundgerüst machten die selbständigen, Bauernhöfe aus. Daran lehnten sich die Handwerke: alle notwendigen Arbeiten waren vertreten, jeder Handwerker hatte regelmäßig eine Anzahl Bauern als seine Kundschaft, der Müller, der Schmied, der Rademacher usw.; ihre Aufträge waren die Unterlage seiner Lebenshaltung. Dazu kam als eine dritte Gruppe der Pastor, der Schullehrer, der Arzt, der Beamte: sie standen einigermaßen außer oder über der Gesellschaft, sie mit Leistungen versehend, die nicht auf einheimischen, bodenständigen Künsten beruhen. Ebenso trat die soziale Schichtung, die Klassenbildung in primitiver Form faßlich zutage. Es gab Großbauern, sie waren mehr in den neuen Kögen heimisch, die nicht selbst mit Hand anlegten bei der Arbeit, dann eine sehr breite Schicht von mittleren Bauern, die regelmäßig mehr oder minder sich selber an der landwirtschaftlichen Arbeit beteiligten. Dann folgte eine Schicht kleiner Besitzer, die auf dem eigenen Landbesitz nicht mehr ausreichende Arbeit für die Familienglieder hatten und daher durch übernommene Dienste ihr Einkommen steigerten, sei es durch Fuhrdienste oder durch Krämerei, Tagelohn und Handwerk. Endlich kamen die eigentlichen Tagelöhner, die nur ein Haus mit Garten und vielleicht noch Land für eine Kuh oder ein paar Schafe hatten, sonst es mieteten; sie standen meist in regelmäßigem Arbeitsverhältnis zu einem Bauernhof, ihre Kinder gingen erst als Hütejungen, dann als Dienstboten in Stellung. Endlich am Rand eine sehr kleine Schicht von Armen, meist durch Krankheit und Unglück heruntergekommene oder auch durch eigene Schuld, durch Trunk und Trägheit verkommene Familien: sie lebten von gelegentlicher Arbeit und vom Betteln. Einige Insassen des Armenhauses, erwerbsunfähige Alte, unversorgte, meist uneheliche Kinder, Krüppel, Idioten, machten den Beschluß.
*
Anmerkung: In der Kirche zu Langenhorn ist unter dem von Prof. Fr. Paulsen gestifteten, dem Andenken seiner Eltern gewidmeten Fenster, das den Apostel Paulus darstellt, eine Gedächtnistafel angebracht. Sie besteht aus drei Teilen. Die mittlere Haupttafel trägt folgende Inschrift:
An
D. Dr. Friedrich Paulsen
Geboren allhier zu Langenhom
Am 16. Juli 1846
Wo seine Eltern waren
Paul Fr. Paulsen u. Christine geb. Ketelsen
Seine Lehrer
Küster S. Brodersen und Pastor C. Thomsen
Gestorben zu Steglitz bei Berlin
Am 14. Aug. 1908 .
Nachdem er an der Berliner Universität
durch 33 Jahre als Lehrer der Philosophie
und Pädagogik gewirkt hat.
*
Der Wahrheit
Und der gesunden Vernunft Freund
Feind der Lüge und dem Schein
Ein Anhänger der guten Sache
Auch der nicht siegreichen
Der Ehre der Welt nicht allzu begierig
Nicht im Gefolge des Willens zur Macht
Der Heimat treu
Den Eltern u. Lehrern seiner Jugend dankbar zugetan
Lebte er in einer Zeit
Die von dem Allen das Gegenteil hielt
Und verließ darum nicht unwillig diese Welt
In der Hoffnung
einer besseren.
So lag die Gliederung der Gesellschaft nach dem Besitz sichtbar vor Augen; man wußte von jedem Bauern, wieviel Demat Land er besaß, und von jeder Familie, in welchen Verhältnissen sie sich befand, sah auch, wie die Verhältnisse von dem Verhalten abhängig waren, warum diese Familie im Aufsteigen war, jene nicht auf einen grünen Zweig kommen konnte: alles Dinge, die in der Großstadt unsichtbar oder doch undurchsichtig bleiben. Womit es denn doch wohl zusammenhängt, daß allerlei seltsame Meinungen hier so leicht sich durchsetzen, z. B. daß das ökonomische Ergehen des einzelnen von seinem Verhalten überhaupt nicht abhängig sei, oder daß seine Verhältnisse nun eben von den Verhältnissen kommen, und ähnliche.
Hinzufügen möchte ich noch dies, daß die soziale Gliederung die Einheit der Lebensgemeinschaft nicht aufhob. Es gab in dieser Bauerngesellschaft nirgends eine Spaltung, eine Kluft zwischen den Klassen, wie sie im Osten des Landes vorhanden ist, ja wie sie hier eigentlich die Grundlage der ganzen Gesellschaftsordnung bildet: die Spaltung in Rittergutsbesitzer und Tagelöhner, in offiziersfähige
*
Die linke Tafel trägt folgende Inschrift:
Der Lieben und Guten,
Der Gefährtin meines ersten Glücks,
Der Mutter meiner Kinder,
Ihr, deren Glück es war, Freude zu machen,
Frau Emilie Paulsen geb. Ferchel
Geb. zu Kaufbeuren 13. März 1846
Durch einen allzufrühen
Vielbeweinten Tod abgerufen
Zu Pyrmont 14. Juni 1883
In treuer Erinnerung
Gewidmet.
Inschrift der rechten Tafel:
Der Gottgeliebten
Der treuesten Gattin
Der aufopferndsten Mutter
Der umsichtigen Hausfrau
Der Freundin der Armen
Der allezeit Fröhlichen
Tapferen Tätigen
Frau Laura Paulsen geb. Ferchel
Geb. Nördlingen 26. Sept. 1851
schrieb diese Inschrift
ihr vor ihr dahingegangener
Gatte.
Familien und Gemeine, in Gebildete und Ungebildete, in Hochwohlgeborene und überhaupt Nicht-Geborene. Alle Stufen des Besitzes waren durch kontinuierliche Übergänge verknüpft; zwischen allen bestand, wenn auch mit Abstufungen, conubium und commercium; man saß wie in der Kirche so in der Schule und im Wirtshaus beisammen. In der Schule hatten die Kinder der reichen Bauern neben denen der Tagelöhner ihren Platz, und selbst die Insassen des Armenhauses saßen durch die Klasse verteilt, je nachdem ihre Fähigkeiten und ihr Fleiß ihnen einen Platz verschafften. Im ganzen hatten natürlich die Wohlhabenden den Vorzug, schon wegen des regelmäßigeren Schulbesuchs; aber zuletzt gab doch die persönliche Leistungsfähigkeit den Ausschlag. Und nicht anders war es beim Spiel: jeder gilt, soviel er kann; eine Ausschaltung kam auch hier nicht vor, wenn einer sich nicht selbst unmöglich machte. Und dieses einheitliche Leben in der Jugend setzte sich fort auch bei den Erwachsenen. Zwar traten die Unterschiede des Besitzes stärker hervor; doch blieb auch hier die Gemeinsamkeit des Tanzplatzes und der Kegelbahn, der Liedertafel und des Ringreitens: auch der Knecht und das Dienstmädchen war nicht ausgeschlossen. Und so kamen denn Zwischenheiraten nicht so gar selten vor; ein tüchtiger und bewährter Knecht konnte um die Tochter eines Bauern oder die Hand seiner Witwe anhalten, ohne von vornherein der Ablehnung gewiß zu sein, und das Umgekehrte kam wohl noch häufiger vor, daß Bauernsöhne Töchter von Handwerkern oder kleinen Leuten, die dienten, heirateten.
Dieser demokratische Charakter der Gesellschaft prägte sich auch überall in der Sitte und Sprache aus. Wie man bei der Arbeit und bei Tisch auf dem Fuß der Gleichheit verkehrte, – es war selbstverständlich, daß die Dienstboten bei uns mit am Tisch aßen – so machte die Sprache in einer bemerkenswerten Weise alle zu Gleichen: alle Gleichalterigen nannten sich du, dagegen wurde die ältere Generation ohne Rücksicht auf die gesellschaftliche Stellung mit der Anrede durch den Namen, wie die Eltern durch die Anrede mit Vater oder Mutter, geehrt, während sie die jüngeren mit dem Du ansprach. Nur der Altersunterschied, ein allgemein menschlicher, nicht der gesellschaftliche Unterschied gab eine Vorzugsstellung. Ausgenommen waren nur die Pastoren, Lehrer, Beamte, die natürlich mit ihren Amtsnamen angeredet wurden, meist auch Fremde waren und nicht Friesisch redeten. So bin ich, wenn ich als Student oder junger Doktor nach Hause kam, von den älteren Leuten, auch unserem Tagelöhner, mit Du angeredet worden, vielleicht einmal mit einer Art Entschuldigung: eigentlich darf ich ja wohl so nicht mehr sagen; während ich sie mit dem Namen anredete. Es wäre mir einfach gegen den eingeborenen Sprachsinn gegangen, anders zu verfahren. So wenig ich gegen Vater und Mutter jemals das Du über die Zunge gebracht hätte – man konnte durchaus nur sagen: ich bitte Vater, dies oder das zu tun – so wenig konnte ich einen doppelt so alten Mann anders als mit Namen anreden: Wie geht es, Carsten?
Aus: Friedrich Paulsen, Aus meinem Leben, (Jena, Eugen Diederichs.)