
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Die Eintretenden waren eine Dame und zwei Herren in Offiziers-Uniform.
Fanny fuhr fast erschreckt zurück, als sie die Ankommenden erblickte.
»Belle-Boyd!« stotterte sie mit einem Blick auf die Dame und sank auf einen Stuhl.
Die junge Dame in äußerst verführerischer Toilette, welche ihre keineswegs geringen Reize noch bedeutend hob, war heiter, ungezwungen, lustig wie immer.
Sie brach in ein lautes Lachen aus, als sie Fanny's Angst bemerkte und als sie Nettice sich scheu hinter Noddy's Stuhl bergen sah.
»Meine lieben Freundinnen!« rief sie mit herzgewinnender Ungezwungenheit, »Sie haben Furcht? Furcht vor mir? O denken Sie nicht, daß ich Sie zurückbringen werde in das Hans der Mrs. Bagges! O nein! es wäre thöricht von mir, das zu wollen, selbst wenn das Haus der Mrs. Bagges noch existirte. Die gute Dame aber ist durch diesen edlen Ritter« – sie deutete auf Noddy – »um ihren Erwerb gebracht. Dieser tapfere Löwenbändiger hat ihr ihre beiden besten Zöglinge entführt und ihr außerdem eine lästige Wachsamkeit der Behörde auf den Hals geschafft. Sie hat es deshalb vorgezogen, mit ihrer liebenswürdigen Schwester eine andere Gegend in den Conföderirten Staaten aufzusuchen, ja vielleicht sich auch ganz aus denselben entfernt, namentlich bei der Gefahr, die in diesem Augenblicke Charleston selbst bevorsteht – Sie wissen doch, daß die Stadt möglicherweise einer Belagerung ausgesetzt sein wird?«
»Ich hörte davon,« antwortete Fanny schüchtern.
»Nun, falls wirklich die Stadt erobert werden sollte, so würden die Beamten der Feinde nicht eben glimpflich mit einem Institut, wie das der Mrs. Bagges verfahren, und, um schimpflichem Gefängnis zu entgehen, hat sie lieber ihr Geschäft aufgegeben. – Also seien Sie unbesorgt, meine schönen Freundinnen; ich komme nicht um Ihnen irgend ein Leides zuzufügen.«
»Aber was verschafft uns das Vergnügen ...?«
»Meines Besuches? ... Ach ich vergaß, Ihnen diese beiden Herren vorzustellen: – Mr. Tucker, Armee-Lieferant – Mr. Alston, Gouverneur des Libby-Gefängnisses.«
Die beiden Offiziere verneigten sich, und Mr. Tucker, dessen graues, funkelndes Auge schon längst mit Lüsternheit auf der schönen Gestalt Fanny's geruht, benutzte die Gelegenheit, sich ihr zu nähern.
»Ich sah Sie zuweilen am Fenster, Miß,« sagte er mit einschmeichelnder Höflichkeit; »mein Freund Alston hatte mich auf das herrlichste Gestirn, das jetzt am Himmel Charleston's strahlt, aufmerksam gemacht. Wir brannten vor Verlangen, das Vergnügen Ihrer werthen Bekanntschaft zu haben. Wir theilten unsern innigsten Wunsch unserer Freundin, Miß Belle-Boyd mit, und diese, sobald sie Sie sah, sagte nicht nur, daß sie Sie kenne, sondern gab uns auch mit liebenswürdiger Zuvorkommenheit das Versprechen, uns Ihnen vorzustellen.«
»Sehr freundlich von Miß Belle-Boyd,« antwortete Fanny. »Ihr Name, Mr. Tucker ist mir nicht unbekannt; ich hörte meinen Vater denselben oft nennen; ebenso den Ihrigen, Mr. Alston.«
»Ihr Vater, Miß? Wer ist Ihr Vater?«
»Mein Name ist Fanny Cleary.«
»Was?!« rief Mr. Tucker erstaunt, »Sie sind die Tochter von George Cleary, von Georgesville in Kentucky.«
»Dieselbe, Sir.«
»Unmöglich, Miß! Wie kämen Sie hierher?«
»Während der Gefangenschaft meines Vaters ...«
»Gefangenschaft Ihres Vaters!?«« wiederholte Tucker.
»Nun ja! Mein Vater gerieth in Tennessee in Gefangenschaft und wurde nach dem Norden fortgeführt.«
Tucker lächelte ungläubig und wechselte mit Alston einen Blick.
»Sie erzählen uns ein Mährchen, Miß.«
»Ich bitte, meine Herren, nicht an der Wahrheit meiner Worte zu zweifeln! Mein Freund hier, Noddy ...«
Tucker und Alston warfen einen verächtlichen Seitenblick auf den Mulatten –; der Blick hatte etwas Beschämendes für Fanny; sie bereute, in Gegenwart so vornehmer Herren Noddy ihren Freund genannt zu haben, und fuhr etwas kleinlaut fort:
»Noddy, der von meinem Vater erzogene Nigger, kann bezeugen, daß ich die Wahrheit spreche.«
»Wir brauchen das Zeugniß eines Dritten nicht,« sagte Alston mit eigenthümlicher Ironie. »Wenn Sie wirklich die Tochter jenes Mr. Cleary sind, der unser Freund ist und einer der Hauptagitatoren der Partei, jenes George Cleary von Georgesville in Kentucky, so ist Ihr Vater nie als Gefangener aus Tennessee fortgeführt, sondern befindet sich noch heute auf freiem Fuße und ist gegenwärtig in Canada.«
»Was?!« rief Fanny, »mein Vater frei und ich von ihm getrennt? O Himmel, was höre ich! Noddy, warum verschwiegst Du mir ...«
»Ich wußte es nicht, Fanny, bei Gott! Ich habe absichtlich Nichts verschwiegen; noch bis heute habe ich geglaubt ...«
»Miß Cleary,« unterbrach Tucker den Mulatten, »daß die Tochter eines Sclavenzüchters und des angesehensten Mannes in Kentucky sich auch nur einen Augenblick unter Protection eines ehemaligen Sclaven ihres Vaters stellt, das ist – verzeihen Sie die etwas bittere Bemerkung – für die Tochter eines Cleary eine unwürdige Stellung.«
Noddy erhob sich und durchbohrte Tucker mit seinen Augen.
»Erlauben Sie mir ein Wort als Freund Ihres Vaters, Miß,« fuhr Tucker fort.
»Da die Unterredung lang zu werden anfängt,« bemerkte Belle-Boyd, »so erlauben mir meine lieben Freundinnen wohl, daß ich mich setze. Ich muß gestehen, daß ich durch einen etwas langen Spazierritt ermüdet bin.«
»Ich bitte die Herren um Entschuldigung,« sagte hier Fanny; »meine Ueberraschung war zu groß; ich dachte nicht daran, Sie zu bitten, daß Sie Platz nähmen. Wollen Sie die Güte haben, meine Herren? Ist's Ihnen gefällig, Mr. Tucker?«
Mit einer Handbewegung deutete sie auf den Sessel, den eben Noddy innegehabt.
Mr. Tucker drehte sich langsam und mit aristocratischer Gelassenheit um und stieß dann den Sessel mit einer verächtlichen Miene beiseite.
»Miß, unser Einer nimmt nicht auf dem Sitze Platz, wo ein Nigger gesessen. Sie erlauben, daß ich einen anderen Stuhl nehme.«
Schamröthe bedeckte wieder Fanny's Stirn.
Sie vermied es, Noddy's Blick zu begegnen, sie fühlte, daß das Benehmen der beiden Herren für ihn demüthigend sein mußte, und doch blieb das stolze, aristocratische sichere Auftreten der beiden Offiziere nicht ohne Eindruck auf sie; ja, als sie im Stillen Vergleiche anstellte zwischen diesen Leuten, die so hoch standen über vielen Tausenden von Männern und der Gegenstand der Aufmerksamkeit der schönsten und reichsten Mädchen sein mußten, und Noddy, dem verachteten Mulatten, da – zu ihrer Schande müssen wir es gestehen, – da schämte sie sich, ihm jemals in ihrem Herzen einen solchen Platz eingeräumt zu haben, und sie ärgerte sich, daß die Herren ihren Freund bei ihr getroffen.
»Sie erlauben, Miß Cleary,« nahm Tucker das Wort, »daß wir, Mr. Alston und ich, es uns zur Pflicht machen, für Ihren Unterhalt so lange zu sorgen, bis es möglich sein wird, Sie zu den Ihrigen zurückzuführen Im Augenblick ist es unmöglich, da, wie gesagt, Ihr Vater sich in Canada befindet. Fürs Erste würden Sie deshalb in Charleston bleiben müssen.«
Fanny dankte für diese Theilnahme, und Nettice heftete fast ängstliche Blicke auf die fremden Herren.
Noddy aber, welcher in einiger Entfernung stand und bis jetzt schweigend zugehört hatte, zitterte vor Wuth. Seine Lippen wurden bleich und bebten.
Jetzt hielt er nicht länger an sich.
»Das geht nicht, Sir,« rief er, »das dulde ich nicht!«
Tucker wandte den Kopf halb über die Schulter nach dem Sprecher hin und fuhr dann, ohne auf ihn zu achten, fort:
»Für ein standesgemäßes Leben wird gesorgt werden, und an passendem Umgange an diesem Orte soll es Ihnen ebenfalls nicht fehlen.«
»Für die Existenz von Miß Cleary ist gesorgt, und ein Umgang wie der Ihrige und der dieser Dame, von welcher ich bereits gehört habe, ist kein passender. Ich gestatte weder, daß Sie für Miß Cleary's Unterhalt sorgen, noch werde ich ihr den Umgang mit Ihnen und den Kupplerinnen Ihrer Freundschaft gestatten.«
»Unverschämter Bube, wirst Du schweigen? rief Alston. »Miß Cleary, Sie haben in Ihrer Gutmüthigkeit Ihrem Sclaven zu viel Freiheit gestattet; Sie finden es hoffentlich nicht unbillig, wenn ich Sie bitte, ihn hinaus zu schicken«
»Er ist nicht mein Sklave; er ist erzogen von meinem Vater wie ein Sohn, und seinem Schutz hat mein Vater mich übergeben. Ich bitte Sie deshalb, seinen Widerspruch zu entschuldigen.«
»Ha! Ihr Vater hatte auch seine schwachen Seiten, ich weiß es, und die Folge davon war, daß er durch seine Nigger aus seinen Besitzungen vertrieben wurde. Das kommt davon, wenn man diese Halbmenschen wie seines Gleichen behandelt, und auch Sie werden es erleben, Miß, daß dieser freche Bube Ihr Verderben wird, wenn Sie ihn nicht zur rechten Zeit in seine Schranken zurückweisen.«
»O nein, nein!« rief Fanny, in deren Seele noch rechtzeitig die Erinnerung dessen auftauchte, was sie ihrem Freunde schuldete, »nein, Noddy wird mir nie verderblich werden; er hat mir mehr als einmal das Leben und mehr als das Leben gerettet. Noddy hat gezeigt, daß er für mich Alles zu wagen bereit ist. Er ist nicht mein Sklave, und auch mein Vater hat ihn nicht gehalten, wie einen Sklaven. Ich bitte, meine Herren, beleidigen Sie Noddy nicht! ... Aber Dich, Noddy, muß ich ebenfalls bitten, Dich nicht durch Deinen Zorn hinreißen zu lassen und durch Deinen
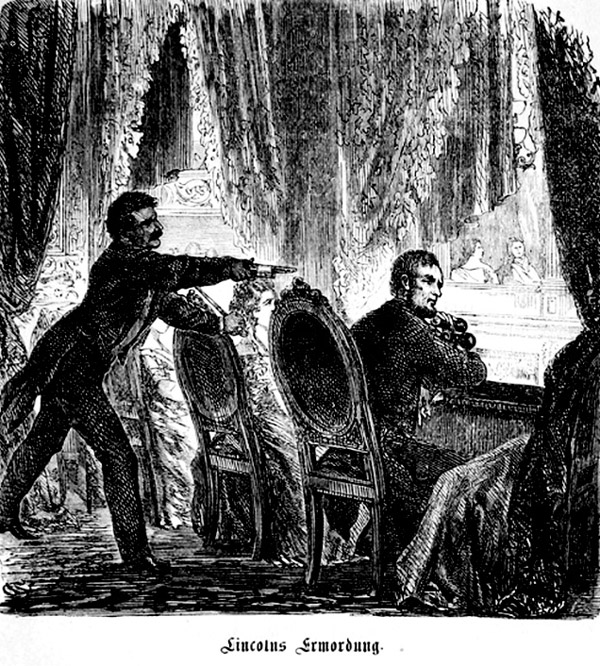
Widerspruch die Freunde meines Vaters zu reizen ... Bitte fahren Sie fort, Mr. Tucker.«
»Ich wiederhole Ihnen, Miß Cleary, daß ich trotz Ihrem Wiederstreben es für meine Pflicht halte, dafür zu sorgen, daß Sie in Charleston standesgemäß leben, und daß Sie des Umganges von Personen Ihres Standes nicht entbehren.«
Für das Erstere sorge ich, Sir, und ich verbiete es Fanny, von Ihnen auch nur einen Cent anzunehmen. Mr. Cleary hat mir die Sorge für seine Tochter übertragen, und ich habe mich dieser Pflicht zu entledigen. – Ich bitte Dich, Fanny, sage den Herren, daß Du keiner fremden Hülfe bedarfst.«
»Noddy!« rief Fanny im Tone des Vorwurfes.
»Ist es Ihnen gefällig,« hob hier Mr. Alston an, »mit uns heute die Oper zu besuchen?«
Noddy blickte Fanny mit Ernst und Spannung in das Gesicht, diese aber vermied es, seinem Blicke zu begegnen, und nach einer Pause antwortete sie, freilich mit nicht ganz sicherer Stimme:
»Noch soeben sprach ich davon, daß ich recht gern einmal die Oper besuchen möchte.«
»Nun,« rief Belle-Boyd, »das trifft sich ja ganz vorzüglich; wir sind eben auf dem Wege zur Oper. Unser Wagen hält vor der Thür – Also kommen Sie, Miß, nehmen Sie ihren Hut und Shawl, weiter ist Nichts nöthig.«
»O, doch, doch!« fiel Noddy ein; »ich lasse Fanny nicht allein. Da ich sie nicht begleiten kann, so wird wenigstens Nettice mitgehen.«
Zehn Minuten später rollte die prächtige Equipage Tucker's über den Platz.
Drinnen saßen Belle-Boyd, Fanny und Nettice, während Mr. Alston und Tucker auf schönen Rennpferden neben dem Wagen herritten.
An der äußersten Ecke des Platzes da stand Noddy. Wuth, Rache, Scham tobten in seiner Brust; und vernichtet und wankenden Schrittes ging er seiner Behausung zu, als der Wagen ihm aus dem Gesichte war.