
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Und was las ich da in den vergilbten Tagebuchblättern? –
1. Juli 1808:
Es ist sehr hübsch, im Ruderboot anzukommen, nachdem man stundenlang in der Postkutsche gerüttelt und geschüttelt wurde. Aber, enfin, auf eine Insel kann man nicht mit Wagen und Pferd gelangen, da muß man sich im Boot dem nassen Element anvertrauen. Aber es war kein Grund zum Fürchten da, zwei galante Kavaliere haben mich sicher hierher geführt, auf die Reichenau, in das Sommerhaus meiner lieben Freundin Caton. Und da bin ich nun. Sehr müde von der Reise, aber sehr glücklich. Glücklich, ich selbst sein zu dürfen, nicht das Stiftsfräulein in Zwang und Etikette.
5. Juli:
Die ersten Tage sind im Flug vergangen und das Glücksgefühl, das mich am ersten Tag erfüllt hat, ist geblieben. Caton ist die gleiche liebe Freundin, das Besitztum ist schön und behaglich, aber das Beste ist doch die Atmosphäre.
Die Menschen selbst gestalten sich die Umwelt zur glücklichen oder unglücklichen, das Innere des Menschen schafft das Glücksgefühl, die Umwelt kann es nur erhöhen, geben kann sie es nie.
Die Menschen hier sind glücklich. Der Doktor Matthias Honsell ist ein aufrechter, tüchtiger Mann, gescheit und voll Humor, liebt seine Caton und trägt sie auf Händen. Caton, die lebendigere, zierlichere, die bis zur Ehe ein schöngeistiges, fast empfindsames Leben geführt hat, die malte und musizierte und konversierte, was ist sie für eine glückliche Frau geworden! Und die beiden Kinder Karl und Josephine sind so gesund und fröhlich. Das Hauswesen ist geordnet und wohlhäbig, und Caton regiert alle – bis auf den Gatten, der ihr immer noch gewaltig imponiert und den sie liebt, wie in jenen Frühlingstagen, als sie von Weimar kam. Und so ist es ein glückliches Haus, in das ich eingezogen, ich arme, glücklose Stiftsdame.
6. Juli:
Gestern abend war ich auf dem besten Wege, elegisch zu werden, und das paßt so gar nicht zu mir, wie die Leute sagen.
Die Sonne hat mich geweckt, sie hat durch die zwei großen Herzen, die in den Laden geschnitten sind, ihre Strahlenbilder auf mein Bett geworfen, zwei Herzen, goldene Herzen – eines würde mir genügen.
Nun sind Läden und Fenster weit offen, das ganze Haus liegt sonnengebadet da. Es steht dicht am Ufer, die Wellen sollen beim Sturm an die Mauern schlagen, drum soll eine Terrasse vorgebaut werden. Einstweilen hat Matthias einen schönen Anbau machen lassen, für seine Frau, wie er sagt. In gutem Empirestil, der jetzt Mode ist. Der große Saal nach dem See, in hellem Grün mit schönen Möbeln, soll Caton an einen Raum im Wittumpalais in Weimar erinnern. Ein großer Vorraum mit einer braunen Eichentreppe gibt das Gefühl behaglicher Weite. Zum alten Teil des Hauses führt ein langer, schmaler Gang, an dessen Wänden lauter Soldatenbilder des badischen Malers Seele hängen. Seele habe ich in Bodman und in Salem getroffen, er ist sehr berühmt geworden und lebt jetzt in Stuttgart. Im alten Teil des Hauses ist's fast noch schöner, heimeliger, gemütlicher. Da ist Catons Zimmer und daneben das Eßzimmer, beide durch einen schönen bunten Kachelofen verbunden. Er stammt aus Steckborn, drüben am Schweizer Ufer, wohl aus dem Jahr 1740. Dort gibt es eine berühmte Kachelofenfabrik, die weit über die Bodenseegegend bekannt ist. Der Ofen hat drei Absätze, da stehen lustige Tonfiguren drauf, die aus Zizenhausen stammen. Und dann hat der Ofen nach der Eßzimmerseite zu eine große eiserne Platte mit dem österreichischen Doppeladler, denn bis 1803 war ja hier alles österreichisch. Ich lerne Geschichte, lebendige Geschichte des Bodensees. Jetzt ist alles hier badisch, der Kaiser Napoleon hat ein Großherzogtum Baden geschaffen und Markgraf Karl Friedrich ist Großherzog. Der Doktor Honsell, mein lieber Hausherr hier, der bis vor kurzem noch Obervogt in Bodman war, ist jetzt auch im badischen Staatsdienst als wohllöblicher Amtmann am hochpreislichen Hofgericht in Konstanz.
7. Juli:
Ich bin gestern unterbrochen worden. Caton rief mich hinaus in den Garten am See, neben dem kleinen Hafen, der durch eine Sandsteinmauer gebildet ist. Dort liegt die Gondel. Hier heißen die Ruderboote Gondeln, und Matthias erzählte eine nette Geschichte, woher das kommt.
Ein Bischof aus Verona hat einmal dem Kloster Reichenau zwei Porphyrsäulen gestiftet. Die Männer, die den Transport ausführten, waren natürlich Italiener, darunter ein blutjunger Bursch aus Venedig. Dem gefiel die Fahrt über die Alpen gar nicht. Aber als er den See sah, war er glücklich, und als er das erste Ruderboot sah, jauchzte er: una gondola, una gondola! Dieser Ausruf gefiel besonders den Kindern und sie übernahmen zuerst das Wort, das man ja fast singen konnte. Dann taten es die großen Leute auch, aber in den alemannischen Kehlen wurde aus gondola Gondele, Gundele – und so heißt es heute noch. – Catons Bruder Eugen meinte zwar, die kleine Geschichte sei nicht historisch.
» Se non è vero, è ben trovato,« lachte Matthias gemütlich. »Vielleicht kommt das Wort auch durch eine andere Beziehung, durch den heiligen Markus.«
»Wieso?« fragte ich neugierig, ich habe es so gern, wenn Matthias Geschichten erzählt. Das tut er immer gern nach dem Essen, wenn man noch gemütlich am Tisch sitzt. Das nennt er »Tischeln«.
»Also wie ist's mit dem heiligen Markus?« fragte nun auch Eugen.
»Ihr wißt, daß sowohl Venedig wie auch Reichenau Gebeine des heiligen Markus haben.«
»O, ich habe den schönen Schrein im Münster gesehen,« rief ich. »Und ich die Markuskirche in Venedig,« brummte Eugen.
»Der Schrein hier ist sehenswert, wie alle unsere Reliquien,« sagte Matthias stolz, »und Venedig möchte ihn, glaube ich, gerne haben. Jedenfalls herrscht bis auf den heutigen Tag ein kleiner Streit der Rivalität. Früher mag er heftiger gewesen sein und da kamen wohl Venezianer persönlich hierher. Anstatt den Schrein mitzunehmen, haben sie das Wort ›Gondola‹ gebracht.«
Mit dem Gondele sollte ich mit Eugen von Seyfried eine Fahrt ans Schweizer Ufer machen. Er hat auch ein Sommerhaus hier, ein reizendes Barockschlößchen, nicht weit vom Honsellschen Gut am See gelegen.
Eugen ist ein eleganter, ritterlicher Mann, nur übersättigt vom Weltgetriebe; er hat im politischen Leben, seit dem Rastatter Kongreß, eine Rolle gespielt. Jetzt hat er sich den Naturwissenschaften verschrieben, ist ein großer Sammler geworden. Er berichtete mir, daß gerade die Naturwissenschaft einen großen Aufschwung genommen habe – ach, ich hätte auf der schönen Fahrt lieber nur über die Natur selber gesprochen, über die Sonne, den See, die Schweizer Berge mit ihren Schlössern – auch über uns selber. Ich bin ja doch ein junges Mädchen, das sich nach Interesse, nach Huldigung – ja, ich gestehe es – nach Liebe sehnt.
12. Juli:
Eugen kommt jeden Tag herüber, immer erfüllt von neuen Entdeckungen und berichtet uns ausführlich. Er richtet seine Worte meistens an mich. Ist es Zufall oder sucht er bei mir Verständnis, oder will er mir gefallen? Ich werde nicht klug daraus und bin doch sonst die kluge Eva; aber – wenn feine Liebesgefühle mitschwingen, hört die Klugheit auf und das Herz will allein reden.
13. Juli:
Wir sollen heute eine große Ruderfahrt machen, den ganzen langen Tag, Eugen und ich. Caton läßt uns viel allein. Ist es nur Zufall? Sie ist viel beschäftigt im Haus und Garten, mit den Kindern, obwohl sie genug dienstbare Geister hat. Dann musiziert sie viel und hat einen regen Briefwechsel. Wie wir alle. Wir schreiben alle viele Briefe, wir leben ja im »Zeitalter der Freundschaft«, wie ich gestern im »Musen-Almanach für 1807« gelesen habe. Freundschaft, Freundschaft, sie ist schön, aber ich, ich sehne mich nach Liebe …
Caton hat die neuen Kompositionen von Goetheschen Gedichten des Komponisten Zelter kommen lassen, wir haben sie gestern gesungen. Die Herren, es war noch ein anderer Bruder Catons, Johann Baptiste, zu Gast gekommen, hörten andächtig zu – auch Eugen –, und seine großen kühlen Augen ruhten oft auf mir. Es war schön.
13. Juli, abends spät:
Nun war ich heute den ganzen Tag mit ihm zusammen. Sind wir uns näher gekommen? Ach, ich war so aufgeschlossen, so bereit und voll Sehnsucht! Und nun sitze ich bei einer Kerze in der stillen Nacht und schreibe, schreibe das Resultat unserer Fahrt und möchte dabei bitter lachen oder bitter weinen.
Wir haben nicht unsere Herzen gefunden, sondern – einen Frosch, einen versteinerten Frosch aus der Tertiärzeit, im Steinbruch von Öhningen!
Eugen war wie berauscht. »Eine Kostbarkeit, eine Seltenheit, etwas Einzigartiges. Die Wissenschaft wird beglückt sein. Eva, Eva, das ist ein wunderbarer Tag! Aber ich darf diesen unerhörten Fund nicht für mich behalten, ich werde ihn dem Britischen Museum in London als Geschenk übersenden. Nun kann ich mein naturwissenschaftliches Werk weiterführen. Eva, Eva, Sie haben mir Glück gebracht!« So redete der kühle, beherrschte Mann, so redete er über einen versteinerten Frosch, und ich, Eva, erschien nur dazu da, ihm zu diesem kleinen Ungetüm verholfen zu haben. –
Und dann hielt er mir einen Vortrag über den Wert des Öhninger Steinbruchs, über die Zeit der Funde, und mir schwirrte der Kopf von Namen wie Tertiär, subtropisches Klima, botanisch-zoologische Beziehungen. Aber dann erfaßte ich doch die Bedeutung, ich war überwältigt von dem Gedanken, daß in diesem stillen Winkel am Ende des Sees uns die Natur aus den Augen von Jahrtausenden anschaut. Es überkam mich ein Gefühl der Ehrfurcht, ja der Demut und Kleinheit vor der schöpferischen Natur, die hier schon einmal eine Wunderwelt des Südens geschaffen, sie dann zerstört und begraben hatte in Eis, jahrtausendelang, und uns nun wieder eine liebliche Schönheit in gemäßigtem Klima geschenkt hat. Ich sprach diese Gedanken aus und Eugen nickte mir zu.
Der Tag stand also unter dem Zeichen des versteinerten Frosches, ich hatte mich damit abgefunden – sollte der Abend nicht unter einem andern Zeichen stehen?
Wir fuhren langsam den Rhein hinauf, und als wir wieder in den breiten See zwischen Berlingen und der Höri kamen, stieg prächtig der rote Vollmond auf. Da fing ich an zu singen, das schöne Goethelied vom Mond. Ich weiß, meine dunkle Stimme klingt gut auf dem Wasser. Solange ich sang, ließ er die Ruder sinken und schaute mich an, und ein weiches Licht schimmerte in seinen Augen. Als ich geendet, sagte er leise: »Wie schön Sie singen, Eva!«
Ach, ich wartete auf eine Antwort, die in die Stimmung des Liedes, des Abends und meiner Sehnsucht passen würde – da sagte er plötzlich wieder kühl und sachlich:
»Goethe! Da habe ich gestern seine Abhandlung über den Zwischenknochen bekommen, sehr neu, sehr interessant, viel umstritten« – und er begann mir die Entdeckung zu erklären. So ging die Fahrt zu Ende – im schönsten Mondschein, im weichsten Zauber der Sommernacht –, und ich hörte den versteinerten Frosch quaken und den Zwischenknochen knirschen – o Liebe! Liebe! – es war doch zum Lachen.
17. Juli:
Sturm! Sturm! – ach ich hätte nicht gedacht, daß dieser friedliche See, der so blau und ruhig zwischen den grünen Ufern lag, so toben könnte! Heute sieht er wild und gefährlich aus, denn ein Weststurm rast drüber hin. Die Wellen können kaum mitschwingen, sie überstürzen sich, sie krallen sich ineinander, schäumen in weißem Gischt und zerschellen am Ufer. Ich könnte stundenlang stehen und schauen, aber der Sturm erfaßt auch mich und raubt mir den Atem. So sitze ich auf einem geschützten Platz an der Ostseite des Hauses und schreibe.
Sturm da draußen, du tobst ja auch in meinem Herzen, plötzlich, ungeahnt. – Ich, die kühle, stolze Eva, das Stiftsfräulein und wohl demnächst domina, ich liebe einen Mann, einen kühlen, selbstsicheren Mann, der vielleicht nicht ahnt, daß ich ihn liebe. Mein Herz, mein ganzes Wesen ist in Aufruhr – wann wird der Sturm sich legen?
20. Juli:
Regentage sind dem Sturm gefolgt. Wir sitzen in der gemütlichen Stube, plaudern und schauen Kupferstiche an. »Wie bei Goethe,« meinte Caton ganz glücklich. Immer wieder spricht sie von dem Besuch in Weimar anno 1800. So stark ist der Einfluß einer großen Persönlichkeit! Ich sprach darüber mit Eugen. Er meinte: »Was wären wir alle ohne Kunst und Wissenschaft? Fast unbewußt nehmen wir sie auf. Die schöne Sprache des Dichters veredelt unsere Sprache, die bildende Kunst lehrt uns die Schönheit von Form und Farbe, und die Wissenschaft befruchtet den Geist.«
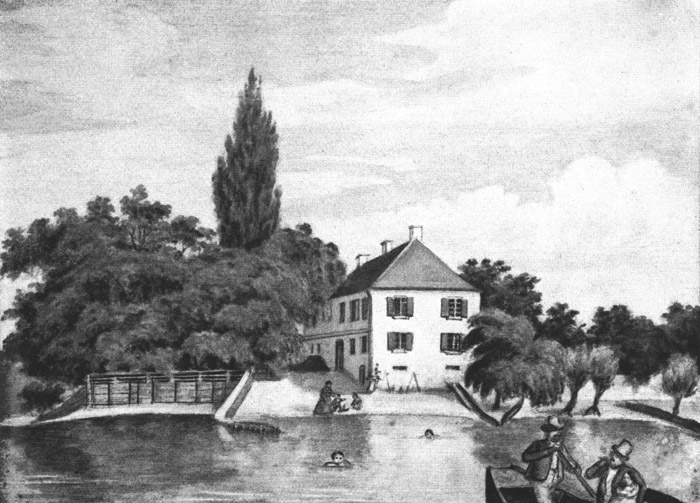
Das Alte Haus auf der Reichenau um 1800
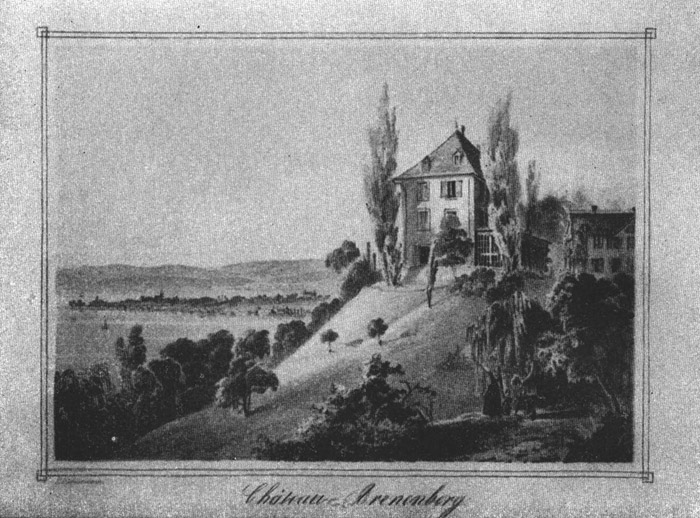
Schloß Arenenberg am Untersee
»Auch die Wissenschaft vom Goetheschen Zwischenknochen?« neckte ich.
»Die erst recht,« rief er, »vielleicht dauert es noch lange – die größte Weisheit dringt am langsamsten durch.« Und nun vertiefte er sich wieder in seine Probleme. Ich Törin! Warum habe ich nicht an die Kunst angeknüpft, die Kunst, die der Liebe geneigter ist als die Wissenschaft – die schreckliche Wissenschaft? –
21. Juli:
Es regnet immer noch. Der See ist bleifarben und spiegelglatt, nur die Regentropfen springen lustig hinein, bilden Blasen und kleine Ringe, die ineinander rieseln. Der Regen auf dem Lande ist schön, er ist ein Geschenk der Natur wie jedes andere, er ist keine Kleiderfrage wie in der Stadt.
Wir haben Besuch gehabt, sozusagen Familienbesuch. Caton hat es nicht leicht mit ihren Verwandten, den Stiefgeschwistern ihres Mannes. Sein Vater war ein Bauer und ein Wirt. Der hat drei Frauen gehabt und Matthias ist der Sohn aus erster Ehe. Aber aus den anderen Ehen sind auch Kinder da, und so gibt es viele Geschwister. Zwei davon, zwei tüchtige Bauersfrauen, kamen heute nachmittag zum Kaffee. Ich hatte ein wenig Angst, denn ich war in meinem exklusiven Leben noch nicht mit Bauersfrauen beim Kaffee gesessen. Aber es ging viel besser als ich dachte, und es war ein sehr gelungener Nachmittag. Draußen klatschte der Regen an die Fenster, dazwischen hörte man das Rauschen der Wellen im Uferkies. Wir saßen um den Tisch, tranken Kaffee und aßen Gugelhupf und Apfeldünne. Caton hatte ihr schönstes Sèvresporzellan herausgeholt, um die Schwestern zu ehren. Und sie empfanden es auch so. Neidlos bewunderten sie alles. Zu mir sagten sie stolz: »Gell, Fräulein von Bodman, bei der Caton ist's schön? Alles städtisch, bei uns ist's bäurisch, wie's für uns paßt, aber auch schön. Wir sind's nicht anders gewöhnt.«
Und als der Bruder Matthias kam, sprach der Stolz über ihren »g'studierten« Bruder aus ihren Reden. Es kam mir zum Bewußtsein, daß die Menschen der verschiedenen Stände gar nicht so weit voneinander entfernt sind, wenn – sie sich neidlos treffen. Darin liegt die Hauptsache. Neidlos und eines das andere anerkennend. Denn wo ist der Unterschied im rein Menschlichen? Wir haben von der Liebe, der Ehe, den Kindern gesprochen und haben uns verstanden. Die Ausdrucksformen sind anders, die Worte sind derber und die Gefühle, die sie aussprechen, sind wohl auch einfacher. Aber was tut das? Ich habe jedenfalls einen lehrreichen Nachmittag erlebt.
Als sie fort waren, nahm Matthias die Hand Catons und küßte sie. »Du hast's wieder gut gemacht, liebste Caton!« Und zu mir gewandt, sagte er mit seinem guten Lächeln: »Caton versteht halt im Verkehr mit meinen Geschwistern alles Verschiedenartige, alles Trennende auszuschalten. Es ist vielleicht nicht immer leicht, aber beide Teile sind guten Willens, und so geht bei uns die Abzweigung eines Familienstammes aus dem bäuerlichen Stand in den studierten friedlich und glücklich vonstatten. Und das sollte immer so sein, denn es ist ein Vorgang, der tausend- und abertausendmal vorkommt. Ich komme mir als Typus vor, und es lohnt sich schon, ein wenig darüber nachzudenken. Mein Vater, ein Bauer, Wirt und Bürgermeister, klug und wohlhabend, schickt den ältesten Sohn auf die Klosterschule, läßt ihn studieren, und so gleitet er in eine andere Gesellschaftsschicht. Dort findet er auch seine Lebensgefährtin, die vielleicht schon einige Generationen länger darin steht, denn einmal war auch ihre Familie bäurisch – ja, Caton, schau mich nur so verwundert an, auch deine Ahnen waren einmal Bauern und – sei nicht bös, Liebste! – Euer Adel ist ja nicht so sehr alt.«
»So,« sagte Caton sehr pikiert.
Darauf Matthias: »Katharina von Seyfried – vielleicht kommt dein Name von: Sey friedlich. So sei es auch!« Und er streckte ihr über den Tisch die Hand hin, in die sie die ihre lachend und versöhnt hinein legte. Man kann dem Matthias nicht bös sein, und ich kann Caton so gut verstehen, daß sie ihn so innig liebt.
Dann hatten wir noch ein langes Gespräch, das mich sehr interessierte und das ich hier festhalten möchte. Matthias fuhr, zu mir gewandt, fort: »Auch aller Grundherrnadel hat den gleichen Ursprung. Hier, unser lieber Gast Eva von Bodman ist ja eine Vertreterin des Uradels am See. Die ersten Sprossen dieses Geschlechts waren wohl besonders starke Söhne eines mächtigen Sippenführers. Der hatte das meiste Land, das er auch im Anfang mit ihnen selbst bebaute. Dann aber holte er sich Hilfskräfte, und er selber und die Söhne ergriffen das ritterliche Handwerk des Schutzes der Sippe, das Kriegshandwerk, das sich dann zum Zweck der Besitzerweiterung entfaltete. Denn am Grundbesitz hielten sie als Herren fest. – Und die Könige? Glaubt ihr, daß sie gekrönt vom Himmel gefallen sind?«
»Darüber habe ich wirklich noch nie nachgedacht.« Auch ich mußte das zugeben.
»Seht ihr, wie gut es ist, daß man über solche Fragen nachdenkt? Und daß wir es tun, das hat uns die französische Revolution gelehrt: die Menschen und ihre Rechte gleich zu werten. Natürlich müssen sie ihren Wert selbst beweisen, und der wird immer verschieden sein. Aber die Möglichkeit, ihn zu beweisen, ist gegeben. Glaubst du, Caton, dein Vater, der hochwohllöbliche Kanzler der Abtei Salem, hätte dem Bauernsohn von der Reichenau sein entzückendes, geistreiches, hochgebildetes Töchterlein zur Frau gegeben, wenn nicht der frische Wind von Westen ihm die Vorurteile über den ungleichen Wert der Menschen weggeblasen hätte?«
»So lassen Sie den sogenannten ersten Stand, den Adel, nicht gelten?« fragte ich.
»Aber gewiß lasse ich den Adel gelten. Die Fürsten und Grundherren haben durch Jahrhunderte in ihrer Geschlechterfolge bewiesen, daß sie tüchtige Vertreter hatten, sonst wären sie schon lange verschwunden. Auch die mit dem Adelsprädikat ›von‹ haben es sich durch persönliche Verdienste erworben, als Soldaten und Beamte. Aber ich meine, heute gehört der Adel schon mehr zum bürgerlichen Patriziat, das der Träger der Kultur ist. Es beginnt die stärkste Schicht im Volk zu sein, die führende Schicht, die es immer geben muß, und die gerade vom Bauernstand anerkannt wird. Ich hoffe, auch ich und meine Nachkommen werden dazu gehören,« schloß er stolz, »dank meiner Caton, die als Frau die Hüterin der Familientradition ist.« Und er küßte galant die Hand seiner geliebten Caton.
Das Gespräch war mir sehr wertvoll und gibt mir viel zu denken.
1. August:
Meine Ferien neigen sich dem Ende zu, und – meine Sommerliebe ist ohne Hoffnung auf Ernte im Herbst. Ich werde gehen und weiterleben als Stiftsfräulein. Aber ich möchte diese Wochen nicht missen mit ihrem Inhalt an schmerzlichem Glück, an starkem, leidenschaftlichem Fühlen. Ist das nicht Gewinn, wenn ein Mensch, der im matten Trott des Alltags dahin lebt, aufgerüttelt sich aufschwingt zur höchsten Höhe? So fühle ich meine Liebe und so nehme ich die Erinnerung mit. Ich sage nicht mit Dante: nessun maggior dolore – kein größerer Schmerz, als sich im Unglück glücklicherer Zeiten zu erinnern. Ich habe diesen Vers nie leiden können; ich sage mit Goethe: Das ist das Schöne eines starken, reinen Gefühls, daß ein Hauch der Ewigkeit uns umweht, – und ich selber sage zu meinem Herzen:
Nimm dich in Acht, mein Herz, mit deinem Überschwang!
Du klopfst zu heiß
und bietest alle Wärme dar,
von der das andere Herz nichts weiß.
Nimm vor der Liebe dich in Acht, mein Herz!
Sie kommt so leis',
erfüllt dich ganz und macht dich unbedacht
und gibt den Reichtum deiner Seele preis.
Nimm dich in Acht, mein Herz, mit deinem Liebesschlag!
Wer weiß, wer weiß,
vielleicht schlägt jenes andere kühle Herz
schon lang um einen andern Preis.
Droht dir ein Leid, mein Herz? – O nein!
Hör nicht darauf, mein Herz, mit deinem Überschwang
und klopfe heiß!
Denn Liebe fühlen ist dein höchstes Glück,
wenn auch das andere Herz davon nichts weiß.
Aber die Tagebuchblätter nehme ich nicht mit. Sie in meinem Schreibtisch zu wissen, sie immer lesen zu können, geht über meine Kraft. Und dann: was haben Liebesgeständnisse in einem Damenstift zu tun? Oder vielleicht gerade? Wie viele Liebende sind wohl hinter solchen Mauern? Wohl viele, viele. Und sie sind trotzdem die Glücklichen, denn ich glaube, die Liebende ist glücklicher als die Geliebte. Für sie ist die Liebe das Schöpferische. Die Qual der Geburt ist die Enttäuschung über den Geliebten; aber dann hält sie ja die Liebe im Arm, ihre Liebe, die ihr ganz allein gehört, die sie zur mütterlich fühlenden Frau macht. Was weiß der Mann von alledem? Und was weiß der Geliebte dieser Wochen davon? Armer Mann, wohl war dein Interesse für mich erwacht, ich fühlte es; aber dir fehlte der Schwung, die Kühnheit zur Liebe, du kamst nicht aus Bedenken und Prüfen heraus. Nun leb wohl! Und sei bedankt trotz alledem, denn du hast mich einmal zum Blühen gebracht! …
Nun weiß ich, wohin ich die Blätter lege. Zu den welkenden Rosen in die Potpourrivase, die ich Caton mitgebracht habe. Wenn ich wiederkomme, vielleicht in zwei Jahren, dann werde ich sie wieder lesen – und werde lächeln können.
*
Es war fast heller Morgen, als ich die Blätter traurig beiseite legte. Sie ist nicht wiedergekommen, die klare und aufrichtige Schreiberin, sie ist gestorben nach kurzen zwei Jahren, so steht es auf der Rückseite des Bildes. Warum so früh?
Und der Mann fuhr inzwischen nach London und verehrte dem Britischen Museum den versteinerten Frosch. Der liegt in einer Vitrine und drunter steht: rana seyfriedi.
Und jeder von der Familie, der nach London kam oder noch kommt, betrachtet sich den Frosch und hört, daß er sehr wertvoll ist, und daß man dem Geber sehr dankbar ist und seiner ehrend gedenkt.
Aber an die Gefährtin beim Finden denkt niemand mehr.
Geheiratet hat der Geheimrat von Seyfried nicht. Er sammelte weiter, schrieb gelehrte Bücher, verbrachte den Sommer auf der Reichenau im Seyfriedschen Schlößle und baute im Jahre 1838 das Lusthäuschen auf der Anhöhe der Insel, das heute noch steht und die Hohwart heißt. Es ist der schönste Punkt der Insel. Weit nach allen vier Himmelsrichtungen kann der Blick wandern, aber am schönsten ist eine Sonnenuntergangsstunde dort droben.
Im alten Schreibpult habe ich ein vergilbtes Blättchen gefunden, mit den gleichen Schriftzügen bedeckt wie die Blätter des Tagebuches, und es soll hier noch aufgeschrieben werden. Denn der Platz des Lusthäuschens Hohwart, das Eugen von Seyfried erbaute, hatte Eva von Bodman schöne und trostreiche Gedanken gebracht, die sie niederschrieb und ihrer Freundin Caton schenkte.
Ihrer geliebten Caton
an einem Sommerabend!
Ich stehe auf der Höhe und schaue in die Sonne, in den leuchtenden, glühenden Sonnenball, der dort drüben über den Hegauer Bergen hängt.
Breit, glitzernd und gleißend liegt der Widerschein auf dem See.
Wohin ich schaue, Glanz und Glut.
Ich habe in die Sonne geschaut, und meine Augen haben ihre Feuergarben zu Kränzen gewunden. Und wie ich mich wende nach dem Tal, das schon im Schatten liegt, da hängen überall leuchtende Kränze, Sonnenkränze, die meine Augen gewunden aus den Strahlen des versinkenden Sonnenballs.
Und meine Augen schmücken mit gebender Lust die dunkelsten Winkel des Tales mit jenen Kränzen des Lichts …
O Sonne, Sonne – Lebenssonne! Laß meine Seele deinen Glanz erfassen, daß auch sie Kränze winde aus deinen Strahlen, daß sie die dunkeln Stunden damit schmücke.
Und die dunkeln Stunden werden umstrahlt sein wie das Tal vor mir im Abendgrauen!
Im August 1808.
Eva.
Immer, wenn ich heute hinauf wandere auf die Hohwart zum Sonnenuntergang, denke ich an diese poetischen Worte, die soviel Trost enthalten.
Und ich denke auch an den Erbauer des Lusthäuschens, meinen Urgroßonkel, der soviel Schönheitssinn, soviel Wissen besaß, und dem doch das Beste fehlte – die Liebe!