
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
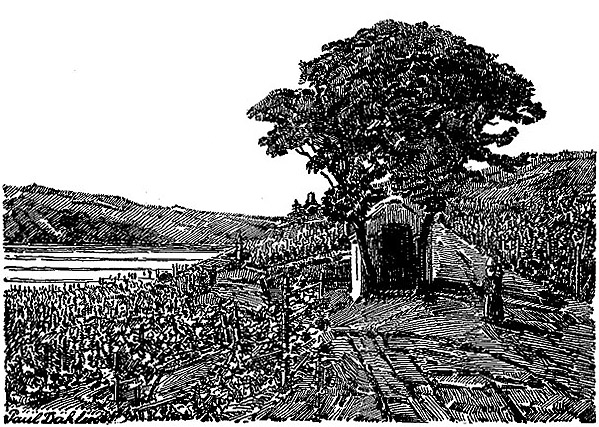
P. Dahlen, Markuskapelle bei Lorch.
Der Rheingauer Humor hat seine besondere Färbung, die ihn von dem Berliner, Mecklenburger, süddeutschen und niederrheinischen Humor merklich unterscheidet. Nicht als ob er an den feinen Duft und süßen Hauch der Nebenblüte erinnerte. Im Gegenteil. Drastische Bilder, derbe Vergleiche und die scharfe Beimischung von Witz oder spöttischer Satire geben ihm seine urwüchsige Eigenart, die sich um so weniger begriffsmäßig abgrenzen läßt, je charakteristischer sie sich in Wortwahl, Tonfall, Mienen und Handbewegung darstellt. Ich habe oft Wortgefechte und Neckereien angehört, die ihren vollen Reiz erst durch das schelmische Mienenspiel und die sprechenden Gebärden der Beteiligten empfingen: sie wirkten wie lustige Texte mit treffendem Bilderschmuck. Zur Zeit, als in Mainz die Rheinhalle gebaut wurde, fuhr ich auf dem »Kaffeemühlchen« (so nannte man den kleinen Trajektdampfer, der zwischen Mainz und Biebrich kreuzte) über den Rhein. In meiner Nähe plauderte ein mir bekannter Winzer aus Geisenheim mit einem riesigen Metzger, der an seiner schwarzseidenen Ballonmütze und dem blauen Kittel als solcher kenntlich war und sich durch seine Sprache als Mainzer auswies. Auf die Frage des Landmanns: »Was is denn das do driwwe for e neu Baajes (Gebäude)?«, antwortete der Metzger:
»Das wißt Ihr nit? Das gibt e Narrehaus, for die verrickte Bauern eninn ze stecke.«
»Aah ... soo ...«, war die schlagfertige Antwort. »Ich hatt' mer doch gleich gedenkt, daß das for die Meenzer nit groß genug wär.«
Als im Jahre 1866 das Herzogtum Nassau preußisch wurde, waren die Rheingauer nicht wenig erbost auf die norddeutschen Eroberer. Eine Gesellschaft von Rüdesheimern setzte in einem Kahn von Bingen her über den Rhein. Es wurde natürlich politisiert und weidlich auf die Preußen geschimpft. Ein Schlaukopf warf die Frage auf, wo denn das Wasser noch Hessisch sei und wo es anfange, preußisch zu werden? »Das is doch leicht zu finne«, bedeutet ihm sein Nebenmann. »Halt' de Finger ins Wasser un riech als emol dra(n), dann inertste gleich, wann 's preißisch is.«
Am 22. März 1867 wurde zum ersten Male Königsgeburtstag gefeiert. Am Schluß des Festgottesdienstes in der Rüdesheimer Pfarrkirche sang der Geistliche das vorgeschriebene Gebet: Domine salvum fac regem nostrum Guilelmum (Schütze, o Herr, das Leben unseres Königs Wilhelm), worauf von der Orgelbühne herab ein klingender Tenor antwortete: Et libera nos a malo (und erlöse uns von dem Übel). Eine gerichtliche Untersuchung blieb ohne Ergebnis.
Wie auf ihren Wein, so sind die Rheingauer stolz auf das prächtige Geläute ihrer Glocken. Voll dröhnen sie von Ort zu Ort und rufen einander feierlich zu: vinum bonum, bonum vinum. Die überrheinischen Glocken aber verraten nach der Ansicht der Rheingauer durch ihren dünneren Klang die geringere Qualität der hessischen Weine. Daher ihr gellender Ruf: Bembelwei(n), Bembelwei(n), Bembelwei(n). Und »über der Höhe«, d. h. tiefer im Taunus, wo gar kein Wein wächst, da tönt es wie spöttisches Lachen vom Kirchturm herab: »Heb' 's Hemd uff, klopp hinne druff.«
In den Jahren vor 1866 tobte heftig der Wahlkampf durch das Herzogtum Nassau. Dem langjährigen konservativen Volksvertreter Bürgermeister Fuchs in Caub erwuchs ein gefährlicher Gegenkandidat in dem Führer der Fortschrittspartei Rechtsanwalt Dr. Braun aus Wiesbaden, der später auch in den Berliner Parlamenten eine Rolle gespielt hat. Besonders eifrig und gehässig wurde Fuchs in Caub selbst bekämpft und angefeindet. Auf einem Feldweg begegnet ihm ein Bauer mit einem Ochsenwagen. »Hott, Bräunche, hott«, drängte der Fuhrmann das hellgelbe Zugtier zur Seite. »Gelt mei(n) Öchsche, das paßt der nit, daß ich dich umgedaaft (umgetauft) hawwe, awwer 's muß halt sei(n); jetzt heeßt de Braun, du host lang genug Fuchs gehaaße.«
»Alle Rheingauer hawwe ihr eige Schenie«, sagt der Volksmund.
Wer dorch Geisenem kimmt ohne geroppt (gerupft),
Un dorch Gehannsberg, ohne gefoppt,
Un dorch Hallgarte ohne dodgeschlah(n),
Der kann von Glück sa(n).
Die Geisenheimer sin Krakehler, die Gehannsberger utze gern und die Hallgarter sin grob wie Bohnestroh; das sin schon halwe »Überhöhische« (d. h. vom Gebirg).
Das Urteil über die Hallgarter wird denn auch bestätigt durch die sprichwörtliche Redensart: »Zahnweh un e Fraa vun Hallgarte, das sin zwaa beese Iwwel (Übel).«
Mcht viel besser kommen die Kiedricher weg. Auch sie galten gewissermaßen als »Überhöhische«. Sie bildeten sich auf ihre Birnenzucht fast ebensoviel ein wie auf ihren Kirchenpatron, den hl. Valentinus. Sie kelterten Birnenmost und kochten aus Birnen und süßem Runkelrübensaft ein Mus (Latwerge) zum Brotaufstrich. Man dichtete ihnen daher das »Nationallied« an:
Wer esse Beern (Birnen)
Und trinke Beern
Un henn aach Beern
Ufs Brot ze schmeern:
Vivat Lakwaari (Latwerge).
Die Bewohner der einzelnen Ortschaften haben ihre besonderen Spitznamen. So heißen die Johannisberger »Schlappehanjer«, die Geisenheimer »Spätzer«. Grund und Bedeutung dieser Benennungen ist mir unbekannt. Wenn aber die Rüdesheimer als »Struntzer« (Prahler) und die Eibinger, in deren Dorf ein kleiner Weiher oder Entenpfuhl liegt, als »Puhlschi.. er« bezeichnet werden, so ist das zwar recht derb, aber verständlich. –
Ein Stückchen humorvoller Gemütlichkeit erlebte ich im November des gesegneten Weinjahres 1865, da ich spät vom Geisenheimer Katharinenmarkt heimwärts ging. Eine Unmenge von Schoppen des »federweißen« Bizzlers (gärender Most des Fünfundsechzigers, den sie Bizzler nannten) war getrunken worden. Vor mir her schwankten im fahlen Sternenlicht Arm in Arm die Gestalten des Vetters Vinzenz und eines anderen Nachbars. Ich hielt mich im Fahrwasser der beiden Alten, natürlich ohne ihren Zickzackkurs mitzumachen, und lauschte mit bubenhaftem Vergnügen ihrem weinseligen Geplauder. »Gewwe Se acht, Nachher,« warnte Vetter Vinzenz, »mer müsse mehr rechts gehe; wenn mer nit aufpasse, falle mer in de Chausseegrawe.«
»Gott bewahre, Vetter Vinzenz, mer gehn jo so hibsch in de Mitt; eher mein ich, mer müßte uns e bißche mehr links halte.«
Der Nachbar behielt das letzte Wort, und nach wenigen Schritten stolperten die Zecher über den linken Straßenrand hinunter und legten sich sanft in den feuchten Graben.
»Ei, ei, ei«, meinte gottergeben Vetter Vinzenz. »Do hawwe mersch.«
»Guck emol do«, lautete die freundliche Antwort, »Sie hawwe recht behalte; mer liege richtig drinn!«
Während der Johannisberger Mission in den sechziger Jahren war scharf gegen das Fluchen und Schwören gepredigt worden. Wie viele andere, so war auch der alte Schloßjosep, ein fürstlich-metternichscher Fuhrknecht, von Reue tief ergriffen. Nach beendigter Andacht hörte ich ihn vor der Kirchentüre seine guten Vorsätze in folgende Form kleiden: »Der Deiwel soll mich lotweis hole, wenn ich noch emol fluche. Wahrhaftig, ehnder soll mich en Himmelkreizmillionedunnerwetter in Grunderdsboden enei(n) schla(n), als daß ich noch en aanziges Mol fluche tat.«
In Winkel lebte ein sehr ungleiches Ehepaar. Er war klein, schmächtig, zaghaft, sie eine bäuerische Semiramis, stark, schaffig, über die Maßen herrschsüchtig und gewalttätig. Wieder einmal gab es einen häuslichen Auftritt, dem die Nachbarn mit boshafter Freude zuhörten. Mit lauter Stimme schilt die Frau: »Ob de gleich hergehst, du Schmachtlappe, du Has', du Ferchtlies ...« Aber entschlossen piept das Männchen dagegen: »Naa, ich kumm nit, du bees Fraa. Ich werd' mich doch noch vor dir ferchte derfe!« Und ein lautes Beifallsgelächter der Zuhörer billigt dem Geängftigten das bescheidene Recht zu, das er beansprucht.