
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Die während des spanischen Feldzugs Napoleons zu den Engländern übergegangenen Herzoglich Nassauischen Truppen waren von diesen nach Plymouth übergesetzt worden. Die Transportflotte, die sie nach den Niederlanden befördern sollte, wurde vom Sturm zerstreut, wobei zwei Schiffe auf der Haalsbank, einer großen Sandbank der Nordsee, scheiterten.
In der Nacht des 8. Februar 1814 morgens um 2 Uhr schlug uns der Sturm gegen die Seeküste Haxt nicht ferne von Texel. Ein fürchterliches Getöse des Schiffes von unten und ein ungewöhnliches Schwanken kündigte uns etwas Außergewöhnliches an. Der Schiffskapitän, der bisher immer noch seine Seekarte, seinen Sonnenzirkel und Kompaß, soviel es beim Sturme möglich war, zur Hand hatte, sagte: »Meine Kinder, wir sind verloren; wir sitzen zwischen zwei Felsen. Der Rum ist freigegeben.« Er brachte selbst Krüge und Flaschen. Das Lamentieren, das auf dem Schiffe herrschte, wird mir nie aus den Ohren gehen. Bisher hatte ich als geborener Schiffer den Matrosen auf dem Verdecke geholfen, war also von den überschlagenden Wellen ganz durchnetzt. Ich lief sogleich nach meiner Hangmatte, schnallte meinen Tornister auf, wechselte meine blaue leinene mit meiner Ordonnanzhose, weil es mich außerordentlich fror. Ich fühlte den Boden unter mir sich mit fürchterlichem Krachen heben.
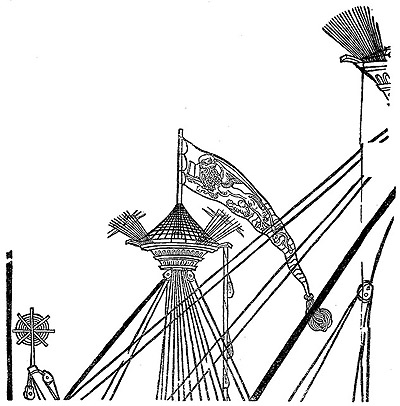
Venetianischer Dreimaster. Nach einer Holztafel in der Landesbibliothek zu Wiesbaden. (Ulm 1500.)
Die Fässer mit süßem Wein gefüllt, die sich im unteren Teil des Schiffes befanden, drückten, von dem mit Gewalt durch das zerquetschte Schiff eindringenden Seewasser gehoben, unter dem schrecklichsten Getöse entzwei. Ich eilte, was ich konnte, mit den sich noch hier befindlichen Kameraden auf das Verdeck. Das erste, was ich erblickte, war unser zweites Schiff, das in dem nämlichen Augenblicke mit Mann und Maus in einer Entfernung von zwei Flintenschüssen vor uns unterging. Nun befahl der Kapitän, zur Erleichterung den hintern Mast abzuhauen und die schon zerrissenen Segel herunterzunehmen. Alles geschah nach Order. Während dieser Arbeit schlugen die Wellen schon viele von uns ins Meer. Das Schiff ward durch die anlaufende Flut öfters flott und gehoben und senkte sich bei der Ebbe mit solcher Gewalt, daß es, so stark es auch war, endlich in der Mitte brach.
Auf dem gewölbten Verdeck des ohnehin wankenden und seitwärts liegenden Schiffes war es sehr mühsam, sich zu erhalten, besonders da die Nebengeländer schon zerbrochen waren. Von dem mit fürchterlicher Gewalt schwankenden Steuerruder sah ich viele meiner Kameraden ins Wasser geschleudert. Zwei Boote, die auf den englischen Schiffen aus dem Verdeck für den Fall der Not befestigt sind, nun von dem Sturm von ihren Seilern abgelöst und hin und her rollend, ergriffen und zermalmten den Herrn Leutnant Groß in dem Augenblicke, als er zu uns an den vorderen Mast eilen wollte. Da nun das Schiff durch die eingedrungene Masse Wasser völlig zu sinken drohte, und man keinen trockenen Fuß mehr auf das Verdeck setzen konnte, suchte die noch übrige Mannschaft ihre Rettung an den Seilern um den Mastbaum, doch mußten die Zeitpunkte, die die Wellen ließen, hier benutzt werden, welche jene, die weniger vorsichtig waren, verschlangen und ins Meer schleuderten. So sah ich unsern Schiffskapitän in dem Momente, als er zu uns an den Mast sich retten wollte, von den Wellen ins Meer geschwemmt. Ebenso verschlangen in meinen Augen die überschlagenden Wogen mehr als hundert meiner Kameraden, als sie sich zu uns an den Mast flüchten wollten. Hier waren nun die Verzweifelnden des ganzen Schiffes auf einem Punkte versammelt. Es waren ihrer ohngefähr noch hundert an der Zahl. Was den Mastkorb zuerst erreichen konnte, stürmte hinauf und saß oben gedrängt und glaubte sich geborgen. Da der ganze Mastbaum aus zwei aufeinander gesetzten Bäumen bestund, kann man die Höhe desselben mit der Höhe unsrer Kirchtürme vergleichen. Er ist mit armsdicken Seilern rundum festgehalten. Zwischen diesen Seilern sind Stufen angebracht, auf welchen die Matrosen zur Regulierung der Segel und in den Mastkorb auf- und absteigen. Diese Seiler, diese Stufen hingen voll von Menschen. Pechfinstere Nacht war es, der Sturm heulte immer so, daß mancher weniger Kräftige von den Seilern ins Meer geschleudert ward. Der Nordwind wütete hier mitten im Wasser so heftig und war so kalt, wie man ihn auf dem festen Lande nie fühlt. Wir wollten früher Notschüsse tun, da wir wußten, daß wir nur zwei Stunden von der holländischen Grenze entfernt waren; allein die Wellen hatten das Pulver unsrer Kanonen alle durchnetzt. Jetzt wollten die Offiziere auf dem Mastkorb ein Notfeuer machen. Man rief nach Zunder; jeder durchsuchte die Tasche und fand dessen; allein er war naß, so auch der meinige. Wir harrten also, mit Sturm, Kälte und den schrecklichsten Gefühlen kämpfend, des Tages. Er kam, aber welcher Tag! Es war der 9. Februar. Die Sonne ging freilich auf, allein wir sahen sie nicht; eine matte Dämmerung ließ uns vermuten, daß es Tag sei. Ein duftiger, mit dem stärksten Reif durchwirkter Nebel hatte die ganze Wasserfläche umhüllt. Wie der Reif in Wintertagen an den Bäumen hängt, so waren unsre Haare und unsre Montur weiß und steif mit Reif überzogen. Meine Haare waren an den Kragen angefroren, daß ich kaum den Kopf drehen konnte. Hier stand ich nun (denn ich hatte noch das Glück, eine Schiffsleiter zu erreichen) unter vielleicht hundert meiner ebenso elenden Kameraden. Keine andere Bewegung konnte ich mir machen, als immer mit den Füßen auf der Staffel zu trappeln, um nur das Gefühl in denselben zu behalten. Doch gab's nach den ersten vierundzwanzig Stunden Luft in den Seilern: teils fielen die mehrsten erfroren herunter. So mußten wir meinen Kameraden, den guten Brückmann aus Frauenstein (es schaudert mir noch die Haut, wenn ich daran gedenke), der ober mir auf der Leiter stand, ganz erfroren überschlug und an den Füßen hängen blieb, losmachen, damit er ins Meer fiel, und wir mehr Raum zur Bewegung erhielten. So hörte ich auch den 9. Februar gegen Abend den Herrn Leutnant von Krift, der nur in den Seilern hing und dieselben mit den Füßen umklammerte, zu dem Oberleutnant v. Goedecke sagen: »Lieber Goedeck, ich kann nicht mehr; komm mit, ich stürze mich hinunter.« »Ach, hätte ich nur ein Pistol,« entgegnete dieser, »da unten geht's zu lange zu.« In diesem Augenblick ließ Herr v. Krift die Hände gehen, stürzte sich hinunter, und wir sahen ihn nicht mehr. Wenige Stunden hernach fiel Oberleutnant v. Goedeck, von dem Froste erstarrt, auch ins Wasser. So hörte ich in der Nacht vom 9. auf den 10. sehr viele, die vom Froste einschliefen oder sich nicht mehr halten konnten, ins Wasser fallen. Ich dachte: so wird es dir auch gehen. Ich zeichnete die vier Buchstaben I.N.R.I., die mich ein alter Kriegsmann gelehrt hatte, und welches ich bei keiner gefährlichen Lage ausließ, auf die Stirne und befahl mich Gott.
Die Sonne des 10. ging ebenso düster und ahnungsvoll auf als am 9. Der Sturm wütete immer noch; die Kälte ward noch heftiger. Der Wind hatte meine Kappe ins Meer gejagt. Zum Glück fand ich noch ein Tuch in meiner Tasche, das ich mir mit einer Hand um den Kopf band. Dies hätte mich bald mein Leben gekostet, indem ich mich mit der einen erfrorenen bloßen Hand (Handschuh hatte ich keine) nicht fest genug gegen den Sturm halten konnte. In dem Augenblick fiel ein Erfrorener, der drei Staffel ober mir stand, mit solcher Heftigkeit auf meine linke Schulter, daß ich schier gleiches Schicksal mit ihm gehabt hätte, nämlich ins Wasser zu stürzen. Dieser Unglückliche war der Korporal Andre.
Gegen 3 Uhr nachmittags verlor sich der Nebel, und wir sahen den Helter auf dem Texel, sahen auch die französische Flotte in dem Hafen und bemerkten, daß man uns auf dem allda errichteten Telegraphen lorgnierte. Sogleich wurden alle weißen Tücher gesammelt, die sich bei der noch lebenden Mannschaft befanden, und zum Zeichen des Pardonbittens und unseres Unglückes an die Spitze des Mastbaumes gebunden. Sogleich liefen mehrere Boote zu unserer Hilfe aus, allein das Treibeis, das vielleicht aus der Oder oder Elbe an der Küste des Baltischen Meeres trieb, vereitelte die Absicht dieser guten Menschen. Es ward zum drittenmal Nacht, ohne daß ich seit dem 8. einen Bissen Brot oder einen Trunk Wasser über meine Lefzen gebracht oder für meine Füße einen anderen Standpunkt hatte, als jenen, den ich am 8. mit vieler Mühe vor meinen Kameraden eroberte.
Eine fürchterliche und gräßliche Nacht brachte ich zu. Das Ächzen und Jammern meiner noch halb lebenden Kameraden um mich herum, die sinkende Kraft in meinen Händen und Füßen brachten mich zur Verzweiflung. Ich zeichnete die 4 gemeldeten Buchstaben auf meine Stirne und dachte: ach, wäre es nur überstanden.
Auch diese schreckliche Nacht (dank der gütigen Vorsehung und meiner Natur!) hielt ich aus. Die Sonne ging zum drittenmal auf. Viele von uns sahen sie nicht mehr aufgehen; denn als ich bei der Morgendämmerung die Staffel und Seiler betrachtete, waren sie meistens leer. Die guten Kameraden waren erfroren und lagen im Wasser. Mein halbtoter Blick war nur immer nach der Gegend gerichtet, wo ich gestern das Boot auf uns zufahren sah. Es war ein heiterer Wintermorgen, zwar nicht weniger kalt als die vorigen Tage; doch erquickte mich der Anblick der Sonne und das nahe Land. Das Bedürfnis der Natur meldete sich bei mir; jetzt fühlte ich, daß ich in drei Tagen nichts gegessen und getrunken hatte. Wie erwünscht war mir also der Anblick eines Mehlfasses, das sich aus dem untern Teil des Schiffes durchgebrochen hatte und nun oben schwamm. Ich rief meinen noch wenig lebenden Kameraden zu und zeigte ihnen den glücklichen Fund. Wir strengten das noch übrige bißchen Lebensart an, um dieses Faß (jetzt unser größter Reichtum) mit Seilern zu befestigen. Es gelang uns. Wie bald war es aufgeschlagen! Gierig verschluckten wir das halbdurchnetzte Mehl.

Erich Nikutowski, Pfalz bei Kaub im Winter
Jetzt schlug die Stunde zu unserer Errettung. Mit dem frühesten Morgen sah ich schon 6 bis 8 Boote am Helter sich durch das Treibeis arbeiten. Endlich waren sie um 12 Uhr in der freien See. Gegen zwei Uhr gelang es einem Boote, die Flanke unseres versenkten Schiffes zu erreichen. Allein hier war es wegen der schlagenden Wellen nicht möglich, zu halten; es mußte sich unter das Bugsprit arbeiten, welches noch ein wenig außer Wasser stand. Hier krochen wir nun, so gut wir konnten, und es unser erfrorener halbtoter Körper erlaubte, aus dem Mastkorb, von den Seilern und Leitern einzeln herunter; denn mehr als einen Mann konnte wegen der noch immer heftig schlagenden Wellen das Boot nicht aufnehmen. Waren wir nun an den Seilern heruntergerutscht, so ließen wir uns entweder in dasselbe fallen, oder die Matrosen hoben uns hinein. Dieser Transport von 3 Offizieren, 26 Gemeinen und 8 Matrosen, die von ohngefähr 200 Mann, welche eingeschifft worden waren, noch übrig blieben, währte von 2 Uhr bis in die Nacht. Gegen halb fünf Uhr landeten wir an einem Dorfe auf dem Texel, dessen Name ich nicht mehr weiß. Hier hatten die guten Menschen schon alles zu unserem Empfang und unserer Verpflegung vorbereitet. Jene von uns, die nicht gehen konnten, wurden von diesen menschenfreundlichen Leuten getragen. Man brachte uns in mehrere Häuser dieses Dörfchens. Ärzte und Chirurgen waren schon da. Viele Bütten mit Wasser und Eisschollen darin standen in der Reihe herum. Wir wurden ausgezogen und mußten Hände und Füße, überhaupt alle verfrorenen Teile unseres Körpers in dieses Eiswasser stecken. Dies Gefühl und diese Pein kann ich mit nichts in der Welt vergleichen. Solche Schmerzen hatte ich auf meiner Leiter in den dreimal vierundzwanzig Stunden nicht ausgestanden.
Nur ein wenig Tee und Biersuppe erlaubten uns anfänglich die Ärzte. Da wir in diesem kleinen Orte zerstreut lagen, verlangten dieselben, daß wir der bessern Pflege wegen näher zusammengebracht wurden, und so wurden wir auf Karren nach dem Städtchen Burg auf den Texel gefahren. In einem großen Gebäude (ob es das Rathaus war, weiß ich nicht) wurden wir einquartiert. Der Sergeant Lebrecht aus Erbach und ich kamen in ein Bett. Wir beide, sowie die ganze Mannschaft mußten dem dortigen Maire oder Bürgermeister (sein Name ist mir entfallen) die Lobrede vor der ganzen Mannschaft halten, daß er sich alle Mühe gab, uns wohl zu verpflegen. Heil und Segen ihm, wenn und wo er noch lebt!
In diesem Städtchen blieben wir drei Wochen, bis wir so weit hergestellt waren, daß wir weiter transportiert werden konnten. Von hier wurden wir ins Hospital nach Alkemar eingeschifft. Allhier verweilten wir bis zu unsrer gänzlichen Herstellung und wurden alsdann nach Herzogenbusch gebracht. Hier ward ich aufs neue krank und kam ins Hospital. Meine Kameraden führte man nach Mastricht, wo sie visitiert und die mehrsten als zum Dienst untauglich erklärt wurden. Nach meiner Herstellung mußte ich ebenfalls nach Mastricht, wo ich auch dienstunfähig erkannt ward, meinen Abschied erhielt und nach meinem Vaterland zurückkehrte, wo ich den 11. April 1814 bei meiner guten Mutter ankam.
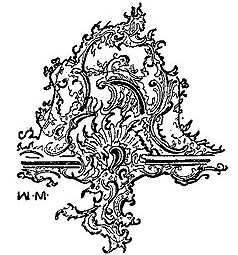
W. Mulot, Marienhausen. Stukkatur des Empfangsaals.