
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Als die den Paradiesvögeln am nächsten stehenden Sperlingsvögel erweisen sich die Raben ( Corvidae), gedrungen gebaute, kräftige Vögel, mit verhältnismäßig großem, starkem, auf der Firste des Oberschnabels oder überhaupt seicht gekrümmtem Schnabel, dessen Schneide vor der meist überragenden Spitze zuweilen einen schwachen Ausschnitt zeigt, und dessen Wurzel regelmäßig mit langen, die Nasenlöcher deckenden Borsten bekleidet ist, großen und starken Füßen, mäßig langen, in der Regel zugerundeten Flügeln, verschieden langem, gerade abgeschnittenem oder gesteigertem Schwanze und dichtem, einfarbigem oder buntem Gefieder.
Die Raben, von denen man gegen zweihundert Arten kennt, bewohnen alle Theile und alle Breiten- oder Höhengürtel der Erde. Nach dem Gleicher hin nimmt ihre Artenzahl bedeutend zu; sie sind aber auch in den gemäßigten Ländern noch zahlreich vertreten und erst im kalten Gürtel einigermaßen beschränkt. Weitaus die meisten verweilen als Standvögel jahraus, jahrein an einer und derselben Stelle oder wenigstens in einem gewissen Gebiete, streichen in ihm aber gern hin und her. Einzelne Arten wandern, andere ziehen sich während des Winters von bedeutenden Höhen mehr in tiefere Gegenden zurück.
Mit Ausnahme eines wohllautenden Gesanges, welcher den Raben fehlt, vereinigen sie sozusagen alle Begabungen in sich, welche den Gliedern der Ordnung eigen sind. Sie gehen gut, fliegen leicht und anhaltend, auch ziemlich rasch, besitzen sehr gleichmäßig entwickelte Sinne, namentlich einen ausgezeichneten Geruch, und stehen hinsichtlich ihres Verstandes hinter keinem ihrer Ordnungsverwandten, vielleicht nicht einmal hinter irgend einem Vogel zurück. Dank ihren vortrefflichen Geistesgaben führen sie ein sehr bequemes Leben, wissen sich alles nutzbar zu machen, was ihr Wirkungskreis ihnen bietet, und spielen daher überall eine bedeutsame Rolle. Sie sind Allesfresser im eigentlichen Sinne des Wortes, daher unter Umständen ebenso schädlich als im allgemeinen nützlich. Ihr großes, zuweilen überdecktes Nest steht frei auf Bäumen und Felsen oder in Spalten und Höhlungen der letzteren; das zahlreiche Gelege besteht aus bunten Eiern, welche mit warmer Hingebung bebrütet werden, ebenso wie alle Raben, dem verleumderischen Sprichworte zum Trotze, als die treuesten Eltern bezeichnet werden dürfen.
In der ersten Unterfamilie vereinigen wir die Felsenraben ( Fregilinae), gestreckt gebaute, langflügelige und kurzschwänzige Arten mit schwächlichem, zugespitztem und etwas gebogenem, meist lebhaft gefärbtem Schnabel, zierlichen Füßen, verhältnismäßig langen Flügeln und schillerndem Gefieder.
Die Alpenkrähe, Steinkrähe, Krähendohle, Gebirgs- oder Feuerrabe, Eremit, Klausrabe oder Thurmwiedehopf ( Fregilus graculus, europaeus, erythropus und himalayanus, Corvus graculus, Gracula pyrrhocorax und eremita, Coracia gracula und erythrorhamphos, Pyrrhocorax rupestris), zeichnet sich durch lang gestreckten, dünnen und bogenförmigen Schnabel aus. Dieser ist, wie die mittelhohen, kurzzehigen Füße, prächtig korallroth gefärbt, das Auge dunkelbraun, das Gefieder gleichmäßig glänzend grün- oder blauschwarz. Die Länge beträgt vierzig, die Breite zweiundachtzig, die Fittiglänge siebenundzwanzig, die Schwanzlänge funfzehn Centimeter. Das Weibchen ist kaum kleiner, äußerlich überhaupt nicht vom Männchen zu unterscheiden. Die jungen Vögel lassen sich an ihrem glanzlosen Gefieder erkennen; auch sind bei ihnen Schnabel und Füße schwärzlich. Nach der ersten Mauser, welche bereits wenige Monate nach ihrem Ausfliegen beginnt, erhalten sie das Kleid der Alten.
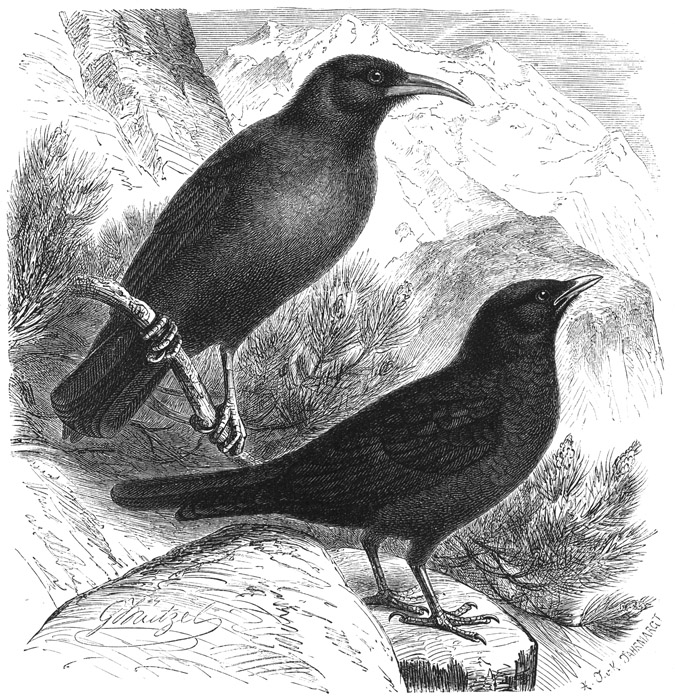
Alpenkrähe ( Fregilus graculus) und Alpendohle ( Pyrrhocorax alpinus). ⅓ natürl. Größe.
Unsere europäischen Alpen in ihrer ganzen Ausdehnung, die Karpathen, der Balkan, die Pyrenäen und fast alle übrigen Gebirge Spaniens, auch einige Berge Englands und Schottlands und alle Gebirge vom Ural und Kaukasus an bis zu den chinesischen Zügen und dem Himalaya, ebenso die Kanarischen Inseln, der Atlas und die höchsten Berggipfel Abessiniens, namentlich Semiéns, beherbergen diesen in jeder Hinsicht anziehenden und beachtungswerthen Vogel. In den Schweizer Alpen ist er selten, in Spanien aber, wenigstens an vielen Orten, außerordentlich zahlreich. Dort bewohnt er nur das eigentliche Hochgebirge, einen Gürtel hart unter der Schneegrenze, und versteigt sich häufig bis in die höchsten Alpenspitzen; in Spanien begegnet man ihm schon an Felsenwänden, welche bis zu höchstens zwei- oder dreihundert Meter über das Meer sich erheben. In den Rätischen Gebirgen nistete er noch vor funfzig Jahren in den Glockenstühlen und Sparren fast aller hochgelegenen Bergdörfer, während er gegenwärtig, meist infolge der Umgestaltung dieser Thürme, gezwungen in die Felsenwildnisse zurückgekehrt ist. Im höchsten Gürtel des Gebirges überwintert er nicht, wandert vielmehr im Oktober tiefer gelegenen Felswänden oder südlicheren Gegenden zu. Bei dieser Gelegenheit soll er in Scharen von vier- bis sechshundert Stück an den Hospizen erscheinen, bald aber wieder verschwinden. Doch erhielt Stölker mitten im Winter eine in den höchsten Gebirgsthälern der Schweiz erlegte Alpenkrähe. In Spanien und wahrscheinlich ebenso in allen südlicheren Gebirgsländern ist diese Stand- oder höchstens Strichvogel; denn es mag wohl möglich sein, daß sie im Winter das Hochgebirge verläßt und in tiefere Thäler herabgeht. Das Tief- oder selbst das Hügelland besucht sie immer nur ausnahmsweise; doch habe ich selbst sie einmal im Winter in den Weinbergen oberhalb Mainz gesehen.
Nach unseren Beobachtungen erinnert die Alpenkrähe lebhaft an die Dohle, fliegt aber leichter und zierlicher und ist auch viel klüger und vorsichtiger als diese. Wenn man durch die Gebirge Murcias oder Andalusiens reist, hört man zuweilen von einer Felsenwand tausendstimmiges Geschrei herniederschallen und glaubt, es zunächst mit unserer Thurmdohle zu thun zu haben, bis die Masse der Vögel sich in Bewegung setzt und man nun leicht an dem zierlicheren und rascheren Fluge, bei günstiger Beleuchtung wohl auch bei der weithin sichtbaren Korallfarbe des Schnabels, die Alpenkrähe erkennt. Beobachtet man die Thiere länger, so bemerkt man, daß sie mit einer gewissen Regelmäßigkeit auf den bestimmten Plätzen erscheinen und sie mit derselben Regelmäßigkeit wieder verlassen. In den frühesten Morgenstunden fliegen sie auf Nahrung aus, kehren gegen neun Uhr vormittags auf ihre Wohnplätze zurück, verweilen hier kürzere Zeit bis zur Tränke, suchen von neuem Nahrung und erscheinen erst in den heißen Mittagsstunden wiederum auf ihrer Felsenwand. Während der Mittagshitze halten sie sich in schattigen Felsenlöchern verborgen, beobachten aber genau die nächste Umgebung und lassen nichts verdächtiges vorüber, ohne es mit lautem Geschrei zu begrüßen. Vorbeistreichende Adler werden von der ganzen Bande streckenweise verfolgt und muthig angegriffen, jedoch mit sorgfältigster Berücksichtigung der betreffenden Art; denn vor dem gewandten Habichtsadler nehmen sich die klugen Vögel wohl in Acht, verbergen sich sogar vor ihm noch tiefer in ihre Felsenhöhlen, während sie sich um den Geieradler gar nicht kümmern. In den Nachmittagsstunden fliegen sie abermals auf Nahrung aus, und erst mit Sonnenuntergange kehren sie, nachdem sie nochmals sich getränkt haben, zu den Wohn- und Schlafplätzen der Gesellschaft zurück.
Eigenthümlich ist es, daß die Alpenkrähe nur gewisse Oertlichkeiten bewohnt und in anderen, scheinbar ebenso günstigen, fehlt. So findet sie sich, nach Bolle, nur auf Palma, auf keiner kanarischen Insel weiter. »Während dort zahlreiche Schwärme sowohl die heißen, grottenreichen Thäler des Küstengebietes wie die hochgelegenen, im Winter mit Schnee bedeckten Bergzinnen bevölkern, haben die in der Entfernung von wenigen Meilen dem Auge weithin sichtbaren, aus dem Meere auftauchenden Gebirgskämme von Teneriffa, Gomera und Ferro die Auswanderungslust dieser fluggewandten Bewohner der hohen Lüfte noch nie gereizt. Scheu, flüchtig und höchst gesellig beleben die Ansiedelungen der Alpenkrähen auf das angenehmste und fesselndste die entzückenden Landschaften jener unvergleichlichen Insel. Ihr Leben scheint ein immerwährendes, heiteres Spiel zu sein; denn man sieht sie einander fortwährend jagen und sich necken. Ein leichter, zierlich schwebender Flug voll der künstlichsten, anmuthigsten Schwenkungen zeichnet sie aus. Auf frisch beackerten Feldern fallen sie in Herden von tausenden nieder; auch an einsamen, aus den Felsen hervorsprudelnden Quellen sah ich sie oft zahlreich zur Tränke kommen.«
Erst wenn man beobachtet, welche Gegenstände die Alpenkrähe hauptsächlich zu ihrer Nahrung wählt, erkennt man, wie geschickt sie ihren bogenförmigen Schnabel zu verwenden weiß. Nach meinen Erfahrungen ist sie nämlich fast ausschließlich ein Kerbthierfresser, welcher nur gelegentlich andere Nahrung aufnimmt. Heuschrecken und Spinnenthiere, darunter Skorpionen, dürften in Spanien die Hauptmasse ihrer Mahlzeiten bilden, und dieser Thiere weiß sie sich mit größtem Geschicke zu bemächtigen. Sie hebt mit ihrem langen Schnabel kleinere Steine in die Höhe und sucht unter denselben die versteckten Thiere hervor, bohrt auch, wie die Saatkrähe, nach Kerfen in die Erde oder steckt ihren Schnabel unter größere Steine, deren Gewicht sie nicht bewältigen kann, um hier nach ihrer Lieblingsspeise zu forschen. Während der Brutzeit, beziehentlich der Aufzucht ihrer Jungen plündert sie auch wohl die Nester kleinerer Vögel und schleppt die noch unbehilflichen Jungen ihren hungrigen Kindern zu, und im Nothfalle bietet ihr sogar Aas erwünschte Kost.
Die Brutzeit fällt in die ersten Monate des Frühlings. In Spanien fanden wir zu Anfange des Juli ausgeflogene Junge. Das Nest selbst haben wir nicht untersuchen können; denn auch auf der iberischen Halbinsel behält die Alpenkrähe die löbliche Gewohnheit bei, die Höhlen unersteiglicher Felsenwände zu dessen Anlage zu wählen. Nach Girtanners neuesten Untersuchungen bestehen Ober- und Unterbau nur aus nach oben hin immer feiner werdenden Wurzelreisern einer oder sehr weniger Pflanzen; die Nestmulde aber ist mit einem äußerst dichten, festen, nicht unter sechs Centimeter dicken Filz ausgekleidet, zu dessen Herstellung annähernd alle Säugethiere des Gebirges ihren Zoll an Haaren lassen mußten. Wollflecken vom Schafe sind mit Ziegen- und Gemshaaren, große Büschel weißer Hasenhaare mit solchen des Rindes sorgfältig ineinander verarbeitet worden. »Wo das Nest an den Fels sich anschmiegte, ist der Filz noch ziemlich hoch an ihm aufgethürmt worden, um Feuchtigkeit und Kälte möglichst vollkommen von Mutter und Kindern abzuhalten.« Die vier bis fünf Eier, welche auch in den Hochalpen bereits gegen Ende des April vollzählig zu sein pflegen, sind vierundvierzig Millimeter lang, nennundzwanzig Millimeter dick, und auf weißlichem oder schmutzig graugelbem Grunde mit hellbraunen Flecken und Punkten gezeichnet. Wie lange die Brutzeit währt, weiß man nicht. Wahrscheinlich brütet das Weibchen allein, während beide Eltern unter großem Geschreie und Gelärme das schwere Geschäft der Auffütterung ihrer Kinder theilen. Letztere verlassen das Nest gegen Ende des Juni, werden aber noch längere Zeit von ihren Eltern geleitet und unterrichtet.
Auch während der Brutzeit leben die Alpenkrähen in derselben engen Verbindung wie in den übrigen Monaten des Jahres. Sie sind gesellschaftliche Vögel im vollen Sinne des Wortes. Ganz ohne Neckereien geht es freilich nicht ab, und möglicherweise bestehlen sich auch die Genossen eines Verbandes nach bestem Können und Vermögen; dies aber ist Rabenart und stört die Eintracht nicht im geringsten. Bei Gefahr steht sich der ganze Schwarm treulich bei, und jeder beweist unter Umständen wirklich erhabenen Muth. So beobachteten wir, daß verwundete Alpenkrähen von den gesunden unter lautem Geschreie umschwärmt wurden, wobei letztere ganz unverkennbar die Absicht bekundeten, den unglücklichen Genossen beizustehen. Eine Alpenkrähe, welche wir flügellahm geschossen und aus dem Auge verloren hatten, fanden wir acht Tage später wieder auf, weil eine Felsenritze, in welcher sie sich versteckt hatte, fortwährend von anderen Mitgliedern der Ansiedelung umschwärmt wurde. Es unterlag für uns kaum einem Zweifel, daß dies nur in der Absicht geschah, die Kranke durch Zutragen von Nahrung zu unterstützen. Als Feinde, welche den behenden, klugen und vorsichtigen Vögeln schaden können, zählt Girtanner Wanderfalk, Habicht und Sperber, außerdem aber auch den Thurmfalken auf, welch letzterer sich namentlich der Nester gern bemächtigt und um einen Nistplatz oft lange und hartnäckig mit den Alpenkrähen streitet, jedoch auch deren unmündige Junge aus dem Neste hebt. Auch der Uhu mag manche alte, der Fuchs wie der Marder manche junge Alpenkrähe erwürgen.
Alle Raben sind anziehende Käfigvögel; kein einziger aber kommt nach meinem Dafürhalten der Alpenkrähe gleich. Sie wird unter einigermaßen sorgsamer Pflege bald ungemein zahm und zutraulich, schließt sich ihrem Pfleger innig an, achtet auf einen ihr beigegebenen Namen, folgt dem Rufe, läßt sich zum Aus- und Einfliegen gewöhnen und schreitet, entsprechend untergebracht und abgewartet, im Käfige auch zur Fortpflanzung. Ihre zierliche Gestalt und lebhafte Schnabel- und Fußfärbung, ihre gefällige Haltung, Lebhaftigkeit und Regsamkeit, Neugierde und Wißbegier, ihr Selbstbewußtsein, Lern- und Nachahmungsvermögen bilden unversiegliche Quellen für fesselnde und belehrende Beobachtung. Mit der Zeit wird sie zu einem Hausthiere im besten Sinne des Wortes, unterscheidet Bekannte und Fremde, erwachsene und unerwachsene Leute, nimmt Theil an allen Ereignissen, beinahe an den Leiden und Freuden des Hauses, befreundet sich auch mit anderen Hausthieren, sammelt allmählich einen Schatz von Erfahrungen, wird immer klüger, freilich auch immer verschlagener und bildet zuletzt ein beachtenswerthes Glied der Hausbewohnerschaft.
Ihre Haltung ist überaus einfach. Sie nährt sich zwar hauptsächlich von Fleisch, nimmt aber fast alle übrigen Speisen an, welche der Mensch genießt. Weißbrod gehört zu ihren Leckerbissen, frischer Käse nicht minder; sie verschmäht aber auch kleine Wirbelthiere nicht, obwohl sie sich längere Zeit abmühen muß, um eine Maus oder einen Vogel zu tödten und bezüglich zu zerkleinern. Schwache Vögel fällt sie mit großer Wuth an, und auch gleich starke, Heher und Dohlen z. B., mißhandelt sie abscheulich. Ihre Zuneigung beschränkt sich auf menschliche Wesen.
Die nah verwandte Alpendohle oder Schneekrähe, Berg- und Steindohle, Schneedachel, Flütäsie und Alpenamsel ( Pyrrhocorax alpinus, montanus, planiceps und Forsythi, Fregilus pyrrhocorax, Bild S. 425) unterscheidet sich von der Alpenkrähe durch nur kopflangen und verhältnismäßig stärkeren Schnabel von gelber Färbung sowie amsel-, nicht krähenartiges Gefieder. Dieses ist bei alten Vögeln sammetschwarz, bei jungen mattschwarz, der Fuß bei jenen roth, bei diesen gelb. Hinsichtlich der Größe ist zwischen Alpenkrähe und Alpendohle kaum ein Unterschied, und Lebensweise und Betragen sind ebenfalls im wesentlichen dieselben.
Auch die Alpendohle verbreitet sich fast über das ganze nördlich altweltliche Gebiet. Sie ist in den Alpen überall gemein, in Spanien ziemlich selten, in Griechenland und Italien häufiger als die Alpenkrähe zu finden, tritt außerdem in Kleinasien, Kaukasien, Persien, Südsibirien und Turkestan auf, bewohnt überhaupt alle Hochgebirge Mittelasiens und lebt im Himalaya nicht minder häufig als die Verwandte. Im Altai besiedelt sie mit dieser dieselben Bergzüge, bildet, wie ich beobachtet habe, mit ihr sogar gemeinschaftliche Flüge.
»Wie zum Saatfelde die Lerche, zum See die Möve, zum Stalle und der Wiese der Ammer und Hausrothschwanz, zum Kornspeicher die Taube und der Spatz, zum Grünhage der Zaunkönig, zum jungen Lerchenwalde die Meise und das Goldhähnchen, zum Feldbache die Stelze, zum Buchwalde der Fink, in die zapfenbehangenen Föhren das Eichhorn gehört«, sagt Tschudi, »so gehört zu den Felsenzinnen unserer Alpen die Bergdohle oder Schneekrähe. Findet der Wanderer oder Jäger auch sonst in den Bergen keine zwei- oder vierfüßigen Alpenbewohner: eine Schar Bergdohlen, welche zankend und schreiend auf den Felsenvorsprüngen sitzen, bald aber schrill pfeifend mit wenigen Flügelschlägen auffliegen, in schneckenförmigen Schwenkungen in die Höhe steigen und dann in weiten Kreisen die Felsen umziehen, um sich bald wieder auf einen derselben niederzulassen und den Fremden zu beobachten, findet er gewiß immer, sei es auf den Weiden über der Holzgrenze, sei es in den todten Geröllhalden der Hochalpen, ebenso häufig auch an den nackten Felsen am und im ewigen Schnee. Fand doch von Dürrler selbst auf dem Firnmeere, welches die höchste Kuppe des Tödi, mehr als vierthalbtausend Meter über dem Meere, umgibt, noch zwei solcher Krähen und Meyer bei seiner Ersteigung des Finsteraarhorns in einer Höhe von über viertausend Meter über dem Meere noch mehrere derselben. Sie gehen also noch höher als Schneefinken und Schneehühner und lassen ihr helles Geschrei als eintönigen Ersatz für den trillernden Gesang der Flüelerche und des Citronfinken hören, welcher fast tausend Meter tiefer den Wanderer noch so freundlich begleitete. Und doch ist es diesem gar lieb, wenn er zwischen ewigem Eise und Schnee wenigstens diese lebhaften Vögel noch schwärmend sich herumtreiben und mit dem Schnabel im Firne nach eingesunkenen Kerbthieren hacken sieht.
»Wie fast alle Alpenthiere gelten auch die Schneekrähen für Wetterprofeten. Wenn im Frühlinge noch rauhe Tage eintreten oder im Herbste die ersten Schneefälle die Hochthalsohle versilbern wollen, steigen diese Krähen scharenweise, bald hell krächzend, bald laut pfeifend in die Tiefe, verschwinden aber sogleich wieder, wenn das Wetter wirklich rauh und schlimm geworden ist. Auch im härtesten Winter verlassen sie nur auf kurze Zeit die Alpengebiete, um etwa in den Thalgründen dem Beerenreste der Büsche nachzugehen, und im Januar sieht man sie noch munter um die höchsten Felsenzinnen kreisen. Sie fressen übrigens wie die anderen Rabenarten alles genießbare; im Sommer suchen sie bisweilen die höchsten Bergkirschenbäume auf. Land- und Wasserschnecken verschlucken sie mit der Schale (im Kropfe einer an der Spiegelalpe im December geschossenen Bergdohle fanden wir dreizehn Landschnecken, unter denen kein leeres Häuschen war) und begnügen sich in der ödesten Nahrungszeit auch mit Baumknospen und Fichtennadeln. Auf thierische Ueberreste gehen sie so gierig wie die Kolkraben und verfolgen in gewissen Fällen selbst lebende Thiere wie echte Raubvögel. Im December 1853 sahen wir bei einer Jagd in der sogenannten Oehrligrube am Säntis mit Erstaunen, wie auf den Knall der Flinte sich augenblicklich eine große Schar von Schneekrähen sammelte, von denen vorher kein Stück zu sehen gewesen. Lange kreisten sie laut pfeifend über dem angeschossenen Alpenhasen und verfolgten ihn, so lange sie den Flüchtling sehen konnten. Um ein unzugängliches Felsenriff des gleichen Gebirges, auf welchem eine angeschossene Gemse verendet hatte, kreisten Monate lang, nachdem der Leichnam schon knochenblank genagt war, die krächzenden Bergdohlenscharen. Mit großer Unverschämtheit stoßen sie angesichts des Jägers auf den stöbernden Dachshund. Ihre Beute theilen sie nicht in Frieden. Schreiend und zankend jagen sie einander die Bissen ab und beißen und necken sich beständig; doch scheint ihre starke gesellige Neigung edler Art zu sein. Wir haben oft bemerkt, wie der ganze Schwarm, wenn ein oder mehrere Stück aus ihm weggeschossen wurden, mit heftig pfeifenden Klagetönen eine Zeitlang noch über den erlegten schwebte.
»Ihre oft gemeinsamen Nester sind in den Spalten und Höhlen der unzugänglichsten Kuppen und darum selten beobachtet worden. Das einzelne Nest ist flach, groß, besteht aus Grashalmen und enthält in der Brütezeit fünf kräheneigroße, etwa sechsundzwanzig Millimeter lange, achtunddreißig Millimeter dicke Eier mit dunkelgrauen Flecken auf hell aschgrauem Grunde. Die Schneekrähen bewohnen gewisse Felsengrotten ganze Geschlechter hindurch und bedecken sie oft dick mit ihrem Kothe.«
Ueber das Gefangenleben gilt genau dasselbe, was von der Alpenkrähe gesagt werden kann; ich wenigstens habe an meinen Pfleglingen der einen wie der anderen Art irgendwie erhebliche Unterschiede nicht beobachten können. »Dieser Vogel ist einer von denjenigen«, sagt Savi, »welche sich am leichtesten zähmen lassen und die innigste Anhänglichkeit an ihren Pfleger zeigen. Man kann ihn Jahre lang halten, frei herumlaufen und fliegen lassen. Er springt auf den Tisch und ißt Fleisch, Früchte, besonders Trauben, Feigen, Kirschen, Schwarzbrod, trockenen Käse und Dotter. Er liebt die Milch und zieht bisweilen Wein dem Wasser vor. Wie die Raben hält er die Speisen, welche er zerreißen will, mit den Klauen, versteckt das übrige und deckt es mit Papier, Splittern und dergleichen zu, setzt sich auch wohl daneben und vertheidigt den Vorrath gegen Hunde und Menschen. Er hat ein seltsames Gelüste zum Feuer, zieht oft den brennenden Docht aus den Lampen und verschluckt denselben, holt ebenso des Winters kleine Kohlen aus dem Kamine, ohne daß es ihm im geringsten schadet. Er hat eine besondere Freude, den Rauch aufsteigen zu sehen, und so oft er ein Kohlenbecken wahrnimmt, sucht er ein Stück Papier, einen Lumpen oder einen Splitter, wirft es hinein und stellt sich dann davor, um den Rauch anzusehen. Sollte man daher nicht vermuthen, daß dieser der ›brandstiftende Vogel‹ ( Avis incendiaria) der Alten sei?
»Vor einer Schlange oder einem Krebse und dergleichen schlägt er die Flügel und den Schwanz und krächzt ganz wie die Raben; kommt ein Fremder ins Zimmer, so schreit er, daß man fast taub wird; ruft ihn aber ein Bekannter, so gackert er ganz freundlich. In der Ruhe singt er bisweilen, und ist er ausgeschlossen, so pfeift er fast wie eine Amsel; er lernt selbst einen kleinen Marsch pfeifen. War jemand lang abwesend und kommt zurück, so geht er ihm mit halb geöffneten Flügeln entgegen, begrüßt ihn mit der Stimme, fliegt ihm auf den Arm und besieht ihn von allen Seiten. Findet er nach Sonnenaufgang die Thüre geschlossen, so läuft er in ein Schlafzimmer, ruft einige Male, setzt sich unbeweglich aufs Kopfkissen und wartet, bis sein Freund aufwacht. Dann hat er keine Ruhe mehr, schreit aus allen Kräften, läuft von einem Orte zum anderen und bezeugt auf alle Art sein Vergnügen an der Gesellschaft seines Herrn. Seine Zuneigung setzt wirklich in Erstaunen; aber dennoch macht er sich nicht zum Sklaven, läßt sich nicht gern in die Hand nehmen, und hat immer einige Personen, die er nicht leiden mag, und nach denen er pickt.«
Die Raben im engsten Sinne ( Corvinae) kennzeichnen sich durch großen, aber verhältnismäßig kurzen, mehr oder weniger gebogenen, an der Wurzel mit steifen Borstenhaaren überdeckten schwarzen Schnabel, kräftige, schwarze Füße, mittellange Flügel, welche zusammen gelegt ungefähr das Ende des Schwanzes erreichen, verschieden langen, gerade abgeschnittenen, zugerundeten und gesteigerten Schwanz und ein ziemlich reiches, mehr oder minder glänzendes Gefieder von vorwaltend schwarzer Färbung.
Als die würdigsten Vertreter der Unterfamilie dürfen zwei afrikanische Verwandte angesehen werden können, welche man bezeichnend Erz- oder Geierraben ( Corvultnr) genannt hat. Ihr riesiger, mehr als kopflanger, ungewöhnlich dicker, ober- und unterseits stark gekrümmter, seitlich zusammengedrückter, seitlich an der Wurzel mit einer breiten abgeflachten Furche versehener, an der Wurzel nicht mit Borsten bekleideter Schnabel, lange Flügel, in denen die vierte und fünfte Schwinge die längsten sind, und der ziemlich bedeutend abgestufte Schwanz sind die hervorstechenden Kennzeichen der Sippe.

Erzrabe ( Corvultur crassirostris). 1/5 natürl. Größe.
Der Erzrabe ( Corvultur crassirostris, Corvus und Archicorax crassirostris) erreicht eine Länge von siebzig Centimeter, bei siebenundvierzig Centimeter Flügel- und vierundzwanzig Centimeter Schwanzlänge. Das kohlschwarze Gefieder der Halsseiten schillert dunkel purpurfarbig, das übrige blauschwarz; die kleinen Deckfedern des Flügelbugs sind dunkel kastanienbraun und schwarz gemischt; ein weißer birnförmiger Fleck bedeckt Hinterkopf und Nacken. Das Auge ist kastanienbraun, der Schnabel wie der Fuß schwarz, an der Spitze weiß.
Ueber die Lebensweise dieses riesigen Raben berichtet Heuglin in eingehender Weise. Der Vogel ist Bewohner der Gebirge Ost- und Mittelafrikas, insbesondere Abessiniens, nordwärts bis Hamasièn, ostwärts bis Galabât und Taka, südlich bis Schoa und die Somalihochländer, westlich wahrscheinlich bis tief ins Innere Afrikas verbreitet, aber nur in Höhen von zwölfhundert Meter aufwärts bis zur Schneegrenze ansässig. Hier, auf Hochebenen und mit Vorliebe in der Nähe von Viehgehegen oder Schlachtplätzen, lebt er paarweise oder in kleinen Gesellschaften, den Menschen weder scheuend noch fürchtend. Man sieht ihn nach Art seiner Verwandtschaft viel auf dem Boden umherlaufen oder über Triften, Feldern und Niederlassungen dahinschweben, selten bäumen, öfter auf einzeln stehenden Felsen oder Hausdächern ruhen und scharfen Auges sein Gebiet durchspähen, vernimmt auch nicht selten seinen rauhen, kolkrabenartigen Ruf oder seinen verhältnismäßig schwachen, rätschenden Lockton. Gesellig und verträglich wie die meisten anderen Raben, lebt er mit den Aasvögeln in gutem Einvernehmen, läßt sich durch sie jedoch nicht vom Aase vertreiben. Im Nothfalle frißt er Käfer und andere Kerbthiere, wahrscheinlich auch Fruchtstoffe mancherlei Art; seine Hauptnahrung besteht jedoch in Fleischabfällen und Knochen. Ihnen zu Gefallen besucht er die Ortschaften, folgt er den Herden oder ebenso den Heeren. Während der Kriegszüge gegen die Galla, an denen Heuglin halb gezwungen theilnehmen mußte, war er in Gemeinschaft des Geieradlers, Aasgeiers, Schmarotzermilans und eines anderen Raben steter Begleiter der Krieger, und nicht selten sah ihn Heuglin auch auf menschlichen Leichen sitzen, diesen zuerst die Augen aushacken und dann den Leib zerreißen. Unser Gewährsmann hat zwar nie beobachten können, daß er lebende Thiere angreift, zweifelt jedoch nicht im geringsten, daß er dies thut. Wahrscheinlich ähnelt er in jeder Beziehung und so auch hinsichtlich seiner räuberischen Thätigkeit seinem Verwandten, dem südafrikanischen Geierraben ( Corvultur albicollis), dessen Betragen Levaillant gezeichnet hat. Dieser Rabe frißt zwar ebenfalls vorzugsweise Aas, greift aber auch lebende Thiere, namentlich Schafe und junge Gazellen an, hackt ihnen die Augen und die Zunge aus und tödtet und zerreißt sie. Nicht minder folgt er den Herden der Büffel, Rinder und Pferde, selbst dem Nashorne und dem Elefanten, welche ihm ebenfalls Nahrung zollen müssen. Hätte er die nöthige Kraft, er würde diesen Thieren gefährlich werden; so aber muß er sich begnügen, mit seinem Schnabel die wunden Stellen zu bearbeiten, welche durch Zecken und Maden verursacht werden. Diese Quälgeister der Säugethiere finden sich bei vielen von ihnen so zahlreich, daß sie es den Raben gern erlauben, auf ihrem Rücken herumzuhacken, selbst wenn das Blut danach läuft; denn der Rabe begnügt sich nicht mit den Kerbthieren, sondern frißt auch die eiternden Wunden aus.
Das Nest fand Heuglin im März auf einer unzugänglichen Stelle über einem Wasserfalle, welche mit Schlingpflanzen gänzlich überwachsen war, so daß der Horst in demselben angebracht zu sein schien.
Unter den deutschen Raben gebührt unserem Kolk- oder Edelraben, welcher auch Aas-, Stein-, Kiel-, Volk- und Goldrabe, Raab, Rab, Rapp, Rave, Raue, Golker, Galgenvogel etc. heißt ( Corvus corax, major, maximus, clericus, carnivorus, leucophaeus, leucomelas, sylvestris, littoralis, peregrinus, montanus, vociferus, lugubris, tibetanus und ferroensis, Corax nobilis und maximus), die erste Stelle. Er ist der Rabe im eigentlichen Sinne des Wortes; die vielen Benennungen, welche er außerdem noch führt, sind nichts anderes als unbedeutsame Beinamen. Der Kolkrabe vertritt mit mehreren Verwandten, welche ihm sämmtlich höchst ähnlich sind, eine besondere Untersippe ( Corvus), deren Kennzeichen im folgenden liegen: Der Leib ist gestreckt, der Flügel groß, lang und spitzig, weil die dritte Schwinge alle übrigen an Länge überragt, der Schwanz mittellang, seitlich abgestuft, das Gefieder knapp und glänzend. Die Färbung des Kolkraben ist gleichmäßig schwarz. Nur das Auge ist braun oder bei den jüngeren Vögeln blauschwarz und bei den Nestjungen hellgrau. Die Länge beträgt vierundsechzig bis sechsundsechzig, die Breite etwa einhundertfünfundzwanzig, die Fittiglänge vierundvierzig, die Schwanzlänge sechsundzwanzig Centimeter.
Unter allen Raben scheint der Kolkrabe, welcher überhaupt in jeder Hinsicht als das Ur- und Vorbild der ganzen Familie zu betrachten ist, am weitesten verbreitet zu sein. Er bewohnt ganz Europa vom Nordkap bis zum Kap Tarifa und vom Vorgebirge Finisterre bis zum Ural, findet sich aber auch im größten Theile Asiens vom Eismeere bis zum Punjab und vom Ural bis nach Japan und ebenso in ganz Nordamerika, nach Süden hin bis Mejiko. Bei uns zu Lande ist der stattliche, stolze Vogel nur in gewissen Gegenden häufig, in anderen bereits ausgerottet und meidet da, wo dies noch nicht der Fall, den Menschen und sein Treiben so viel als möglich. Aus diesem Grunde haust er ausschließlich in Gebirgen oder in zusammenhängenden, hochständigen Waldungen, an felsigen Meeresküsten und ähnlichen Zufluchtsorten, wo er möglichst ungestört sein kann. Gegen die Grenzen unseres Erdtheiles hin lebt er mit dem Herrn der Erde in besseren Verhältnissen, und in Rußland oder Sibirien scheut er diesen so wenig, daß er mit der Nebelkrähe und Dohle nicht allein Straßen und Wege, sondern auch Dörfer und Städte besucht, ja gerade hier, auf den Kirchthürmen, ebenso regelmäßig nistet wie hier zu Lande die Thurmdohle. Damit steht im Einklange, daß er hier noch heutigen Tages gemein genannt werden darf. Auch in Spanien, Griechenland und ebenso in Skandinavien tritt er häufig auf. Gleichwohl schart er sich selten zu zahlreichen Flügen, und solche von funfzig Stück, wie ich sie in der Sierra Nevada sah, gehören immer zu den Ausnahmen. Der Standort eines Paares ist stets vortrefflich gewählt. Der Kolkrabe bewohnt ein umfangreiches Gebiet und sieht besonders auf Mannigfaltigkeit der Erzeugnisse desselben. Gegenden, in denen Wald und Feld, Wiese und Gewässer mit einander abwechseln, sind seine liebsten Wohnsitze, weil er hier die meiste Nahrung findet.

Raben.
1. Dohle. 2. Saatkrähe. 3. Nebelkrähe 4. Elster 5. Rabe
»Der Kolkrabe«, sagt mein Vater, welcher ihn vor nunmehr fast sechzig Jahren in noch unübertroffener Weise beschrieben hat, »lebt gewöhnlich, also auch im Winter, paarweise. Die in Nähe meines Wohnortes horstenden Paare fliegen im Winter oft täglich über unsere Thäler weg und lassen sich auf den höchsten Bäumen nieder. Hört man den einen des Paares, so braucht man sich nur umzusehen: der andere ist nicht weit davon. Trifft ein Paar bei seinem Fluge auf ein anderes, dann vereinigen sich die beiden und schweben einige Zeit mit einander umher. Die einzelnen sind ungepaarte Junge, welche umherstreichen; denn der Kolkrabe gehört zu den Vögeln, die, einmal gepaart, zeitlebens treu zusammenhalten. Sein Flug ist wunderschön, geht fast geradeaus und wird, wenn er schnell ist, durch starkes Flügelschwingen beschleunigt; oft aber schwebt der Rabe lange Zeit und führt dabei die schönsten kreisförmigen Bewegungen aus, wobei Flügel und Schwanz stark ausgebreitet werden. Man sieht deutlich, daß ihm das Fliegen keine Anstrengung kostet, und daß er oft bloß zum Vergnügen weite Reisen unternimmt. Gelegentlich derselben nähert er sich auf den Bergen oft dem Boden; über die Thäler aber streift er gewöhnlich in bedeutender Höhe hinweg. Bei seinen Spazierflügen stürzt er oft einige Meter tief herab, besonders wenn nach ihm geschossen worden ist, so daß der mit dieser Spielerei unbekannte Schütze glauben muß, er habe ihn angeschossen und werde ihn bald herabstürzen sehen. Während des Winters bringt er den größten Theil des Tages fliegend zu. Der Flug ähnelt dem der Raubvögel mehr als dem anderer Krähen und ist so bezeichnend für ihn, daß ihn der Kundige in jeder Entfernung von den verwandten Krähenarten zu unterscheiden im Stande ist. Auf der Erde schreitet der Rabe mit einer scheinbar angenommenen lächerlichen Würde einher, trägt dabei den Leib vorn etwas höher als hinten, nickt mit dem Kopfe und bewegt bei jedem Tritte den Leib hin und her. Beim Sitzen auf Aesten hält er den Leib bald wagerecht, bald sehr aufgerichtet. Die Federn liegen fast immer so glatt an, daß er wie gegossen aussieht, werden auch nur bei Gemüthsbewegungen auf dem Kopfe und dem ganzen Halse gesträubt. Die Flügel hält er gewöhnlich etwas vom Leibe ab. Wie er hierin nichts mit seinen Verwandten gemein hat, so ist es auch hinsichtlich einer gewissen Liebe, welche die anderen Krähenarten zu einander hegen. Die Rabenkrähen leben in größter Freundschaft mit den Nebelkrähen und Elstern, die Dohlen mischen sich unter die Saatkrähen, und keine Art thut der anderen etwas zu Leide: die Kolkraben aber werden von den Verwandten gehaßt und angefeindet. Ich habe die Rabenkrähe sehr heftig auf den Kolkraben stoßen sehen, und wenn sich dieser unter einen Schwarm Rabenkrähen mischen will, entsteht ein Lärm, als wenn ein Habicht oder Bussard unter ihnen erscheine. Ein allgemeiner Angriff nöthigt den unwillkommenen Gefährten, sich zu entfernen. Auch dadurch zeichnet sich der Kolkrabe vor den anderen Arten aus, daß er an Scheu alle übertrifft. Es ist unglaublich, wie vorsichtig dieser Vogel ist. Er läßt sich nur dann erst nieder, wenn er die Gegend gehörig umkreist und weder durch das Gesicht, noch durch den Geruch etwas für sich gefährliches bemerkt hat. Er verläßt, wenn sich ein Mensch dem Neste mit Eiern nähert, seine Brut sofort und kehrt dann zu den Jungen, so innig seine Liebe zu ihnen ist, nur mit der äußersten Vorsicht zurück. Sein Haß gegen den Uhu ist außerordentlich groß, seine Vorsicht aber noch weit größer; deshalb ist dieser scheue Vogel selbst von der Krähenhütte aus nur sehr schwer zu erlegen. Die gewöhnlichen Töne, welche die beiden Gatten eines Paares von sich geben, klingen wie ›Kork kork, Kolk kolk‹ oder wie ›Rabb rabb rabb‹, daher sein Name. Diese Laute werden verschieden betont und so mit anderen vermischt, daß eine gewisse Mannigfaltigkeit entsteht. Bei genauer Beobachtung begreift man wohl, wie die Wahrsager der Alten eine so große Menge von Tönen, welche der Kolkrabe hervorbringen soll, annehmen konnten. Besonders auffallend ist eine Art von Geschwätz, welches das Männchen bei der Paarung im Sitzen hören läßt. Es übertrifft an Vielseitigkeit das Plaudern der Elstern bei weitem.«
Es gibt vielleicht keinen Vogel weiter, welcher im gleichen Umfange wie der Rabe Allesfresser genannt werden kann. Man darf behaupten, daß er buchstäblich nichts genießbares verschmäht und für seine Größe und Kraft unglaubliches leistet. Ihm munden Früchte, Körner und andere genießbare Pflanzenstoffe aller Art; aber er ist auch ein Raubvogel ersten Ranges. Nicht Kerbthiere, Schnecken, Würmer und kleine Wirbelthiere allein sind es, denen er den Krieg erklärt; er greift dreist Säugethiere und Vögel an, welche ihn an Größe übertreffen, und raubt in der unverschämtesten Weise die Nester aus, nicht allein die wehrloser Vögel, sondern auch die der kräftigen Möven, welche sich und ihre Brut wohl zu vertheidigen wissen. Vom Hasen an bis zur Maus und vom Auerhuhne an bis zum kleinsten Vogel ist kein Thier vor ihm sicher. Frechheit und List, Kraft und Gewandtheit vereinigen sich in ihm, um ihn zu einem wahrhaft furchtbaren Räuber zu stempeln. In Spanien bedroht er die Haushühner, in Norwegen die jungen Gänse, Enten und das gesammte übrige Hausgeflügel; auf Island und Grönland jagt er Schneehühner, bei uns zu Lande Hasen, Fasanen und Rebhühner; am Meeresstrande sucht er zusammen, was die Flut ihm zuwarf; in den nordischen Ländern macht er den Hunden allerlei Abfälle vor den Wohnungen streitig; in den Steppen Ostasiens wird er zum unabwendbaren Peiniger der wundgedrückten Kamele, auf Island zum Schinder der beulenbehafteten Pferde, indem er sich auf den Rücken der einen wie der anderen setzt, mit Schnabelhieben das zu seiner Nahrung ausersehene Fleisch von den Wundrändern trennt und nur dadurch, daß die gequälten Thiere sich wälzen, vertrieben werden kann. »Der Kolkrabe sucht«, wie Olafsen mittheilt, »im Winter sein Futter zwischen Hunden und Katzen auf den Höfen, geht in der warmen Jahreszeit am Strande den Fischen nach, tödtet im Frühjahre mit Schnabelhieben die neugeborenen Lämmer und verzehrt sie, verjagt die Eidergänse vom Neste, säuft ihre Eier aus und verbirgt diejenigen, welche er nicht fressen kann, einzeln in die Erde. Er folgt in kleinen Scharen dem Adler, wagt sich zwar nicht an ihn, sucht aber Ueberbleibsel von seiner Beute zu erschnappen. Sind wo kranke oder todte alte Kolkraben, oder junge aus dem Neste gefallene zu finden, so verzehrt er sie. Im Winter gesellt sich zu jedem Hause eine Anzahl von zwei bis zehn Kolkraben, und diese dulden dann keinen anderen mehr unter sich.« Für den unbetheiligten Beobachter ist es ergötzlich zu sehen, wie er zu Werke geht. Den schweizer Jägern folgt er, laut Tschudi, um die geschossenen Gemsen aufzunehmen; hartschalige Muscheln erhebt er, nach Fabers und Holboells übereinstimmenden Berichten, hoch in die Luft und läßt sie von hier auf einen harten Stein oder bezüglich Felsblock fallen, um sie zu zerschmettern; den Einsiedlerkrebs weiß er, nach Alexander von Homeyers Beobachtungen, geschickt zu fassen und aus seiner Wohnung, dem Schneckengehäuse, herauszuziehen: will dieses wegen gänzlichem Zurückziehen des Krebses nicht gleich gelingen, so hämmert er mit dem Gehäuse so lange hin und her, bis der Einsiedler endlich doch zum Vorscheine kommt. Er greift große Thiere mit einer List und Verschlagenheit sondergleichen, aber auch mit großem Muthe erfolgreich an, Hasen z. B. ohne alle Umstände, nicht bloß kranke oder angeschossene, wie mein Vater annahm. Graf Wodzicki hat hierüber Erfahrungen gesammelt, welche jeden etwa noch herrschenden Zweifel beseitigen. »Die Rolle, welche der Fuchs unter den Säugethieren spielt«, sagt der genannte treffliche Forscher, »ist unter den Vögeln dem Raben zuertheilt. Er bekundet einen hohen Grad von List, Ausdauer und Vorsicht. Je nachdem er es braucht, jagt er allein oder nimmt sich Gehilfen, kennt aber auch jeden Raubvogel und begleitet diejenigen, welche ihm möglicher Weise Nahrung verschaffen können. Oft vergräbt er, wie der Fuchs, die Ueberbleibsel, um im Falle der Noth doch nicht zu hungern. Hat er sich satt gefressen, so ruft er seine Kameraden zu dem Reste der Mahlzeit herbei. Ebenso verfährt er, wenn er sie zur Jagd braucht; denn diese betreibt er mit Leidenschaft. Im December 1847 ging ich bei hohem Schnee mit einem Gefährten auf die Hasenjagd. Obgleich wir schon einige Male geschossen hatten, erblickten wir doch an einer Schlucht des gegenüber liegenden Berges zwei Raben. Der eine saß ruhig auf dem Rande und blickte hinunter, der andere, welcher etwas niedriger stand, langte mit dem Schnabel vorwärts und sprang behend zurück. Dies wiederholte er mehrere Male. Beide waren so eifrig beschäftigt, daß sie unser Kommen nicht zu bemerken schienen. Erst als wir uns ihnen bis auf einige Schritte genähert hatten, flogen die Räuber auf, setzten sich aber in einer Entfernung von wenigen hundert Schritten wieder nieder, wie es schien, in der Hoffnung, daß auch wir, wie sonst die Bauern, vorbei gehen würden, ohne ihnen Schaden zu thun: an der Stelle nun, wo wir sie beobachtet hatten, saß in der Schneewand, etwa sechzig Centimeter tief, ein großer alter Hase. Der eine Rabe hatte denselben von vorn angegriffen, um ihn zum Aufstehen zu zwingen, der andere hatte mit Schnabel und Krallen von oben ein Loch in die Schneewand gebohrt, augenscheinlich in der Absicht, den Hasen von oben herauszujagen. Dieser aber war so klug gewesen, sitzen zu bleiben, und hatte durch Brummen und Fauchen den Raben zurückgescheucht. Im Jahre 1850 sah ich im Felde zwei Raben, welche in einer Vertiefung beschäftigt waren. Als ich an die Stelle kam, lag daselbst ein Hase mit blutendem Kopfe in den letzten Zügen. Ich folgte der Spur etwa zwanzig Schritte und fand hier sein Lager mit den deutlichen Anzeigen, daß die Raben ihn herausgetrieben hatten. Wie kurz war seine Flucht gewesen! Im December 1851 sah ich drei Raben, zwei auf dem Boden, den dritten in der Luft. Ein Hase sprang auf und lief was er laufen konnte. Alle Raben verfolgten ihn laut krächzend und stießen, Raubvögeln vergleichbar, bis auf die Erde herab. Der Hase setzte sich einmal, lief darauf weiter, setzte sich zum zweiten Male und duckte sich endlich zu Boden. Sofort stürzte der eine Rabe sich auf das Opfer, schlug die Krallen in des Hasen Rücken und hieb auf dessen Kopf los. Der andere Rabe kam bald zu Hülfe, und der dritte traf Anstalt, der Beute den Bauch aufzubrechen. Obgleich ich schnell aus dem Schlitten sprang und eiligst auf den Hasen zulief, kam derselbe doch nur noch halb lebendig in meine Hände. Im December 1855 traf ich wiederum Raben an, welche bereits mit dem Säubern eines Hasengerippes beschäftigt waren. Ich ging der Hasenspur nach und gelangte in einer Entfernung von etwa zweihundert Schritt zum Lager. Dasselbe war zweidrittel Meter tief unter dem Schnee und sehr merkwürdig angelegt; denn ein unterirdischer Gang von etwa dritthalb Meter Länge, welcher sehr rein ausgetreten war, führte zu dem eigentlichen Lager und ein ähnlicher aus der entgegengesetzten Seite wieder ins Freie. Die Spur der Raben zeigte mir deutlich, daß sich der eine der Räuber in den Gang gewagt hatte, um den Hasen dem anderen zuzutreiben. Gleich Jagdhunden folgen sie der Spur eines Hasen oft funfzehn bis zwanzig Schritt weit zu Fuße, ängstigen ihn durch Krächzen und Stoßen und bringen ihn dahin, daß er sich niederdrückt, schließlich die Besinnung verliert und ihnen dann leicht zur Beute wird.« Als Nesträuber benimmt er sich nicht minder kühn; Wodzicki sah, daß einer sogar das Ei eines Schreiadlerpaares davon trug. Im Norden ist unser Vogel der abscheulichste Nesterplünderer, welchen es geben kann. Ich bestieg in Norwegen einen Felsen, auf dem eine junge Rabenfamilie saß, welche noch von den Eltern gefüttert wurde. Hier fand ich auf einer einzigen Platte gegen sechzig ausgefressene Eier von Eidergänsen, Möven und Brachvögeln unter Hühnerbeinen, Entenflügeln, Lemmingpelzen, leeren Muschelschalen, Ueberresten von jungen Möven, Strandläufern, Regenpfeifern etc. Da die vier Jungen unaufhörlich nach Nahrung kreischten, trugen die Alten fortwährend neue Beute zur Schlachtbank. Kein Wunder, daß sämmtliche Möven der Nachbarschaft, sobald die Raben sich zeigten, wüthend über sie herfielen und sich nach Kräften mit ihnen herumbalgten, kein Wunder, daß auch die Bewohner der nächsten Gehöfte sie verwünschten und aufs äußerste haßten!
Auf dem Aase jeder Art ist der Rabe eine regelmäßige Erscheinung, und die vielen biblischen Stellen, welche sich auf ihn beziehen, werden wohl ihre Richtigkeit haben. »Man behauptet«, fährt mein Vater fort, »er wittere das Aas meilenweit. So wenig ich seinen scharfen Geruch in Zweifel ziehen will, so unwahrscheinlich ist mir dennoch diese starke Behauptung, welche schon durch das Betragen widerlegt wird. Bei genauerer Beobachtung merkt man leicht, daß der Kolkrabe bei seinen Streifereien etwas unstetes hat. Er durchfliegt fast täglich einen großen Raum, und zwar in verschiedenen Richtungen, um durch das Gesicht etwas ausfindig zu machen. Man sieht daraus deutlich, daß er einem Aase nahe sei oder sich wenigstens in dem Luftstriche, welcher von dem Aase herzieht, befinden muß, um es zu finden. Wäre er im Stande, Aas meilenweit zu riechen, so würde er auch meilenweit in gerader Richtung darauf zufliegen. Auch der Umstand, daß er einen Ort, auf dem er sich niederlassen will, allemal erst umkreist, beweist, daß er einen Gegenstand nur in gewisser Richtung und schwerlich meilenweit wittern kann.« Jeder, welcher den Kolkraben kennt, muß diesen Worten beistimmen, auch trotz Naumann, welcher die von meinem Vater bestrittene Ansicht vertritt. Letzterer Naturforscher stellt die Frage auf, ob wohl der Kolkrabe, wie so oft behauptet worden, auch menschliche Leichname angehe. Nach meiner Ansicht darf unbedingt mit Ja geantwortet werden: dem Raben gilt es sicherlich vollständig gleich, ob er den Leichnam eines Menschen oder das Aas eines anderen Säugethieres vor sich hat.
Es unterliegt leider keinem Zweifel, daß der Kolkrabe durch seine Raubsucht sehr schädlich wird und nicht geduldet werden darf. Auch er bringt Nutzen wie die übrigen Krähen; der Schaden aber, welchen er anrichtet, überwiegt alle Wohlthaten, welche er dem Felde und Garten zufügt. Deshalb ist es auffallend genug, daß dieser Vogel von einzelnen Völkerschaften geliebt und verehrt wird. Namentlich die Araber achten ihn hoch und verehren ihn fast wie eine Gottheit, weil sie ihn für unsterblich halten. »Als ich einst«, sagt Dr. Labouyssé, »einen Raben mit der Kugel erlegen wollte, hielt mich ein Araber zurück mit der Versicherung, daß jener als Heiliger unverwundbar sei. Ich fehlte, zur großen Genugthuung des Arabers, welcher, gläubiger als je, mich nun lebhaft verspottete.« Auch die Isländer und Grönländer scheinen nicht feindselig gegen den argen Räuber gesinnt zu sein. »Der Kolkrabe«, sagt Faber, »ist so zahm, daß er auf den Häusern und dem Rücken weidender Pferde ruht.« In Grönland darf er nach Holboells Mittheilung sogar in die Häuser kommen, obgleich er dort stiehlt wie überall. Die Hirten der Kanarischen Inseln dagegen nennen ihn den niederträchtigsten Vogel, welchen es gibt, und behaupten, daß er nur allzuoft jungen Ziegen und Lämmern die Augen aushacke, um sie dann bequemer tödten und bezüglich fressen zu können, vernichten ihn und seine Brut deshalb so viel als möglich.
Unter allen deutschen Vögeln, die Kreuzschnäbel etwa ausgenommen, schreitet der Kolkrabe am frühesten zur Fortpflanzung, paart sich meist schon im Anfange des Januar, baut im Februar seinen Horst und legt in den ersten Tagen des März. Der große, mindestens vierzig, meist sechzig Centimeter im Durchmesser haltende, halb so hohe Horst steht auf Felsen oder bei uns auf dem Wipfel eines hohen, schwer oder nicht ersteigbaren Baumes. Der Unterbau wird aus starken Reisern zusammengeschichtet, der Mittelbau aus feineren errichtet, die Nestmulde mit Baststreifen, Baumflechten, Grasstückchen, Schafwolle und dergleichen warm ausgefüttert. Ein alter Horst wird gern wieder benutzt und dann nur ein wenig aufgebessert. Auch bei dem Nestbaue zeigt der Kolkrabe seine Klugheit und sein scheues Wesen. Er nähert sich mit den Baustoffen sehr vorsichtig und verläßt den Horst, wenn er oft Menschen in dessen Nähe bemerkt oder vor dem Eierlegen von demselben verscheucht wird, während er sonst jahrelang so regelmäßig zu ihm zurückkehrt, daß ein hannöverscher Forstbeamter nach einander vierundvierzig Junge einem und demselben Horste entnehmen konnte. Das Gelege besteht aus fünf bis sechs ziemlich großen, etwa vierundfunfzig Millimeter langen, vierunddreißig Millimeter dicken Eiern, welche auf grünlichem Grunde braun und grau gefleckt sind. Nach meines Vaters Beobachtungen brütet das Weibchen allein, nach Naumanns Angaben mit dem Männchen wechselweise. Die Jungen werden von beiden Eltern mit Regenwürmern und Kerbthieren, Mäusen, Vögeln, jungen Eiern und Aas genügend versorgt; ihr Hunger aber scheint auch bei der reichlichsten Fütterung nicht gestillt zu werden, da sie fortwährend Nahrung heischen. Beide Eltern lieben die Brut außerordentlich und verlassen die einmal ausgekrochenen Jungen nie. Sie können allerdings verscheucht werden, bleiben aber auch dann immer in der Nähe des Horstes und beweisen durch allerlei klagende Laute und ängstliches Hin- und Herfliegen ihre Sorge um die geliebten Kinder. Wiederholt ist beobachtet worden, daß die alten Raben bei fortdauernder Nachstellung ihre Jungen dadurch mit Nahrung versorgt haben, daß sie die Atzung von oben aus das Nest herabwarfen. Werden einem Rabenpaare die Eier genommen, so schreitet es zur zweiten Brut, werden ihm aber die Jungen geraubt, so brütet es nicht zum zweiten Male in demselben Jahre. Unter günstigen Umständen verlassen die jungen Raben zu Ende des Mai oder im Anfange des Juni den Horst, nicht aber die Gegend, in welcher er stand, kehren vielmehr noch längere Zeit allabendlich zu demselben zurück und halten sich noch wochenlang in der Nähe auf. Dann werden sie von den Eltern auf Anger, Wiesen und Aecker geführt, hier noch gefüttert, gleichzeitig aber in allen Künsten und Vortheilen des Gewerbes unterrichtet. Erst gegen den Herbst hin macht sich das junge Volk selbständig.
Jung dem Neste entnommene Raben werden nach kurzer Pflege außerordentlich zahm; selbst alt eingefangene fügen sich in die veränderten Verhältnisse. Der Verstand des Raben schärft sich im Umgange mit dem Menschen in bewunderungswürdiger Weise. Er läßt sich abrichten wie ein Hund, sogar auf Thiere und Menschen hetzen, führt die drolligsten und lustigsten Streiche aus, ersinnt sich fortwährend neues und nimmt zu so wie an Alter, so auch an Weisheit, dagegen nicht immer auch an Gnade vor den Augen des Menschen. Aus- und Einfliegen kann man den Raben leicht lehren; er zeigt sich jedoch größerer Freiheit regelmäßig bald unwürdig, stiehlt und versteckt das gestohlene, tödtet junge Hausthiere, Hühner und Gänse, beißt Leute, welche barfuß gehen, in die Füße und wird unter Umständen selbst gefährlich, weil er seinen Muthwillen auch an Kindern ausübt. Mit Hunden geht er oft innige Freundschaft ein, sucht ihnen die Flöhe ab und macht sich ihnen sonst nützlich; auch an Pferde und Rinder gewöhnt er sich und gewinnt sich deren Zuneigung. Er lernt trefflich sprechen, ahmt die Worte in richtiger Betonung nach und wendet sie mit Verstand an, bellt wie ein Hund, lacht wie ein Mensch, knurrt wie die Haustaube etc. Es würde viel zu weit führen, wollte ich alle Geschichten, welche mir über gezähmte Raben bekannt sind, hier wieder erzählen, und deshalb muß es genügen, wenn ich sage, daß der Vogel »wahren Menschenverstand« beweist und seinen Gebieter ebenso zu erfreuen als andere Menschen zu ärgern weiß. Wer Thieren den Verstand abschwatzen will, braucht nur längere Zeit einen Raben zu beobachten: derselbe wird ihm beweisen, daß die abgeschmackten Redensarten von Instinkt, unbewußten Trieben und dergleichen nicht einmal für die Klasse der Vögel Gültigkeit haben können.
Südlich des achtzehnten Grades nördlicher Breite begegnet man zuerst einem durch sein Gefieder sehr ausgezeichneten, kleinen, schwachschnäbeligen Raben, welcher weit über Afrika verbreitet ist und im Westen durch eine sehr nah verwandte Art vertreten wird: dem Schildraben ( Corvus scapulatus, scapularis, dauricus, curvirostris, leuconotus, phaeocephalus und madagascariensis, Corax und Pterocorax scapulatus). Er ist glänzend schwarz, auf Brust und Bauch sowie am unteren Nacken aber, breit bandförmig gezeichnet, blendend weiß. Das dunkle Gefieder schillert, das lichte glänzt wie Atlas. Das Auge ist lichtbraun, der Schnabel und die Füße sind schwarz. Die Länge beträgt fünfundvierzig bis funfzig, die Fittiglänge fünfunddreißig, die Schwanzlänge sechzehn Centimeter.
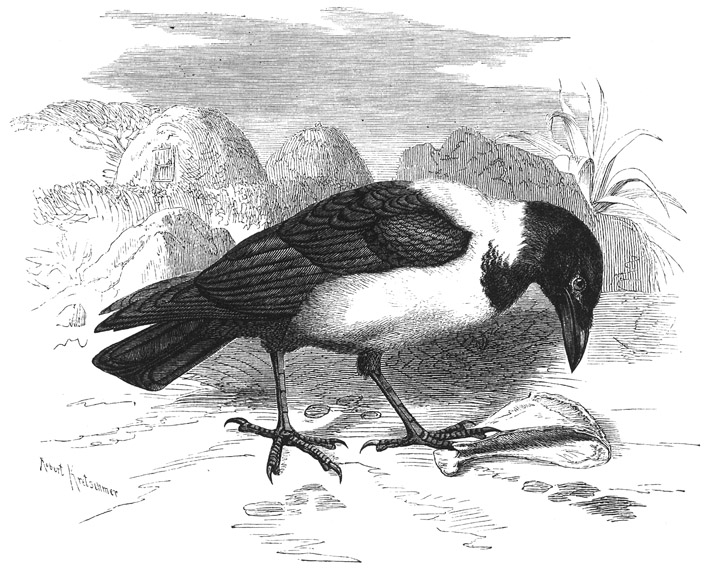
Schildrabe (Corvus scapulatus). 3/10 natürl. Größe.
Das Verbreitungsgebiet des Schildraben erstreckt sich über Mittel- und Südafrika nebst Madagaskar und vom Meeresgestade bis zu viertausend Meter unbedingter Höhe. Im ganzen Sudân und auch in den Tiefebenen Abessiniens ist er eine regelmäßig vorkommende, wenn auch nicht gerade gemeine Erscheinung. Er tritt in der Ebene überall, im Gebirge dagegen an manchen Orten gar nicht auf. Ich habe ihn gewöhnlich paarweise gefunden. Zuweilen vereinigen sich übrigens mehrere Paare zu einer kleinen Gesellschaft, welche jedoch niemals längere Zeit zusammenbleibt. In größeren Scharen habe ich ihn nicht bemerkt. Hartmann sagt, daß ihn der Vogel nicht bloß durch seine Befiederung, sondern auch durch sein heiteres Wesen an die Elster erinnert habe: ich meinestheils glaube gefunden zu haben, daß er unseren Kolkraben mehr als allen übrigen Verwandten entspricht. Sein Flug ist gewandt, leicht, schwebend und sehr schnell; dabei nimmt sich der Vogel prächtig aus. Die spitzigen Schwingen und der abgerundete Schwanz geben ihm beinahe etwas falkenartiges, und der weiße Brustfleck schimmert auf weit hin. Sein Gang ist ernst und würdevoll, aber doch leicht und fördernd, seine Stimme ist ein sanftes »Kurr«.
In allen Gegenden, wo der Schildrabe häufig ist, hat er sich mit dem Menschen befreundet. Scheu fand ich ihn nur in manchen Theilen der Samhara; doch war es auch hier mehr die fremdartige, ihm auffallende Erscheinung des Europäers als die Furcht vor dem Menschen überhaupt, welche ihn bedenklich machte. Am Lagerplatze einer Karawane scheut er sich auch vor dem Europäer nicht mehr. In den Küstendörfern der Samhara ist er regelmäßiger Gast; im Dorfe Ed sah ich ihn auf den Firsten der Strohhütten sitzen wie die Nebel- oder Saatkrähe auf unseren Gebäuden. Sein Horst wird auf einzelnen Bäumen der Steppe oder des lichteren Waldes angelegt und enthält in den ersten Monaten der großen Regenzeit drei bis vier Eier. Ich habe dieselben nicht gesehen, aber genügende Beschreibungen von ihnen erhalten. Sie scheinen denen der übrigen Raben in jeder Hinsicht zu ähneln. Gegen die Jungen zeigt sich das Elternpaar außerordentlich zärtlich, und muthvoll stößt es falkenartig auf den sich nahenden Menschen herab.
Im ganzen Ostsudân wie in Habesch wird der Schildrabe von dem Menschen geduldet oder, wenn man will, nicht beachtet. Als eigentlich unreinen Vogel betrachtet man ihn nicht; doch fällt es niemand ein, sich seiner zu bemächtigen und sein Fleisch zu benutzen. In Gefangenschaft benimmt er sich ganz ähnlich wie der Kolkrabe.
Die Krähen, welche man in einer besonderen Untersippe (Corone) vereinigen darf, unterscheiden sich von den Raben durch verhältnismäßig kleinen Schnabel, nur abgerundeten, nicht aber abgestuften Schwanz und sehr lockeres, wenig glänzendes Gefieder.
Zwei Arten dieser Gruppe, welche in unserem Vaterlande ständig vorkommen, gleichen sich in der Größe so vollständig, daß sie, gerupft, schwerlich zu unterscheiden sein dürften, paaren sich auch nicht selten unter einander, und sind deshalb seit geraumer Zeit der Zankapfel der Vogelkundigen gewesen. Einzelne von diesen vertreten mit aller Entschiedenheit die Ansicht, daß beide nur als klimatische Ausartungen eines und desselben Thieres zu betrachten seien; ich glaube mit derselben Entschiedenheit das Gegentheil behaupten zu dürfen, weil die Verbreitung der Vögel jener Annahme widerspricht.
Die Rabenkrähe (Corvus corone, subcorone, pseudocorone, hiemalis und assimilis, Corone corone) ist schwarz mit veilchen- oder purpurfarbenem Schiller und braunem Augensterne, in der Jugend mattschwarz mit grauem Augensterne. Die Nebelkrähe (Corvus cornix, cinereus, subcornix und tenuirostris, Corone cornix) dagegen ist nur auf Kopf, Vorderhals, Flügeln und Schwanz schwarz, übrigens hell aschgrau oder bei den Jungen schmutzig aschgrau. Die Länge beträgt bei der einen wie bei der anderen siebenundvierzig bis funfzig, die Breite einhundert bis einhundertundvier, die Fittiglänge dreißig, die Schwanzlänge zwanzig Centimeter.
Die Nebelkrähe ist weiter verbreitet als ihre Verwandte; denn ihr begegnen wir nicht allein in Skandinavien, vom Nordkap bis Falsterbo, im größten Theile Rußlands und in Norddeutschland, sondern auch in Galizien, Ungarn, Steiermark, Süditalien, Griechenland und in ganz Egypten, hier vom Meere an bis zur Grenze Nubiens, sowie in ganz Mittelasien, vom Ural an bis Afghanistan und Japan. Die Rabenkrähe hingegen lebt in Mittel- und Süddeutschland, in Frankreich, aber auch in einem großen Theile Asiens, regelmäßig da, wo die Nebelkrähe nicht auftritt. Eine ersetzt also die andere, ohne sich jedoch irgendwie an die Verschiedenheit des Klimas zu binden, und deshalb eben kann von einem Einflusse desselben durchaus keine Rede sein. Nun gibt es aber allerdings Gegenden, wo die Verbreitungskreise der beiden Arten an einander stoßen, und hier geschieht es in der That häufig, daß die beiden so innig verwandten Vögel eine Mischlingsehe eingehen; diese Thatsache beweist aber keineswegs, daß die beiden Krähen, weil sie sich paaren, gleichartig sein müssen. Bildeten beide wirklich nur eine Art, so wäre es unbegreiflich, warum da, wo die eine ausschließlich auftritt, nicht auch einmal die andere vorkommen könnte.
Hinsichtlich der Lebensweise unterscheiden sich Raben- und Nebelkrähe allerdings nicht, wenigstens unseren blöden Sinnen nicht. Beide sind Stand- oder höchstens Strichvögel. Sie halten sich paarweise zusammen und bewohnen gemeinschaftlich ein größeres oder kleineres Gebiet, aus welchem sie sich selten entfernen. Strenge Winterkälte macht insofern eine Ausnahme, daß die im Norden lebenden Paare kurze Streifzüge nach Süden hin antreten, wogegen die Mitglieder derselben Art in südlichen Ländern kaum an Umherstreichen denken. Feldgehölze bilden ihre liebsten Aufenthaltsorte; sie meiden aber auch größere Waldungen nicht und siedeln sich da, wo sie sich sicher wissen, selbst in unmittelbarer Nähe des Menschen, also beispielsweise in Baumgärten an. Sie sind gesellig in hohem Grade, leiblich wie geistig begabt und somit befähigt, eine sehr bedeutsame Rolle zu spielen. Sie gehen gut, schrittweise, zwar etwas wackelnd, jedoch ohne jede Anstrengung, fliegen leicht und ausdauernd, wenn auch minder gewandt als die eigentlichen Raben, sind feinsinnig, namentlich was Gesicht, Gehör und Geruch anlangt, und stehen an geistigen Fähigkeiten kaum oder nicht hinter dem Kolkraben zurück. Im kleinen leisten sie ungefähr dasselbe, was der Rabe im großen auszuführen vermag; da sie aber regelmäßig bloß kleineren Thieren gefährlich werden, überwiegt der Nutzen, welchen sie stiften, wahrscheinlich den Schaden, den sie anrichten. Man darf mit aller Bestimmtheit annehmen, daß sie zu den wichtigsten Vögeln unserer Heimat gehören, daß ohne sie die überall häufigen und überall gegenwärtigen schadenbringenden Wirbelthiere und verderblichen Kerbthiere in der bedenklichsten Weise überhand nehmen würden. Vogelnester plündern allerdings auch sie aus, und einen kranken Hasen und ein Rebhuhn überfallen sie ebenfalls; sie können auch wohl im Garten und im Gehöfte mancherlei Unfug stiften und endlich das reifende Getreide, insbesondere die Gerste, in empfindlicher Weise brandschatzen: was aber will es sagen, wenn sie während einiger Monate in uns unangenehmer Weise stehlen und rauben, gegenüber dem Nutzen, welchen ihre Thätigkeit während des ganzen übrigen Jahres dem Menschen bringt! Der kleine Bauer, dessen Gerstenfelder sie in dreister und merklicher Weise plündern, ist berechtigt, das fast ungehinderte Anwachsen ihres Bestandes mit mißgünstigem Auge anzusehen und selbst zu beschränken; der Jäger wird sich ebenfalls nicht nehmen lassen, dann und wann sein Gewehr auf sie zu richten: der Land- und Forstwirt aber dürfte sehr wohl thun, sie zu schützen. Es ist ein Irrthum, zu glauben, daß der Mensch die Thätigkeit der Krähen zu ersetzen im Stande sei, und daher zu beklagen, wenn man zum Beispiel Gift gegen Mäusefraß auslegt und dadurch kaum mehr Mäuse vertilgt als Krähen, welche ihrerseits das gefräßige Heer in der umfassendsten und erfolgreichsten Weise bekämpfen, da mit aller Bestimmtheit behauptet werden kann, daß durch den Tod einer einzigen Krähe der Land- und Forstwirtschaft weit größerer Schaden erwächst als durch die Thätigkeit von zehn lebenden. Vor allem hüte man sich, einzelne Beobachtungen zu verallgemeinern. Ebenso wie der Staar, der nützlichste aller deutschen Vögel, in Weinbergen nicht geduldet werden kann, verursachen auch die im allgemeinen wesentlich nützlichen Krähen unter besonderen Umständen an einzelnen Orten, selbst in ganzen Gegenden, dann und wann merklichen, sogar empfindlichen Schaden, sei es, daß sich eine einzelne zum Uebelthäter herangebildet oder ein ganzes Geschlecht von solchen entwickelt habe: und dennoch würde es falsch sein, der Gesammtheit jene Unthaten entgelten zu lassen.
Das tägliche Leben der Krähen ist ungefähr folgendes: Sie fliegen vor Tagesanbruch auf und sammeln sich, so lange sie nicht Verfolgung erfahren, ehe sie nach Nahrung ausgehen, auf einem bestimmten Gebäude oder großen Baume. Von hier aus vertheilen sie sich über die Felder. Bis gegen Mittag hin sind sie eifrig mit Aufsuchen ihrer Nahrung beschäftigt. Sie schreiten Felder und Wiesen ab, folgen dem Pflüger, um die von ihm bloßgelegten Engerlinge aufzusammeln, lauern vor Mäuselöchern, spähen nach Vogelnestern umher, untersuchen die Ufer der Bäche und Flüsse, durchstöbern die Gärten, kurz, machen sich überall zu schaffen. Dabei kommen sie gelegentlich mit anderen ihrer Art zusammen und betreiben ihre Arbeit zeitweilig gemeinschaftlich. Ereignet sich etwas auffallendes, so sind sie gewiß die ersten, welche es bemerken und anderen Geschöpfen anzeigen. Ein Raubvogel wird mit lautem Geschrei begrüßt und so eifrig verfolgt, daß er oft unverrichteter Sache abziehen muß. Snell hat sehr Recht, wenn er auch diese Handlungsweise der Krähen als Nutzen hervorhebt; denn es unterliegt keinem Zweifel, daß die räuberische Thätigkeit der schädlichen Raubvögel durch die Krähen bedeutend gehindert wird, sei es, indem sie den Raubvogel unmittelbar angreifen, sei es, indem sie ihn dem Menschen und den Thieren verrathen. Gegen Mittag fliegen die Krähen einem dichten Baume zu und verbergen sich hier im Gelaube desselben, um Mittagsruhe zu halten. Nachmittags gehen sie zum zweiten Male nach Nahrung aus, und gegen Abend versammeln sie sich in zahlreicher Menge auf bestimmten Plätzen, gleichsam in der Absicht, hier gegenseitig die Erlebnisse des Tages auszutauschen. Dann begeben sie sich zum Schlafplatze, einem bestimmten Waldtheile, welcher alle Krähen eines weiten Gebietes vereinigt. Hier erscheinen sie mit größter Vorsicht, gewöhnlich erst, nachdem sie mehrmals Späher vorausgesandt haben. Sie kommen nach Einbruch der Nacht an, fliegen still dem Orte zu und setzen sich so ruhig auf, daß man nichts als das Rauschen der Schwingen vernimmt. Nachstellungen machen sie im höchsten Grade scheu. Sie lernen den Jäger sehr bald von dem ihnen ungefährlichen Menschen unterscheiden und vertrauen überhaupt nur dem, von dessen Wohlwollen sie sich vollständig überzeugt haben.
Im Februar und März schließen sich die einzelnen Paare noch enger als sonst an einander, schwatzen in liebenswürdiger Weise zusammen, und das Männchen macht außerdem durch sonderbare Bewegungen oder Verneigungen und eigenthümliches Breiten der Schwingen seiner Gattin in artiger Weise den Hof. Der Horst, welcher zu Ende des März oder im Anfange des April auf hohen Bäumen angelegt oder, wenn vorjährig, für die neue Brut wieder hergerichtet wird, ähnelt dem des Kolkraben, ist aber bedeutend kleiner, höchstens sechzig Centimeter breit und nur vier Centimeter tief. Auf die Unterlage dürrer Zweige folgen Baststreifen, Grasbüsche, Quecken und andere Wurzeln, welche sehr oft durch eine Lage lehmiger Erde verbunden werden, wogegen die Ausfütterung der Mulde aus Wolle, Kälberhaaren, Schweinsborsten, Baststückchen, Grashalmen, Moosstengeln, Lumpen und dergleichen besteht. In der ersten Hälfte des April legt das Weibchen drei bis fünf, höchst selten sechs Eier, welche etwa einundvierzig Millimeter lang, neunundzwanzig Millimeter dick und auf blaugrünlichem Grunde mit olivenfarbenen, dunkelgrünen, dunkel aschgrauen und schwärzlichen Punkten und Flecken gezeichnet sind. Das Weibchen brütet allein, wird aber nur dann vom Männchen verlassen, wenn dieses wegfliegen muß, um für sich und die Gattin Nahrung zu erwerben. Die Jungen werden mit der größten Liebe von beiden Eltern gepflegt, gefüttert und bei Gefahr muthvoll vertheidigt.
Paarung beider Arten geschieht ohne zwingende Nothwendigkeit; wenigstens kann man nicht annehmen, daß da, wo es so viele Krähen gibt, ein Weibchen in die Verlegenheit kommen könne, ein Männchen von der anderen Art suchen zu müssen oder umgekehrt. Naumann hat beobachtet, daß das Männchen einer Rabenkrähe, dessen Weibchen er getödtet hatte, einem Nebelkrähenweibchen sich anpaarte und mit diesem brütete, es also durchaus nicht für nöthig fand, eine gleichartige Gattin zu suchen. Die aus derartiger Ehe herrührenden Blendlinge ähneln entweder dem Vater und bezüglich der Mutter, oder aber sie stehen hinsichtlich ihrer Färbung zwischen beiden Eltern mitten inne, wenn auch nicht in der strengen Bedeutung des Wortes; denn es ist geradezu unmöglich, die unendliche Menge der Farbenverschiedenheiten, welche jene zeigen, anzugeben. Nun soll es, und zwar ebenfalls nicht selten, auch vorkommen, daß zwei Blendlinge mit einander sich paaren und Junge erzeugen, welche, wie man sagt, immer wieder in die beiden Hauptarten zurückschlagen, das heißt entweder die Färbung der Rabenkrähe zeigen, oder das Kleid der Nebelkrähe erhalten. Hierauf hauptsächlich begründet sich die Auffassung einiger Naturforscher, daß man beide Krähen als gleichartig zu betrachten habe. Ich glaube, daß diese Ansicht schon aus dem Grunde bedenklich ist, weil wir über Bastarde noch keineswegs hinlänglich unterrichtet sind, also gar nicht sagen können, ob sich eine Bastardfärbung wirklich durch Geschlechter hindurch erhält oder nicht.
Beide Krähenarten lassen sich ohne irgend welche Mühe jahrelang in Gefangenschaft erhalten und leicht zähmen, lernen auch sprechen, falls es dem Lehrer nicht an Ausdauer fehlt. Doch sind sie als Stuben- oder Hausvögel kaum zu empfehlen. Aus dem Zimmer verbannt sie ihre Unreinlichkeit oder richtiger der Geruch, welchen sie auch dann verbreiten, wenn ihr Besitzer den Käfig nach Kräften rein zu halten sich bemüht; im Gehöfte oder Garten aber darf man auch sie nicht frei umherlaufen lassen, weil sie ebenso wie der Rabe allerlei Unfug stiften. Die Sucht, glänzende Dinge aufzunehmen und zu verschleppen, theilen sie mit ihren schwächeren Verwandten, die Raub- und Mordlust mit dem Kolkraben. Auch sie überfallen kleine Wirbelthiere, selbst junge Hunde und Katzen, hauptsächlich aber Geflügel, um es zu tödten oder wenigstens zu martern. Hühner- und Taubennester werden von den Strolchen bald entdeckt und rücksichtslos geplündert.
Im Fuchse und im Baummarder, im Wanderfalken, Habicht und Uhu haben die Krähen Feinde, welche ihnen gefährlich werden können. Außerdem werden sie von mancherlei Schmarotzern, die sich in ihrem Gefieder einnisten, belästigt. Es ist wahrscheinlich, daß der Uhu den außerordentlichen Haß, welchen die Krähen gegen ihn an den Tag legen, durch seine nächtlichen Anfälle auf letztere, dann wehrlosen, Vögel sich zugezogen hat; man weiß wenigstens mit Bestimmtheit, daß er außerordentlicher Liebhaber von Krähenfleisch ist. Seine nächtlichen Mordthaten werden von den Krähen nach besten Kräften vergolten. Weder der Uhu noch eine andere Eule dürfen sich bei Tage sehen lassen. Sobald einer der Nachtvögel entdeckt worden ist, entsteht ungeheurer Aufruhr in der ganzen Gegend. Sämmtliche Krähen eilen herbei und stoßen mit beispielloser Wuth auf diesen Finsterling in Vogelgestalt. In ähnlicher Weise wie den König der Nacht necken die Krähen auch alle übrigen Raubthiere, vor deren Rache ihre Fluggewandtheit oder ihre Menge augenblicklich sie schützt. Durch den Menschen haben sie gegenwärtig weniger unmittelbar als mittelbar zu leiden. Hier und da verfolgt man sie regelrecht auf der Krähenhütte, zerstört und vernichtet auch wohl ihre Nester und Bruten; viel mehr als derartige Unternehmungen aber schadet ihnen das Ausstreuen vergifteter Körner auf den von Mäusen heimgesuchten Feldern. In Mäusejahren findet man ihre Leichen zu dutzenden und hunderten und kann dann erhebliche Abnahme ihres Bestandes leicht feststellen. Doch gleicht ihre Langlebigkeit und Fruchtbarkeit derartige Verluste immer bald wieder aus, und somit ist es ebensowenig nöthig, Schutzmaßregeln zu ihren Gunsten zu empfehlen, als räthlich, einen Ausrottungskrieg gegen sie zu predigen.
Nützlicher noch als Raben- und Nebelkrähe erweist sich die vierte unserer Rabenarten, die Saatkrähe, Feld-, Hafer- und Ackerkrähe, Krahenveitel, Karechel, Kurock, Rooke, Nackt- oder Grindschnabel ( Corvus frugilegus, agricola, agrorum, granorum und advena, Frugilegus segetum, Coloeus und Trypanocorax frugilegus). Sie unterscheidet sich von den eigentlichen Krähen durch schlankeren Leibesbau, sehr gestreckten Schnabel, verhältnismäßig lange Flügel, stark abgerundeten Schwanz, knappes, prachtvoll glänzendes Gefieder und ein im Alter nacktes Gesicht, welch letzteres jedoch nur Folge von ihren Arbeiten im Boden ist, und gilt daher als Vertreter einer besonderen gleichnamigen Untersippe ( Coloeus). Ihre Länge beträgt siebenundvierzig bis funfzig, die Breite etwa einhundert, die Fittiglänge fünfunddreißig, die Schwanzlänge neunzehn Centimeter. Das Gefieder der alten Vögel ist gleichmäßig purpurblauschwarz, das der Jungen mattschwarz. Letztere unterscheiden sich von den Alten auch durch ihr befiedertes Gesicht.
Die Saatkrähe, hinsichtlich ihrer Verbreitung beschränkter als Raben- und Nebelkrähe, bewohnt die Ebenen Südeuropas und des südlichen Sibirien, Afghanistan, Kaschmir etc. Schon in Schweden ist sie selten, und in Südeuropa erscheint sie nur auf ihrer Winterreise. Abweichend von ihren bisher genannten Verwandten wandert sie regelmäßig, und zwar in unzählbaren Scharen, bis Südeuropa und Nordafrika. In Spanien habe ich sie während des ganzen Winters, von Ende des Oktober an bis zu Anfang des März, häufig und immer in zahlreichen Banden gesehen, in Egypten in denselben Monaten ebenso regelmäßig beobachtet. Fruchtbare Ebenen, in denen es Feldgehölze gibt, sind der eigentliche Aufenthaltsort dieser Krähe. Im Gebirge fehlt sie als Brutvogel gänzlich. Ein hochstämmiges Gehölz von geringem Umfange wird zum Nistplatze und bezüglich zum Mittelpunkte einer gewissen, oft sehr erheblichen Anzahl dieser Krähen, und von hier aus vertheilen sie sich über die benachbarten Felder.
In ihrem Betragen hat die Saatkrähe manches mit ihren beschriebenen Verwandten gemein, ist aber weit furchtsamer und harmloser als diese. Ihr Gang ist ebenso gut, ihr Flug leichter, ihre Sinne sind nicht minder scharf, und ihre geistigen Kräfte in gleichem Grade entwickelt als bei den übrigen Krähen; doch ist sie weit geselliger als alle Verwandten. So vereinigt sie sich gern mit Dohlen und Staaren, überhaupt mit Vögeln, welche ebenso schwach oder schwächer sind als sie, während sie Raben- und Nebelkrähe schon meidet und den Kolkraben so fürchtet, daß sie sogar eine altgewohnte Niederung, aus welcher sie der Mensch kaum vertreiben kann, verläßt, wenn sich ein Kolkrabe hier häuslich niederläßt. Doch habe ich in Sibirien Nebel- und Saatkrähen, Dohlen und Raben gleichzeitig an einem Aase schmausen sehen. Ihre Stimme ist ein tiefes, heiseres »Kra« oder »Kroa«; im Fliegen aber hört man oft ein hohes »Girr« oder »Quer« und regelmäßig auch das »Jack jack« der Dohle. Es wird ihr leicht, mancherlei Töne und Laute nachzuahmen; sie soll sogar in gewissem Grade singen lernen, läßt sich dagegen kaum zum Sprechen abrichten.
Wenn man die Saatkrähe vorurtheilsfrei beobachtet, lernt man sie achten. Auch sie kann da, wo sie sich fest ansiedelt und allen Bemühungen des Menschen, sie zu vertreiben, den hartnäckigsten Widerstand entgegensetzt, in Lustgärten während der Nistzeit die Wege in der abscheulichsten Weise beschmutzt oder in Gehölzen nahe menschlichen Wohnungen durch ihr ewiges Geplärre die Gehörnerven fast betäubt, sehr unangenehm werden; auch sie kann wohl ab und zu einmal ein kleines Häschen erwürgen oder ein junges, mattes Rebhuhn übertölpeln; sie kann ferner den Landmann durch Auflesen von Getreidekörnern und den Gärtner durch Wegstehlen reifender Früchte ärgern: aber derselbe Vogel bezahlt jeden Schaden, welchen er anrichtet, tausendfältig. Er ist der beste Vertilger der Maikäfer, ihrer Larven und der Nacktschnecken, auch einer der trefflichsten Mäusejäger, welchen unser Vaterland aufzuweisen hat. Bei der Maikäferjagd geht diese Krähe, wie Naumann beobachtete, regelrecht zu Werke. »Einige fliegen auf den Baum, an dessen Zweigen und jungen Blättern die Maikäfer in Menge sitzen, suchen da ab, was nicht durch die Erschütterung, welche sie durch ihr Niederlassen auf die Spitze der Zweige verursachen, herabfällt; andere lesen unter dem Baume auf, was ihnen jene herunterschütteln. In dieser Art verfahren sie mit jedem Baume nach der Reihe und vernichten so eine unschätzbare Menge dieser schädlichen Kerfe. Die dem Getreide so nachtheiligen Brachkäfer und die kleinen Rosenkäfer haben an ihnen auch sehr schlimme Feinde.« Sie lesen die Larven derselben ebenso wie die Maikäferlarven und Regenwürmer entweder auf den frischgefurchten Aeckern und hinter dem Pfluge her auf, oder ziehen sie mit ihrem Schnabel aus der Erde heraus. Ihr feiner Geruch scheint ihnen das Vorhandensein einer derartigen Larve unfehlbar anzuzeigen, und sie bohren dann so lange in dem Boden, bis sie der Beute habhaft geworden sind. Ebenso eifrig, wie die Saatkrähe Kerbthiere verfolgt, jagt sie hinter den Mäusen her. »Ich habe«, sagt Naumann, »Jahre erlebt, in denen eine erschreckliche Menge Feldmäuse den grünenden und reifenden Saaten Untergang drohten. Oft sah man auf den Roggen- und Weizenfeldern ganze Striche von ihnen theils abgefressen, theils umgewühlt; aber immer fanden sich eine große Menge Raubvögel und Krähen ein. welche das Land, allerdings mit Hülfe der den Mäusen ungünstigen Witterung, bald gänzlich von den Plagegeistern befreiten. Ich schoß in jenen Jahren weder Krähen noch Bussarde, welche nicht ihren Kropf von Mäusen vollgepfropft gehabt hätten. Oft habe ich ihrer sechs bis sieben in einem Vogel gefunden. Erwägt man diesen Nutzen, so wird man, glaube ich, besser gegen die gehaßten Krähen handeln lernen und sie lieb gewinnen.«
Man sollte meinen, daß diese nun schon vor fast sechzig Jahren ausgesprochene Wahrheit bei den in Frage kommenden Leuten, namentlich bei unseren größeren Gutsbesitzern, doch endlich anerkannt worden wäre; dem ist aber leider nicht so. Noch heutigen Tages wird die Saatkrähe, dieser unersetzliche Wohlthäter der Felder, gerade von diesen Gutsbesitzern in der rücksichtslosesten Weise verfolgt. Man hat in England erfahren, daß in Gegenden, in denen wirklich alle Saatkrähen vernichtet worden waren, jahrelang nach einander Mißernten kamen, und man ist dann klug genug gewesen, die Vögel zu schonen. Unsere großen oder kleinen Bauern freilich wissen davon nichts oder wollen davon nichts wissen und stellen sich durch ihr alljährlich wiederkehrendes, als Fest gefeiertes Krähenschießen ein nicht eben schmeichelhaftes Zeugnis ihres Bildungsgrades aus.
Wenn die Brutzeit herannaht, sammeln sich tausende dieser schwarzen Vögel auf einem sehr kleinen Raume, vorzugsweise in einem Feldgehölze. Paar wohnt bei Paar; auf einem Baume stehen funfzehn bis zwanzig Nester, überhaupt so viele, als er aufnehmen kann. Jedes Paar zankt sich mit dem benachbarten um die Baustoffe, und eines stiehlt dem anderen nicht nur diese, sondern sogar das ganze Nest weg. Ununterbrochenes Krächzen und Geplärre erfüllt die Gegend, und eine schwarze Wolke von Krähen verfinstert die Luft in der Nähe dieser Wohnsitze. Endlich tritt etwas Ruhe ein. Jedes Weibchen hat seine vier bis fünf, achtunddreißig Millimeter langen, siebenundzwanzig Millimeter dicken, blaßgrünen, aschgrau und dunkelbraun gefleckten Eier gelegt und brütet. Bald aber entschlüpfen die Jungen, und nun verdoppelt oder verdreifacht sich der Lärm; denn jene wollen gefüttert sein und wissen ihre Gefühle sehr vernehmlich durch allerlei unliebsame Töne auszudrücken. Dann ist es in der Nähe einer solchen Ansiedelung buchstäblich nicht zum Aushalten. Nur die eigentliche Nacht macht das Geplärre verstummen; es beginnt aber bereits vor Tagesanbruch und währt bis lange nach Sonnenuntergang ohne Aufhören fort. Wer eine solche Ansiedelung besucht, wird bald ebenso bekalkt wie der Boden um ihn her, welcher infolge des aus den Nestern herabfallenden Mistregens greulich anzuschauen ist. Dazu kommt nun die schon erwähnte Hartnäckigkeit der Vögel. Sie lassen sich so leicht nicht vertreiben. Man kann ihnen Eier und Junge nehmen, so viel unter sie schießen, als man will: es hilft nichts – sie kommen doch wieder. Mit Vergnügen erinnere ich mich der Anstrengung, welche der hochwohlweise Rath der guten Stadt Leipzig machte, um sich der Saatkrähen, welche sich auf einem Spaziergange angesiedelt hatten, zu entledigen. Zuerst wurde die bewehrte Mannschaft aufgeboten, hierauf sogar die Scharfschützen in Bewegung gesetzt: nichts wollte fruchten. Da griff man, wie es schien in Verzweiflung, zu dem letzten Mittel: man zog die blutrothe Fahne des Umsturzes auf. Buchstäblich wahr: rothe Fahnen flatterten unmittelbar neben und über den Nestern lustig im Winde, zum Grauen und Entsetzen aller friedliebenden Bürger. Aber die Krähen ließen sich auch durch das verdächtige Roth nicht vertreiben. Erst als man ihnen ebenso hartnäckig ihre Nester immer und immer wieder zerstörte, verließen sie den Ort. Solche Uebelthaten sind allerdings nicht geeignet, urtheilslose Menschen mit den Saatkrähen zu befreunden; wer aber ihre Nützlichkeit würdigt, wird sie wenigstens in Feldgehölzen, welche von Wohnungen entfernt sind, gern gewähren lassen.
So groß auch die Menge ist, welche eine Ansiedelung bevölkert: mit den Massen, welche sich gelegentlich der Winterreise zusammenschlagen, kann sie nicht verglichen werden. Tausende gesellen sich zu tausenden, und die Heere wachsen umsomehr an, je länger die Reise währt. Sie verstärken sich nicht bloß durch andere Saatkrähen, sondern auch durch Dohlen. »In dem ungünstigen Frühlinge 1818«, erzählt mein Vater, »sah ich einen Schwarm dieser Krähen an der Kante eines Waldes. Er bedeckte im Umkreise mehrerer Geviertkilometer alle Bäume und einen großen Theil der Felder und Wiesen. Gegen Abend erhob sich der ganze Schwarm und verfinsterte da, wo er am dichtesten zusammengedrängt war, im eigentlichen Sinne die Luft. Die Bäume des nahen Fichtenwaldes reichten kaum hin, den unzähligen Vögeln Schlafstellen abzugeben.« Ziehende Saatkrähen entfalten alle Künste des Fluges. Ueber die Berge fliegt der Schwarm gewöhnlich niedrig, über die Thäler oft in großer Höhe dahin. Plötzlich fällt es einer ein, dreißig bis hundert Meter herabzusteigen; dies aber geschieht nicht langsam und gemächlich, sondern jäh, sausend, so wie ein lebloser Körper aus großer Höhe zu Boden stürzt. Der einen folgen sofort eine Menge andere, zuweilen der ganze Flug, und dann erfüllt die Luft ein auf weithin hörbares Brausen. Unten, hart über dem Boden angekommen, fliegen die Saatkrähen gemächlich weiter, erheben sich hierauf allgemach wieder in die Höhe, schrauben sich nach und nach mehr empor und ziehen kaum eine Viertelstunde später, dem Auge als kleine Pünktchen erscheinend, in den höchsten Luftschichten weiter. Im Süden Europas oder in Nordafrika sieht man selten so große Flüge der Saatkrähe wie bei uns. Das gewaltige Heer, welches sich allgemach sammelte, hat sich nach und nach wieder in einzelne Haufen zertheilt; diese aber suchen verschiedene Oertlichkeiten bestmöglichst auszubeuten. Aber es geht ihnen, namentlich in Afrika, oft recht schlimm in der Fremde. Das fruchtbare Nilthal scheint für alle eingewanderten Saatkrähen nicht Raum und Nahrung genug zu haben. Sie fliegen dann in die umliegenden Wüsten nach Futter aus, finden es nicht und erliegen zu Hunderten dem Mangel. Die Mosesquellen in der Nähe von Sues werden von Palmen umgeben und letztere von den schwarzen Wintergästen zum Schlafplatze gewählt. Hier fand ich einmal den Boden bedeckt von todten Saatkrähen, buchstäblich Hunderte von Leichen neben einander. Sie alle waren verhungert.
Die Feinde, welche der Saatkrähe nachstellen, sind dieselben, welche auch die verwandten Arten bedrohen. In Gefangenschaft ist sie weniger unterhaltend und minder anziehend, wird daher auch seltener im Käfige gehalten als Rabe und Dohle.
Der Zwerg unter unseren deutschen Raben ist die Dohle, Thurmkrähe, Thalke, Thalicke, Dachlücke, Geile, Kaike, Elke und Tschokerle ( Corvus monedula, collaris und spermologus, Monedula turrium, arborea, septentrionalis und spermologos, Coloeus monedula, Lycus monedula und collaris), welche des kurzen und starken, oben wenig gebogenen Schnabels wegen ebenfalls als Vertreter einer besonderen Sippe oder Untersippe ( Lycus) angesehen wird. Die Länge beträgt dreiunddreißig, die Breite fünfundsechzig, die Fittiglänge zweiundzwanzig, die Schwanzlänge dreizehn Centimeter. Das Gefieder ist auf Stirn und Scheitel dunkelschwarz, auf Hinterkopf und Nacken aschgrau, auf dem übrigen Oberkörper blauschwarz, auf der Unterseite schiefer- oder grauschwarz, der Augenring silberweiß, der Schnabel wie der Fuß schwarz. Die Jungen unterscheiden sich durch schmutzigere Farben und graues Auge.
Auch die Dohle findet sich nicht bloß im größten Theile Europas, sondern ebenso in vielen Ländern Asiens, nach Norden hin mindestens soweit, als der Getreidebau reicht, sich verbreitend. Im Süden Europas ist sie seltener als in Deutschland, nirgends aber so häufig wie in Rußland und Sibirien. Bei uns zu Lande tritt sie keineswegs allerorten, sondern nur hier und da auf, ohne daß man hierfür einen stichhaltigen Grund zu finden wüßte. Wo sie vorkommt, bewohnt sie hauptsächlich die alten Thürme der Städte oder andere hohe Gebäude, deren Mauern ihr passende Nistplätze gewähren; außerdem begegnet man ihr in Laubwäldern, namentlich in Feldgehölzen, in denen hohle Bäume stehen. In Rußland und Sibirien bevölkert sie alle Dörfer in Menge, wird den Blockhäusern zum reizenden Schmucke und nistet unter Schindeldächern, hinter den zurückgeklappten Fensterladen und wo sie sonst noch eine Höhlung oder Lücke findet, welche ihrem Neste Raum gewährt. In Spanien trafen wir die wenigen Flüge, denen wir begegneten, unter eigentümlichen Umständen an. Ungeachtet die vielen und in jeder Hinsicht geeigneten Kirchen dieses Landes ihr die passendsten Wohnplätze bieten, sahen wir sie doch niemals in Städten oder Dörfern, sondern einzig und allein in den öden, fast unbewohnten Theilen des sogenannten Campo oder des nicht der Bewässerung unterworfenen Landstriches. Hier herbergten ihre Schwärme in steil abfallenden Wänden der vom Wasser ausgewaschenen Schluchten. Ein dort hausender Bauer erzählte uns, daß vor wenigen Jahren ein Paar Dohlen in der Nähe seines Gehöftes erschienen sei und sich in einer jener Schluchten angesiedelt habe. Die ausgeflogenen Jungen wären bei den Alten geblieben und hätten das nächste Jahr mit diesen gebrütet. Von Jahr zu Jahr habe der Schwarm zugenommen, bis er die jetzt bedrohliche Stärke erreicht habe; denn keine Frucht gäbe es in der Nähe seiner Behausung, welche von diesen ungebetenen Gästen verschont bliebe. Kein Thier auf der weiten Erde sei so hungrig und gefräßig wie die Dohle. Ihr sei alles recht und nichts vor ihr sicher, nicht einmal die Stachelfeigen, welche sie geschickt aus ihrer Stachelhülle herauszuschälen wisse.
Die Dohle ist ein munterer, lehafter, gewandter und kluger Vogel. Unter allen Umständen weiß sie ihre muntere Laune zu bewahren und die Gegend, in welcher sie heimisch ist, in wirklich anmuthiger Weise zu beleben. Außerordentlich gesellig, vereinigt sie sich nicht nur mit anderen ihrer Art zu starken Schwärmen, sondern mischt sich auch unter die Flüge der Krähen, namentlich der Saatkrähen, tritt sogar mit diesen die Winterreise an und fliegt ihnen zu Gefallen möglichst langsam; denn sie selbst ist auch im Fluge sehr gewandt und gleicht hinsichtlich des letzteren mehr einer Taube als einer Krähe. Das Fliegen wird ihr so leicht, daß sie sich sehr häufig durch allerhand kühne Wendungen zu vergnügen sucht, ohne Zweck und Ziel steigt und fällt und die mannigfachsten, anmuthigsten Schwenkungen in der Luft ausführt. Sie ist ebenso klug wie der Rabe, zeigt aber nur die liebenswürdigen Seiten desselben. Lockend stößt sie ein wirklich wohllautendes »Jäk« oder »Djär« aus; sonst schreit sie »Kräh« und »Krijäh«. Ihr »Jäk jäk« ähnelt dem Lockrufe der Saatkrähe auf das täuschendste, und dies mag wohl auch mit dazu beitragen, beide Vögel so häufig zu verbinden. Während der Zeit ihrer Liebe schwatzt sie allerliebst, wie überhaupt ihre Stimme biegsam und wechselreich ist. Dies erklärt, daß sie ohne sonderliche Mühe menschliche Worte nachsprechen oder andere Laute, z. B. das Krähen eines Hahnes, nachahmen lernt.
Hinsichtlich der Nahrung kommt die Dohle am nächsten mit der Saatkrähe überein. Kerbthiere aller Art, Schnecken und Würmer bilden unzweifelhaft die Hauptmasse ihrer Mahlzeiten. Die Kerbthiere liest sie auf den Wiesen und Feldern zusammen oder von dem Rücken der größeren Hausthiere ab; dem Ackersmanne folgt sie, vertrauensvoll hinter dem Pfluge herschreitend; auf den Straßen durchstöbert sie den Mist und vor den Häusern den Abfall; Mäuse weiß sie geschickt, junge Vögel nicht weniger gewandt zu fangen, und Eier gehören zu ihren besonderen Lieblingsgerichten. Nicht minder gern frißt sie Pflanzenstoffe, namentlich Getreidekörner, Blattspitzen von Getreide, Wurzelknollen, keimende und schossende Gemüse, Früchte, Beeren und dergleichen, kann daher in Gärten und Obstpflanzungen, wenn nicht empfindlich, so doch merklich schädlich werden, plündert in Rußland und Sibirien auch Getreidefeimen und Tennen. Ob man deshalb berechtigt ist, sie als überwiegend schädlichen Vogel zu bezeichnen, erscheint mir zweifelhaft; ich möchte im Gegentheile annehmen, daß der von ihr auf Flur und Feld gestiftete Nutzen den von ihr verursachten Schaden mindestens ausgleicht, falls nicht übersteigt.
Die Dohle zieht im Spätherbste mit den Saatkrähen von uns weg und erscheint zu derselben Zeit wie diese wieder im Vaterlande; nicht wenige ihres Geschlechtes überwintern jedoch auch in Deutschland, insbesondere in unseren Seestädten; ebensowenig verlassen alle Dohlen Rußland und Sibirien, so streng der Winter hier auch auftreten möge. Ihre Winterreise dehnt sie bis Nordwestafrika, Nordwestasien und Indien aus. In Egypten haben sie weder Heuglin noch ich jemals beobachtet, obgleich Rüppell sie dort häufig gefunden haben will; in den Atlasländern dagegen kommt sie vor, und in Spanien, Süditalien, Griechenland, Kleinasien, Armenien, Kaukasien und Kaschmir, woselbst sie freilich überall auch brütet, ist sie regelmäßiger Wintergast. Sobald der Frühling wirklich zur Herrschaft gelangt ist, haben alle Paare die altgewohnten Brutplätze wieder bezogen, und nun regt sich hier tausendfältiges Leben. Einzelne Dohlen nisten unter Saatkrähen, die große Mehrzahl aber auf Gebäuden. Hier findet jede Mauerlücke ihre Bewohner; ja es gibt deren gewöhnlich mehr als Wohnungen. Deshalb entsteht viel Streit um eine geeignete Niststelle, und jede baulustige Dohle sucht die andere zu übervortheilen, so gut sie kann. Nur die schärfste Wachsamkeit schützt ein Paar vor den Diebereien des anderen; ohne die äußerste Vorsicht wird Baustelle und Nest erobert und gestohlen. Das Nest selbst ist verschieden, je nach dem Standorte, gewöhnlich aber ein schlechter Bau aus Stroh und Reisern, welcher mit Heu, Haaren und Federn ausgefüttert wird. Vier bis sechs, fünfunddreißig Millimeter lange, fünfundzwanzig Millimeter dicke, auf blaß blaugrünlichem Grunde schwarzbraun getüpfelte Eier bilden das Gelege. Die Jungen werden mit Kerbthieren und Gewürm groß gefüttert, äußerst zärtlich geliebt und im Nothfalle auf das muthigste vertheidigt. »Läßt sich«, sagt Naumann, »eine Eule, ein Milan oder Bussard blicken, so bricht die ganze Armee mit gräßlichem Geschrei gegen ihn los und verfolgt ihn stundenweit. Wenn sich die Jungen einigermaßen kräftig fühlen, machen sie es wie die jungen Krähen, steigen aus den Nestern und setzen sich vor die Höhlen, in welchen sie ausgebrütet sind, kehren aber abends wieder ins Nest zurück, bis sie sich endlich stark genug fühlen, die Alten aufs Feld zu begleiten.«
Ungeachtet der starken Vermehrung nehmen die Dohlenscharen nur in einzelnen Städten erheblich, in anderen dagegen nicht oder doch nicht merklich zu, ohne daß hierfür die Ursache erkenntlich wäre. »Was wird aus den zahlreichen Jungen?« fragt Liebe. »Wanderfalken und Uhus sind jetzt in Mitteldeutschland viel zu selten geworden, als daß sie wesentlich schaden könnten, und die Unbilden der Witterung thun den abgehärteten und klugen, in den Ortschaften angesiedelten Allesfressern sicher nichts.« Der Mensch befehdet sie bei uns zu Lande nicht, thut aber auch denen, welche wandern, wenig zu Leide, und die außerdem noch zu nennenden Feinde, Hauskatze, Marder, Iltis und Habicht, können dem Bestande doch ebenfalls so erhebliche Verluste nicht zufügen, daß sich ihr geringer Zuwachs erklären ließe.
Kein Rabe wird häufiger gefangen gehalten als die Dohle. Ihr heiteres Wesen, ihre Gewandtheit und Klugheit, ihre Anhänglichkeit an den Gebieter, ihre Harmlosigkeit und ihre Nachahmungsgabe endlich sind wohl geeignet, ihr Freunde zu erwerben. Ohne Mühe kann man jung aufgezogene gewöhnen, aus- und einzufliegen. Sie gewinnen das Haus ihres Herrn bald lieb und verlassen es auch im Herbste nicht oder kehren, wenn sie wirklich die Winterreise mit anderen ihrer Art antreten, ihm nächsten Frühjahre nicht selten zu ihm zurück.
Der Nußknacker oder Tannenheher, Nußrabe, Nußkrähe, Nußbeißer, Nußpicker, Nußprangl, Nußjäägg, Spechtrabe, Stein-, Schwarz-, Berg- und Birkheher, Bergjäck, Zirbelkrähe, Zirbelkrach, Zirmgratschen etc. ( Nucifraga caryocatactes, macrorhynchos, brachyrhynchos platyrhynchos, guttata, hamata, arquata, alpestris und minor, Corvus caryocatactes, Caryocatactes maculatus, guttatus und nucifraga), nimmt innerhalb der Rabenfamilie eine sehr vereinzelte Stellung ein; denn er hat nur in Amerika und im Himalaya Verwandte, welche wirklich mit ihm verglichen werden dürfen. Sein Leib ist gestreckt, der Hals lang, der Kopf groß und platt, der Schnabel lang, schlank und rundlich, auf der Firste gerade oder kaum merklich gekrümmt, an der Spitze niedrig und in einen wagerecht liegenden, breiten Keil auslaufend, der Fuß ziemlich lang und stark mit mäßig langen Zehen, welche mit kräftigen und deutlich gebogenen Nägeln bewehrt sind, der Flügel mittellang, stumpf, mit sehr stark abgestuften Schwingen, unter denen die vierte die längste ist, der Schwanz mittellang und gerundet. Das Gefieder ist dicht und weich, der Hauptfarbe nach dunkelbraun, auf Scheitel und Nacken ungefleckt, an der Spitze jeder einzelnen Feder mit einem reinweißen, länglich runden Flecke besetzt; die Schwingen und Schwanzfedern sind glänzend schwarz, letztere an der Spitze weiß; dieselbe Farbe zeigen auch die Unterschwanzdeckfedern. Die Augen sind braun, der Schnabel und die Füße schwarz. Die Länge beträgt sechsunddreißig, die Breite neunundfunfzig, die Fittiglänge neunzehn, die Schwanzlänge zwölf Centimeter.
Geschlossene Nadelwälder unserer Hochgebirge sowie die ausgedehnten Waldungen des Nordens der Alten Welt bilden die Heimat dieses Vogels, für dessen ständiges Vorkommen die Zirbelkiefer maßgebend ist. Auf unseren Alpen begegnet man ihm ebenso regelmäßig wie im hohen Norden, am häufigsten immer da, wo die gedachten Bäume wachsen. Aber auch er zählt zu den Zigeunervögeln, nimmt seinen Aufenthalt im wesentlichen je nach dem Gedeihen oder Nichtgedeihen der Zirbelnüsse, bewohnt daher im Sommer gewisse Striche in Menge und fehlt in anderen benachbarten gänzlich. So tritt er in den mittleren Theilen Schwedens sehr häufig auf, während er den größten Theil Norwegens nur während seiner Reise besucht. Letztere findet ebenso unregelmäßig statt wie die des Seidenschwanzes. In manchen Jahren ist er während des Winters in Deutschland überall zu finden; dann vergehen wieder viele Jahre, ehe man nur einen einzigen zu sehen bekommt. Im hohen Norden wandert er regelmäßiger, aber nicht immer gleich weit und nicht in jedem Herbste in derselben Anzahl; denn einzig und allein das Mißrathen der Zirbelnüsse treibt ihn vom Norden nach dem Süden hin oder vom Gebirge in die Ebene herab. Dies geschieht wie bei allen Zigeunervögeln in dem einen Jahre früher, in dem anderen später. Vogels sorgfältige Beobachtungen machen es glaublich, daß wir im mittleren und nördlichen Deutschland immer nur hochnordische Gäste, nicht aber solche, welche den Alpen entstammen, zu sehen bekommen, wogegen letztere es sind, welche zeitweilig, manchmal sehr frühzeitig im Sommer, in den tieferen Lagen ihres Wohngebirges erscheinen. So lange sie dort wie hier genügende Nahrung finden, wandern sie nicht, streichen vielmehr nur in sehr beschränktem Grade; wenn ihnen aber die Heimat nicht genügenden Unterhalt bietet, verlassen sie dieselbe, um anderswo ihr tägliches Brod zu suchen. Erzherzog Rudolf von Oesterreich sah sie im Salzkammergute und in Obersteyermark bereits im Juli dieses Jahres (1878) in namhafter Menge in den tieferen Thälern des Gebirges; wir beobachteten in Nordwestsibirien in den ersten Tagen des September 1876, zuerst am achten dieses Monats, unzählbare, sicherlich tausende enthaltende Schwärme in südlicher Richtung dem Ob entgegen ziehend, offenbar in der Absicht, in den im oberen Gebiete des Stromes gelegenen Zirbelbeständen sich festzusetzen. Mißräth die Zirbelnuß, so verlassen sie auch deren Bestände und streichen weiter nach Süden, durchwandern bei dieser Gelegenheit ganz Südskandinavien, Dänemark, Norddeutschland, Belgien und Nordfrankreich, Nordrußland, Sibirien und Nordchina und beenden ihre Wanderungen erst im südlichsten Deutschland, Südfrankreich, Südrußland, den Donautiefländern und den südlichsten Waldländern Nordasiens. Ob solche Wandergäste auch die Alpen überfliegen, bleibt fraglich, da diejenigen, welche man in Norditalien, auf Sardinien und in Südostfrankreich beobachtet und erlegt hat, ebensogut den Alpen wie dem Norden entstammt sein können. Aeußerst selten bleibt ein Paar dieser Wandergäste in den mitteldeutschen Gebirgen oder in den norddeutschen Waldungen zurück, um zu brüten, wogegen der den Alpen benachbarte Schwarzwald wohl allsommerlich brütende Paare beherbergt.
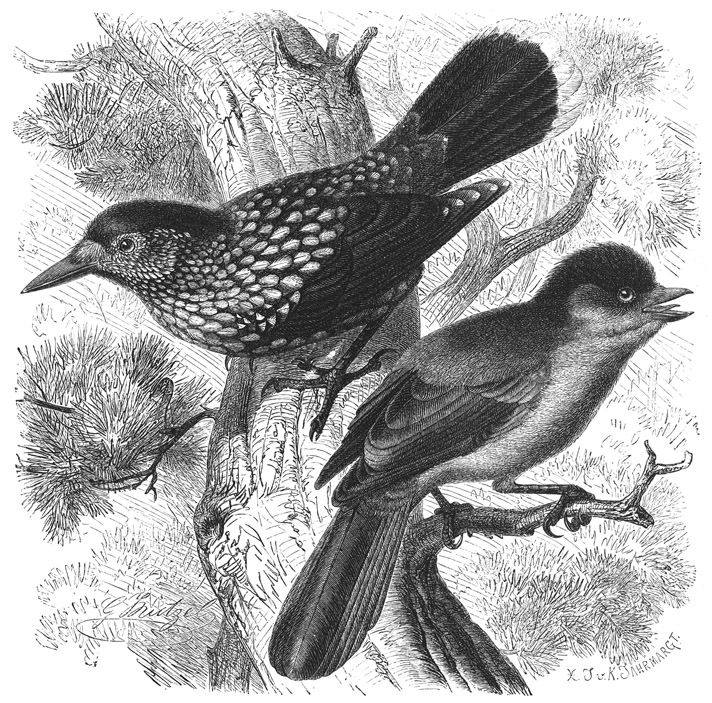
Nußknacker ( Nucifraga caryocatactes) und Unglücksheher ( Perisoreus infaustus). 1/3 natürl. Größe.
Mein Vater hat nicht Unrecht, wenn er sagt, daß der Tannenheher mit dem Eichelheher kaum mehr Aehnlichkeit habe als mit einem Spechte. Der Vogel sieht ungeschickt, sogar tölpisch aus, ist aber ein gewandter und munterer Gesell, welcher auf dem Boden gut geht und mit sehr großer Geschicklichkeit auf den Aesten und Stauden herumhüpft oder sich wie die Meisen an den Stamm klebt, daß man wohl sagen kann, er klettere an den Bäumen herum. Wie ein Specht hängt er sich an Stämme und Zweige, und wie ein Specht meiselt er mit seinem scharfen Schnabel in der Rinde desselben, bis er sie stückweise abgespaltet und die unter ihr sitzende Beute, welche er witterte, erlangt hat. Sein Flug ist leicht, aber ziemlich langsam, mit starker Schwingung und Ausbreitung der Flügel. Die Stellung ist verschieden. Gewöhnlich zieht er die Füße an, trägt den Leib wagerecht, den Kopf eingezogen und läßt die Federn hängen: dann hat er ein plumpes Ansehen, während er schmuck und schlank erscheint, wenn er den Leib erhebt, den Kopf in die Höhe richtet und das Gefieder knapp anlegt. Ungeachtet seines leichten Fluges fliegt er übrigens, falls er nicht auf der Reise ist, ungern weit, läßt sich vielmehr gewöhnlich, wenn er nicht geradezu aufgescheucht ist, bald wieder nieder. Während des Tages ist er viel beschäftigt, jedoch nicht so unruhig und unstet wie der Eichelheher. Seine Stimme ist ein kreischendes, weittönendes »Kräck, kräck, kräck«, welchem er im Frühjahre oft wiederholt »Körr, körr« zufügt. Während der Brutzeit vernimmt man, jedoch nur, wenn man sich ganz in seiner Nähe befindet, auch wohl einen absonderlichen, leisen, halb unterdrückten, bauchrednerischen Gesang. Seine Sinne scheinen wohl entwickelt zu sein. An Verstand steht er einzelnen Mitgliedern seiner Familie wahrscheinlich nach; dumm aber, wie er gescholten worden, ist er nicht. In seinen menschenleeren Wildnissen kommt er so wenig mit dem Erzfeinde der Thiere zusammen, daß er sich diesem gegenüber bei seinen Reisen oft recht einfältig benimmt; erfährt er jedoch Nachstellungen, so beweist auch er, daß er verständig ist. Er flieht dann vor dem Menschen ebenso ängstlich wie vor anderen, ihm von jeher wohl bekannten Feinden, zum Beispiel Raubsäugethieren und Raubvögeln.
Im Hügelgürtel ist es, laut Tschusi, welcher eigene und fremde Beobachtungen in ansprechender Weise zusammengestellt hat, vorzüglich der Haselstrauch, dessen Nüsse die Tannenheher lieben. Sobald die Haselnüsse reifen, versammeln sich alle Nußknacker der ganzen Gegend auf solchen Strecken, welche der Strauch überzieht. Zu dieser Zeit fliegen sie viel herum, und ihre Stimme ist fast überall zu hören. Der Morgen wird dem Aufsuchen der Nahrung gewidmet; gegen Mittag verschwinden die bis dahin emsig arbeitenden Nußknacker im Walde; in den späteren Nachmittagsstunden zeigen sie sich wieder, wenn auch minder zahlreich als am Morgen, in den Büschen. In den Morgenstunden nimmt ihr Schreien und Zanken kein Ende. Jeden Augenblick erscheinen einige, durch jenes Geschrei herbeigelockt, und ebenso fliegen andere, welche ihren dehnbaren Kehlsack zur Genüge mit Nüssen angefüllt haben, schwerbeladen und unter sichtlicher Anstrengung dem Walde zu, um ihre Schätze dort in Vorrathskammern für den Winter aufzuspeichern. Um die Mittagszeit pflegen fast alle im dichten Unterholze der Waldungen wohlverdienter Ruhe. In den späten Nachmittagsstunden erscheinen sie wiederum, schreien wie am Morgen, setzen sich aber oft halbe Stunden lang auf die höchste Spitze einer Tanne oder Fichte, um von hier aus Umschau zu halten. Im Berggürtel oder in den hochnordischen Waldungen sind es die Zirbelnüsse, welche sie zu ähnlichen Ausflügen veranlassen. Schon um die Mitte des Juli, vor der Reife dieser Nüsse, finden sie sich, wenn auch zunächst noch in geringer Anzahl, auf den zapfentragenden Arven ein; bei vollständiger Reife der Frucht erscheinen sie in erheblicher Menge und unternehmen nunmehr förmliche Umzüge von Berg zu Thal und umgekehrt, beladen sich auch ebenso wie jene, welche die Haselsträucher plündern. Nach Wiedemanns Beobachtungen fliegen sie in Tirol, Zirbelnüsse sammelnd, während des ganzen Tages auf und nieder, benutzen beim Auf- und Abfliegen gewisse hervorragende Bäume, um auf ihnen ein wenig zu rasten, und beenden ihre Ernte erst, wenn der in der Höhe frühzeitig fallende Schnee sie in die Tiefe hinabdrückt. Beim Sammeln ihrer Vorräthe verfahren sie sehr geschickt. So lange sie noch hinlänglich viele Haselnüsse zu pflücken haben, setzen sie sich einfach auf die fruchtbehangenen Zweige; wenn die Büsche jedoch fast abgeerntet sind, halten sie sich, wie Vogel sah, über den wenigen noch vorhandenen Nüssen rüttelnd in der Luft und pflücken in solcher Stellung. An den Zapfen der Arve oder Zirbel und anderer Nadelbäume krallen sie sich mit den Nägeln fest, brechen mit kräftigen Schnabelhieben die Schuppen auf und gelangen so zu den Samen, deren Schalen sie mittels Zusammendrücken des Schnabels öffnen. Haselnüsse werden auf bestimmten Plätzen mit geschickt geführten Schnabelhieben gespalten. Abgesehen von Hasel- und Zirbelnüssen frißt der Tannenheher Eicheln, Bücheln, Tannen-, Fichten- und Kiefersamen, Getreide, Eberesch- oder Vogel-, Weißdorn-, Faulbaum-, Erd-, Heidel-, Preiselbeeren, sonstige Sämereien und Früchte, allerlei Kerbthiere, Würmer, Schnecken und kleine Wirbelthiere aller Klassen, ist überhaupt kein Kostverächter und leidet daher selbst im Winter keine Noth. Eine Zeitlang hält er sich an seine Speicher; sind diese geleert, so erscheint er in den Gebirgsdörfern oder wandert aus, um anderswo sein tägliches Brod zu suchen.
Ueber das Brutgeschäft des Nußknackers haben wir erst in den beiden letzten Jahrzehnten sichere Aufschlüsse erhalten. Ein Nest zu finden, ist auch dann schwierig, wenn ein Paar in unseren Mittelgebirgen nistet; die eigentlichen Brutplätze des Vogels aber sind die Waldungen seiner wahren Heimat, Dickichte, welche kaum im Sommer, noch viel weniger, wenn der Nußknacker zur Fortpflanzung schreitet, begangen werden können. Nach Schütts und Vogels Erfahrungen werden die Nester schon im Anfange des März gebaut und in der letzten Hälfte des Monats die Eier gelegt; um diese Zeit aber liegen die Waldungen des Gebirges ebenso wie die nordischen Wälder noch in tiefem Schnee begraben und sind schwer oder nicht zugänglich. Der Forscher muß also einen schneearmen Frühling abwarten, bevor er überhaupt an das Suchen eines Nestes denken kann.
Mein Vater erfuhr, daß im Voigtlande ein Nußknackernest in einem hohlen Baume gefunden worden sei, und diese Angabe erscheint keineswegs unglaublich, da auch Dybowski und Parrox in Ostsibirien dasselbe zu hören bekamen, ihnen sogar eine Kiefer, in deren Höhlung ein Paar gebrütet haben sollte, gezeigt wurde; indessen stimmen alle Beobachter, welche in Deutschland, Oesterreich, Dänemark, Skandinavien und der Schweiz Nester untersuchten, darin überein, daß letztere im dichten Geäste verschiedener Nadelbäume, insbesondere Fichten, außerdem Tannen, Arven, Lärchen, in einer Höhe von vier bis zehn Meter über dem Boden angelegt werden. Laut Vogel wählt das Paar zum Standorte seines Nestes am liebsten einen freien und sonnigen, also nach Süden oder Südosten gelegenen Bergeshang und hier auf dem erkorenen Baume Aeste nahe am Stamme. Die Baustoffe trägt es oft von weither zusammen. Unter hörbarem Knacken bricht es dünne und dürre, mit Bartflechten behangene Reiser von allen Nadelbaumarten seines Brutgebietes, auch wohl von Eschen und Buchen ab, legt diese lockerer oder dichter zum Unterbaue zusammen, schichtet darauf eine Lage Holzmoder, baut nunmehr die Mulde vollends auf, durchsticht auch wohl die Außenwände, vielleicht der Ausschmückung halber, mit grünen Zweigen und kleidet endlich das Innere mit Bartflechten, Moos, dürren Halmen und Baumbast aus. Unter regelrechten Verhältnissen findet man das volle Gelege um die Mitte des März, im Norden vielleicht erst im Anfange des April. Es besteht aus drei bis vier länglich eirunden, durchschnittlich vierunddreißig Millimeter langen, fünfundzwanzig Millimeter dicken Eiern, welche auf blaß blaugrünem Grunde mit veilchenfarbenen, grün- und lederbraunen, über die ganze Fläche gleichmäßig vertheilten, am stumpfen Ende zuweilen zu einem Kranze zusammenfließenden Flecken gezeichnet sind. Das Weibchen brütet, der frühen Jahreszeit entsprechend, sehr fest und hingebend; das Männchen sorgt für Sicherung und Ernährung der Gattin, welche die ihr gebrachte Atzung, mit den Flügeln freudig zitternd, begierig empfängt. Nach siebzehn bis neunzehn Tagen sind die Jungen gezeitigt, werden von beiden Eltern mit thierischen und pflanzlichen Stoffen ernährt und muthig beschützt, verlassen etwa fünfundzwanzig Tage nach ihrem Ausschlüpfen das Nest und treiben sich, zunächst noch von den Eltern geführt und geleitet, im dichtesten Walde umher, bis sie selbständig geworden sind und nunmehr die Lebensweise ihrer Eltern führen können. Sie sind, nach Girtanners Beobachtungen, »schon im Neste ganz die Alten in verjüngtem Maßstabe, aber gedrungene, unschöne Gestalten von steifer Haltung. In ihren linkischen, eckigen Bewegungen, besonders aber in ihrem eigenthümlichen Zucken mit dem Oberkörper nach hinten erinnern sie am ehesten an junge Spechte. Mit dem Schwanze wippen sie wie Würger. Als Nahrungsruf lassen sie eintöniges Gegilfe hören, zwischen welches sich jedoch bald das verfeinerte Gerätsche der Alten mischt«. So lange das Weibchen brütet, verhält es sich möglichst lautlos, um das Nest nicht zu verrathen, fliegt, gestört und vertrieben, lautlos ab und kehrt ebenso zum Neste zurück, sieht sogar von einem nahestehenden Baume stumm dem Raube seiner Brut zu, vereinigt sich auch nicht mit seinem Männchen, dessen Wandel, Thun und Treiben ebenso heimlich, verborgen, laut- und geräuschlos ist; wenn jedoch die Jungen heranwachsen, geht es lebhafter am Neste her, weil deren Begehrlichkeit durch auf weithin vernehmliches Geschrei sich äußert und auch die Alten, wenigstens bei herannahender Gefahr, ihrer Sorge durch ängstliches Schnarren Ausdruck verleihen oder durch heftige Verfolgung aller vorüberfliegenden Raubvögel sich bemerklich machen. Nachdem die Jungen ausgeflogen sind, vereinigen sich mehrere Familien und streifen gesellig umher. Dies geschieht fast immer hastig, unruhig, aber doch mit einer gewissen Regelmäßigkeit. Der ganze Flug zerstreut sich rasch im Walde, durchfliegt denselben in einer und derselben Richtung, sammelt sich von Zeit zu Zeit auf hohen Bäumen, in Sibirien namentlich auf abgestorbenen Lärchen, und fliegt dann weiter, durch wechselndes Erscheinen und Verschwinden dem Auge eine größere Menge vortäuschend als wirklich vorhanden.
Während seiner winterlichen Streifereien wird der Tannenheher ohne sonderliche Mühe auf dem Vogelherde oder unter geköderten Netzen gefangen. Er gewöhnt sich bald an Käfig und Gefangenkost, zieht zwar Fleisch allem übrigen Futter vor, nimmt aber mit allen genießbaren Stoffen vorlieb. Ein angenehmer Stubenvogel ist er nicht. Täppisch und etwas unbändig geberdet er sich, arbeitet und meiselt an den Holzwänden des Käfigs herum und hüpft rastlos von einem Zweige auf den anderen. Mit schwächeren Vögeln darf man ihn nicht zusammensperren; denn seine Mordlust ist so groß, daß er sich schwer abhalten läßt, jene zu überfallen. Er packt dann, wie Naumann beobachtete, sein Schlachtopfer mit dem Schnabel, kneipt ihm das Genick ein, öffnet durch einige Hiebe den Kopf, frißt zuerst das Gehirn und dann alles übrige. Einer fraß sogar Eichhörnchen, ohne daß man diesen vorher das Fell abzustreifen brauchte. Boje und ich haben an einem und demselben gefangenen eine Mordlust wahrgenommen, wie solche wohl Falken, kaum aber Raben zeigen. Am anmuthigsten erscheint der Vogel, wenn er mit Aufknacken der Nüsse beschäftigt ist. Diese nimmt er geschickt zwischen die Fänge, dreht sie, bis das stumpfe Ende nach oben kommt, und zermeiselt sie rasch, um zu dem Kerne zu gelangen. Er bedarf viel zu seinem Unterhalte und ist fast den ganzen Tag über mit seiner Mahlzeit beschäftigt.
Bei uns zu Lande würde der Nußknacker schädlich werden können; in seiner Sommerheimat macht er sich verdient. Ihm hauptsächlich soll man die Vermehrung der Arven danken, er es sein, welcher diese Bäume selbst da anpflanzt, wo weder der Wind noch der Mensch die Samenkörner hinbringen kann.
Langschwänzige Raben sind die Elstern ( Pica), deren Merkmale in dem im ganzen wie bei den Krähen gebildeten, auf der Firste jedoch stärker gebogenen Schnabel, den hochläufigen Füßen, kurzen, gerundeten Flügeln, unter deren Schwingen die fünfte die Spitze bildet, mehr als körperlangem, stark gesteigertem Schwanze und reichem Gefieder gefunden werden.
Die Elster, Alster, Schalaster, Acholaster, Algarde, Heste, Heister, Argerst, Gartenrabe etc. ( Pica caudata, vulgaris, melanoleuca, albiventris, europaea, germanica, septentrionalis, hiemalis, megaloptera, media, varia, sericea, bottanensis, butanensis, tibetana, japonica, chinensis und bactriana, Corvus pica und rusticus, Garrulus picus, Cleptes pica und hudsonicus), erreicht eine Länge von fünfundvierzig bis achtundvierzig und eine Breite von fünfundfunfzig bis achtundfunfzig Centimeter, wobei sechsundzwanzig Centimeter auf den Schwanz und achtzehn Centimeter auf den Fittig zu rechnen sind. Kopf, Hals, Rücken, Kehle, Gurgel und Oberbrust sind glänzend dunkelschwarz, auf Kopf und Rücken ins Grünliche scheinend, die Schultern, ein mehr oder minder vollständiges, oft nur angedeutetes Querband über den Rücken sowie die Untertheile weiß, die Schwingen blau, außen wie die Handschwingendecken grün, innen größtenteils weiß und nur an der Spitze dunkel, die Steuerfedern dunkelgrün, an der Spitze schwarz, überall metallisch, zumal kupferig schillernd. Das Auge ist braun, der Schnabel wie der Fuß schwarz. Bei den Jungen ist die Färbung gleich, jedoch matt und glanzlos. Mehrere Abarten, zum Theil auch ständig vorkommende, sind als besondere Arten aufgestellt worden, mit Sicherheit jedoch nicht zu unterscheiden.
Das Verbreitungsgebiet der Elster umfaßt Europa und Asien vom nördlichen Waldgürtel an bis Kaschmir und Persien. In den meisten Ländern und Gegenden tritt sie häufig auf, in anderen fehlt sie fast gänzlich. So sieht man sie in vielen Provinzen Spaniens gar nicht, wogegen sie in anderen gemein ist. Auch hohe Gebirge, baumfreie Ebenen und ausgedehnte Waldungen meidet sie. Feldgehölze, Waldränder und Baumgärten sind ihre eigentlichen Wohnsitze. Sie siedelt sich gern in der Nähe des Menschen an und wird da, wo sie Schonung erfährt, ungemein zutraulich oder richtiger aufdringlich. In Skandinavien, wo man sie gewissermaßen als heiligen Vogel des Landes ansieht, nimmt sie nicht in den Gärten, sondern in den Gehöften selbst ihre Wohnung und baut auf besonders für sie hergerichteten Vorsprüngen unter den Dächern ihr Nest. Sie ist, wo sie vorkommt, Standvogel im vollsten Sinne des Wortes. Ihr eigentliches Wohngebiet ist klein, und sie verläßt dasselbe niemals. Wird sie in der Gemarkung eines Dorfes ausgerottet, so währt es lange Jahre, bevor sie allgemach von den Grenzen her wieder einrückt. Nur im Winter streift sie, obgleich immer noch in sehr beschränktem Grade, weiter umher als sonst.
In Lebensweise und Betragen erinnert die Elster zwar vielfach an die Krähen, unterscheidet sich aber doch in mehrfacher Hinsicht nicht unwesentlich von den Verwandten. Sie geht schrittweise, ungefähr wie ein Rabe, trägt sich aber anders; denn sie erhebt den langen Schwanz und bewegt ihn wippend, wie Drossel oder Rothkehlchen thun. Ihr schwerfälliger, durchaus von dem der eigentlichen Raben verschiedener Flug erfordert häufige Flügelschläge und wird schon bei einigermaßen starkem Winde unsicher und langsam. Der Rabe fliegt zu seinem Vergnügen stundenlang umher; die Elster gebraucht ihre Schwingen nur, wenn sie muß. Sie bewegt sich von einem Baume zum anderen oder von dem ersten Gebüsche zu dem nächsten, unnützer Weise niemals. Ihre Sinne scheinen ebenso scharf zu sein wie die der Raben, und an Verstand steht sie hinter diesen durchaus nicht zurück. Sie unterscheidet genau zwischen gefährlichen und ungefährlichen Menschen oder Thieren: den ersteren gegenüber ist sie stets auf ihrer Hut, den letzteren gegenüber dreist und unter Umständen grausam. Gesellig wie alle Glieder ihrer Familie, mischt sie sich gern unter Raben und Krähen, schweift auch wohl mit Nußhehern umher, vereinigt sich aber doch am liebsten mit anderen ihrer Art zu kleineren oder größeren Flügen, welche gemeinschaftlich jagen, überhaupt an Freud und Leid gegenseitig den innigsten Antheil nehmen. Gewöhnlich sieht man sie familienweise. Ihre Stimme ist ein rauhes »Schak« oder »Krak«, welches auch oft verbunden wird und dann wie »Schakerak« klingt. Diese Laute sind Lockton und Warnungsruf und werden je nach der Bedeutung verschieden betont. Im Frühlings vor und während der Paarungszeit schwatzt sie mit staunenswerthem Aufwande von ähnlichen und doch verschiedenen Lauten stundenlang, und das Sprichwort beruht deshalb auf thatsächlichem Grunde.
Kerbthiere und Gewürm, Schnecken, kleine Wirbelthiere aller Art, Obst, Beeren, Feldfrüchte und Körner bilden die Nahrung der Elster. Im Frühjahre wird sie sehr schädlich, weil sie die Nester aller ihr gegenüber wehrlosen Vögel unbarmherzig ausplündert und einen reichbewohnten Garten buchstäblich verheert und verödet. Auch den Hühner- und Entenzüchtern, den Fasanerien und dem Federwilde wird sie lästig, fängt sogar alte Vögel und diese, wie Naumann sagt, oft ganz unvermuthet, weil sie beständig mit ihnen in Gesellschaft ist, jene sich vor ihr nicht fürchten und so in ihrer Sicherheit von ihr übertölpeln lassen. Ebenso betreibt sie freilich auch Mäusejagd und fängt und verzehrt viele schädliche Kerbthiere, Schnecken und sonstiges unnützes Gewürm, tritt aber überall als ein so räuberischer Vogel auf, daß sie unzweifelhaft unter nützlichen Thieren schlimmer haust als unter schädlichen, daher zu den letzteren gezählt werden muß.
Die Norweger behaupten, daß die Elster am Weihnachtstage das erste Reis zu ihrem Horste trage; in Deutschland geschieht dies gewöhnlich nicht vor dem Ende des Februar, Das Nest wird bei uns auf den Wipfeln hoher Bäume und nur da, wo sich der Vogel ganz sicher weiß, in niedrigen Büschen angelegt. Dürre Reiser und Dornen bilden den Unterbau; hierauf folgt eine dicke Lage von Lehm und nun erst die eigentliche Nestmulde, welche aus feinen Wurzeln und Thierhaaren besteht und sehr sorgsam hergerichtet ist. Das ganze Nest wird oben, bis auf einen seitlich angelegten Zugang, mit einer Haube von Dornen und trockenen Reisern versehen, welche zwar durchsichtig ist, den brütenden Vogel aber doch vollständig gegen etwaige Angriffe der Raubvögel sichert. Das Gelege besteht aus sieben bis acht, dreiunddreißig Millimeter langen, dreiundzwanzig Millimeter dicken, auf grünem Grunde braun gesprenkelten Eiern, Nach etwa dreiwöchentlicher Brutzeit entschlüpfen die Jungen und werden nun von beiden Eltern mit Kerbthieren, Regenwürmern, Schnecken und kleinen Wirbelthieren groß gefüttert. Vater und Mutter lieben die Kinderschar ungemein und verlassen sie nie. Wir haben erfahren, daß eine Elster, auf welche wir geschossen hatten, mit dem Schrotkorn im Leibe noch fortbrütete. Wenige Vögel nähern sich mit größerer Vorsicht ihren Nestern als die Elstern, welche alle möglichen Listen gebrauchen, um jene nicht zu verrathen. In Spanien muß die Elster oft in derselben Weise Pflegemutterdienste verrichten wie die Nebelkrähe in Egypten: der Heherkukuk vertraut dort ihr seine Eier an, und sie unterzieht sich der Pflege des Findlings mit derselben Liebe, welche sie ihren eigenen Kindern erweist. Werden diese geraubt oder auch nur bedroht, so erheben die Alten ein Zetergeschrei und vergessen nicht selten die ihnen eigene Vorsicht. Um ein getödtetes Junge versammeln sich alle Elstern der Umgegend, welche durch das Klagegekrächze der Eltern herbeigezogen werden können.
Jung aus dem Neste genommene Elstern werden außerordentlich zahm, lassen sich mit Fleisch, Brod, Quark, frischem Käse leicht auffüttern, zum Aus- und Einfliegen gewöhnen, zu Kunststückchen abrichten, lernen Lieder pfeifen und einzelne Worte sprechen und bereiten dann viel Freude, durch ihre Sucht, glänzende Dinge zu verstecken, aber auch wieder Unannehmlichkeiten,
Der Mensch, welcher dem Kleingeflügel seinen Schutz angedeihen läßt, wird früher oder später zum entschiedenen Feinde der Elster und vertreibt sie erbarmungslos aus dem von ihm überwachten Gehege. Auch der Aberglaube führt den Herrn der Erde gegen sie ins Feld. Eine im März erlegte und an der Stallthüre aufgehangene Elster hält, nach Ansicht glaubensstarker Leute, Fliegen und Krankheiten vom Viehe ab; eine in den zwölf Nächten geschossene, verbrannte und zu Pulver gestoßene Schalaster aber ist ein unfehlbares Mittel gegen die fallende Sucht. Liebe, dessen trefflichem Berichte über die Brutvögel Thüringens ich vorstehende Angaben entnehme, meint, daß der letzterwähnte Aberglaube wesentlich dazu beigetragen habe, die früher in Thüringen häufigen Elstern zu vermindern: so viele von ihnen wurden erlegt, verbrannt und zerstoßen, um das fallsuchtheilende »Diakonissinnenpulver« zu erzielen. Ihre List und Verschlagenheit macht übrigens selbst dem geübtesten Jäger zu schaffen und fordert Verstand und Tücke des Menschen heraus. Außer dem Menschen stellen wohl nur die stärkeren Raubvögel dem pfiffigen und muthigen Vogel nach. Am schlimmsten treibt es der Hühnerhabicht, gegen dessen Angriffe nur dichtes Gebüsch rettet. Eine von ihm ergriffene Elster schreit, nach Naumanns Beobachtungen, kläglich und sucht sich mit grimmigen Bissen zu vertheidigen: was aber der Habicht gepackt hat, muß sterben.
In Süd- und Mittelspanien tritt neben der gemeinen Elster eine Verwandte auf, welche zum Vertreter einer besonderen Untersippe ( Cyanopolius) erhoben worden ist. Die Unterscheidungsmerkmale beschränken sich auf den schwächeren Schnabel und die verschiedene Färbung.
Unter den europäischen Vögeln gehört die Blauelster ( Pica Cookii, (Cyanopolius, Cyanopica und Dolometis Cookii) zu den schönsten. Kopf und der obere Theil des Nackens sind sammetschwarz, Rücken und Mantel blaß bräunlichgrau, Kehle und Wangen grauweiß, die Untertheile licht fahlgrau, Flügel und Schwanz licht blaugrau, die Handschwingen außen weiß gesäumt. Das Auge ist kaffeebraun, Schnabel und Füße sind schwarz. Die Länge beträgt sechsunddreißig, die Breite zweiundvierzig, die Fittiglänge vierzehn, die Schwanzlänge einundzwanzig Centimeter. Das Weibchen ist um drei Centimeter kürzer und ein wenig schmäler. Bei den Jungen sind alle Farben matter; das Schwarz des Kopfes und das Blau der Schwung- und Steuerfedern ist unscheinbar, das Grau des Unterkörpers unrein und der Flügel durch zwei graue, wenig in die Augen fallende Binden gezeichnet.
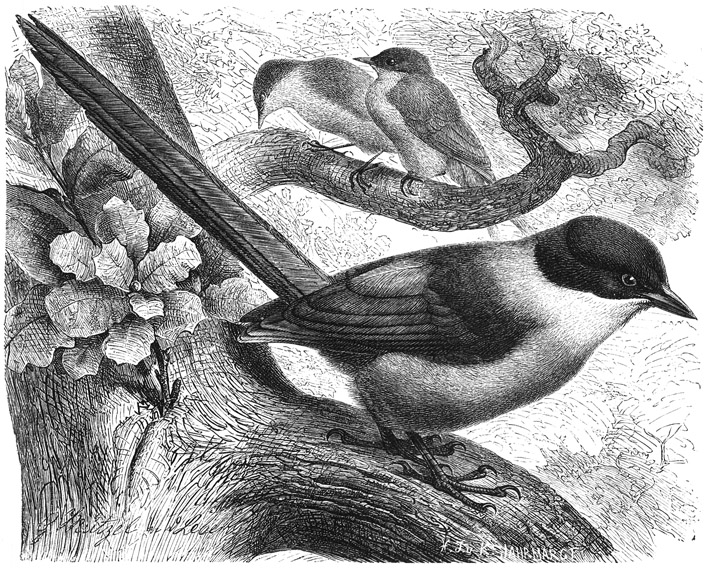
Blauelster ( Pica Cookii). 1/2 natürl. Größe.
Man begegnet der Blauelster in allen Theilen Süd- und Mittelspaniens, da, wo die immergrüne Eiche zusammenhängende Waldungen bildet. Sie ist fast undenkbar ohne diesen Baum, dessen dichte Krone ihr Obdach und Schutz gewährt, dessen dunkles Laub sie trotz ihres Prachtgewandes versteckt und dem Auge entzieht. Deshalb auch wird sie da, wo diese Eiche nur vereinzelt auftritt, nicht gefunden: in den östlichen Provinzen fehlt sie gänzlich, und nach Norden hin reicht sie nicht über Kastilien hinaus. In Nordwestafrika, namentlich in Marokko, lebt sie ebenfalls; in Ostsibirien wird sie durch eine nah verwandte Art ( Pica cyana) vertreten. Wo sie vorkommt, ist sie häufig. Sie ist geselliger als die Elster und deshalb stets zu zahlreichen Banden vereinigt; aber sie meidet die Nähe des Menschen und findet sich daher nur ausnahmsweise in der Nähe von bewohnten Gebäuden. Dagegen besucht sie sehr oft, hauptsächlich des Pferdemistes halber, die Straßen. In ihrem Betragen ähnelt sie der gemeinen Elster sehr. Sie geht und fliegt, ist klug und vorsichtig und leistet im Verhältnisse zu ihrer Größe dasselbe wie diese. Ihre Stimme aber ist ganz verschieden von der unserer Elster; sie klingt ungefähr wie »Krrih« oder »Prrih«, langgezogen und abgebrochen, und wenn der Vogel schwatzt, wie »Klikklikklikkli«, dem heiteren Rufe des Grünspechtes entfernt ähnlich. Verfolgt, benimmt sich die Blauelster wie der Heher: sie verläßt das Gebiet nicht, hält sich aber immer außerhalb Schußweite, fliegt von Baum zu Baum, zeigt sich fortwährend, läßt sich aber niemals nahe genug kommen. Ihre Jagd verursacht deshalb besondere Schwierigkeiten, und diese wachsen, sobald sie einmal mißtrauisch geworden ist. Ueberhaupt zeigt sie etwas außerordentlich unstetes. Sie ist thatsächlich keinen Augenblick ruhig, sondern fortwährend in Bewegung. Ein Flug dieser anmuthigen Vögel durchsucht und durchstöbert das ganze Gebiet, welches er beherrscht. Einige sind auf dem Boden, andere in den dichten Wipfeln der Eichen, diese in niedrigen, jene in hohen Gebüschen beschäftigt. Auf freien Plätzen zeigt sich die Gesellschaft nur dann, wenn kein Mensch in der Nähe ist; jedes Fuhrwerk scheucht sie in das Gebüsch zurück. So kommt es, daß man Blauelstern zwar fortwährend sehen, jedoch vielleicht nicht eine einzige von ihnen erlegen kann.
Die Brutzeit fällt erst in die mittleren Frühlingsmonate: in der Umgegend Madrids brütet die Blauelster nicht vor Anfang des Mai. Zum Standorte des Nestes wählt sie gern hohe Bäume, nicht ihre sonst so heiß geliebten immergrünen Eichen, sondern regelmäßig Ulmen und andere hochstämmige Waldbäume. Es kann vorkommen, daß mehrere Nester auf einem und demselben Baume stehen; in einem sehr kleinen Umkreise werden gewiß alle Nester gefunden, welche eine Gesellschaft überhaupt erbaut; denn die Blauelster gibt auch während der Brutzeit ihren geselligen Verband nicht auf. Das Nest ist von dem unserer Elster durchaus verschieden und ähnelt mehr einem Heher- oder richtiger vielleicht einem Würgerneste. Nur der Unterbau besteht aus dürren Reisern, das eigentliche Nest hingegen aus grünen und weichen Pflanzenzweigen, Stengeln von Heidegras und Kräutern aller Art, welche nach innen zu immer sorgfältiger ausgesucht, auch wohl mit Ziegenhaaren und Wolle ausgelegt werden. Das Gelege zählt fünf bis neun durchschnittlich siebenundzwanzig Millimeter lange, zwanzig Millimeter dicke Eier, welche auf graugelblichem Grunde mit dunkleren verwaschenen Flecken und gleichsam darüber noch mit olivenbraunen Punkten und Tüpfeln, am dickeren Ende zuweilen kranzartig, gezeichnet sind. Nach Rey's Erfahrungen legt der Heherkukuk seine Eier auch in die Nester dieser Art.
Gefangene Blauelstern sind seltene, aber allerliebste Erscheinungen in unseren Käfigen, halten sich sehr gut und werden, freundlich gepflegt, ebenso zahm wie andere Raben.
Die Baumkrähen oder Heher ( Garrulinae) unterscheiden sich von den bisher beschriebenen Raben durch kurzen und stumpfen Schnabel mit oder ohne schwachen Haken am Oberkiefer, schwache Füße, sehr kurze, stark gerundete Flügel, verhältnismäßig langen, schwach gesteigerten Schwanz und reiches, weiches, zerschlissenes, buntfarbiges Gefieder.
Alle hierher gehörigen Vögel leben weit mehr auf Bäumen und viel weniger auf dem Boden als die eigentlichen Raben. Sie vereinigen sich höchst selten zu zahlreichen Flügen, bilden vielmehr kleine Trupps oder Familien und schweifen den ganzen Tag über im Walde umher, von einem Baume zum anderen streichend. Ihr Flug ist infolge der kurzen Schwingen schwankender und unsicherer als der der Raben; sie sind nicht im Stande, sich in bedeutende Höhen zu erheben, und denken niemals daran, nach Art der letztgenannten fliegend sich zu vergnügen. Ebenso sind sie auf dem Boden ungeschickt; denn ihr Gang ist gewöhnlich ein erbärmliches Hüpfen. Das Gezweige der Bäume bildet ihr Gebiet: in ihm bewegen sie sich mit größerer oder geringerer Behendigkeit. Hinsichtlich ihrer Sinnesfähigkeiten stehen sie kaum hinter den Raben zurück: Gesicht, Gehör und Geruch sind auch bei ihnen wohl entwickelt; die geistige Begabung dagegen erreicht bloß ausnahmsweise die Höhe, welche die Raben im allgemeinen auszeichnet. Auch die Heher sind klug, aber mehr listig als verständig, wie denn überhaupt nur die niederen Eigenschaften besonders hervortreten. Sie zeigen in ihrem Wesen viele Ähnlichkeit mit den Würgern, sind so grausam und raubgierig wie diese, ohne aber den Muth derselben oder die Kühnheit der Raben zu bekunden. Ihre Nahrung entnehmen sie ebensowohl dem Pflanzen- wie dem Thierreiche. Früchte aller Art bilden zeitweilig fast ausschließlich ihre Speise, während zu anderen Jahreszeiten Nester und Eier von ihnen aufs unbarmherzigste geplündert werden. Sie gehören deshalb mit Recht zu den nicht beliebten Vögeln, obwohl sich wiederum auch nicht verkennen läßt, daß sie durch andere Eigenschaften, namentlich durch eine große Nachahmungsgabe verschiedener Stimmen, für sich einzunehmen wissen. Hinsichtlich des Nestbaues unterscheiden sie sich wesentlich von den Raben. Sie brüten nicht gesellschaftlich, sondern einzeln, und ihre Nester sind kleiner und immer anders gebaut als die eigentlichen Rabennester. Das Gelege zählt fünf bis sieben Eier.
Jung aus dem Neste genommen, werden alle Heher zahm. Viele lassen sich zum Aus- und Einfliegen gewöhnen, andere zum Nachplappern von Worten oder Nachpfeifen von Liedern abrichten. Die Sucht, glänzende Dinge zu entwenden und zu verstecken, theilen sie mit den Raben, und deshalb, wie auch wegen ihrer Unverträglichkeit und Raublust, können sie im Käfige recht unangenehm werden.
Unser Heher, Eichel-, Nuß-, Holz- und Waldheher, Holzschreier, Holzheister, Nußhacker, Nußjäck, Hatzel, Heger, Hägert, Herold, Herrenvogel, Marquard, Margolf, Murkolf etc. ( Garrulus glandarius und pictus, Glandarius germanicus, septentrionalis, robustus, taeniurus und leucocephalus, Corvus und Lanius glandarius), Vertreter einer gleichartigen Sippe ( Garrulus), kennzeichnet sich durch kurzen, kräftigen, stumpfen, auf der Firste wenig gebogenen, schwachhakigen Schnabel, mäßig hochläufige, mittellangzehige, mit scharf gebogenen, spitzigen Nägeln bewehrte Füße, kurze, stark zugerundete Flügel, unter deren Schwingen die fünfte mit der sechsten die Spitze bildet, mäßig langen, sanft zugerundeten Schwanz und sehr reichhaltiges, weiches, strahliges, auf dem Kopfe verschmälertes und hollenartig verlängertes Gefieder. Die vorherrschende Färbung desselben ist ein schönes, oberseits dunkleres, unterseits lichteres Weinrothgrau; die Hollenfedern sind weiß, in der Mitte durch einen lanzettförmigen schwarzen, bläulich umgrenzten Fleck gezeichnet, die Zügel gilblichweiß und dunkler längsgestreift, die Kehlfedern weißlich, die des Bürzels und Steißes weiß, ein breiter und langer Bartstreifen jederseits und die Schulterschwingen sammetschwarz, die Handschwingen braunschwarz, außen grauweiß gesäumt, die Armschwingen in der Wurzelhälfte weiß, einen Spiegel bildend, nahe an der Wurzel blau geschuppt, in der Endhälfte sammetschwarz, die Oberflügeldeckfedern innen schwarz, außen himmelblau, weiß und schwarzblau in die Quere gestreift, wodurch ein prachtvoller Schild entsteht, die Schwanzfedern endlich schwarz, in der Wurzelhälfte mehr oder weniger deutlich blau quergezeichnet. Das Auge hat perlfarbene, der Schnabel schwarze, der Fuß bräunlich fleischrothe Färbung. Die Länge beträgt vierunddreißig, die Breite bis fünfundfunfzig, die Fittiglänge siebzehn, die Schwanzlänge funfzehn Centimeter.
Mit Ausnahme der nördlichsten Theile Europas findet sich der Eichelheher in allen Waldungen dieses Erdtheiles. An den östlichen, südöstlichen und südwestlichen Grenzen vertreten ihn nahe verwandte Arten, welche von einzelnen Forschern auch wohl als ständige Abarten angesehen werden, hier aber außer Betracht kommen können, weil erwiesenermaßen nur eine von ihnen, und gerade diejenige, deren Artselbständigkeit am meisten bestritten wird, in Europa vorkommt. Zudem führen, so viel bekannt, alle Heher genau dieselbe Lebensweise, und es genügt daher unserem Zwecke, wenn ich mich auf den Eichelheher beschränke.
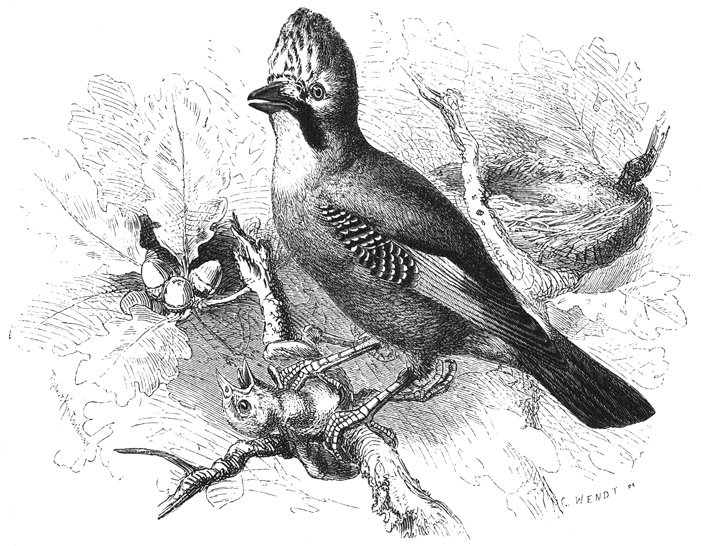
Heher ( Garrulus glandarius). 1/3 natürl. Größe.
In Deutschland ist dieser überall zu finden, in den tieferen Waldungen ebensowohl wie in den Vor- und Feldhölzern, im Nadelwalde fast ebenso häufig wie im Laubwalde. Er lebt im Frühjahre paarweise, während des ganzen übrigen Jahres in Familien und Trupps und streicht in beschränkter Weise hin und her. Da, wo es keine Eichen gibt, verläßt er die Gegend zuweilen wochen-, ja selbst monatelang; im allgemeinen aber hält er jahraus jahrein getreulich an seinem Wohnorte fest. Er ist ein unruhiger, lebhafter, listiger, ja äußerst verschlagener Vogel, welcher durch sein Treiben viel Vergnügen, aber auch viel Aerger gewährt. Zu seiner Belustigung und Unterhaltung nimmt er die mannigfaltigsten Stellungen an, ahmt auch die verschiedensten Stimmen in trefflicher Weise nach. Er ist höchst gewandt im Gezweige, ebenso ziemlich geschickt auf dem Boden, aber ein ungeschickter Flieger, daher überaus ängstlich, auf weithin freie Strecken zu überfliegen. So lange er irgend kann, hält er sich an die Gebüsche, und bei seinen Flügen über offene Gegenden benutzt er jeden Baum, um sich zu decken. Er lebt in beständiger Furcht vor den Raubvögeln, welche ihm nur im Walde nicht beizukommen wissen, ihn aber bei länger währendem Fluge sofort ergreifen. Naumann schreibt dieser Furcht, und wohl mit vollem Rechte, eine Eigenheit des sonst so geselligen Vogels zu, daß er nämlich, wenn er über Feld fliegt, niemals truppweise, sondern immer nur einzeln, einer in weitem Abstande hinter dem anderen, dahinzieht.
Höchst belustigend ist die wirklich großartige Nachahmungsgabe des Hehers, unter unseren Spottvögeln unzweifelhaft eines der begabtesten und unterhaltendsten. Sein gewöhnliches Geschrei ist ein kreischendes, abscheuliches »Rätsch« oder »Räh«, der Angstruf ein kaum wohllautenderes »Käh« oder »Kräh«. Auch schreit er zuweilen wie eine Katze »Miau«, und gar nicht selten spricht er, etwas bauchrednerisch zwar, aber doch recht deutlich das Wort »Margolf« aus. Außer diesen Naturlauten stiehlt er alle Töne und Laute zusammen, welche er in seinem Gebiete hören kann. Den miauenden Ruf des Bussards gibt er auf das täuschendste und so regelmäßig wieder, daß man im Zweifel bleibt, ob er damit fremdes oder eigenes Gut zu Markte bringt. Für ersteres sprechen andere Beobachtungen. Man weiß, daß er die Laute hören ließ, welche das Schärfen einer Säge hervorbringt. Naumann hat einen das Wiehern eines Füllens bis zur völligen Täuschung nachahmen hören; andere haben sich im Krähen des Haushahnes und im Gackern des Huhnes mit Erfolg versucht. Die verschiedenen, hier und da aufgeschnappten Töne werden unter Umständen auch zu einem sonderbar schwatzenden Gesange verbunden, welcher bald mehr, bald minder wohllautend sein kann. »Einst im Herbste«, erzählt Rosenheyn, »setzte ich mich, von der Jagd ermüdet, im Walde unter einer hohen Birke nieder und hing in Gedanken den Erlebnissen des Tages nach. Darin störte mich in nicht unangenehmer Weise das Gezwitscher eines Vogels. So spät im Jahre, dachte ich, und noch Gesang in dem schon ersterbenden Walde? Aber wer und wo ist der Sänger? Alle nahestehenden Bäume wurden durchmustert, ohne daß ich denselben entdecken konnte, und dennoch klangen immer kräftiger seine Töne. Ihre große Ähnlichkeit mit der Singweise einer Drossel führte mich auf den Gedanken, sie müsse es sein. Bald erschallten jedoch in kurz abgerissenen Sätzen auch minder volltönende Laute als die ihrigen; es schien, als hätte sich ein unsichtbarer Sängerkreis in meiner Nähe gebildet. Ich vernahm z. B. ganz deutlich sowohl den pickenden Ton der Spechte, als den krächzenden der Elster; bald wiederum ließ der Würger sich hören, die Drossel, der Staar, ja selbst die Rake: alles mir wohlbekannte Laute. Endlich erblickte ich in bedeutender Höhe einen – Heher! Er war es, welcher sich in diesen Nachahmungen versuchte.«
Leider besitzt der Heher andere Eigenschaften, wodurch er sich die gewonnene Gunst des Menschen bald wieder verscherzt. Er ist Allesfresser im ausgedehntesten Sinne des Wortes und der abscheulichste Nestzerstörer, welchen unsere Wälder aufzuweisen haben. Von der Maus oder dem jungen Vögelchen an bis zum kleinsten Kerbthiere ist kein lebendes Wesen vor ihm gesichert, und ebensowenig verschmäht er Eier, Früchte, Beeren und dergleichen. Im Herbste bilden Eicheln, Bücheln und Haselnüsse oft wochenlang seine Hauptnahrung. Die ersteren erweicht er im Kropfe, speit sie dann aus und zerspaltet sie; die letzteren zerhämmert er, wenn auch nicht ganz ohne Mühe, mit seinem kräftigen Schnabel. Gelegentlich seiner Eicheldiebereien nützt er in beschränktem Grade, indem er zur Anpflanzung der Waldbäume beiträgt. Im übrigen ist er durchaus nicht nützlich, sondern nur schädlich. Lenz hält ihn für den Hauptvertilger der Kreuzotter und beschreibt in seiner »Schlangenkunde« in ausführlicher Weise, wie er jungen Kreuzottern, so oft er ihrer habhaft werden kann, ohne Umstände den Kopf spaltet und sie dann mit großem Behagen frißt, wie er selbst die erwachsenen überwältigt, ohne sich selbst dem Giftzahne auszusetzen, indem er den Kopf des Giftwurmes so sicher mit Schnabelhieben bearbeitet, daß dieser bald das Bewußtsein verliert und durch einige rasch aufeinander folgende Hiebe binnen wenigen Minuten getödtet wird. Unser Forscher stellt wegen dieser Heldenthaten den Eichelheher hoch und hat ihn sogar in einem recht hübschen Gedichte verherrlicht; aber die räuberische Thätigkeit gilt leider nicht dem giftigen Gewürme allein, sondern gewiß in noch viel höherem Grade dem nützlichen kleinen Geflügel. Seine Raubgier wird groß und klein gefährlich. Naumanns Bruder fand einen Eichelheher beschäftigt, eine alte Singdrossel, die Mutter einer zahlreichen Kinderschar, welche sich, wie es schien, derselben zu Liebe aufgeopfert hatte, abzuwürgen, und derselbe Beobachter traf später den Heher als eifrigen und geschickten Jäger junger Rebhühner an, Trinthammer und Alexander von Homeyer verdammen den Heher ebenso, wie Lenz ihn hochpreist, »Was treibt dieser fahrende Ritter«, fragt ersterer, »dieser verschmitzte Bursche, der schmucke Vertreter der Galgenvögelgesellschaft, die ganze Brutzeit hindurch? Von Baum zu Baum, von Busch zu Busch schweifend, ergattert er die Nester, säuft die Eier aus, verschlingt die nackten Jungen mit Haut und Haar und hascht und zerfleischt die ausgeflogenen Gelbschnäbel, welche noch unbeholfen und ungewitzigt ihn zu nahe kommen lassen. Der Sperber und die drei Würger unserer Wälder sind zwar ebenfalls schlimme Gesellen; aber sie alle zusammen hausen noch lange nicht so arg unter den Sängern des Waldes, als der Heher. Er ist der ›Neunmalneuntödter‹, der Würger in des Wortes eigentlicher Bedeutung und als solcher geschmückt mit Federbusch und Achselbändern. Wo dieser Strauchmörder überhand nimmt, ist an ein Aufkommen der Brut nicht mehr zu denken. Meine Beschuldigung ist gewiß nicht zu hart; zum Beweise sei hier ein schlagendes Beispiel seiner Frechheit angeführt. Seit einer Reihe von Jahren kam während der Brutzeit fast jeden Morgen ein Heher in meinen Hausgarten, stöberte dort wie in den anstoßenden Gärten Baumgruppen und Strauchwerk durch und zerstörte sofort die ausgekundeten Nester. Auf einem meiner Bäume hatte von lange her ein Edelfink und im Stachelbeergebüsche eine Klappergrasmücke genistet. Sie konnten beide kein Gehecke mehr aufbringen und zogen sich schließlich ganz hinweg. Endlich machte der Räuber, dessen unwillkommenes Erscheinen mir jedesmal durch das Gebaren aller befiederten Insassen verrathen war, sein ausgezeichnetes Meisterstück. Er verfolgte junge Rothschwänzchen und kaperte eines nach dem anderen weg, so daß in kurzem keine Spur der niedlichen Vögelchen zu sehen war. Ein anderes Mal zerrte er aus einem Loche in der Brandmauer meines Nachbars einen halbflüggen Spatz hervor und zerlegte ihn ganz gemüthlich auf dem nächsten Baume, bei welchem Frevel die Alten nebst ihrer Sippschaft ein gewaltiges Zetermordio erhoben, ja sogar kühn auf den Räuber lospickten. Dies brachte ihn jedoch ebensowenig als mein Schelten und Hutschwenken außer Fassung; denn nach gehaltenem Fleischschmause fraß er noch zum Nachtische einige Kirschen und flog dann hohnschreiend in sein Leibgehege zurück. Wenn es dem Forstwirte lieb ist, daß die kleinen Waldvögel verwüstende Raupen ablesen, was Menschenhände keineswegs zu Stande bringen können, so wird es ihm ebenso warm am Herzen liegen müssen, auch den geschworenen Erbfeind dieser freundlichen Raupenleser, den blutgierigen Heher, in gesetzlicher Ordnung zu halten und ihm zu gebieten, bis hierher und nicht weiter,« Ich muß mich, so gern ich den Heher im Walde sehe, der Ansicht Trinthammers vollständig anschließen und will nur noch hinzufügen, daß die hauptsächlichsten Dienste, welche er zu leisten vermag, durch den Bussard viel besser und vollständiger ausgeführt werden, während dieser die kleinen nützlichen Vögel kaum behelligt.
Das Brutgeschäft des Hehers fällt in die ersten Frühlingsmonate. Im März beginnt das Paar mit dem Baue des Nestes; zu Anfang des April pflegt das Gelege vollständig zu sein. Das Nest steht selten hoch über dem Boden, bald im Wipfel eines niederen Baumes, bald in der Krone eines höheren, bald nahe am Schafte, bald außen in den Zweigen, Es ist nicht besonders groß, zuunterst aus zarten, dünnen Reisern, dann aus Heidekraut oder trockenen Stengeln erbaut und innen mit feinen Würzelchen sehr hübsch ausgelegt. Die fünf bis neun Eier sind dreißig Millimeter lang, dreiundzwanzig Millimeter dick und auf schmutzig gelbweißem oder weißgrünlichem Grunde überall mit graubraunen Tüpfeln und Punkten, am stumpfen Ende gewöhnlich kranzartig, gezeichnet. Nach etwa sechzehntägiger Bebrütung entschlüpfen ihnen die Jungen, welche zunächst mit Räupchen und Larven, Käfern und anderen Kerbthieren, Würmern und dergleichen, später aber vorzugsweise mit jungen Vögeln aufgefüttert werden. Ungestört, brütet das Paar nur einmal im Jahre,
Als schlimmster Feind des Hehers ist wohl der Habicht, nächst diesem der Sperber anzusehen. Der erstere überwältigt ihn leicht, der letztere erst nach langem Kampfe. Wir haben wiederholt Sperber und Heher erhalten, welche bei einem derartigen Streite sich ineinander verkrallt und verbissen hatten, zu Boden gestürzt und so gefangen worden waren. Bei seinen Ausflügen nach einzeln stehenden Eichbäumen fällt er dem Wanderfalken zur Beute. Nachts bedroht ihn der Uhu und vielleicht auch der Waldkauz; das Nest endlich wird durch den Baummarder geplündert. Andere gefährliche Gegner scheint der wehrhafte Gesell nicht zu haben. Da nun alle genannten Feinde, vielleicht mit alleiniger Ausnahme des Habichtes, im Abnehmen begriffen sind, ebenso auch Jagd und Jägerei von Jahr zu Jahr mehr abnehmen, vermehrt sich der Bestand der Heher in besorgniserregender Weise. Wettergestählt und hinsichtlich seiner Nahrung in keiner Weise wählerisch, klug, listig und verschmitzt, hat er ohnehin wenig zu leiden. Vierfüßige Raubthiere entdeckt er gewöhnlich eher, als sie ihn, und verleidet ihnen durch fortwährendes Verfolgen und fürchterliches Schreien oft genug die Jagd. Dem Menschen gegenüber zeigt er sich stets vorsichtig, und wenn er einmal verscheucht wurde, ungemein scheu, foppt auch den Jäger nach Herzenslust und ärgert ihn, weil er andere Thiere vor ihm warnt. So sind leider alle Bedingungen für seine stetige Vermehrung gegeben. Der Fang ist Sache des Zufalles. Einer oder der andere nascht von den Beeren auf Vogelherden oder in Dohnenstegen und kommt dabei lebend in die Gewalt des Menschen; die Mehrzahl aber, welche man in Gefangenschaft sieht, wurde jung aus dem Neste genommen. An alt eingefangenen hat man wenig Freude, weil sie selten zahm werden; jung aufgezogene hingegen können ihrem Besitzer viel Vergnügen gewähren. Auch sie lernen unter Umständen einige Worte nachplaudern, öfters kurze Weisen nachpfeifen. Daß sie im Gesellschaftsbauer nicht geduldet werden dürfen, braucht kaum erwähnt zu werden; denn ihre Raubsucht verleugnen sie nie.
Unserem Margolf in jeder Beziehung ebenbürtige Mitglieder der Hehergruppe sind die Blauraben, (Cyanocorax), südamerikanische Heher, mit etwa kopflangem oder etwas kürzerem, starkem, geradem, in der Vorderhälfte etwas zusammengedrücktem, auf der kantigen Firste sanft gewölbtem, an der Wurzel in Borsten gehülltem Schnabel, ziemlich starken, hochläufigen Füßen, kurzen Flügeln, unter deren Schwingen die fünfte und sechste die Spitze bilden, und ziemlich langem, sanft gerundetem Schwanze.
Der Kappenblaurabe (Cyanocorax chrysopsund pileatus, Pica chrysops und pileata, Corvus und Cyanurus pileatus, Uroleuca pileata), eine der verbreitetsten Arten der Sippe, erreicht eine Länge von fünfunddreißig bis siebenunddreißig und eine Breite von fünfundvierzig Centimeter; sein Fittig mißt funfzehn, sein Schwanz siebzehn Centimeter. Stirn, Zügel und Oberkopf, Halsseiten, Kehle und Vorderhals bis zur Brust herab sind kohlschwarz, Nacken, Rücken, Flügel- und Schwanzfedern, soweit letztere nicht von den Schwingen bedeckt werden, ultramarinblau, an der Wurzel schwarz, die Untertheile von der Brust an bis zum Steiße, die Unterflügeldeckfedern und die Schwanzspitze gilblichweiß; über und unter dem Auge steht ein breiter, halbmondförmiger Fleck von himmelblauer Färbung, an der Wurzel des Unterschnabels ein ähnlicher; ersterer ist oben silbern gesäumt. Das Auge ist gelb, der Schnabel wie der Fuß schwarz.
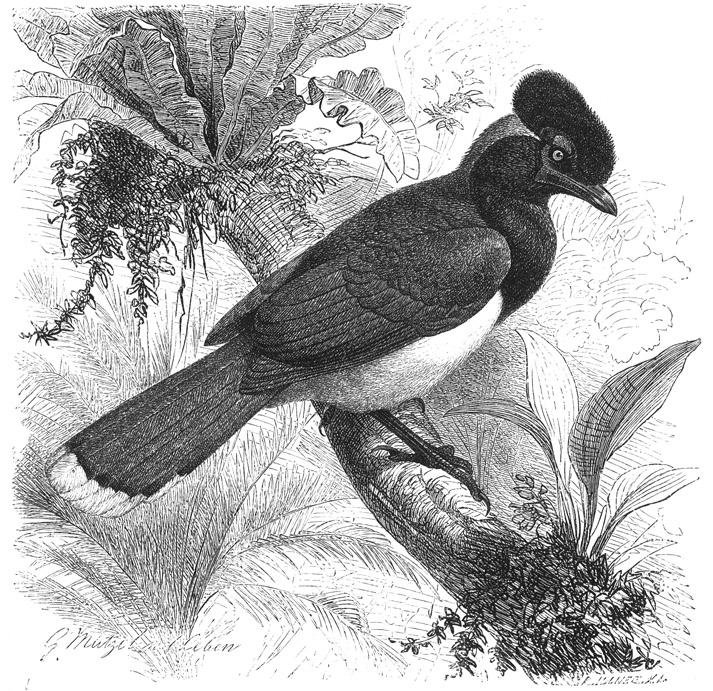
Kappenblaurabe (Cyanocorax chrysops). 3/5 natürl. Größe.
Das Verbreitungsgebiet umfaßt das ganze wärmere Südamerika und erstreckt sich nach Süden hin bis Paraguay. Hier hat unser Vogel an Hudson einen trefflichen Beschreiber gefunden. Der Blaurabe, welcher von den Spaniern »Uracca« oder Elster genannt wird, bekundet durch die kurzen Fittige, den langen Schwanz und das knappe Gefieder sowie endlich durch die zum Klettern wohl eingerichteten Beine, daß er kein Vogel der Pampas ist, vielmehr von seinen heimischen Waldungen aus allmählich das letztere Gebiet sich erobert hat. In der That findet er sich hier auch nur da, wo Bäume gedeihen. Während des Winters ist er hier ein beklagenswerther Vogel; denn mehr als irgend ein anderer scheint er von der Kälte zu leiden. Ein Schwarm, welcher aus zehn bis zwanzig Stück besteht, sucht allabendlich dichte Zweige vor dem Winde geschützter Bäume auf und setzt sich hier, um zu schlafen, so dicht nebeneinander nieder, daß er nur einen einzigen Klumpen bildet. Nicht selten hocken einige buchstäblich auf den Rücken der anderen, und der Klumpen bildet so eine vollständige Pyramide. Demungeachtet wird mehr als einem von ihnen die Kälte verhängnisvoll; denn nicht selten findet man erstarrte oder erfrorene Blauraben unter den Schlafplätzen. Wenn der Morgen schön ist, begibt sich der Trupp auf einen hohen, der Sonne ausgesetzten Baum, wählt hier die Zweige der Ostseite, breitet die Schwingen und reckt sich mit Vergnügen in den Sonnenstrahlen, verweilt auch in dieser Stellung fast regungslos eine oder zwei Stunden, bis das Blut sich wieder erwärmt hat und das Federkleid vom Thaue trocken geworden ist. Auch während des Tages sieht man die Vögel oft sich sonnen und gegen Abend auf der Westseite der Bäume die letzten Strahlen des wärmenden Gestirnes auffangen. Nur ihre Fruchtbarkeit und der Ueberfluß an Nahrung befähigt sie, ihre Stelle unter den Pampasvögeln zu behaupten; entgegengesetztenfalls würde die Kälte, ihr einziger Feind, sie sicherlich ausrotten.
Mit Beginn des warmen Frühlingswetters zeigt sich die Uracca ganz anders als früher. Sie wird lebendig, laut, heiter und lustig. Ununterbrochen wandert der Schwarm von einem Platze zum anderen, ein Vogel einzeln und unstet hinter dem anderen herfliegend, jeder einzelne aber fortwährend in kläglicher Weise schreiend. Dann und wann läßt auch wohl einer seinen Gesang vernehmen: eine Reihe lang gedehnter, pfeifender Töne, von denen die ersten kräftig und laut, die anderen matter und immer matter ausgestoßen werden, bis das ganze plötzlich in einem innerlichen, dem tiefen Athmen oder Schnarchen des Menschen ähnelnden Gemurmel sein Ende findet. Naht jemand dem Schwarme, so schreit derselbe so unerträglich laut, schrillend und anhaltend, daß der Eindringling, heiße er Mann oder Thier, in der Regel froh ist, der Nachbarschaft der Schreihälse wieder zu entrinnen. Gegen die Brutzeit hin vernimmt man übrigens, wahrscheinlich von den Männchen, auch sanfte und zarte, plaudernde oder schwatzende Laute. Nunmehr theilen sich die Schwärme in Paare und zeigen sich mißtrauisch in ihrem ganzen Auftreten. Ihr Nest wird in der Regel auf langen, dornigen Bäumen aus sehr starken Reisern errichtet, meist aber nur lose und so liederlich gebaut, daß die Eier durchscheinen, zuweilen sogar durchfallen. Nester von besserer Bauart, welche innen mit Federn, trockenen oder grünen Blättern ausgekleidet sind, werden schon seltener gefunden. Das Gelege enthält sechs bis sieben, im Verhältnisse zur Größe des Vogels umfangreiche Eier, manchmal auch ihrer mehr: einmal fand Hudson sogar deren vierzehn in einem Neste und konnte, da er die Vögel von Beginn des Baues an beobachtete, feststellen, daß sie von einem Paare herrührten. Ihre Grundfärbung ist ein schönes Himmelblau; die Zeichnung besteht aus einer dicht aufgetragenen, weißen, zarten, kalkartigen Masse, welche anfänglich leicht abgewischt oder abgewaschen werden kann. Die Häßlichkeit der jungen Blauraben ist sprichwörtlich und der Ausdruck »Blaurabenkind« zur Bezeichnung eines Menschen geworden, welcher aller Anmuth entbehrt. Abgesehen von ihrer Häßlichkeit zeichnen sich die Jungen auch durch ihre Unsauberkeit aus, so daß ein mit sechs oder acht von ihnen gefülltes Nest ebensowenig vor den Augen als vor der Nase Gnade findet. Dagegen ist der Eindruck des Geschreies der Jungen stets ein erheiternder, weil ihre Stimmlaute an das schrillende Gelächter eines Weibes erinnern. Ein in unmittelbarer Nähe von Hudsons Hause errichtetes Nest gab Gelegenheit, das Betragen der Alten zu beobachten. Bei Ankunft der futterbringenden Alten brachen die Jungen in ein so zügelloses, wild tobendes Geschrei aus, daß man ihnen ohne Lächeln kaum zuhören konnte.
Jung dem Neste enthobene Blauraben werden bei einiger Pflege bald außerordentlich zahm und benehmen sich in der Gefangenschaft etwa nach Art unserer Dohlen oder Elstern, zeichnen sich aber dadurch zu ihrem Vortheile aus, daß sie mit ihresgleichen auch jetzt noch Frieden halten. Im Freien verzehren sie zwar vorzugsweise Kerbthiere, rauben aber doch auch allerlei kleine Säugethiere, Vögel und Kriechthiere; in Gefangenschaft ernährt man sie mit dem, was auf den Tisch kommt. Dank ihrer Anspruchslosigkeit gelangen sie neuerdings recht oft in unsere Käfige.
Im Norden Amerikas werden die Blauraben durch die Schopfheher ( Cyanocitta) ersetzt. Ihr Leib ist schlank, der Schnabel kurz, stark, kaum gewölbt und spitzig, der Flügel kurz, in ihm die vierte und fünfte Schwinge länger als alle übrigen, der Schwanz lang und stark abgerundet, das Gefieder weich, sanft und glänzend, das Kopfgefieder zu einer Haube verlängert.
Die bekannteste Art der wenig artenreichen Gruppe ist der Blauheher ( Cyanocitta cristata, Pica cristata, Corvus, Garrulus, Cyanurus, Cyanocorax und Cyanogarrulus cristatus). Das Gefieder der Oberseite ist der Hauptfarbe nach glänzend blau; die Schwanzfedern sind durch schmale dunkle Bänder und die Flügelfedern durch einzelne schwarze Endflecke gezeichnet, die Enden der Armschwingen, der größeren Flügeldeckfedern und die seitlichen Schwanzfedern aber wie die Unterseite von der Brust an weiß oder grauweiß gefärbt, die Kopfseiten blaßblau, ein ringförmiges Band, welches vom Hinterkopfe an über den Augen weg nach dem Oberhals verläuft, und ein schmales Stirnband, welches sich zügelartig nach den Augen zu verlängert, tiefschwarz. Das Auge ist graubraun, der Schnabel und die Füße sind schwarzbraun. Die Länge beträgt achtundzwanzig, die Breite einundvierzig, die Fittiglänge vierzehn, die Schwanzlänge dreizehn Centimeter.

Blauheher ( Cyanocitta cristata). 3/5 natürl. Größe.
Alle Naturforscher stimmen darin überein, daß der Blauheher eine Zierde der nordamerikanischen Waldungen ist. Demungeachtet hat sich der Vogel wenig Freunde erwerben können. Er ist allerwärts bekannt und überall gemein, in den meisten Gegenden Standvogel, nur in den nördlichen Staaten Strich- oder Wandervogel. Sein Leben ist mehr oder weniger das unseres Eichelhehers. Er bevorzugt die dichten und mittelhohen Wälder, ohne jedoch die hochstämmigen zu meiden, kommt gelegentlich in die Fruchtgärten herein, schweift beständig von einem Orte zum anderen, ist auf alles aufmerksam, warnt durch lautes Schreien andere Vögel und selbst Säugethiere, ahmt verschiedene Stimmen nach, raubt nach Verhältnis seiner Größe im weitesten Umfange, kurz ist in jeder Hinsicht ebenbürtiger Vertreter seines deutschen Verwandten.
Die amerikanischen Forscher geben ausführliche Nachrichten über seine Lebensweise und theilen manche ergötzliche Geschichte mit. Wilson nennt ihn den Trompeter unter den Vögeln, weil er, sobald er etwas verdächtiges sieht, unter den sonderbarsten Bewegungen aus vollem Halse schreit und alle anderen Vögel dadurch warnt. Sein Geschrei klingt, nach Gerhardt, wie »Titullihtu« und »Göckgöck«; der gewöhnliche Ruf ist ein schallendes »Käh«. Gerhardt erwähnt, daß er die Stimme des rothschwänzigen Bussard, Audubon, daß er den Schrei des Sperlingsfalken aufs täuschendste nachahmt und alle kleinen Vögel der Nachbarschaft dadurch erschreckt, daß er ferner, wenn er einen Fuchs oder ein Schupp oder ein anderes Raubthier entdeckt hat, dieses Ereignis der ganzen Vogelwelt anzeigt, jeden anderen Heher der Nachbarschaft und alle Krähen herbeiruft und dadurch die Raubthiere aufs äußerste ärgert. Eulen plagt er so, daß sie so eilig als möglich ihr Heil in der Flucht suchen müssen. Dagegen ist er selbst ein sehr gefräßiger und schädlicher Raubvogel, plündert rücksichtslos alle Nester aus, welche er finden kann, frißt die Eier und die Jungen auf und greift sogar verwundete Vögel von bedeutender Größe oder wehrhafte Säugethiere an. Alle Arten von kleinen Säugethieren und Vögeln, alle Kerbthiere, Sämereien und dergleichen bilden seine Nahrung. Er ist, wie Audubon sagt, listig im höchsten Grade, verschlagen und tückisch, aber mehr herrschsüchtig als muthig, bedroht die Schwachen, fürchtet die Starken und flieht selbst vor gleich Starken. Deshalb hassen ihn denn auch die meisten Vögel und beweisen große Angst, wenn er sich ihren Nestern nähert. Drosseln und dergleichen vertreiben ihn, wenn sie ihn gewahren; er aber benutzt ihre Abwesenheit, stiehlt sich sacht herbei und frißt die Eier oder zerfleischt die Jungen. »Ich habe ihn«, sagt Audubon, »einen ganzen Tag lang von einem Neste zu dem anderen fliegen sehen und beobachtet, daß er dieselben mit derselben Regelmäßigkeit besuchte wie ein Arzt, welcher von einem seiner Kranken zu dem anderen geht. Dies geschah einzig und allein in der Absicht, um die Eier auszutrinken. Auf junge Küchlein wagte er wiederholte Angriffe, ward aber von der Glucke zurückgescheucht.« Im Herbste erscheint er scharenweise auf Ahorn-, Eich- und ähnlichen Bäumen, um von deren Früchten zu schmausen, füllt sich dort die Kehle an und trägt auch wohl Massen der Körner oder Eicheln an bestimmten Plätzen zusammen, in der Absicht, im Winter von ihnen zu schmausen. Dabei befördert er allerdings die Besamung der Wälder; doch ist dieser Nutzen wohl kaum hoch anzuschlagen.
Je nach der Gegend brütet er ein- oder zweimal im Jahre. Sein Nest wird aus Zweigen und anderen dürren Stoffen aufgebaut und innen mit zarten Wurzeln ausgelegt. Vier bis fünf Eier, welche etwa dreißig Millimeter lang, zweiundzwanzig Millimeter dick und auf olivenbraunem Grunde mit dunklen Flecken bezeichnet sind, bilden das Gelege. Das Männchen hütet sich, während das Weibchen brütet, das Nest zu verrathen, ist still und lautlos und macht seine Besuche so heimlich als möglich. Die Jungen werden vorzugsweise mit Kerbthieren groß gefüttert.
Jung aus dem Neste genommene Blauheher werden bald zahm, müssen jedoch abgesondert im Gebauer gehalten werden, weil sie andere Vögel blutgierig überfallen und tödten. Ein Gefangener, welcher in einem Gesellschaftskäfige lebte, vernichtete nach und nach die sämmtliche Mitbewohnerschaft desselben. Auch alte Vögel dieser Art gewöhnen sich leicht an den Verlust ihrer Freiheit. Audubon erzählt, daß er einmal gegen dreißig habe fangen lassen, in der Absicht, sie mit sich nach Europa zu nehmen und ihnen hier die Freiheit zu geben. Die Vögel wurden in gewöhnlichen Fallen, welche mit Mais geködert waren, berückt und dem Forscher gebracht, sobald sie sich gefangen hatten. Audubon steckte die ganze Gesellschaft in einen Käfig. Der Neuangekommene pflegte sich erschreckt und vorsichtig in eine Ecke zu drücken und verweilte gewöhnlich in dieser Stellung während des ersten Tages still und ruhig mit einem ihm sonst völlig fremden Ausdrucke von Dummheit; die anderen rannten neben ihm dahin und über ihn weg, ohne daß er sich rührte. Nahrungsmittel, welche man ihm vorhielt, beachtete er kaum. Berührte man ihn mit der Hand, so kauerte er sich nieder und blieb nun regungslos auf dem Boden hocken. Der nächste Tag änderte jedoch ein derartiges Benehmen; dann war auch der frisch gefangene wieder vollständig Heher, nahm sein Korn, hielt es hübsch zwischen den Füßen, hämmerte mit seinem Schnabel darauf, zersplitterte es, um zu den Körnern zu gelangen, und bewegte sich so ungezwungen als möglich. Als der Käfig wohl besetzt war, gewährte das beständige Hämmern der Vögel erheiternde Unterhaltung. Es war, wie Audubon sagt, als ob eine Menge Schmiede beschäftigt wären. Außer dem Mais fraßen die Blauheher übrigens auch Früchte aller Arten und mit besonderem Wohlbehagen frisches Fleisch. Unter sich waren sie verträglich und überhaupt recht liebenswürdige Gesellen. Dann und wann erhob einer einen Lärmschrei, und dieser erregte auch unter den übrigen einen ebenso großen Aufruhr als unter Umständen draußen im Walde.
Audubon erreichte seinen Zweck, unsere europäischen Wälder mit Blauhehern zu bevölkern, nicht. Seine Vögel überstanden die Reise vortrefflich, bekamen zuletzt aber kleine Schmarotzer in solcher Menge, daß sie daran, aller Gegenmittel ungeachtet, zu Grunde gingen. So brachte er nur einen einzigen nach London. In der Neuzeit kommt der Blauheher öfter nach Europa und ist deshalb fast in jedem Thiergarten eine regelmäßige Erscheinung. Bis jetzt aber hat sich noch niemand gefunden, welcher Audubons Vorsatz ausgeführt und einige Vögel dieser Art in unseren Wäldern freigelassen hätte. Sicherlich würden sie diesen einen großen Schmuck verleihen; Verdienste aber um die Wälder dürften sie sich ebensowenig erringen wie ihr europäischer Vertreter.
Die größeren Falkenarten und wahrscheinlich auch mehrere Eulen Amerikas sind schlimme Feinde des Blauhehers. Mit dem kleinen Sperlingsfalken balgt er sich, wie Gerhardt berichtet, fortwährend herum; doch sollen seine Kämpfe mit diesen gewandten Räubern und mit den Sperbern unblutig sein, also mehr des Spieles wegen geschehen. Nach Gerhardts Meinung ist bald der Falk, bald der Heher der angreifende Theil.
Im Hochlande Mejikos vertritt den Blauheher der vielleicht noch schönere Diademheher ( Cyanocitta diademata, Cyanogarrulus, Lophocorax und Cyanurus diadematus), welcher sich besonders durch seine hohe, aufrichtbare Haube auszeichnet. Kopf und Haube sind ultramarinblau, der Vorderkopf silbern kobaltblau, der Vordertheil der Haube lebhaft blau, die Nasenfedern, der Zügel und die Kopfseiten schwarz, die Wangen und Ohrdecken bläulich verwaschen, ein Brauenfleck über den Augen und ein kleinerer runder unter denselben weiß, die Obertheile im allgemeinen grünlichblau, auf dem Unterrücken und den oberen Schwanzdeckfedern lebhafter und mehr kobaltblau, die Kinnfedern graulich weiß, die übrigen Untertheile licht kobaltblau, auf Kehle und Brust purpurblau, die Flügel tiefer blau als der Rücken, die Handschwingen außen licht grünblau gesäumt, alle größeren Deckfedern und ebenso die Armschwingen und die tiefblauen Schwanzfedern dicht schwarz gebändert. Das Auge ist braun, der Schnabel wie der Fuß schwarz. Die Länge beträgt etwa neunundzwanzig, die Fittiglänge wie die Schwanzlänge vierzehn Centimeter.
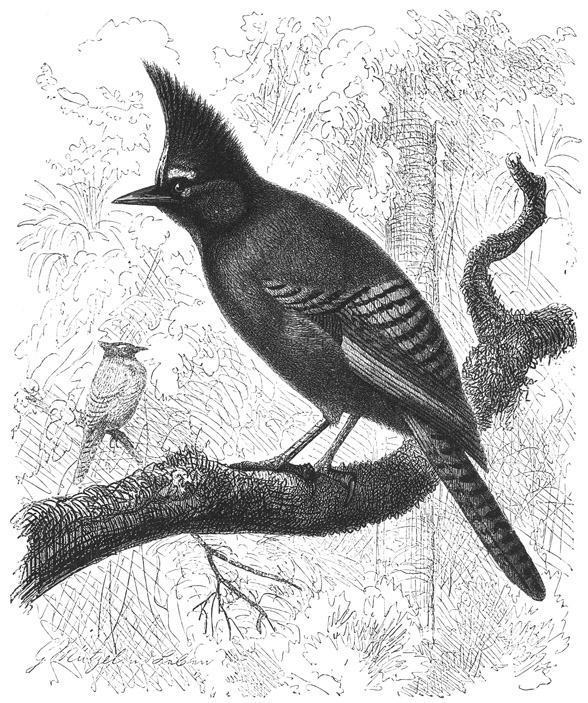
Diademheher (Cyancitta diademata). 3/5 natürl. Größe.
Ueber die Lebensweise liegen verschiedene Berichte vor; da die amerikanischen Vogelkundigen jedoch Formen, welche wir als Arten auffassen, nur als Abarten bezeichnen, läßt sich nicht immer mit Sicherheit bestimmen, welche der fünf verwandten Haubenheher sie meinen. Im allgemeinen geht aus ihren Schilderungen hervor, daß die Vögel da, wo sie leben, häufig auftreten, wenig scheu, geschwätzig und im höchsten Grade neugierig sind, daher zur Belebung der Waldungen wesentlich beitragen, zumal sie nach Heherart die Stimmen der verschiedensten Vögel nachahmen und einzelne Theile aus den Liedern aller mit ihnen zusammenwohnenden gefiederten Waldbewohner zum besten geben. Während des Sommers verlassen sie den Wald nicht, im Winter dagegen besuchen sie die Nähe der Häuser und spähen mit Diebesgelüsten nach allem für sie genießbaren umher, bewahren bei ihren Raubzügen auch, ganz gegen sonstige Gewohnheit, tiefes Stillschweigen, gerade als ob sie sich der Gefahr ihrer Unternehmungen bewußt wären. Im Walde dagegen schweigen sie selten und theilen eine Entdeckung, welche ihre ununterbrochene Neugier sie machen ließ, der ganzen Welt durch lautes Geschrei mit, folgen auch dem Wanderer, welcher ihre vom Menschen noch wenig heimgesuchten Wildnisse betritt, auf weit hin, als ob sie dessen Thun und Treiben auf das genaueste beobachten wollten. Coues, welcher sie vielfach beobachtete, spricht ihnen alle Bescheidenheit und Zurückhaltung, welche kleine Vögel bekunden, gänzlich ab und nennt sie Strolche, welche für jede Art von Abenteuern, gleichviel, ob solche ihnen Beute oder nur Vergnügen einbringen, gefahrlos oder mit Gefahr verbunden find, stets bereit erscheinen. Zuweilen ziehen sie einzeln, in der Regel aber in Gesellschaft gleichgearteter Genossen auf diebische Unternehmungen aus, unterstützen sich gegenseitig und nehmen dabei mit, was sie erlangen können. Bei einer solchen Gelegenheit beobachtete der genannte einen Trupp, welcher auf seinem Kriegspfade durch einen dicht verwachsenen Busch zu der Hoffnung angeregt sein mochte, in ihm ein Vogelnest mit Eiern oder sonst etwas passendes für den allezeit fertigen Schnabel oder wenigstens einen Gegenstand der Unterhaltung zu finden. Zum allergrößten Vergnügen entdeckte die Gesellschaft eine kleine Eule, welche dieses Versteck gewählt hatte, um in ihm geschlossenen Auges der Ruhe und Verdauung zu pflegen. Unsäglicher Lärm erhob sich, und entsetzt entflohen alle kleineren Vögel, während die Bande, vielleicht in Erinnerung an irgend eine vom Geschlechte der Eulen dem ihrigen zugefügte Uebelthat, den hülflosen, verdutzten Nachtvogel anschrie, dieser aber, das Gefieder sträubend, mit dem Schnabel klappend, fauchend und den Kopf rundum drehend, die Heher zu schrecken suchte. Letztere aber wurden kühner und zudringlicher, bis endlich das Opfer ihrer Angriffe sein Heil in der Flucht suchte und einem benachbarten Wacholder zueilte, in der Hoffnung, hier sich zu verbergen. Sofort flogen alle Heher hinterdrein, und wahrscheinlich wäre der Streit nicht zum Vortheile der Eule ausgefallen, hätte der Beobachter nicht zunächst die letztere und sodann vier von den zudringlichen Hehern erlegt.
Der Diademheher frißt alles, was genießbar ist, vom Eie, jungen oder kleinen Vogel an bis zum Kerbthiere herunter, der Hauptsache nach aber doch die verschiedensten Pflanzenstoffe, harte Baumsamen ebensowohl wie Früchte und Beeren. Im Gebirge scheinen die Samen der Nadelbäume einen nicht unbeträchtlichen Theil seiner Mahlzeiten auszumachen, wenigstens sah ihn Coues sehr häufig an den Zapfen arbeiten; ebenso oft begegnet man ihm auch in den Eichenwaldungen oder in Wacholdergebüschen, auf Ahornbäumen oder Beerengesträuchen etc. Wo er sich aber auch zeigen möge: von sämmtlichem kleinen Geflügel gehaßt und gefürchtet ist er überall. Doch auch er hat seine Feinde. Alle die kleinen Tyrannen und Fliegenfänger, ja selbst die Spechte, greifen ihn an und suchen ihn in die Flucht zu schlagen. Der Mensch verfolgt ihn selten und vielleicht niemals mit Eifer und Haß; denn seine Farbenschönheit, die Zierlichkeit seiner Zeichnung, die Lebendigkeit seines Wesens gewinnen ihm mehr Freunde, als er verdient. Unter den Goldgräbern und anderen Bergleuten auf eigene Faust hat er meist nur gute Freunde. Seine Allgegenwart unterhält, seine Erscheinung und sein Auftreten erfreut diese von der übrigen Welt abgeschlossenen Leute, und seine neugierige Zudringlichkeit rechtfertigt die Schonung, welche man ihm zu theil werden läßt, kirrt ihn aber mit der Zeit so, daß er vor der Hütte des Goldgräbers sich einfindet, um wegzunehmen, was ihm an Nahrung gereicht wird. Zudem will seine Jagd geübt sein. Ihm blindlings zu folgen, wäre vergeblich; geduldiges Lauern oder Erregen seiner maßlosen Neugier führt eher zum Ziele.
Ueber das Fortpflanzungsgeschäft finde ich keine Angabe; nur die Eier werden beschrieben. Sie sind etwa vierunddreißig Millimeter lang, dreiundzwanzig Millimeter breit und auf blaß und düster bläulichgrünem Grunde mehr oder minder dicht, gewöhnlich gleichmäßig mit kleinen oliven- und lichter braunen Flecken gezeichnet.
Gefangene, welche ich gesehen habe, unterscheiden sich nicht von ihren nächsten Verwandten.
An der nördlichen und östlichen Grenze des Verbreitungskreises unseres Eichelhehers beginnt das Wohngebiet des Unglückshehers ( Perisoreus infaustus, Pica infausta, Corvus infaustus, russicus und sibiricus, Lanius und Garrulus infaustus, Bild S. 447), welcher mit drei anderen, nordamerikanischen Arten die Sippe der Flechtenheher ( Perisoreus) vertritt. Von den vorstehend beschriebenen Verwandten unterscheiden ihn vor allem der sehr schlanke, auf der Firste bis gegen die Spitze hin gerade, vor ihr sanft abwärts, längs der Dillenkante stärker gebogene, vor der Spitze schwach gezahnte Schnabel, sodann der kurzläufige Fuß, der etwas gesteigerte Schwanz und das sehr weiche, strahlige, auf dem Kopfe nicht verlängerte Gefieder. Letzteres ist auf Oberkopf und Nacken rußbraun, auf Rücken und Mantel düster bleigrau, auf Hinterrücken und Bürzel fuchsroth, auf Kinn, Kehle und Brust schwach grünlichgrau, auf Bauch und Steiß röthlich; die Federn, welche die Nasenlöcher decken, sind schmutzig gelbbraun, die Schwingen innen rußbraun, außen bräunlichgrau, an der Wurzel meist röthlich, die größeren Flügeldeckfedern mehr oder minder vollständig lebhaft rothbraun, die kleinen Deckfedern bräunlichgrau, die Steuerfedern, mit Ausnahme der beiden mittleren bleigrauen, lebhaft fuchsroth, die beiden Paare zunächst der Mittelfedern an der Spitze bleigrau. Das Auge ist dunkelbraun, der Schnabel wie der Fuß schwarz. Die Länge beträgt einunddreißig, die Breite siebenundvierzig, die Fittig- wie die Schwanzlänge vierzehn Centimeter.
Das Verbreitungsgebiet erstreckt sich von Finnmarken bis zur Insel Sachalin und von der nördlichen Baumgrenze bis zum sechzigsten Breitengrade, in Sibirien wohl noch etwas weiter nach Süden hinab. Von hier aus besucht er dann und wann niedere Breiten und hat sich bei dieser Gelegenheit wiederholt auch in Deutschland eingefunden. Innerhalb seines Wohngebietes ist er nicht gerade selten, kaum irgendwo aber so häufig wie der Heher. In den Waldungen zu beiden Seiten des unteren Ob kann er keine seltene Erscheinung sein, da wir ihm bei unserem flüchtigen Durchstreifen der Gegend mehrere Male begegneten. Seinen Aufenthalt scheint er besonders da zu nehmen, wo die Bäume sehr dicht und auf feuchtem Grunde stehen, auch mit langen Bartflechten behangen sind. Hier macht sich der Vogel durch seinen Ruf bald bemerklich. Paarweise oder in kleinen Gesellschaften durchzieht er den Wald, nirgends längere Zeit auf einer und derselben Stelle sich aufhaltend, durchsucht rasch die Bäume und fliegt weiter. Sein Betragen ist höchst anmnthig, aber mehr dem eines Heherlings ( Garrulax) als dem unseres Hehers ähnelnd, der Flug von dem des letztgenannten gänzlich verschieden, ungemein leicht und sanft, meist gleitend, wobei die rothen Schwanz- und Flügelfedern sehr zur Geltung kommen. Weite Strecken durchmißt auch der Unglücksheher nicht, fliegt vielmehr, so viel ich habe beobachten können, immer nur von einem Baume zum anderen oder höchstens über eine Lichtung hinweg dem nächsten dichten Bestande zu. Im Gezweige hüpft er mit jedesmaliger Zuhülfenahme der Flügel überaus rasch und gewandt umher, indem er entweder mit weiten Sprüngen auf und nieder klettert,oder aber förmlich rutschend längs eines Zweiges dahinläuft; geschickt hängt er sich auch, obschon meist in schiefer Richtung zur Längsaxe des Baumes, nach Art eines Spechtes an die Stämme, um hier etwas auszuspähen. Auf dem Boden habe ich ihn nur ein einziges Mal gesehen, als eine kleine Gesellschaft am Waldrande an dem steil abfallenden Ufer erschienen war. Aber auch hier hing er sich an die fast senkrechte Wand, arbeitete ein wenig mit dem Schnabel und flog sodann wiederum zum nächsten Baume auf. Der Lockton ist ein klangvolles »Güb, güb«; laute, kreischende Laute vernahm ich nur von verwundeten, die jammervoll klagenden, welche ihm zu seinem Namen verholfen haben, dagegen niemals.
Beide Gatten eines Paares wie auch die Glieder eines Trupps hängen treu aneinander. Das erste Männchen, welches ich schoß, nachdem ich das Weibchen gefehlt, fiel flügellahm vom Baume herab und erhob, als ich es aufnehmen wollte, ein ziemlich lautes, wie »Gräe, geräe« klingendes Kreischen. Sofort eilte das Weibchen, beständig lockend, herbei, setzte sich in meiner unmittelbaren Nähe auf einen Baum, kam aber, als ich den schreienden Gefährten ergriffen hatte, bis auf zwei Meter an mich heran, lockte fortwährend und verharrte so zähe in der Nähe seines unglücklichen Genossen, daß ich diesen endlich wieder auf den Boden werfen mußte, um zurückgehend die richtige Entfernung zum Schusse nehmen zu können; anderenfalls würde ich es in Fetzen zerschossen haben. Als aus der bereits erwähnten Gesellschaft einer erlegt wurde, kamen alle übrigen sofort zur Stelle, um sich über das Schicksal ihres Gefährten zu vergewissern, und verließen erst, nachdem noch ein zweiter Schuß gefallen war, den Unglücksort.
Von anderen Beobachtern, welche weit mehr Gelegenheit zur Beobachtung des Vogels hatten als ich während unserer eiligen Reise durch Westsibirien, erfahren wir wenig mehr als genaue Angaben über das Vorkommen; alle aber stimmen darin überein, daß sie den Unglücksheher als einen überaus zutraulichen und neugierigen Gesellen bezeichnen. Nilsson behauptet, daß er Holzmachern zuweilen auf den Hut fliege; Schrader erzählt, daß er mit den Renthierlappen auf vertrautestem Fuße lebe und sie oder ihre Herden zu den Ruheplätzen geleite, die harmlosen Hirten aber bestimmt vom Jäger unterscheide. Am eingehendsten berichten Wolley über Fortpflanzung und Gefangenleben, Sommerfelt, Collett und Sundström über die Nahrung.
Hinsichtlich letzterer erweist sich unser Vogel als echter Heher, weil Allesfresser im vollsten Sinne des Wortes. Im Herbste und Winter bilden Beeren und Sämereien, namentlich solche der Arve und anderer Nadelholzbäume, wohl den Haupttheil seiner Mahlzeiten. Die von uns erlegten Unglücksheher hatten fast ausschließlich Beeren und Kerbthierreste im Magen. Später, wenn hoher Schnee die Beerengesträuche verdeckt, nimmt er zu den Nadelholzzapfen seine Zuflucht. Er klettert wie eine Meise im Gezweige herum, zerbricht die Zapfen auf einem stärkeren Aste und hämmert und klaubt den Samen heraus. Gegen den Winter hin legt er sich Vorrathskämmerchen an und speichert in ihnen oft eine Menge von Körnern auf, muß aber freilich häufig genug erfahren, daß Eichhörnchen und Mäuse oder Spechte und Meisen seine Schätze plündern. Während der Brutzeit des Kleingeflügels wird er zu einem ebenso grausamen Nesträuber wie der Heher, verzehrt auch erwachsene kleine Vögel und kleine Säugethiere, welche er erlangen kann, frißt von dem zum Trocknen aufgehängten Renthierfleische oder den in Schlingen gefangenen Rauchfußhühnern, soll sogar Aas angehen.
Nordvy theilte mir mit, daß der Unglücksheher, welcher am Varangerfjord nicht selten ist, bereits im März zum Nestbaue schreite, spätestens aber in den ersten Tagen des April brüte. Das Nest, welches er mir gab, war ein großer Bau, welcher äußerlich aus Reisern, Gräsern, Moos und dürren Flechten bestand, innen aber eine außerordentlich dichte Lage von Haaren und vor allem von Schneehuhnfedern enthielt, welche eine ebenso weiche wie warme Nestmulde bildeten. Alle Nester, welche durch Wolley's Jäger gesammelt wurden, standen auf Fichten, nahe am Stamme und meist so niedrig, daß man sie vom Boden aus mit der Hand erreichen konnte. Die drei bis fünf Eier sind etwa einunddreißig Millimeter lang, einundzwanzig Millimeter dick und auf schmutzigweißem bis blaß grünlichweißem Grunde mit röthlichgrauen Schalen- und lichter oder dunkler braunen Oberflecken verschiedener Größe gezeichnet. Beide Eltern lieben ihre Brut sehr, verhalten sich am Neste ganz still, um dasselbe nicht zu verrathen, und suchen bei Gefahr durch Verstellung den Feind zu täuschen und abzulenken, hüpfen oder gaukeln auf dem Boden dahin, als ob ihre Flügel gelähmt wären und sie so leicht eine Beute des Jägers werden könnten, führen diesen dann ein Stück fort, heben sich plötzlich auf und fliegen davon, um im weiten Bogen zu den Jungen zurückzukehren. Wolley's Leute fanden um die Mitte des Mai in den meisten Nestern mehr oder weniger erwachsene Junge. Eine Brut, welche sie in einen Käfig setzten, um sie von den Alten auffüttern zu lassen, wurde von diesen befreit, indem die klugen Vögel den Verschluß des Bauers öffneten.
Nach mancherlei Mühen gelang es Wolley, fünf lebende Unglücksheher zu erhalten und glücklich nach London zu bringen. Sie mit Schlingen zu fangen, verursachte keinerlei, die Eingewöhnung im Käfige um so mehr Schwierigkeiten. Lebhaftere und listigere Vögel als sie kann es, wie der genannte glaubt, nicht geben. In Stockholm erregten die gedachten Gefangenen Bewunderung. Ihre weittönenden und mannigfaltigen Stimmlaute hielten alle Buben in beständiger Aufregung. Die Knaben versuchten die Stimmlaute der Heher nachzuahmen, und diese antworteten wiederum, jenen. Nachbarn und Wohlfahrtsbeamte erwiesen sich duldsam, weil auch sie durch die Vögel unterhalten wurden. Leider lebten letztere in London nicht lange.
Sehr verschiedenartige Vögel werden in der Unterfamilie der Schweifkrähen ( Glaucopinae) vereinigt. Ihr Schnabel ist bald kurz und auf der Firste gebogen, bald lang, schlank kegelförmig und auf der Firste gerade, bald endlich im ganzen sichelförmig gebogen, der Fuß ebenfalls verschieden, meist aber kräftig und hochläufig, der Flügel immer kurz, der Schwanz bald lang, bald kurz.
Die Unterfamilie verbreitet sich über Südasien, Australien und Oceanien, bewohnt die Waldungen und lebt im ganzen nach Art unserer Elstern und Heher.
Wohl die bekanntesten Glieder der Gruppe sind die Baumelstern ( Dendrocitta), ziemlich große Vögel mit kurzem, zusammengedrücktem, stark gebogenem Schnabel, mäßig starken oder kurzen Füßen, kurzen, sehr gerundeten Flügeln, deren fünfte oder sechste Schwinge am längsten ist, und verlängertem, keilförmigem Schwanze, in welchem die zwei Mittelfedern weit hervorragen.
Als Vertreter der Sippe mag die Wanderelster oder der Landstreicher, »Kotri« der Inder ( Dendrocitta rufa, vagabunda und pallida, Pica rufa und vagabunda, Crypsirhina rufa, vagabunda und pallida, Temnurus rufus und vagabundus, Lanius und Corvus rufus, Coracias vagabunda und Glaucopis rufa), gelten. Ihre Länge beträgt einundvierzig, die Fittiglänge funfzehn, die Schwanzlänge sechsundzwanzig Centimeter. Kopf, Nacken und Brust sind rußbraun oder schwärzlichbraun, auf dem Vorderkopfe, Kinne und der Brust am dunkelsten, von da an mehr graulich, die Untertheile von der Brust an röthlich oder fahlgilblich, Schulterfedern, Rücken und obere Schwanzdeckfedern dunkelröthlich, die Flügeldeckfedern und die Außenfahnen der Schwingen zweiter Ordnung lichtgrau, fast Weiß, die übrigen Schwingen schwarz, die Steuerfedern aschgrau mit schwarzen Endspitzen. Der Schnabel ist schwarz, der Fuß dunkelschieferfarben, das Auge blutroth.

Wanderelster ( Dendrocitta rufa). ½ natürl. Größe.
Die Wanderelster ist über ganz Indien verbreitet und kommt außerdem in Assam, China und, nach Adams, auch in Kaschmir vor. Sie ist überall häufig, namentlich aber in den waldigen Ebenen ansässig. In den nördlichen Theilen Indiens sieht man sie in jeder Baumgruppe und in jedem Garten, auch in unmittelbarer Nähe der Dörfer. Sehr selten begegnet man einer einzigen, gewöhnlich einem Paare und dann und wann einer kleinen Gesellschaft. Diese fliegt langsam und in wellenförmigen Linien von Baum zu Baum und durchstreift während des Tages ein ziemlich ausgedehntes Gebiet, ohne sich eigentlich einen Theil desselben zum bestimmten Aufenthaltsorte zu erwählen. Auf den Bäumen findet die Wanderelster alles, was sie bedarf; denn sie nährt sich zuweilen lange Zeit ausschließlich von Baumfrüchten, zu anderen Zeiten aber von Kerbthieren, welche auf Bäumen leben. Die Eingeborenen versichern, daß auch sie Vogelnester ausnehme und nach Würgerart jungen Vögeln nachstelle. Smith beobachtete, daß einer dieser Vögel in den Schattenraum des Hauses flog, hier zunächst junge Pflanzen abbiß und hierauf einen Käfig mit kleinen Vögeln besuchte, welche nach und nach sämmtlich von ihm getödtet und gefressen wurden; Buckland behauptet sogar, daß ein anderer Landstreicher Fledermäuse gejagt habe.
Von den Indern scheint der schmucke Vogel oft in Gefangenschaft gehalten zu werden, da auch wir ihn nicht selten lebend erhalten. Sein Betragen ist mehr das der Blauelster als das unserer deutschen Elster. Bei guter Pflege dauert er vortrefflich in der Gefangenschaft aus, wird auch bald sehr zahm.
Die Laubelstern oder Kittas ( Urocissa) sind zierlich gebaute Vögel mit lebhaft gefärbtem Kleide. Ihr Schnabel ist fast kopflang, dick, stark, von der Wurzel an gekrümmt, an der Spitze übergebogen, der Fuß lang und stark mit kräftigen, mittellangen, durch tüchtige Nägel bewehrten Zehen; in den runden Flügeln sind die vierte und die fünfte Schwinge die längsten; der Schwanz ist entweder sehr lang und abgestuft oder kurz und abgerundet.
Die Schweifkitta ( Urocissa erythrorhyncha, sinensis und brevivexilla, Corvus erythrorhynchus, Coracias melanocephalus, Psilorhynohus sinensis, Calocitta erythrorliyncha und sinensis, Cissa erythrorhyncha und sinensis) ist eine der schönsten Arten der Sippe. Die Länge beträgt dreiundfunfzig, die Fittiglänge neunzehn, die Schwanzlänge zweiundvierzig Centimeter. Kopf, Hals und Brust sind mit Ausnahme eines weißen Längsbandes, welches über das Haupt und den Rücken verläuft und allmählich in Blau übergeht, tiefschwarz, Rücken und Mantel licht kobaltblau, die oberen Schwanzdeckfedern ebenso gefärbt, aber breit schwarz zugespitzt, die Untertheile von der Brust an weißlich, mit einem Schimmer ins Röthlichaschfarbene, die Flügel glänzend kobaltblau, die Innenfahnen der Schwingen aber schwarz, alle Federn weiß zugespitzt, die Steuerfedern blau, die Mittelfedern an der Spitze weiß, die übrigen weiß und schwarz. Das Auge ist scharlachrothbraun, der Schnabel korallroth, der Fuß blaß zinnoberroth.
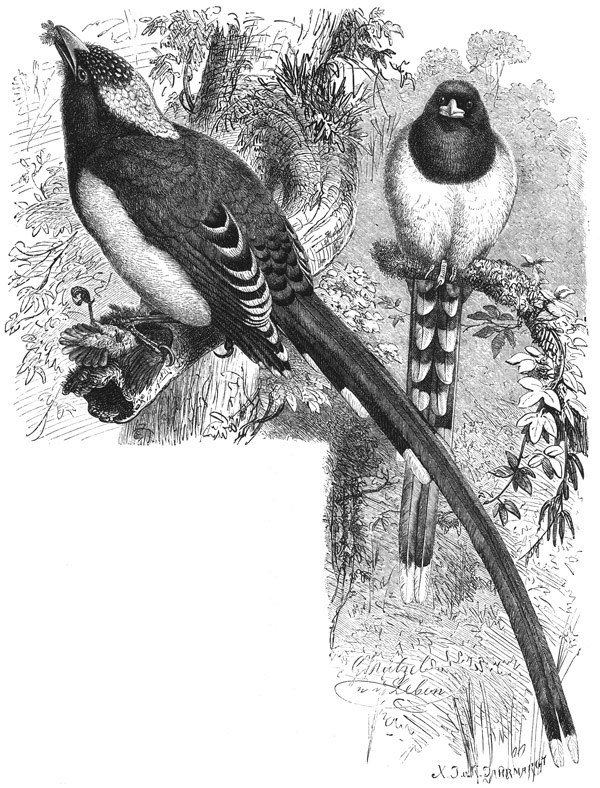
Schweifkitta (Urocissa erythrorhyncha). 2/5 natürl. Größe.
Die Schweifkitta findet sich im westlichen Himalaya und wird im Osten durch eine ihr nah verwandte Art vertreten. In China, namentlich in den Wäldern um Hongkong, ist sie nach Swinhoe's Beobachtungen häufig. Hier lebt sie im Gebüsche, aber meist auf dem Boden, welcher als ihr eigentliches Weidegebiet betrachtet werden muß. Sie ist ein kluges, aufmerksames Geschöpf, welches anderen Vögeln zum Rathgeber, den Raubthieren oft zum Jagdverderber wird. Zumal dem Leoparden soll sie oft meilenweit folgen und manche Jagd ihm vereiteln. Ihr Flug ähnelt, nach Swinhoe, dem unserer Elster, geht geradeaus und erfordert beständige Flügelschläge; der Schwanz wird dabei wagerecht getragen. Im Sitzen auf dem Gezweige richtet sie sich hoch auf und wippt oft mit dem Schwanze. Der Lock- und Warnungston ist ein scharfes »Pink, pink, pink«, dem ein lautes Geschnatter angehängt wird. Auf letzteres hin sieht man alle Mitglieder des Fluges eilfertig von Baum zu Baum fliegen, bis von der Ferne her das »Pink, pink« wieder zum Sammeln ruft. Die Nahrung besteht, laut David, aus Kerbthieren und Früchten. Letzteren zu Liebe besucht sie nicht selten die Nähe der Ortschaften, dringt jedoch nicht in das Innere derselben ein, wie unsere Elster unter ähnlichen Umständen zu thun pflegt.
Das Nest erbaut die Schweifkitta auf Bäumen, zuweilen sehr niedrig über dem Grunde, manchmal bedeutend höher. Es ist ein locker zusammengefügter Bau, welcher aus Reisern besteht und mit Wurzelfasern ausgekleidet wird. Die Zahl der Eier beträgt drei bis fünf; ihre Färbung ist ein mattes Grünlichgrau mit dichter brauner Fleckung, welche am breiteren Ende kranzartig zusammenläuft.
In China hält man unseren Vogel zuweilen in der Gefangenschaft und ernährt ihn mit rohem Fleische, jungen oder kleinen Vögeln, Kerbthieren und dergleichen. Von hier aus erhalten auch wir zuweilen einen oder den anderen dieser Prachtvögel lebend.
Raben mit Finkenschnabel sind die Gimpelheher, wie ich sie genannt habe ( Brachyprorus), ausgezeichnet durch hohen, seitlich zusammengedrückten, an der Wurzel verbreiterten, auf der Firste stark gebogenen, in die Stirne einspringenden Schnabel mit großen, runden, freiliegenden Nasenlöchern, sehr kräftige Füße, mittellange Flügel, unter deren Schwingen die dritte und vierte die Spitze bilden, langen, breiten, stark abgerundeten Schwanz und verhältnismäßig hartes, breites, kurzes, glatt anliegendes Gefieder.
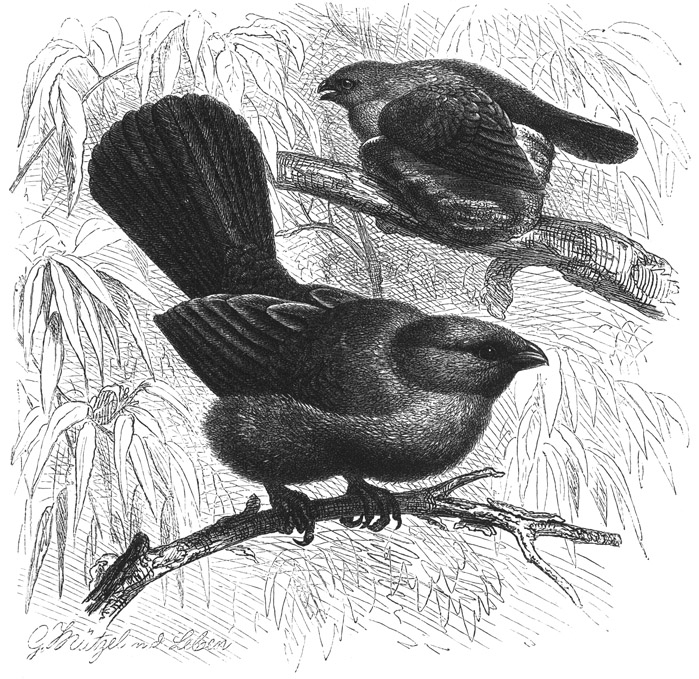
Grauling ( Brachyprorus cinereus). 1/3 natürl. Größe.
Der Grauling (Brachyprorus cinereus, Struthidea und Brachystoma cinerea) ist fast einfarbig bräunlichaschgrau; die schmalen Federn auf Kopf, Hals und Brust zeigen etwas hellere Endspitzen; die Schwingen und Flügeldecken sind oliven-, die hinteren Armdecken schwarzbraun wie die Innenfahne der Schwingen, die Schwanzfedern rauchbraun mit metallisch scheinendem Außensaume. Der Augenring ist perlweiß, der Schnabel wie der Fuß schwarz. Die Länge beträgt etwa dreißig, die Fittiglänge funfzehn, die Schwanzlänge siebzehn Centimeter.
Ueber das Freileben des Graulings, welcher neuerdings nicht allzuselten in unsere Käfige gelangt und in Gefangenschaft vortrefflich ausdauert, liegen nur dürftige Berichte vor. Gould, welcher den Vogel als eine der auffallendsten Erscheinungen der gefiederten Welt Australiens ansieht, begegnete ihm im Inneren der südlichen und östlichen Theile des Erdtheils, und zwar in Nadelwaldungen, meist in Gesellschaften von drei oder vier Stücken, welche namentlich in den Wipfelzweigen rasch und ruhelos umherhüpften, von Zeit zu Zeit die Flügel breiteten und dabei rauhe, ungefällige Töne ausstießen, im ganzen aber sich nach Rabenart benahmen und von Kerbthieren ernährten. Das Nest fand Gilbert in einem kleinen Buschgehölze, auf dem wagerechten Zweige eines Baumes aufgeklebt. Es besteht aus Schlamm, ist innen mit Gras ausgelegt und enthält vier etwa dreißig Millimeter lange und zweiundzwanzig Millimeter breite, auf weißem Grunde mit röthlichbraunen, purpurbraunen und kleinen grauen Flecken, namentlich am dickeren Ende, bedeckte Eier.
Gefangene Vögel dieser Art, welche ich längere Zeit pflegte, gaben mir Gelegenheit, eingehendere Beobachtungen anzustellen. Selbst unter Raben fallen die Graulinge durch ihre außerordentliche Beweglichkeit und Rastlosigkeit auf. Hinsichtlich der ersteren erinnern sie in mancher Beziehung an die Heher, springen aber leichter und bewegen auch die Flügel kräftiger als diese. Ihre Stellung ist sehr verschieden, eine besondere Lieblingsstellung von ihnen diejenige, welche unser Zeichner dem Leben abgelauscht und vortrefflich wiedergegeben hat. Die Stimmlaute, welche zwischen Krächzen und Seufzen ungefähr in der Mitte liegen, wie sich während der Paarungszeit leicht beobachten läßt, sind vielfacher Vertönung fähig. Gesellig, verträglich und friedfertig, bekümmern sich die Graulinge um andere Vögel, welche denselben Raum mit ihnen theilen, so lange nicht, als diese sie selbst in Ruhe lassen; während der Brutzeit aber ändert sich ihr Wesen insofern, als sie jede Annäherung irgend eines Vogels an das Nest sofort zurückweisen. Bei dieser Gelegenheit zeigen sie sich als ebenso muthige wie kampffähige Gegner und gebrauchen nicht allein den Schnabel, sondern auch die Klauen in gefährlicher Weise. Je abstoßender nach außen, um so zärtlicher benehmen sie sich gegen den Gatten. Die rauhen Laute des liebebegehrenden Männchens gewinnen eine Sanftheit und Gefälligkeit, welche man ihm nie zugemuthet haben würde, und seine Liebeswerbungen werden aus dem Grunde besonders anmuthig, als es das Weibchen mit zierlichen Schritten umgeht und zeitweilig mit einem Flügel förmlich überdeckt. Währenddem beginnt auch der Bau des Nestes, welcher, wie mir scheinen wollte, vom Weibchen allein ausgeführt wird. Nachdem sich dieses für einen mehr oder minder wagerecht verlaufenden, nicht allzuschwachen Ast und eine bestimmte Stelle auf ihm entschieden hat, beginnt es, die Oberfläche desselben mit Lehm zu bestreichen, bringt letzteren klümpchenweise herbei, befeuchtet ihn mit Speichel, durchknetet ihn währenddem sehr sorgfältig und trägt ihn endlich langsam auf; denn es wartet wie andere Kleibe-Vögel stets so lange, bis eine Schicht vollkommen trocken geworden ist. Um die Unterlage des Nestes herzustellen, wird zuerst eine länglichrunde, wagerecht liegende Scheibe zu beiden Seiten des Astes in Angriff genommen und auf dieser sodann allmählich die napfartige Mulde aufgebaut, bis das ganze Nest die Gestalt eines mehr als halbkugeltiefen Napfes erreicht hat. Schon zum Aufbaue der Scheibe verwendet der kluge Vogel Pferdehaare; zur Herstellung der Wandungen benutzt er dieselben in reichlicher Menge derart, daß sie allenthalben den Lehm zusammenhalten und zur Befestigung des ganzen wesentlich beitragen. Die Wandung des Nestes besitzt unten eine Stärke von etwa fünfundzwanzig, oben am Rande von nur funfzehn Millimeter. Die innere Auskleidung besteht, falls sie überhaupt vorhanden, aus einer dünnen Schicht von Halmen und Haaren.
Seitdem ich vorstehende Beobachtungen sammelte, haben die Graulinge auch unter anderer Pfleger Obhut gebaut und gebrütet, soviel mir bekannt, aber noch nirgends Junge aufgebracht, weil zufällige Störungen jedesmal das Gedeihen der Brut verhinderten.
Zur Familie der Raben rechnet man neuerdings auch den Hopflappenvogel ( Heteralocha acutirostris und Gouldii, Neamorpha acutirostris, crassirostris und Gouldii), welcher mit verwandten Sippen eine besondere, auf Neuseeland beschränkte Gruppe bildet und mit ihnen an der Schnabelwurzel entspringende, mehr oder minder entwickelte buntfarbige Hautlappen gemein hat. Der Hopflappenvogel unterscheidet sich von seinen nächsten Verwandten und allen bekannten Vögeln überhaupt dadurch, daß der Schnabel des Weibchens von dem des Männchens wesentlich abweicht. Bei letzterem ist er etwa kopflang, auf der Firste fast gerade, der Breite nach flach gerundet, an der Wurzel hoch, seitlich stark zusammengedrückt, im ganzen aber gleichmäßig nach der Spitze hin verschmächtigt; bei dem Weibchen dagegen mindestens doppelt so lang als beim Männchen, verschmächtigt und verschmälert, merklich gekrümmt und in eine feine Spitze ausgezogen, der Oberschnabel auch über den unteren verlängert. Gegenüber diesen Merkmalen sind die übrigen Kennzeichen untergeordneter Art. Der hochläufige und langzehige Fuß ist mit äußerst kräftigen, starkgebogenen Klauen bewehrt, der Flügel lang, aber abgerundet, weil in ihm die fünfte bis siebente Schwinge die Spitze bildet, der Schwanz mittellang, breit, sanft abgerundet, das Kleingefieder reich, dicht und etwas glänzend. Die Länge des männlichen Hopflappenvogels beträgt etwa achtundvierzig, die des Weibchens funfzig, bei beiden die Fittiglänge etwa zwanzig Centimeter, die Schnabellänge dagegen beim Männchen vierzig, beim Weibchen sechsundneunzig Millimeter. Das Gefieder ist bis auf einen breiten weißen Endrand der Steuerfedern einfarbig schwarz, schwach grünlich scheinend, der Augenring tiefbraun, der Schnabel elfenbeinweiß, an der Wurzel schwärzlichgrau, der große winkelige Mundwinkellappen orangefarbig, der Fuß dunkel blaugrau. Junge Vögel unterscheiden sich nur durch die röthlich getrübte Färbung des Schwanzspitzenbandes und die weiß gerandeten Unterschwanzdeckfedern von den alten.

Hopflappenvogel ( Heteralocha acutirostris). ⅓ natürl. Größe
Die Berichte über das Freileben des Hopflappenvogels sind noch ungemein dürftig, so sehr dieser, die »Huia« der Maoris, die Beachtung aller Vogelkundigen und Ansiedler Neuseelands auf sich gezogen hat. Auf wenige Oertlichkeiten Neuseelands beschränkt und auch hier von Jahr zu Jahre seltener werdend, bietet er wenig Gelegenheit zu eingehenden Beobachtungen. Er lebt mehr auf dem Boden als im Gezweige, bewegt sich mit großen Sprüngen außerordentlich rasch, flieht bei dem geringsten Geräusche oder beim Anblicke eines Menschen so eilig als möglich dichten Gebüschen oder Waldstrecken zu und entzieht sich hier in der Regel jeder Nachstellung. So erklärt es sich, daß man eigentlich nur an gefangenen einige Beobachtungen sammeln konnte. In der Neuzeit sind Huias lebend auch nach London gelangt, soweit mir bekannt, über ihr Betragen Mittheilungen aber nicht veröffentlicht worden; ich vermag deshalb nur mitzutheilen, was Buller von denen berichtet, welche er einige Tage lang pflegte. Bemerkenswerth war die Leichtigkeit, mit welcher die im Freien so scheuen Vögel an die Gefangenschaft sich gewöhnen. Wenige Tage nach ihrer Erbeutung waren sie ganz zahm geworden und schienen den Verlust ihrer Freiheit nicht im geringsten zu empfinden. Schon am nächsten Morgen, nachdem sie in Besitz Bullers gekommen waren, fraßen sie begierig, tranken Wasser und begannen nunmehr, sich lebhaft und flüchtig zu bewegen, bald auch miteinander zu spielen. Ihre Bewegungen auf dem Boden wie im Gezweige waren anmuthig und fesselnd; besonders hübsch sah es aus, wenn sie ihren Schwanz fächerartig breiteten und in verschiedenen Stellungen unter leisem und zärtlichem Gezwitscher einander mit ihren Elfenbeinschnäbeln liebkosten. Mit letzterem untersuchten, behackten und bemeiselten sie alles. Sobald sie entdeckt hatten, daß die Tapeten ihres Zimmers nicht undurchdringlich waren, lösten sie einen Streifen nach dem anderen ab und hatten in kürzester Frist die Mauer vollständig entblößt. Besonders anziehend aber war für Buller die Art und Weise, wie sie bei Erbeutung ihrer Nahrung gegenseitig sich unterstützten. Da man verschiedene Erdmaden, Engerlinge und ebenso Samen und Beeren in dem Magen erlegter Stücke gefunden hatte, brachte Buller einen morschen Klotz mit großen, fetten Larven eines »Huhu« genannten Kerbthieres in ihren Raum. Dieser Klotz erregte sofort ihre Aufmerksamkeit; sie untersuchten die weicheren Theile mit dem Schnabel und gingen sodann kräftig ans Werk, um das morsche Holz zu behauen, bis die in ihm verborgenen Larven oder Puppen des besagten Kerbthieres sichtbar wurden und hervorgezogen werden konnten. Das Männchen war hierbei stets in hervorragender Weise thätig, indem es nach Art der Spechte meiselte, wogegen das Weibchen mit seinem langen, geschmeidigen Schnabel alle jene Gänge, welche wegen der Härte des umgebenden Holzes von dem Männchen nicht erbrochen werden konnten, untersuchte und ausnutzte. Mehrmals beobachtete Buller, daß das Männchen vergeblich sich bemühte, eine Larve aus einer bloßgelegten Stelle hervorzuziehen, dann stets durch das Weibchen abgelöst wurde und ihm den Bissen, welches letzteres leicht sich aneignete, auch gutwillig abtrat. Anfänglich verzehrten beide nur Huhularven, im Laufe der Zeit gewöhnten sie sich auch an anderes Futter, und zuletzt fraßen sie gekochte Kartoffeln, gesottenen Reis und rohes, in kleine Stücke zerschnittenes Fleisch ebenso gern wie ihre frühere Nahrung. Zu ihrem Badenapfe kamen sie oft, immer aber nur, um zu trinken, nicht aber, um sich zu baden. Ihr gewöhnlicher Lockton war ein sanftes und klares Pfeifen, welches zuerst langgezogen und dann kurz nach einander wiederholt, zuweilen in höheren Tönen ausgestoßen oder sanft vertönt oder in ein leises Krächzen umgewandelt wurde, zuweilen dem Weinen kleiner Kinder bis zum Täuschen ähnelte.
Ueber die Fortpflanzungsgeschichte der Huia vermag Buller nur die Berichte der Eingeborenen mitzutheilen, denen zufolge der Vogel in hohlen Bäumen nistet und wenige Eier legt.
Die Hauptursache des vereinzelten Auftretens und der stets fortschreitenden Abnahme des Hopflappenvogels ist darin zu finden, daß die Eingeborenen dessen Federn als Kopfschmuck verwenden, lebhaft begehren und theuer bezahlen, der Huia dementsprechend nachstellen, wo und wann immer sie können. Wahrscheinlich haben die neuseeländischen Forscher nicht Unrecht, wenn sie fürchten, daß infolge dieser Liebhaberei der Maoris der so überaus merkwürdige Vogel früher oder später das Loos anderer gefiederten Heimatsgenossen theilen, nämlich ausgerottet werden möge.
In den Wüsten, welche im Inneren Asiens, zwischen dem Aralsee und Tibet, sich erstrecken hausen absonderliche Rabenvögel, über deren Verwandtschaft mit anderen ihrer Familie verschiedene Anschauungen herrschen. Sharpe bringt sie in der Unterfamilie der Felsenraben unter, Gray vereinigt sie mit den Hehern; wir erkennen in ihnen Raben, welche von allen übrigen abweichen und deshalb zu Vertretern einer besonderen Unterfamilie, der Wüstenheher ( Podocinae), erhoben werden müssen. Der Schnabel der vier bekannten Arten, welche einer einzigen, gleichnamigen Sippe angehören, ist ziemlich lang und im ganzen, oben von der Wurzel bis zur Spitze gleichmäßig und sanft, unten sehr schwach gebogen, oberseits kaum über den Unterschnabel verlängert, der Fuß schlank, sein Lauftheil doppelt so hoch als die Mittelzehe lang, mit kräftigen, stark gebogenen Nägeln bewehrt, der Flügel mittellang, in ihm die vierte Schwinge die längste, der Schwanz mäßig lang, am Ende sanft abgerundet, das Gefieder reich und weich, nach Geschlecht und Alter wenig oder nicht verschieden gefärbt.
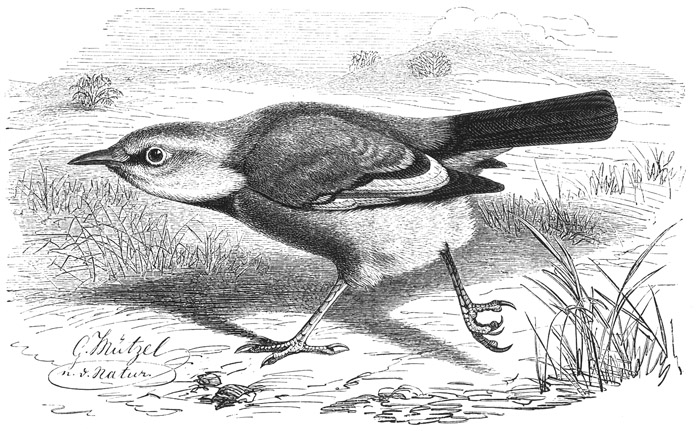
Saxaulheher ( Podoces Panderi). 2/5 natürl. Größe.
Das Urbild der Sippe und Unterfamilie ist der Saxaulheher ( Podoces Panderi, Corvus, Pica und Garrulus Panderi). Seine Länge beträgt ungefähr fünfundzwanzig, die Fittiglänge zwölf, die Schwanzlänge zehn Centimeter. Alle Obertheile sind schön hell aschgrau, Kehle und Vorderhals etwas lichter, die Untertheile weißlichgrau, licht weinroth überflogen, die unteren Schwanzdecken fast weiß, ein breiter, bis zum weiß umrandeten Auge reichender Zügelstrich und ein dreieckiger, nach unten verbreiterter Fleck am Unterhalse schwarz, die Schwingen weiß, die ersten beiden außen und an der Spitze, die übrigen nur im Spitzendrittel schwarz, alle auch ebenso geschaftet, stahlblau glänzend, die Armschwingen und großen Flügeldecken an der Wurzel schwarz, übrigens weiß, die letzten Schulterfedern bis auf einen nach hinten zu mehr und mehr sich verschmälernden Endrand schwarz, wodurch zwei weiße und ebensoviele schwarze Binden gebildet werden, die Steuerfedern schwarz mit grünlichem Metallglanze. Das Auge hat braune, der Schnabel wie der Fuß bleigraue Färbung. Männchen und Weibchen unterscheiden sich nicht, junge Vögel durch schmutzig hellbräunlichgraue Hauptfärbung, Fehlen des schwarzen Zügelstreifens und des Halsfleckes, Glanzlosigkeit der Schwingen und schwächeren Glanz der Steuerfedern.
Obwohl der Saxaulheher bereits im Jahre 1823 von Eversmann entdeckt und später von einzelnen Reisenden wiederholt beobachtet wurde, danken wir doch erst Bogdanow eine im Jahre 1877 veröffentlichte Lebensschilderung desselben. Seine Heimat ist die im Osten des Aralsees, zwischen Sir- und Amu-Darja gelegene Einöde Kysil-Kum, eine Sandwüste im vollen Sinne des Wortes, »eben und grenzenlos wie ein offenes, aber im Sturmesschwunge erkaltetes Meer«, in welcher außer seltsamem Gethier nur wenige wunderbare Pflanzen, insbesondere aber der Saxaul- oder Widderholzstrauch, dürftiges Leben fristen. Hier, auf dem Sande, lebt der Vogel; selten nur verläuft er sich bis auf den Lehmboden, niemals auf steinigen Grund dieser Wüste; in der Nähe von Flüssen und Seen begegnet man ihm ebensowenig. Mit Bestimmtheit kann man sagen, daß er niemals trinkt und keines Wassers bedarf (?). In der Sandwüste sucht er solche Stellen auf, wo die Sandhügel mit sehr spärlichem Wachsthume bedeckt sind, wo die Wüstensträucher einzeln zerstreut und von einander weit entfernt stehen. Wahrscheinlich aber rückt er nach Norden hin vor, hat wenigstens den Sir-Darja bereits überschritten.
Einzeln und ungesellig verlebt der Saxaulheher den größten Theil des Jahres in einem und demselben Gebiete, ohne zu wandern. Den ganzen Tag über läuft er, in der Nähe der Sträucher und im Sande Nahrung suchend, mit weiten Schritten, weder springend noch hüpfend, sondern nach Art der Hühnervögel eilfertig und ungewöhnlich rasch dahinrennend, innerhalb seines Wohnkreises umher. Kein einziger Rabe schreitet so weit aus wie er. Bei Gefahr eilt er von einem Saxaulstrauche zum anderen, versteckt sich hinter jedem und lugt bald von der einen, bald von der anderen Seite hinter dem dicken Stamme hervor. Zum Auffliegen entschließt er sich selten und kaum ohne Zwang; fliegt er wirklich einmal, so läßt er sich sobald als möglich wieder nieder, um wie zuvor zu laufen. Ebenso selten und wohl nur, um von einem erhöhten Punkte weitere Umschau zu halten, setzt er sich auf die Spitzen eines Strauches. Sein Flug erinnert an den der Elster, des Hehers und des Würgers. Für gewöhnlich betreibt er seine Geschäfte schweigsam; doch vernimmt man dann und wann auch einen aus mehreren grellen, hohen, abgerissenen, dem Jauchzen der Spechte nicht unähnlichen Tönen bestehenden Schrei von ihm.
Ungestört beschäftigt er sich fast beständig mit Aufnahme seiner Nahrung, welche er entweder vom Boden aufliest, oder zwischen dem Gewurzel der Gesträuche hervorwühlt. Im Frühlings und Sommer fand Bogdanow fast nur Käferlarven in dem Magen der von ihm getödteten Stücke, wahrscheinlich die verschiedener Trauerkäfer ( Blaps), welche die Wüste in Menge bewohnen, seltener die Reste dieser Käfer selbst. Bereits im August muß sich der Vogel, weil die Käfer um diese Zeit zu verschwinden beginnen, nach anderer Nahrung umsehen und mit den Samen des Saxaul und anderer Wüstensträucher begnügen. Diese Sämereien bilden wahrscheinlich sein ausschließliches Winterfutter. Im Spätherbste gesellt er sich den Viehherden der Kirgisen und untersucht jener Mist, um irgendwelche Nahrung zu erlangen. Bei dieser Gelegenheit nähert er sich nicht allein den Karawanenstraßen, sondern auch den Jurten der Kirgisen, ohne irgendwie Scheu vor dem Menschen zu verrathen.
Schon im Winter, wahrscheinlich im Februar, vereinigen sich die so ungeselligen Vögel zu Paaren, um zur Fortpflanzung zu schreiten. Bis dahin hatte ein Begegnen zweier Saxaulheher, besonders zweier eines und desselben Geschlechtes, stets einen Kampf zur Folge, nach dessen Beendigung beide wiederum aus einander liefen. Wie es sich nunmehr verhält, vermag Bogdanow nicht zu sagen, da er weder das eheliche Leben des Vogels beobachten, noch dessen Nest und Eier auffinden konnte. Letztere, mit denen uns Fedtschenko bekannt gemacht hat, sind etwa dreißig Millimeter lang, zwanzig Millimeter dick und auf graugrünlichem Grunde überall, gegen das dicke Ende hin kranzartig, mit verschieden großen, dunkel graugrünen und feinen blaßrothen Punkten gezeichnet. Die Nester, welche nicht weiter beschrieben werden, standen in Manneshöhe über dem Boden auf den oben genannten Sträuchern. Fedurin, ein Begleiter Bogdanows, fand am dreiundzwanzigsten April ein Saxaulheherpaar mit zwei ausgeflogenen Jungen, und letzterer schließt daraus, daß die Legezeit schon in den ersten Tagen des März beginnen muß.
Die letzte Unterfamilie vereinigt die Pfeifkrähen ( Phonigaminae), Verbindungsglieder der Raben- und Würgerfamilie. Sie kennzeichnen der gestreckt kegelförmige, an der Wurzel breite, seitlich zusammengedrückte, mit der Firste in die Stirn eindringende, auf ihr bis gegen die Spitze hin fast gerade, an der Spitze hakig übergebogene Schnabel, der echt rabenartige Fuß, der lange, spitzige Flügel und der mittellange, gerade abgeschnittene oder sanft gerundete Schwanz.
Neuholland ist die Heimat der Pfeifkrähen. Hier leben sie an allen geeigneten Orten, ungewöhnlich behend auf dem Boden laufend, nicht minder gewandt im Gezweige sich bewegend, aber nicht gerade leicht und sicher fliegend. Kleine Thiere verschiedener Klassen, insbesondere Schrecken, kleine Wirbelthiere, Früchte, Körner und Sämereien bilden ihre Nahrung. »Wenige Vögel«, sagt Gould, »sind zierlicher oder beleben die Gegend, in welcher sie erscheinen, in anmuthigerer Weise als sie, sei es durch ihre gewandten Bewegungen auf und über dem Boden, oder sei es durch ihre laut schallenden Flötentöne, welche sie im Sitzen wie im Fliegen hören lassen.« Sie fliegen meist in Gesellschaften zu vier bis sechs Stück, wahrscheinlich in Familien, aus den beiden Eltern und ihren Kindern bestehend. Ihre Nester werden aus Reisig aufgebaut und mit Gräsern und anderen passenden Stoffen ausgefüllt; das Gelege enthält drei bis vier Eier. Die Jungen, welche von beiden Eltern aufgefüttert und sehr muthig vertheidigt werden, erhalten schon nach der ersten Mauser das ausgefärbte Kleid.
Der Flötenvogel ( Gymnorhina tibicen, Coracias, Barita und Cracticus tibicen), welcher in den letzten Jahren ein Bewohner aller Thiergärten geworden ist, kommt einer Saatkrähe an Größe ungefähr gleich. Seine Länge beträgt dreiundvierzig, die Fittiglänge siebenundzwanzig, die Schwanzlänge vierzehn Centimeter. Das Gefieder ist der Hauptsache nach schwarz, auf Nacken, Unterrücken, den oberen und unteren Schwanzdeckfedern und den vorderen Flügeldeckfedern aber weiß. Das Auge ist röthlichnußbraun, der Schnabel bräunlichaschgrau, der Fuß schwarz.
Nach Gould ist der Flötenvogel besonders in Neusüdwales häufig und ein in hohem Grade augenfälliger Vogel, welcher die Gefilde sehr zu schmücken weiß, da, wo man ihn nicht verfolgt oder vertreibt, in die Gärten der Ansiedler hereinkommt, bei einiger Hegung sogar die Wohnungen besucht und ihm gewährten Schutz durch größte Zutraulichkeit erwidert. Sein buntes Gefieder erfreut das Auge, sein eigenthümlicher Morgengesang das Ohr. Offene Gegenden, welche mit Baumgruppen bewachsen sind, bilden seine bevorzugten Wohnsitze; deshalb zieht er das Innere des Landes der Küste vor. Die Nahrung besteht hauptsächlich aus Heuschrecken, von denen er eine unschätzbare Menge verzehrt. Im August beginnt und bis zum Januar währt die Brutzeit, da jedes Pärchen zweimal nistet. Das runde und offene Nest wird aus Reisholz und Blättern erbaut und mit zarteren Stoffen, wie sie eben vorkommen, ausgefüttert. Die drei bis vier Eier, welche das Gelege ausmachen, konnte Gould nicht erhalten; dagegen beschreibt er die eines sehr nahen Verwandten. Sie sind auf düster bläulichweißem, zuweilen ins Röthliche spielendem Grunde mit großen braunrothen oder licht kastanienbraunen Flecken zickzackartig gezeichnet.
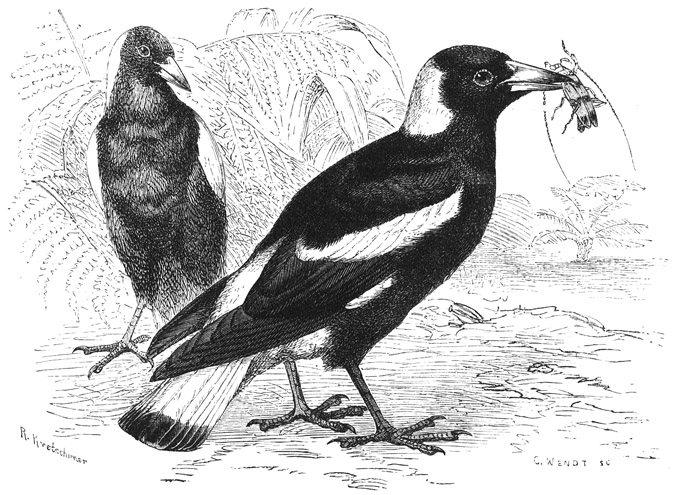
Flötenvogel ( Gymnorhina tibicen). 3/10 natürl. Größe.
Als Gould Australien bereiste, gehörte ein gefangener Flötenvogel noch zu den Seltenheiten; gegenwärtig erhalten wir ihn häufig lebend. Er findet viele Liebhaber und ist in Thiergärten geradezu unentbehrlich. Schon der schweigsame Vogel zeigt sich der Theilnahme werth; allgemein anziehend aber wird er, wenn er eines seiner sonderbaren Lieder beginnt. Ich habe Flötenvögel gehört, welche wunderherrlich sangen, viele andere aber beobachtet, welche nur einige fugenartig verbundene Töne hören ließen. Jeder einzelne Laut des Vortrages ist volltönend und rein; nur die Endstrophe wird gewöhnlich mehr geschnarrt als geflötet. Unsere Vögel sind, um es mit zwei Worten zu sagen, geschickt im Ausführen, aber ungeschickt im Erfinden eines Liedes, verderben oft auch den Spaß durch allerlei Grillen, welche ihnen gerade in den Kopf kommen. Gelehrig im allerhöchsten Grade, nehmen sie ohne Mühe Lieder an, gleichviel, ob dieselben aus beredtem Vogelmunde ihnen vorgetragen, oder ob sie auf einer Drehorgel und anderweitigen Tonwerkzeugen ihnen vorgespielt werden. Sämmtliche Flötenvögel, welche ich beobachten konnte, mischen bekannte Lieder, namentlich beliebte Volksweisen, in ihren Gesang; sie scheinen dieselben während der Ueberfahrt den Matrosen abgelauscht zu haben. Bekannte werden regelmäßig mit einem Liede erfreut, Freunde mit einer gewissen Zärtlichkeit begrüßt. Die Freundschaft ist jedoch noch leichter verscherzt als gewonnen; denn nach meinen Erfahrungen sind diese Raben sehr heftige und jähzornige, ja rachsüchtige Geschöpfe, welche sich bei der geringsten Veranlassung, oft in recht empfindlicher Weise, ihres Schnabels bedienen. Erzürnt, sträuben sie das Gefieder, breiten die Flügel und den Schwanz und fahren wie ein erboster Hahn gegen den Störenfried los. Auch mit ihresgleichen leben sie viel im Streite und Kampfe, und andere Vögel fallen sie mörderisch an.
Ihre Haltung im Käfige verursacht keine Schwierigkeiten. Sie bedürfen allerdings thierischer Nahrung, nehmen aber auch gerne mit Pflanzenstoffen vorlieb. Fleisch, Brod und Früchte bilden den Haupttheil ihrer Mahlzeit. Gegen die Witterung zeigen sie sich wenig empfindlich, könnten wohl ohne Gefahr auch während des Winters im Freien gehalten werden.