
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Unserem Edelfinken zu Liebe benennen wir eine ungefähr fünfhundert Arten umfassende, mit alleiniger Ausnahme Australiens über alle Erdtheile verbreitete Familie die der Finken ( Fringillidae). Der Schnabel der zu ihr zählenden Sperlingsvögel ist kegelförmig, verschieden dick, an der Wurzel mit einem mehr oder minder deutlichen Wulste umgeben, der Oberschnabel oft ein wenig länger als der untere und mit schwachem Haken über diesen herabgebogen, ausnahmsweise auch mit letzterem gekreuzt, an den Schneiden bis zum Mundwinkel eingezogen, der Fuß mäßig lang, meist ziemlich kurzzehig und durchgehends mit schwachen Nägeln bewehrt, der Lauf hinten mit ungeteilten Schienen bekleidet, der Handtheil des Fittigs stets mit neun Schwingen besetzt, der Flügel übrigens verschieden lang, der Schwanz immer kurz, höchstens mittellang, das Gefieder, mit wenigen Ausnahmen, dicht anliegend, nach Geschlecht und Alter in der Färbung meist erheblich, zuweilen auch gar nicht verschieden.
Innerhalb der angegebenen Grenzen bewohnen die Finken alle Gürtel der Breite und Höhe, alle Oertlichkeiten von der Küste des Meeres an bis zu den höchsten Spitzen der Berge hinauf, einsame Inseln nicht minder als volksbelebte Städte, die Wüste wie den Wald, nacktes Gestein wie alle denkbaren Pflanzenbestände. Viele von den nordischen Arten sind Zugvögel, die im Süden des gemäßigten Gürtels und in den Gleicherländern lebenden ausnahmslos Standvögel; aber auch viele von denen, welche im Sommer auf eisigen Gefilden ihre Nahrung finden und nisten, verlassen dieselben nicht, so streng der Winter sein möge. Die wandernden Arten stellen sich mit der Schneeschmelze ein und meiden die Heimat erst, wenn der Winter in sie einzieht.
Alle Finken zählen zu den begabten Sperlingsvögeln, mag auch der Volksmund Von einzelnen das Gegentheil behaupten. Sie sind sehr geschickte Läufer oder richtiger Hüpfer, gute Flieger und größtentheils angenehme, einzelne von ihnen sogar vortreffliche Sänger, ihre Sinne wohlentwickelt und ihre geistigen Fähigkeiten denen der meisten übrigen Sperlingsvögel mindestens gleich, sie daher wohl befähigt, die verschiedensten Oertlichkeiten auszunutzen. Meist gesellig, leben viele unter sich doch nur im Herbste und Winter friedfertig zusammen, wogegen auf den Brutplätzen erbitterter Streit nie endet. Solcher hat aber immer nur in Eifersucht seinen Grund; denn Futterneid, obwohl auch ihnen nicht fremd, erregt sie nicht in besonderem Grade. Sämereien der verschiedensten Pflanzen und im Hochsommer Kerbthiere bilden ihre Nahrung, letztere auch vorzugsweise die Atzung der Jungen; an beiden aber fehlt es selten, und wenn es wirklich der Fall ist, einigt die gemeinsame Noth. Fast alle Arten bauen sorgsam hergestellte, dickwandige, außen und innen zierlich gestaltete, sauber ausgekleidete Nester aus verschiedenen pflanzlichen und thierischen Stoffen, brüten zweimal, einzelne auch dreimal im Jahre, legen fünf bis acht auf lichterem Grunde dunkler gefleckte und gestrichelte Eier, ziehen demnach eine zahlreiche Nachkommenschaft heran und gleichen somit die vielen Verluste aus, welche allerlei Raubthiere ihrem Bestande zufügen. Auch der Mensch tritt ihnen zuweilen feindlich entgegen, um sie von seinen Nutzpflanzen abzuwehren; im allgemeinen aber sind sie wohlgelitten, schaden auch in der That nur ausnahmsweise und zeitweilig, bringen dafür erheblichen Nutzen und erfreuen außerdem durch ihr lebhaftes Betragen und die angenehmen Lieder, welche sie zum besten geben. Ihrer Anspruchslosigkeit und leichten Zähmbarkeit halber eignen sie sich mehr als die meisten Angehörigen ihrer Ordnung zu Käfigvögeln. Von Alters her sind sie Haus- und Stubengenossen des Menschen, und einzelne von ihnen werden, wenigstens hier und da, noch mehr als die Nachtigall geschätzt, verehrt, ja förmlich vergöttert. Eine Art, und zwar der einzige Sperlingsvogel, ist sogar zum förmlichen Hausthiere geworden, hat sich als solches die ganze Erde erobert und belebt durch seinen angenehmen Gesang das einsamste Blockhaus auf frisch gerodeter Waldstelle wie das Dachstübchen des Arbeiters. Mehr als ein Fink gehört in Deutschland zum Hause, zur Familie, läßt diese ihre Armut vergessen und erheitert den arbeitsmüden Mann durch den belebenden, frischen Klang, welchen sein Lied in die Werkstatt bringt. Mehr noch über ihre Bedeutung zu sagen, erscheint unnöthig; denn so nützlich sie sonst auch sein mögen durch Verzehren der Unkrautsämereien und Kerbthiere wie durch ihr wohlschmeckendes Fleisch, so sehr sie jeden Naturfreund durch ihr helles Lied draußen im Felde und Walde erfreuen: größeren Ruhm können sie sich doch nicht erringen, als sie im Käfige durch Beglückung des Menschen bereits sich erworben haben.
Ueber die Eintheilung der Finken herrschen noch heutigen Tages sehr verschiedene Ansichten; denn auch diese Familie befindet sich, um Wallace's Worte zu gebrauchen, »in einem sehr ungeordneten Zustande«. Doch einigt man sich mehr und mehr, die nachstehend von mir angegebenen Unterfamilien anzuerkennen. Eine solche bilden die Ammer ( Emberizinae), eine an Sippen reiche, etwa fünfundfunfzig Arten umfassende, sehr übereinstimmende Gruppe. Die Ammer sind dickleibige Sperlingsvögel mit verhältnismäßig kleinem, kurz kegelförmigem und spitzigem, an der Wurzel dickem, nach vorn seitlich zusammengedrücktem, oberseits mehr als unten verschmälertem, an den Rändern stark eingebogenem, am Mundwinkel eckig und steil herabgebogenem Schnabel, dessen Oberkiefer im Gaumen einen knöchrigen, in eine entsprechende Aushöhlung des Unterkiefers passenden Höcker trägt, kurzen, langzehigen Füßen, unter deren Nägeln der oft spornartig verlängerte der hinteren Zehe besonders hervortritt, mittelgroßen Flügeln, in denen die zweite und dritte Schwinge die längsten zu sein pflegen, ziemlich langem, etwas breitfederigem, am Ende schwach ausgeschnittenem Schwanze und lockerem, nach Geschlecht und Alter meist verschiedenem Gefieder.
Die Ammer gehören ihrer Hauptmenge nach der Nordhälfte der Erde an, leben größtenteils in niederem Buschwerke oder Röhrichte, gehören nicht zu den beweglichsten und begabtesten Finken, entbehren jedoch keineswegs der Anmuth in ihrem Wesen, sind sehr gesellig und friedlich, nähren sich während des Sommers vorzugsweise von Kerbthieren, im Herbste und Winter von mehligen Sämereien, welche sie, wie die Kerfe, auf dem Boden suchen, bauen ihr stets einfaches Nest auf dem Boden in eine kleine Vertiefung desselben oder doch nur wenig über die Bodenfläche erhöht und belegen dasselbe mit vier bis sechs dunklen, betüpfelten und geaderten Eiern, welche von beiden Eltern bebrütet werden. Ihres wohlschmeckenden, im Herbste sehr fetten Fleisches halber werden einzelne Arten schon seit Alters her eifrig verfolgt, wogegen andere unbehelligt von den Menschen leben, da sie auch im Gebauer nur ausnahmsweise gehalten werden.
Als Verbindungsglieder zwischen Lerchen und Finken dürfen die Sporenammer ( Plectrophanes) angesehen werden. Ihre Merkmale liegen in dem kleinen Schnabel mit wenig bemerkbarem Gaumenhöcker, den kräftigen Gehfüßen, deren Hinterzehe einen ihr an Länge gleichen Sporn trägt, den spitzigen Flügeln, unter deren Schwingen die beiden ersten die längsten sind, dem kurzen, am Ende ausgeschnittenen Schwänze und dem reichen Federkleide.

Ammer.
1, 2 Weidenammer. 3 Grauammer. 4, 5 Goldammer. 6 Zwergammer. 7, 8 Schneeammer.
Beim Sporenammer, Lerchen- und Lappenammer, Sporen-, Lerchen- und Ammerfink ( Plectrophanes lapponicus und calcaratus, Fringilla lapponica und calcarata, Emberiza calcarata, Passerina und Centrophanes lapponica) sind Kopf, Kinn und Kehle schwarz, ein breiter Augen- und Schläfenstreifen rostweißlich, Nacken und Hinterhals, ein Feld bildend, zimmetroth, die übrigen Obertheile rostbraun, durch schwarze Schaftflecke gezeichnet, Halsseiten und Untertheile weiß, letztere seitlich mit schwarzen Schaftstreifen, welche auf der Brustseite zu einem großen Fleck zusammenfließen, geziert, die Schwingen braunschwarz mit schmalen, fahlbraunen, die hinteren Armschwingen und Deckfedern mit breiten rostbraunen Außen-, die oberen Flügeldecken mit falben Endsäumen, welche auf dem größten breiter und heller sind und eine Querbinde herstellen, die Schwanzfedern endlich schwarz, fahl gesäumt, die beiden äußersten außen an der Wurzel und innen am Ende größtentheils weiß, die zweiten von außenher innen mit weißen Endflecken ausgestattet. Der Augenring ist dunkelbraun, der Schnabel strohgelb, bei der Spitze schwarz, auf der Firste blauschwarz, der Fuß bläulichgrau. Beim Weibchen ist die Oberseite rostbräunlich mit dunklen Schaftstrichen, jede Feder dunkel geschäftet, der Nacken roströthlich, der Schläfenstreifen rostgelb, die Unterseite rostfahl und mit undeutlichen dunklen Schaftflecken geschmückt, die Ohrgegend dunkelbräunlich gestrichelt; auch ist ein undeutlicher Bartstreifen vorhanden. Die Länge beträgt sechzehn, die Breite siebenundzwanzig, die Fittiglänge neun, die Schwanzlänge sechs Centimeter.
Der Sporenammer ist ein Kind der Tundra, sein Verbreitungsgebiet daher über den Norden beider Welten ausgedehnt. Von hier aus wandert er im Winter so weit nach Süden hinab, als er unbedingt muß, erscheint schon in Deutschland nur ausnahmsweise, weiter südlich höchstens als verflogener Irrling, und kehrt, sobald er irgend kann, wieder in seine rauhe Heimat zurück. Hier ist er aller Orten überaus häufig, macht auch zwischen der Tiefe und Höhe kaum einen Unterschied, vorausgesetzt, daß die Zwergbirke eine filzige Bodendecke bildet, wie er sie liebt.
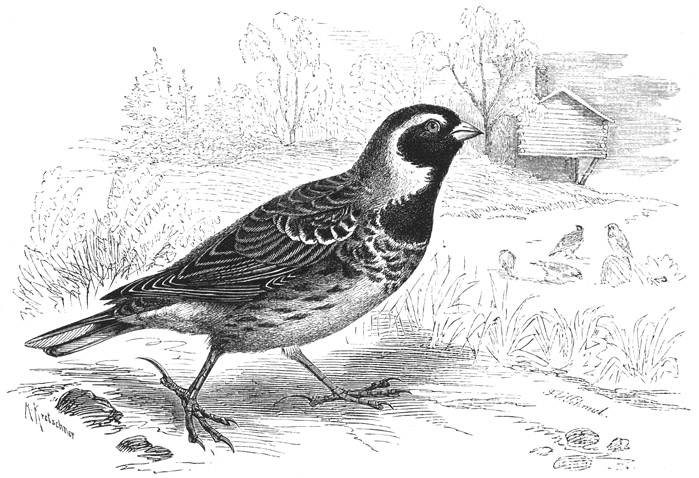
Sporenammer ( Plectrophanes lapponicus). 2/3 natürl. Größe.
Durch sein Betragen gibt er sich als Mittelglied zwischen Lerche und Ammer zu erkennen. Als Ammer zeigt er sich im Sitzen, sei es, daß er auf einem Steine oder auf schwankendem Zweige ruhe, als Lerche und Ammer zugleich im Laufen und Fliegen. Schreitend, nicht hüpfend, läuft er behend dahin, leicht und gewandt fliegt er, und nach Lerchenart schwebt er oft lange Zeit, um zu singen. Sein schwermüthiger, der öden Heimat entsprechender Lockton kann durch die Silben »Tjü, tjüeb« ungefähr wiedergegeben werden. Das Weibchen lockt ebenso wie das Männchen, aber etwas tiefer. Der Warnungsruf ist ein sperlingsartiges »Terrr errr«. Der sehr einfache, aber angenehme Gesang besteht aus einer einzigen Strophe, in welcher der Lockton oft wiederkehrt, und wird, so weit ich erfahren habe, nur im Fliegen, jedoch sehr fleißig, vorgetragen. Naumann vergleicht ihn, nicht unrichtig, mit dem Stümpern einer Feldlerche.
Nach Schraders Beobachtungen trifft der Sporenammer erst gegen die Mitte des April in Lappland ein und schreitet dann sofort zur Brut. Das Nest, welches man an feuchten Stellen zwischen den Wurzeln einer Zwergbirke, auf einem Hügelchen, gut versteckt unter dickbuschigen Pflanzen, und an ähnlichen Orten findet, besteht äußerlich aus gröberen und feineren Hälmchen und ist innerlich mit weichen Federn des Moorhuhns ausgefüllt. Gegen die Mitte des Juni findet man das vollständige Gelege, fünf bis sechs Eier von zwanzig Millimeter Längs- und funfzehn Millimeter Querdurchmesser, welche auf graulichem, gilblichem oder hellbräunlichem Grunde mehr oder weniger mit dunkleren, der Grundfarbe entsprechenden Haarstrichen und Punkten gezeichnet sind. Die Zeichnung kann übrigens auch fehlen, ohne daß jedoch das Gepräge des Eies dadurch verwischt würde. Eben ausgeflogene Junge fand ich bereits in der Mitte des Juli. Um diese Zeit lebten die von mir beobachteten Sporenammer gewöhnlich paarweise, aber doch auch schon in kleinen Gesellschaften, vielleicht solchen, welche bereits gebrütet hatten. Sie waren nirgends scheu, wurden es aber, sobald sie Verfolgung erfuhren, und selbst in der ödesten Tundra hatte man Mühe, nach einigen Schüssen anzukommen; in richtiger Würdigung der Gefährlichkeit des Jägers erhoben sie sich schon ehe man in Schußnähe kam, flogen hoch in die Luft und wichen in großen Bogen aus.
Die Nahrung besteht während der Brutzeit ausschließlich aus Kerbthieren, und zwar hauptsächlich aus Mücken, welche alle von mir erlegten in Kropf und Magen hatten. Während des Winters dagegen ernährt sich auch dieser Ammer von Gesäme. Da sich der Sporenammer im Spätherbste gern zu den Lerchen gesellt, wird er oft mit diesen und zuweilen in Menge gefangen, so namentlich in China, wo man ihn zu Zeiten massenhaft auf die Wildmärkte bringt.
Der verwandte Schneeammer, Eisammer, Schneeammerling, Schneeortolan, Winterling, Neu- und Schneevogel ( Plectrophanes nivalis, hiemalis und borealis, Emberiza nivalis, borealis, notata, mustelina, montana und glacialis, Passerina nivalis und borealis) ist im Sommer schneeweiß, auf Mantel, Schultern, Handschwingen und den mittelsten vier Schwanzfedern, bis auf schmale weiße Endsäume der Mantel- und Schulterfedern und die weiße Wurzel der Handschwingen, aber schwarz, im Winter dagegen auf Ober- und Hinterkopf sowie in der Ohrgegend rostzimmetbraun, auf Schultern und Mantel schwarz, jede Feder am Ende rostzimmetbraun gesäumt, quer über den Kropf und an den Seiten rostgelblich, auf den äußeren Schwanzfedern außen mit schwarzem Endfleck geziert. Die Weibchen sind im Winter noch stärker rostzimmetbraun gefärbt als die Männchen, die Oberflügeldecken rostbraun mit weißen Endsäumen und die schwarzen Flecke am Ende der Schwanzfedern verbreitert. Der Augenring ist tiefbraun, der Schnabel im Sommer schwarz, im Winter orangegelb, der Fuß schwarz.
Ungefähr dieselben Länder, welche den Sporenammer beherbergen, sind auch die Heimat des Schneeammers. Sein Verbreitungsgebiet ist umfassender, sein Brutgebiet dagegen beschränkter als das des genannten. Er bewohnt die Hochtundra, nach Norden hin, so weit sie, und wenn auch nur für einige Wochen, schneefrei wird, immer aber die nächste Nachbarschaft des ewigen Schnees. Auf Island ist er der gemeinste Landvogel, auf Spitzbergen, Nowaja Semlja und in Nordgrönland, soweit es bekannt geworden, noch Brutvogel. Ich habe ihn während des Sommers in Skandinavien nur auf den höchsten Bergen des Dovrefjelds und im nördlichen Lappland unmittelbar unter der Schneegrenze, hier aber sehr einzeln, in der Tieftundra der Samojedenhalbinsel gar nicht beobachtet. Seine Winterreise führt ihn bis Süddeutschland, zuweilen noch weiter südlich, in Asien bis Südsibirien und Mittelchina, in Amerika bis in die mittleren Vereinigten Staaten. Gebirgshalden und felsige Berge bilden seine Wohnsitze. Hier verlebt er sein kurzes Sommerleben, hier liebt und brütet er. Das Nest wird stets in Felsspalten oder unter großen Steinen angelegt, besteht äußerlich aus Grashalmen, Moos und Erdflechten und ist inwendig mit Federn und Dunen ausgefüttert, der Eingang, wenn thunlich, nicht größer, als daß die Eltern bequem aus- und einschlüpfen können. Das Gelege besteht aus fünf bis sechs Eiern von durchschnittlich zweiundzwanzig Millimeter Länge und sechzehn Millimeter Dicke, welche vielfach abändern, gewöhnlich aber auf bläulichweißem Grunde mit dunkel rostbraunen, gegen das dicke Ende hin kranzartig sich häufenden Flecken, Punkten und Streifen gezeichnet sind. Schon zu Ende des April läßt das Männchen, auf der Spitze eines Steines sitzend, seinen kurzen, aber hell tönenden und angenehmen Gesang hören. Bald nach der Brutzeit schlagen sich die Paare mit ihren Jungen in große Flüge, welche noch eine Zeitlang in der Heimat verweilen, dann aber ihre Winterreise antreten. An der Brutstelle ernähren sie sich fast ausschließlich von Kerbthieren, zumal Mücken; während des Winters müssen sie sich mit Gesäme begnügen.
Wenig andere Vögel reisen in so ungeheueren Gesellschaften wie die Schneeammer. Auch Deutschland besuchen sie fast allwinterlich, aber nur selten in solchen Massen wie den hohen Norden. In Rußland nennt man sie »Schneeflocken«, und dieser Ausdruck ist für sie bezeichnend; denn in der That wirbeln sie wie Schneeflocken vom Himmel hernieder und bedecken Straßen und Felder. Zuweilen erscheinen sie auch massenhaft auf Schiffen, um hier einige Augenblicke von ihrer Wanderung auszuruhen. »Am siebzehnten Mai«, sagt Malmgren, »schlug auf der Takelage unseres Fahrzeuges ein Schwarm von Schneeammern nieder, welche sehr ermüdet zu sein schienen. Sie gaben sich jedoch nicht lange Zeit zum Ausruhen, sondern begannen von neuem ihren mühevollen Zug, bei starkem Gegenwinde gerade auf Spitzbergen zu.« Aehnliche Erfahrungen haben auch andere Reisende, namentlich Holboell, gemacht. Es geht aus diesen Angaben zur Genüge hervor, daß unsere Ammer einen weiten Flug, selbst über das Meer hinweg, nicht scheuen.
Die Schneeammer ähneln in ihrem Betragen den Lerchen ebenso sehr wie den Ammern. Sie laufen ganz nach Lerchenart, fliegen leicht und geschickt, wenig flatternd und in großen Bogenlinien, auf der Reise in bedeutender Höhe, sonst gern dicht über den Boden dahin. Gesellschaften, welche Nahrung suchen, wälzen sich, wie Naumann sehr bezeichnend sagt, über die Erde dahin, indem nur ein Theil sich niederläßt und die letzteren über die ersteren dahinfliegen. Sie sind unruhige, bewegliche Vögel, welche auch während der strengsten Kälte ihre Munterkeit nicht verlieren und selbst bei entschiedenem Mangel noch vergnügt zu sein scheinen. Selten nur verweilen sie an einem und demselben Orte längere Zeit, durchstreifen vielmehr gern ein gewisses Gebiet. Bei tiefem Schneefalle suchen sie die Straßen auf und kommen selbst in die Städte herein; so lange sie jedoch auf den Feldern noch Nahrung finden können, wählen sie diese zu ihrem Winteraufenthalte und treiben sich hier während des ganzen Tages in der beschriebenen Weise umher. Ihre Lockstimme ist ein hell pfeifendes »Fit« und ein klingendes »Zirr«, der Gesang des Männchens ein Gezwitscher, welches in manchen Theilen dem Gesange der Feldlerche ähnelt, sich aber durch laute, scharf schrillende Strophen unterscheidet. Auf ihren Brutplätzen singen sie, auf dem Schnee oder noch lieber auf Steinen sitzend.
Gefangene dauern selten lange im Käfige aus, weil ihnen unser Klima zu warm ist.
Die Sippe der Ammer im engeren Sinne ( Emberiza) kennzeichnet sich durch verschieden langen und starken, durch Ungleichmäßigkeit der Kiefer und stets deutlichen Gaumenhöcker ausgezeichneten Schnabel, schwächliche Füße, deren Hinterzehe mit kurzem, stark gekrümmtem Nagel bewehrt ist, mittellange Flügel, in denen die zweite oder dritte Schwinge die Spitze bildet, und ziemlich langen, ausgeschweiften Schwanz.
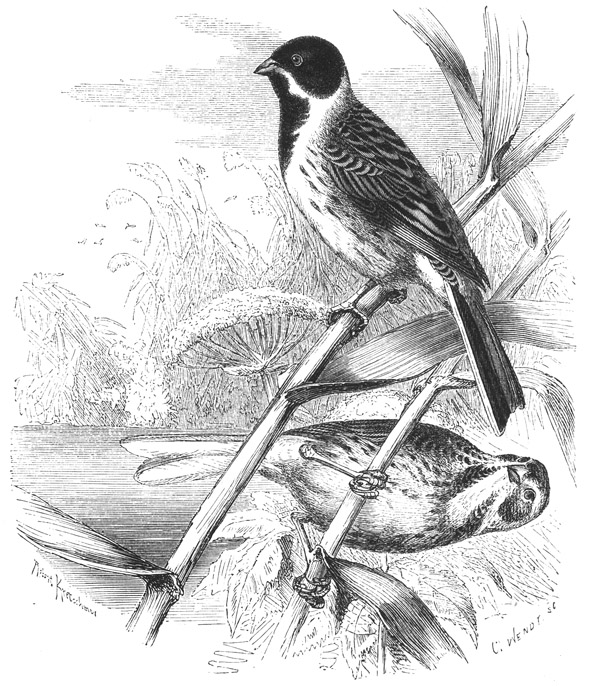
Rohrammer ( Emberiza schoeniclus). 2/3 natürl. Größe.
Bei unserem Rohrammer, Rohrspatz, Rohrleps, Rohr-, Moos-, Wasser-, Ried- und Reithsperling, Schilfvogel, Schilfschwätzer, Schiebchen, Rohrleschspatz etc. ( Emberiza schoeniclus, arundinacea und Durazzi, Cynchramus schoeniclus, stagnatilis und septentrionalis, Hortulanus arundinaceus, Schoenicula arundinacea), sind Kopf, Kinn und Kehle bis zur Kropfmitte herab schwarz, ein Bartstreifen, ein den Hals umgebendes Nackenband und die Untertheile, mit Ausnahme der grauen, dunkel längsgestrichelten Seiten, weiß, Mantel und Schultern von Grau in Schwarzbraun übergehend, durch die rostbraunen Seitensäume der Federn angenehm gezeichnet, Bürzel und Oberschwanzdecken graubraun, die Schwingen braunschwarz, außen, an den Armschwingen und oberen Deckfedern sich verbreiternd, rostbraun gesäumt, die Oberflügeldecken rostroth, die größten an der Wurzel schwarz, wodurch eine dunkle Querbinde hergestellt wird, die Steuerfedern schwarz, die beiden mittelsten rostroth gerandet, die beiden äußersten jederseits in der Endhälfte der Innenfahne, die äußersten auch an der Außenfahne weiß. Der Augenring ist tiefbraun, der Schnabel dunkelbraun, der Fuß bräunlich. Beim Weibchen ist der Kopf rothbraun, schwarz längsgestrichelt, der Augenstreifen rostbräunlich, Kinn und ein breiter Bartstreifen rothweiß, einen undeutlichen schwarzen, rostbraun gesäumten Kehlfleck einschließend, Hinterhals, Kropf und Seiten endlich rostbräunlich, dunkel längsgestrichelt. Die Länge beträgt einhundertundsechzig, die Breite zweihundertunddreißig, die Fittiglänge fünfundsiebzig, die Schwanzlänge fünfundfunfzig Millimeter.
Das Verbreitungsgebiet umfaßt ganz Europa und Westasien.
In Südeuropa vertritt oder ersetzt ihn der Gimpelammer ( Emberiza pyrrhuloides, pa1ustris, caspia und intermedia, Cynchramus und Schoenicola pyrrhuloides), welcher sich durch stärkeren, dick aufgetriebenen, auf der Firste gleichmäßig gekrümmten Schnabel unterscheidet.
Innerhalb seines ausgedehnten Verbreitungsgebietes fehlt der Rohrammer nur dem Gebirge. Doch herbergt er ausschließlich da, wo sumpfige Orte mit hohen Wasserpflanzen, Rohre, Schilfe, Riedgrase, Weidengestrüppe und ähnlichen Sumpfgewächsen bestanden sind, also mit anderen Worten an Teichen, Flüssen, Seeufern, in Morästen und auf nassen Wiesen. Hier brütet er auch.
Das Nest wird sehr versteckt auf dem Boden kleiner Inseln und anderer wasserfreien Erdstellen zwischen Wurzeln und Gras errichtet, gewöhnlich aus allerlei Halmen und Ranken, Grasstoppeln und dürren Grasblättern liederlich zusammengebaut und innerlich mit einzelnen Pferdehaaren oder mit Rohr- und Weidewolle ausgelegt. Zweimal im Sommer, im Mai oder im Anfange des Juli, findet man vier bis sechs niedliche, sehr abändernde, durchschnittlich neunzehn Millimeter lange, vierzehn Millimeter dicke, auf grauweißem, ins Bräunliche oder Röthliche spielendem Grunde mit aschgrauen bis schwarzbraunen, schärferen oder verwaschenen Flecken, Punkten und Aederchen bezeichnte Eier. Das brütende Weibchen sitzt so fest über denselben, daß man es fast mit der Hand fangen kann; das Männchen kommt, sobald man sich dem Neste nähert, ängstlich herbeigeflogen und schreit kläglich. Die Jungen werden in üblicher Weise ernährt und erzogen.
Der Rohrspatz, ein munterer, netter Vogel, ist behender und gewandter als seine Verwandten, klettert geschickt im Rohre auf und nieder und weiß sich auf den schwächsten Zweigen oder Halmen sitzend zu erhalten, hüpft rasch auf dem Boden dahin, fliegt schnell und leicht, obgleich zuckend, schwingt sich beim Aufstiegen hoch empor und stürzt sich beim Niedersetzen plötzlich herab, tummelt sich auch oft in schönen Bogen über dem Röhrichte. Sein Lockton ist ein helles, mehr als üblich gedehntes »Zie«, der Gesang, wie Naumann sehr bezeichnend sagt, stammelnd, denn »der Rohrammer würgt die einzelnen Töne hervor«. Dafür singt er sehr fleißig, und dieser Eifer befriedigt.
Während seines Sommerlebens nährt sich auch der Rohrammer fast ausschließlich von Kerbthieren, welche im Rohre, im und am Wasser leben; im Herbste und Winter bilden die Gesame von Rohr, Schilf, Binsen, Seggengras und anderen Sumpfpflanzen seine Kost. Bald nach der Brutzeit sammelt er sich zu kleinen Flügen, besucht ab und zu Felder, steigt an Hirsenstengeln oder Getreidehalmen in die Höhe und klaubt die Samen aus den Rispen. Mit Eintritt der rauhen Witterung verläßt er die nördlichen Gegenden und sucht in den Rohrwäldern oder auf den mit höheren Gräsern und Disteln bestandenen Flächen Südeuropas Winterherberge. Ich fand ihn als Wintergast häufig an den Ufern des Tajo wie früher in den Sümpfen Unteregyptens. In Griechenland und Algerien überwintert er auch; am See Albufera bei Valencia haust er jahraus, jahrein.
In Europa und ganz Nordasien lebt der Zwergammer ( Emberiza pusilla und sordida, Ocyris oinops, Euspiza pusilla, Cynchramus pusillus). Seine Länge beträgt einhundertundfunfzig, die Fittiglänge achtzig, die Schwanzlänge fünfundsechzig Millimeter. Oberkopf, Zügel und Kopfseiten sind lebhaft zimmetrothbraun, zwei breite Längsstreifen vom Nasenloche bis zum Nacken, ein breiterer, hinter den Augen beginnender Streifen, welcher sich mit einem die Ohrgegend hinterseits säumenden verbindet, schwarz, wogegen ein Querstreifen an den Halsseiten roströthliche Färbung hat; die Obertheile sind braun, die Untertheile weißlich, erstere auf Mantel und Schultern, letztere an den Seiten mit breiten braunschwarzen, rothbraun gesäumten Schaftflecken, Kropf und Brust mit dicht stehenden schwarzen Schaftstrichen gezeichnet, Flügel und Schwanzfedern dunkelbraun, außen fahlbraun, die hinteren Armschwingen und deren Deckfedern außen breiter rostbraun, die größten Flügeldecken, eine Querbinde bildend, am Ende rostbraun gesäumt, die äußersten Schwanzfedern auf der ganzen Außenfahne und am Ende der Innenfahne weiß, während die zweiten Federn jederseits nur einen weißen Innenfleck zeigen. Das Auge ist tiefbraun, der Schnabel dunkelbraun, der Fuß bräunlich. Beim Weibchen ist die Färbung minder lebhaft, der Scheitel mit einem blassen Mittel- und zwei dunklen Seitenstreifen geziert, Zügel und Augenstreifen hell rostfahl, das die Ohren umgebende Gefieder rostroth.
Dem Zwergammer nahe verwandt ist der Waldammer ( Emberiza rustica, borealis, provincialis und lesbia, Hypocenter und Cynchramus rusticus). Bei ihm sind Oberkopf und Kopfseiten schwarz, ein breiter Schläfenstrich, Kinn und Kehle weiß, die Obertheile, ein breites Querband über den Kopf und die unteren Seiten dunkel rothbraun, die übrigen Untertheile und die unteren Flügeldecken weiß, Mantel- und Schulterfedern mit breiten schwarzen Schaftflecken, die rothbraunen Seitenfedern mit weißen Rändern, die dunkelbraunen Schwingen mit fahlbraunen Außensäumen, die braunschwarzen Armschwingen- und größten Oberdeckfedern mit braunen Außen- und weißen Endsäumen, welche zwei weiße Querbinden bilden, geziert, die kleinen oberen Deckfedern rothbraun, die Schwanzfedern schwarz, die beiden mittelsten braun gerandet, die beiden äußeren innen in Gestalt eines Längsfleckes, die äußersten außen fast bis zu Ende weiß. Der Augenring ist braun, der Schnabel röthlichbraun, auf der Firste dunkler, der Fuß horngelb. Beim Weibchen sind Vorder- und Oberkopf rostbraun, dunkel geschäftet, ein Schläfenstrich rostgelb, Kinn und Kehle rostweißlich, Nacken und Kropfquerbinde rostroth, jede Feder am Ende rostgelblich gesäumt, die Seite rothbraun längsgefleckt. Die Länge beträgt einhundertundsiebzig, die Breite zweihundertundsiebzig, die Fittiglänge vierundachtzig, die Schwanzlänge achtundsechzig Millimeter.
Das Verbreitungsgebiet des Waldammers fällt mit dem des verwandten Zwergammers fast zusammen, erstreckt sich aber weiter nach Westen hin und reicht somit von Kamtschatka bis Lappland. Beide Vögel besuchen im Winter südlichere Gegenden; während ersterer aber regelmäßig bis Südchina und Mittelindien herabzieht, entfernt sich der letztere niemals so weit von seiner Heimat. Ebenso wie beide in südlicher Richtung wandern, reisen sie auch in südwestlicher, berühren bei dieser Gelegenheit unser Vaterland und durchziehen dasselbe unerkannt oder unbeachtet viel häufiger, als wir, auf unsere bisherigen Beobachtungen uns stützend, glauben.
Ueber Lebensweise und Betragen der beiden nahe verwandten Arten ist wenig zu berichten. Beide bewohnen die Waldungen ihrer nördlichen Heimat, insbesondere die Weidenbestände an den Ufern und auf den Inseln der nördlichen großen Ströme, erscheinen hier jedoch nur, um zu brüten, und wandern, sobald sie ihre Brut aufgezogen haben, ebenso langsam wieder weg, als sie kamen. Radde hebt hervor, daß der Waldammer in Ostsibirien unter allen Verwandten am frühesten den Südosten Sibiriens durchreist, bereits am sechsundzwanzigsten März am Tarainor, nach der Wanderung durch die öden Steppen aber so todtmüde antrifft, daß er mit der Hand gefangen werden kann, nunmehr weiterzieht, um zu Ende des April oder im Mai seine Heimat zu erreichen. Aehnliches dürfte für den Zwergammer Gültigkeit haben. Ueber sein Sommerleben kann ich nach eigener Anschauung einiges berichten. Entsprechend der Bodenfärbung und versteckten Lebensweise übersieht man den kleinen Vogel leicht und bekommt ihn eigentlich nur dann vor das Auge, wenn das Männchen auf eine Baumspitze fliegt, um von dieser aus seinen sehr kurzen, dürftigen Ammergesang, eigentlich nur drei oder vier Töne, vernehmen zu lassen. Sobald der Schnee in den Waldungen geschmolzen, erst um die Mitte des Juni, schreitet das Paar zur Fortpflanzung. Ein Nest, welches das Lahmheit heuchelnde Männchen mir verrieth, fand ich am elften Juli nach langem Suchen auf. Es stand auf dem Boden in altem, dürrem Grase sehr versteckt, war, der Größe des Vogels entsprechend, klein, flach, füllte eine kleine seichte Vertiefung nothdürftig aus und bestand einzig und allein aus feinen, dünnen, gut ineinander verwobenen Grashalmen, ohne irgend welche Auskleidung. Die Alten geberdeten sich ungemein ängstlich und verstellten sich in üblicher Weise; durch das warnende Männchen bewogen, verließ das Weibchen endlich das Nest, hüpfte beim Abgehen von demselben erst längere Zeit, von mir unbemerkt, im Grase fort und zeigte sich sodann in weiter Entfernung freier. Beide Eltern hielten sich, so lange ich suchte, in unmittelbarer Nähe des Nestes auf, kamen bis auf drei Schritte an mich heran und stießen dabei ihren Lockton, ein scharfes, aber schwaches »Zipp, zipp, zipp«, ununterbrochen aus. Ich ließ die Jungen selbstverständlich liegen und würde vielleicht ebenso mit den Eiern verfahren haben, hätte ich solche gefunden. Baldamus, welcher sie durch Middendorff erhielt, bemerkt, daß dieselben sehr verschieden gestaltet, siebzehn bis zwanzig Millimeter lang, vierzehn Millimeter dick und auf gelblichem Grunde, vorzugsweise um das dicke Ende, mit violettbraunen Punkten, Strichen und verwaschenen Flecken gezeichnet sind, denen des Gartenammers am meisten ähneln und durch ihre geringe Größe von ihnen wie von allen übrigen Ammereiern sich unterscheiden. Seebohm, welcher im Juni an der unteren Petschora mehrere Nester fand, beschreibt die Eier in ähnlicher Weise.
Unter den übrigen deutschen Arten der Sippe mag der schwerleibige Grauammer, Lerchen-, Gersten-, Hirsen-, Wiesen-, Winterammer, Gassenknieper, Kornquarker, Mischer, Knipper, Kerust, Braßler, Gerstling, Winterling und Strumpfwirker ( Emberiza miliaria, Miliaria septentrionalis, germanica und peregrina, Cynchramus und Spinus miliarius, Cryptophaga miliaria), zunächst genannt sein. Seine Länge beträgt neunzehn, seine Breite neunundzwanzig, seine Fittiglänge neun, seine Schwanzlänge sieben Centimeter. Die Obertheile, mit Ausnahme der einfarbigen Bürzel- und Schwanzdeckfedern, sind auf erdbräunlichem Grunde mit dunklen Schaftstrichen gezeichnet, welche vom Unterschnabel herab undeutliche Bartstreifen bilden und auf der Kropfmitte zu einem größeren dunklen Fleck zusammenfließen, auf dem Bauche dagegen fehlen, Zügel und undeutlicher Schläfenstrich fahlweiß, Backen- und Ohrgegend auf bräunlichem Grunde dunkel längsgestrichelt, unterseits durch einen fahlweißen, ebenfalls dunkel gestrichelten Streifen begrenzt, Schwingen und Schwanzfedern dunkelbraun, außen, die Armschwingen- und größten Oberflügeldeckfedern, zwei helle Querstreifen bildend, auch am Ende fahlweißlich gesäumt. Das Auge ist dunkelbraun, der Schnabel horngelb, der Fuß blaßgelb.
Vom südlichen Norwegen an begegnet man in ganz Europa und ebenso im westlichen Asien dem Grauammer an geeigneten Orten überall, entweder als Stand- oder wenigstens als Strichvogel. Auf dem Zuge geht er einzeln oder in Scharen bis nach Nordafrika hinüber, ist dann in Egypten nicht selten und auf den Kanarischen Inseln gemein. Seine Sommerwohnsitze sind weite, fruchtbare, mit Getreide bebaute Ebenen, seine beliebtesten Aufenthaltsorte Gegenden, in denen Feld und Wiese miteinander abwechseln und einzeln stehende Bäume und Sträucher vorhanden sind. In größeren Waldungen sieht man ihn ebensowenig als auf Gebirgen. In Norddeutschland ist er nirgends selten; in Mitteldeutschland verbreitet er sich, allmählich einwandernd, mehr und mehr; in den reichen Getreideebenen Oesterreichs-Ungarns ist er, wenn nicht der häufigste aller Vögel, so doch der häufigste aller Ammer.
Der gedrungene, kräftige Leib, die kurzen Flügel und die schwachen Beine lassen vermuthen, daß der Grauammer ein schwerfälliger Gesell ist. Er hüpft am Boden in gebückter Stellung langsam umher, zuckt dazu mit dem Schwanze und fliegt mit Anstrengung unter schnurrender Flügelbewegung in Bogenlinien, jedoch immer noch schnell genug, weiß auch mancherlei geschickte Wendungen, welche man ihm nicht zutrauen möchte, auszuführen. Seine Lockstimme, welche beim Aufstiegen oft wiederholt und auch im Fluge häufig ausgestoßen wird, ist ein scharfes »Zick«, der Warnungsruf ein gedehntes »Sieh«, der Ton der Zärtlichkeit ein sanfteres »Tick«, der Gesang weder angenehm noch laut, dem Geräusche, welches ein in Bewegung gesetzter Strumpfwirkerstuhl hervorbringt, in der That ähnelnd, da auf ein wiederholtes »Tick, tick« ein unnachahmliches Klirren folgt und das sonderbare Tonstück beendet. Während des Sommers nimmt der Grauammer verschiedene Stellungen an und bemüht sich nach Möglichkeit, mit seinen Geberden dem mangelhaften Gesänge nachzuhelfen. Liebenswürdige Eigenschaften zeigt er nicht, ist im Gegentheile ein langweiliger Vogel, welcher außerdem friedfertigeren Verwandten durch Zanksucht beschwerlich fällt.
Das Nest wird im April in eine kleine Vertiefung in das Gras oder zwischen andere deckende Pflanzen, immer nahe über dem Boden, gebaut. Alte Strohhalme, trockene Grasblätter, Hälmchen bilden die Wandungen; die innere Höhlung ist mit Haaren oder sehr feinen Hälmchen ausgelegt. Die vier bis sechs, vierundzwanzig Millimeter langen, achtzehn Millimeter dicken Eier haben eine feine, glanzlose Schale und sind auf mattgraulichem oder schmutzig gilblichem Grunde mit rothbläulichgrauen Punkten, Fleckchen und Strichelchen gezeichnet und geädert, am stumpfen Ende am dichtesten. Die Jungen werden mit Kerbthieren groß gefüttert und sind zu Ende des Mai flugbar.
Sobald sie selbständig geworden, schreiten die Alten zur zweiten Brut; wenn auch diese glücklich vollendet ist, scharen sie sich in Flüge und beginnen nun ihre Wanderung.
Man stellt dem Grauammer des leckeren Bratens halber mit dem Gewehre oder mit dem Strichnetze, auch wohl auf eigenen Herden nach. Für das Gebauer fängt man ihn nicht.
Häufiger, jedoch kaum mehr verbreitet, ist der Goldammer ( Emberiza citrinella, sylvestris und septentrionalis). Die Länge beträgt einhundertundsiebzig, die Breite zweihundertundsiebzig, die Fittiglänge fünfundachtzig, die Schwanzlänge siebzig Millimeter. Kopf, Hals und Untertheile sind schön hochgelb, die Stirne, ein von ihr aus über den Augen bis zum Nacken, ein zweiter vom hinteren Augenrande bis auf die Schläfe verlaufender Längsstreifen und der Hinterhals olivengraugrün, spärlich dunkel längsgestrichelt, Kopf und Kopfseiten zimmetrothbraun, Bürzel und Oberschwanzdecken etwas dunkler, Mantel und Schultern fahlrostbraun, die unteren Körperseiten mit dunkelbraunen, zimmetbraun gesäumten, die oberen mit breiten schwarzen Schaftstrichen gezeichnet, die Schwingen schwarzbraun, die der Hand mit schmalen blaßgelben, die Armschwingen und deren Decken mit breiten sahlrostbraunen Außen-, die größten Oberflügeldecken auch mit rostbraunen Endsäumen, eine Querbinde bildend, geziert, die Schwanzfedern schwarzbraun, außen schmal heller gesäumt, die beiden äußersten innen mit breiten weißen Endflecken ausgestattet. Der Augenring ist dunkelbraun, der Schnabel dunkelblau, an den Schneiden heller, der Fuß röthlichgelb. Bei dem Weibchen sind alle Farben matter, Scheitelfleck, Augenbrauen, Kinn und Kehle deutlich gelb, Kropf und Brust matt rostbräunlich gefärbt.
Nord- und Mitteleuropa, ebenso ein großer Theil Asiens, namentlich Sibirien, sind die Heimat des Goldammers. In Deutschland fehlt er keinem Gaue, steigt auch im Gebirge bis gegen die Waldgrenze auf, und darf da, wo zwischen Feldern, Wiesen und Obstpflanzungen niedrige Gebüsche stehen, mit Sicherheit erwartet werden.
Im Süden gesellt sich ihm, hier und da vertritt ihn der über ganz Südeuropa lückenhaft verbreitete, und ebenso in der Schweiz, in Frankreich, Belgien, England und Südwestdeutschland stellenweise vorkommende, ihm in Sein und Wesen, Stimme und Gesang höchst ähnliche Zaunammer, Hecken-, Zirb-, Pfeif- und Frühlingsammer, Zaun- und Waldemmerling, Moosbürz, Zizi etc. ( Emberiza cirlus und eleathorax). Seine Länge beträgt einhundertachtundfunfzig, die Breite zweihundertundvierzig, die Fittiglänge fünfundsiebzig, die Schwanzlänge siebzig Millimeter. Der auf dem Scheitel schwarz gestrichelte Kopf, der Hinterhals, die Halsseiten und ein breites Querband über den Kropf sind graugrün, Augenbrauen und ein Streif unter dem Auge, welche durch ein schwarzes Zügelband getrennt werden, sowie ein breites, halbmondförmiges Schild zwischen Kehle und Kropf gelb, Kinn, Oberkehle und ein von letzterer ausgehender, bis hinter die Ohrgegend reichender Streifen schwarz, die Untertheile hellgelb, seitlich zimmetroth, Bauch und Schenkelseiten mit dunklen Schaftstrichen geziert, Mantel und Schultern zimmetroth, die Federn am Ende grau gesäumt und dunkel geschäftet, Bürzel und Oberschwanzdecken grünbräunlich, die Schwingen dunkelbraun, außen schmal fahl, Armschwingendecken und hintere Armschwingen außen breit zimmetbraun gesäumt, die Oberflügeldecken grünbraun, die größten am Ende rostfahl gerandet, wodurch eine Querbinde entsteht, die Schwanzfedern dunkelbraun, außen fahl gesäumt, die äußersten beiden mit breiten weißen Längsflecken geziert, welche auf der äußersten Feder fast die ganze Außenfahne mit bedeckt. Das Auge dunkelbraun, der Schnabel oberseits schwarz, unterseits lichtbräunlich, der Fuß lichtröthlich. Dem Weibchen fehlen das Schwarz der Kehle und die beiden gelben Streifen am Kopfe; die Federn der Untertheile sind gelblich, dunkel geschäftet; der zimmetrothe Fleck an der Brustseite ist blasser.
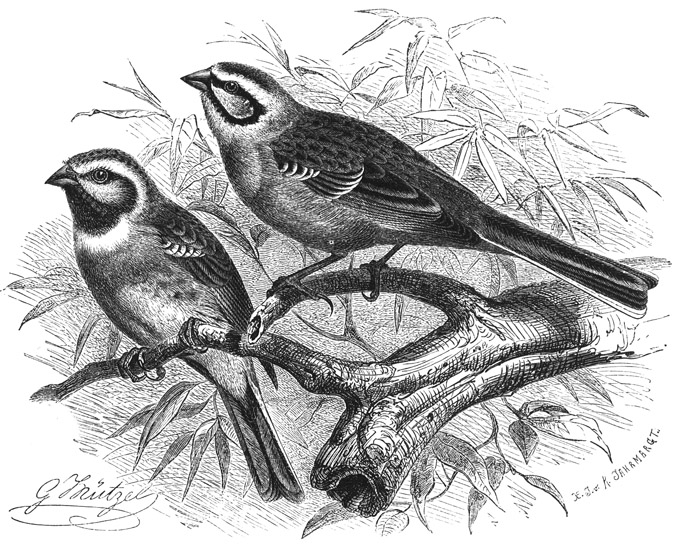
Zaun- und Zippammer ( Emberiza cirlus und cia). 5/8 natürl. Größe.
Während des ganzen Sommers trifft man unseren allbekannten Goldammer paarweise oder seine Jungen in kleinen Gesellschaften an. Die Alten gehen mit Eintritt des Frühlings an ihr Brutgeschäft. Oft findet man schon im März das Nest, welches aus groben, halb verrotteten Pflanzenstengeln, Grashalmen und dürrem Laube erbaut, innen aber mit Grashalmen und Pferdehaaren ausgelegt ist, in niederem Gesträuche, meist nahe auf dem Boden, zwischen Stämmen oder im dichten Gezweige steht und spätestens zu Anfang des April das erste Gelege enthält. Letzteres besteht aus vier bis fünf Eiern, welche einundzwanzig Millimeter lang, fünfzehn Millimeter dick, feinschalig, auf trübweißem oder röthlichem Grunde mit dunkleren bunten Flecken und Aederchen gezeichnet und bekritzelt sind und von beiden Eltern wechselseitig bebrütet werden, wie beide auch der Sorge um die Brut gemeinschaftlich sich widmen. In günstigen Jahren brütet er zwei-, nicht selten dreimal. So lange die Brutzeit währt, ist das Männchen sehr munter, singt vom frühesten Morgen bis zum späten Abend sein einfaches, aus fünf bis sechs fast gleichen Tönen und dem um eine Oktave höheren, etwas gezogenen Schlußlaute bestehendes Liedchen, welches das Volk sich in die Worte übersetzt hat: »S'is, s'is noch viel zu früh« oder »Wenn ich 'ne Sichel hätt', wollt' ich mit schnitt«, oder endlich, um mit Mosen zu sprechen, »Wie, wie hab ich dich lieb«. Der Sänger sitzt beim Singen auf einer freien Astspitze und läßt den Menschen sehr nahe an sich herankommen, sich und sein Treiben daher leicht beobachten.
Nach der Brutzeit sammelt sich alt und jung zu Scharen, welche bald sehr zahlreich werden, und schweift nun zunächst in einem ziemlich kleinem Gebiete Landes umher, vereinigt sich wohl auch mit Lerchen und Finken, selbst mit Wacholderdrosseln. In strengen Wintern wird unser Vogel gezwungen, seine Nahrung von den Menschen sich zu erbetteln und kommt massenhaft, oft als gern gesehener oder wenigstens geduldeter Gast, in das Gehöft des Landmannes herein, kehrt aber im nächsten Frühjahre auf seinen Standort zurück. Hier und da wird er auf besonderen Herden gefangen; doch hat er in dem Raubzeuge ungleich gefährlichere Feinde als in dem Menschen.

Garten- und Kappenammer ( Emberiza hortulana und melanocephala). 5/8 natürl. Größe.
Berühmter als der Goldammer ist der Gartenammer oder Ortolan, Urtlan, Utlan, Fett-, Feld- und Sommerammer, Gärtner, Jutvogel, Windsche, Grünzling, Heckengrünling ( Emberiza hortulana, chlorocephala, badensis, antiquorum, pinguescens, delicata, malbeyensis, Buchanani und Tunstalli, Euspiza und Glycispina hortulana). Seine Länge beträgt sechzehn, die Breite sechsundzwanzig, die Fittiglänge acht, die Schwanzlänge sieben Centimeter. Kopf, Hals und Kropf sind matt graugrünlich, ein schmaler Augenkreis, Kinn und Kehle sowie ein Streifen vom Unterschnabel herab, welcher unterseits durch einen schmalen dunklen Bartstreifen begrenzt wird, gelblich, die übrigen Untertheile zimmetrostroth, auf den Unterschwanzdecken lichter, die Obertheile matt rostbraun, Mantel und Schultern durch breite dunkle Schaftstriche gezeichnet, die Schwingen dunkelbraun und, die erste weiß gesäumte ausgenommen, mit schmalen fahlbraunen, die hintersten Armschwingen und deren Deckfedern mit breiten rostbraunen Außensäumen, die oberen Flügeldecken auch mit rostbraunen, eine Querbinde bildenden Endsäumen geziert, die Schwanzfedern dunkelbraun, außen fahl gesäumt, die äußersten beiden Federn innen in der Endhälfte, die äußersten auch in der Mitte der Augenfahne weiß. Das Auge ist dunkelbraun, der Schnabel wie der Fuß röthlich hornfarben. Beim Weibchen sind Kopf und Hinterhals bräunlichgrau, Kehle und Kropf roströthlich, alle diese Theile mit feinen schwarzen Schaftstrichen gezeichnet, Kinn, Kehle und ein Streif unter den braunen Backen, welcher unterseits durch einen schmalen Bartstreifen begrenzt wird, roströthlichgelb.
Auch der Gartenammer verbreitet sich über einen großen Theil Europas, kommt aber immer nur hier und da, in vielen Gegenden nicht oder äußerst selten vor. In Deutschland bewohnt er ständig die unteren Elbgegenden, die Mark und Lausitz, Schlesien, Westfalen und die Rheinlande. Häufig ist er in Südnorwegen und Schweden und gemein in Südeuropa, außerdem Brutvogel in Holland, England, Frankreich, Rußland, im mittleren Asien bis zum Alatau, in den Gebirgen Kleinasiens und Palästinas. Im Winter wandert er bis West- und Ostafrika, bezieht mit Vorliebe Gebirge und steigt in ihnen bis zu einem Höhengürtel von dreitausend Meter über dem Meere empor.
Im südöstlichen Europa, zumal in Griechenland, ebenso in Kleinasien, Palästina, Westasien und Nordafrika gesellt sich ihm der, auch in Süddeutschland und auf Helgoland erlegte, Rostammer ( Emberiza caesia, rubibarba und rufigularis, Fringilla und Glycispina caesia), welcher sich von ihm, seinem nächsten Verwandten, durch grauen Kopf und graue Kropfquerbinde, blaß zimmetrothe Kehle, dunkel zimmetrothe Unterseite, kleinere weiße Endflecke der äußeren Schwanzfedern und korallrothen Schnabel unterscheidet.
Leben und Betragen unterscheiden den Gartenammer wenig von anderen Arten seiner Familie. Er bewohnt ungefähr dieselben Oertlichkeiten wie der Goldammer, beträgt sich ihm sehr ähnlich, singt aber etwas besser, obschon in ganz ähnlicher Weise. Der Lockton lautet wie »Gif gerr«, der Ausdruck der Zärtlichkeit ist ein sanftes »Gi« oder ein kaum hörbares »Pick«, das Zeichen unangenehmer Erregung ein lautes »Gerk«. Nest und Eier gleichen den bereits beschriebenen. Ersteres steht ebenfalls nahe an der Erde, gewöhnlich im dichtesten Gezweige niederer Bäume; letztere, vier bis sechs an der Zahl, sind neunzehn Millimeter lang, fünfzehn Millimeter dick und auf hell- oder weißröthlichem und röthlichgrauem Grunde schwarzbläulich gefleckt und geschnörkelt.
Bereits die Römer wußten das schmackhafte, zarte Fleisch des Fettammers zu würdigen und mästeten ihn in besonders dazu hergerichteten Käfigen, welche nachts durch Lampenschein erhellt wurden. Dasselbe Verfahren soll jetzt noch in Italien, dem südlichen Frankreich und namentlich auf den griechischen Inseln angewendet werden. Dort fängt man die Fettammern massenhaft ein, würgt sie ab, nachdem sie den nöthigen Grad von Feistigkeit erhalten haben, siedet sie in heißem Wasser und verpackt sie zu zwei- und vierhundert Stück mit Essig und Gewürz in kleine Fäßchen, welche dann versendet werden. Gutschmecker zahlen für so zubereitete Ortolane gern hohe Preise.
Einer der schönsten seiner Unterfamilie ist der Zippammer, Bart- und Rothammer, Steinemmerling ( Emberiza cia, lotharingica, canigularis, barbata, meridionalis, pratensis und Hordei, Citrinella cia und meridonalis, Euspiza, Buscarla und Hylaespezia cia, Bild S. 285). Die Länge beträgt einhundertundachtzig, die Breite zweihundertundvierzig, die Fittiglänge fünfundsiebzig, die Schwanzlänge sechsundsiebzig Millimeter. Kopf und Hinterhals sind aschgrau, Kopfseiten, Kehle und Kropf etwas heller, ein breiter Augenstreifen, Backen und Kinn weißlichgrau, zwei Streifen, welche den Brauenstreifen oberhalb und unterhalb einfassen, und von denen der eine vom Nasenloche bis zum Nacken, der andere über die Zügel bis aus die Schläfe reicht, sowie ein dritter, welcher sich vom Mundwinkel herabzieht und mit den beiden ersten am Ende durch einen schmalen Ouerstreifen sich verbindet, schwarz, Mantel und Schultern rostrothbraun, alle Federn dunkel geschäftet, Bürzel, obere Schwanzdecken und die Untertheile zimmetrostroth, aus der Bauchmitte heller, die Schwingen schwarzbraun, außen schmal, die hinteren Armschwingen und deren Deckfedern hier und am Ende breiter, rostbraun gesäumt, die Oberflügeldecken dunkelgrau, ihre größte Reihe schwarz, am Ende rostfahl, wodurch eine Querbinde entsteht, die Schwanzfedern, mit Ausnahme der beiden mittelsten, dunkel braunschwarz, die beiden äußersten in der Endhälfte innen weiß, die Außenfahne der äußersten ebenso. Der Augenring ist dunkelbraun, der Oberschnabel schwarz-, der untere lichtbraun, der Fuß licht hornfarben. Bei dem im allgemeinen matter gefärbten Weibchen sind die schwarzen Längsstreifen des Kopfes minder deutlich, der Oberkopf braun, dunkel längsgestrichelt, der mittlere Streifen grau, der Augenstreifen fahlweiß und das Grau der Kehle und des Kopfes mit verwaschenen dunklen Tüpfelchen gezeichnet.
In Deutschland bewohnt der Zippammer gegenwärtig nur die Rheinlande, namentlich den Mittelrhein zwischen Irlich und Linz, und ebenso Südostbaden, hier auf die höheren Bergthäler, dort auf die Weinberge des rechten Rheinufers sich beschränkend; nicht minder selten kommt er in Oesterreich vor. Häufig dagegen ist er in Südeuropa, namentlich in Spanien, Italien und Griechenland, außerdem in Westasien. Von hier aus durchreist er den größten Theil Asiens, bis zum Himalaya, in dessen westlichem Theile er regelmäßig auftritt. Er ist ein Gebirgsvogel, welcher, nach meinen in Spanien angestellten Beobachtungen, die Ebenen meidet. Halden mit möglichst zerrissenem Gesteine bilden seine Lieblingsplätze. Hier treibt er sich zwischen und auf den Steinen und Blöcken nach Art anderer Ammer umher. Auf Bäume oder Sträuche setzt er sich selten. Im übrigen ist er ein echter Ammer in seinem Betragen und in seinen Bewegungen, im Fluge und in der Stimme. Letztere, ein oft wiederholtes »Zippzippzipp« und »Zei«, entspricht seinem Namen. Der Gesang ähnelt dem des Goldammers, ist aber kürzer und reiner; Bechstein hat ihn sehr gut mit »Zizizizirr« wiedergegeben.
Das Nest hat man am Rheine, wo er an einzelnen Orten nicht selten nistet, in den Ritzen und Höhlungen der Weinbergsmauern gefunden. Die drei bis vier Eier sind einundzwanzig Millimeter lang, sechzehn Millimeter dick, auf grauweißlichem Grunde mit grauschwarzen und zwischendurch mit einigen grauen Fäden, oft gürtelartig in der Mitte des Eies, umsponnen, diese Fäden aber nicht kurz abgebrochen, die Eier also dadurch leicht von den oft ähnlich gezeichneten des Goldammers zu unterscheiden. Auch der Zippammer brütet wahrscheinlich zweimal im Jahre: in Spanien bemerkten wir seine Jungen jedoch nicht vor dem Juli. Um die Mitte des August begann bereits die Mauser. Am Rhein erscheint der Vogel zu Anfang des April und verweilt dort bis zum November. In Spanien fanden wir ihn im Winter, zu sehr großen Flügen vereinigt, außerordentlich häufig an allen sonnigen Abhängen der Sierra Nevada.
Ein nicht minder schöner Vogel, der Weidenammer ( Emberiza aureola, sibirica, dolichonia, pinetorum und Selysii, Euspiza, Hypocenter, und Passerina aureola), gehört Nordasien an, bewohnt jedoch auch den Nordosten Europas in zahlreicher Menge und verfliegt sich von hier aus nicht allzu selten nach Westeuropa, während die Hauptmenge ihre Winterreise nach Südchina, Cochinchina, Assam, Burma und die übrigen Länder des westlichen Himalaya richtet. Die Länge beträgt einhundertundachtzig, die Breite zweihundertundachtzig, die Fittiglänge achtundachtzig, die Schwanzlänge fünfundvierzig Millimeter. Die Obertheile, ein Querband unter der gelben Kehle und die Kropfseiten sind tiefrostbraun, Mantel- und Schulterfedern mit undeutlichen Schaftflecken und schmalen weißlichen Außensäumen, Zügel, Kopfseiten und Kinn schwarz, die Untertheile gelb, seitlich durch rothbraune Schaftstriche geziert, die Unterschwanzdecken weiß, die Schwingen dunkelbraun mit fahlbraunen, die hinteren Armschwingen mit breiten rostbraunen Außensäumen, die rothbraunen Handschwingendecken mit breiten fahlweißen, eine Querbinde bildenden Endrändern gesäumt; ein großes Feld auf den oberen und die unteren Flügeldecken sind weiß, die äußerste Schwanzfeder weiß, innen an der Wurzel und am Ende dunkel, die zweite innen durch einen weißen Längsstreifen geschmückt, die übrigen haben die Färbung der Handschwingen. Das Auge ist röthlichbraun, der Schnabel gelblich, der Unterschnabel röthlich, der Fuß bräunlich hornfarben. Beim Weibchen sind die Obertheile rostbräunlich, dunkel geschäftet, die Bürzelfedern rothbraun, ein über die Kopfmitte verlaufender, ein Augenbrauen- und ein über die Unterbacken ziehender Streifen sowie die Untertheile gilblich, an den Seiten etwas dunkler und hier ebenfalls durch Schaftstriche gezeichnet.
Im ganzen mittleren Sibirien, und zwar in Niederungen wie im Gebirge, bis zu zweitausend Meter unbedingter Höhe, zählt der Weidenammer zu den häufigsten Arten seiner Unterfamilie. Nicht minder zahlreich tritt er auch in Osteuropa, namentlich im mittleren und südlichen Ural, auf, von hier aus bis zur Dwina und dem Südwesten des Onegasees sich verbreitend. Auf unserer Reise haben wir ihn auffallenderweise nur an wenigen Stellen, und zwar im Krongute Altai, gefunden. Wasserreiche Gegenden, welche mit buschigen Weiden gut bestanden sind, bilden seine bevorzugten Aufenthaltsorte. Nächstdem herbergt er in sonnigen Birkenhainen, nie aber in Nadelwaldungen. Auch er trifft, von seiner Winterreise kommend, erst spät im Frühjahre, selten vor den ersten Tagen des Mai, am Brutgebiete ein, treibt sich hier ganz nach Art des Goldammers umher, läßt wie dieser den so vielen Arten gemeinsamen Lockton, ein scharfes »Zip, zip«, vernehmen, singt aber, auf hohen Zweigspitzen sitzend, besser als die meisten Ammer, da der einfache Gesang sich durch drei kurze, von einander Wohl unterschiedene, flötende Strophen auszeichnet. Die Nester, welche Henke auf den Dwinainseln nördlich von Archangel am sechzehnten Juni fand, standen niedrig am Boden oder nicht hoch über demselben im Grase, Gestrüppe und Gesträuche versteckt, waren auf einer Unterlage aus trockenen Halmen, Blättern und Gewürzel erbaut und mit feinen Würzelchen, Bastfasern, zarten Grasblättern, zuweilen auch mit einzelnen Haaren und Federn ausgelegt. Die fünf bis sechs Eier, deren Längsdurchmesser dreiundzwanzig und deren Querdurchmesser siebzehn Millimeter beträgt, sind auf grünlichem oder bräunlich grauweißem Grunde mit kleinen und großen, theilweise ineinander geflossenen verwaschenen Schalenflecken von grünlicher oder bräunlichgrauer Färbung und mit brandfleckiger Zeichnung, Punkten, unregelmäßigen Flecken, Haarzügen und Schnörkeln von brauner und schwarzer Farbe geziert. Nach der Brutzeit schart sich alt und jung in zahlreiche Flüge und begibt sich allmählich auf die Wanderung. Bei dieser Gelegenheit werden in der Umgegend von Moskau oft sehr viele berückt, und sie sind es, welche dann auch lebend bis in unsere Käfige gelangen.
Südosteuropa von Istrien an, namentlich Dalmatien und Griechenland, viele Inseln des Adriatischen Meeres, die Levante und einen großen Theil Südwestasiens bis in die Nord- und Westprovinzen Indiens, insbesondere aber Persien, bewohnt der Kappenammer, Königsammer, Ortolankönig ( Euspiza melanocephala, Emberiza melanocephala, granativora und simillima, Fringilla crocea, Xanthornus caucasicus, Passerina und Granativora melanocephala; Bild S. 286), durch den kräftigen, spitzkegelförmigen, fast gleichkieferigen Schnabel mit kleinem, länglichem Höcker vor dem Gaumen, die stämmigen Füße, langen Fittige, unter deren Schwingen die erste die längste ist, und den mäßig langen, am Ende geraden Schwanz von anderen Ammern unterschieden und deshalb Vertreter einer besonderen Sippe ( Euspiza), welche wir Pfeifammer nennen wollen. Seine Länge beträgt einhundertfünfundachtzig, die Breite zweihundertundneunzig, die Fittiglänge achtundneunzig, die Schwanzlänge achtzig Millimeter. Der Kopf ist schwarz, die Oberseite lebhaft zimmetrothbraun, durch schmale und verwaschene grauliche Endsäume geziert, die ganze Unterseite hochgelb; die dunkelbraunen Schwingen und Steuerfedern zeigen fahlbraune, an den hinteren Armschwingen und Deckfedern sich verbreiternde Außen-, die kleinen zimmetbraunen Deckfedern gelbgraue, die bräunlichen größten Flügeldeckfedern weiße Endsäume, welche eine Querbinde herstellen. Das Auge ist dunkelbraun, der Schnabel hornblau, der Fuß bräunlichgelb. Dem Weibchen fehlt die schwarze Kappe; die Oberseite ist graulich rostroth, die Kehle weiß, die übrige Unterseite weißlich rostfarben.
Zu Ende des April trifft der Kappenammer, aus seiner Winterherberge kommend, in Griechenland, kaum später auch in Istrien ein. An einem schönen Frühlingsmorgen sind in Griechenland oft alle Hecken am Meeresufer, welche man Tages vorher vergeblich nach ihm absuchte, förmlich bedeckt mit dem in voriger Nacht angekommenen Könige der Ortolane. Dieser begibt sich nunmehr sofort nach seinen Brutstätten, Weinbergen der Ebene oder noch unbebaueten, mit Salbei und Christusdorn bestandenen Hügeln, baut sein Nest, brütet, erzieht die Jungen und verläßt die Heimat zu Ende des Juli oder im August wieder, um seiner Winterherberge zuzuwandern. Sein Zug richtet sich jedoch nicht nach Südwesten, sondern nach Südosten. Von Persien, dem Brennpunkte seines Verbreitungsgebietes, mag er ausgegangen sein und Kleinasien und die Balkanhalbinsel erst später aufgefunden haben; durch Persien, woselbst er noch immer und bis zu fast dreitausend Meter unbedingter Höhe allüberall häufig ist, wandert er der Herberge zu. Wenige Wochen nach seinem Abgange aus Europa erscheint er in Dekhan und in den oberen Provinzen von Hindostan, schlägt sich in ungeheuere Flüge zusammen, richtet arge Verwüstungen in den Getreidefeldern an und verläßt das Land im März erst wieder.
Hinsichtlich seines Betragens unterscheidet er sich von anderen Ammern unwesentlich; doch behauptet Graf von der Mühle, daß er sehr dumm und wenig scheu sei, und man oft in Versuchung käme, das singende Männchen mit dem Stocke zu erschlagen. Um die Fortpflanzungszeit setzt sich das Männchen frei auf die Spitze eines Strauches oder Baumes und läßt beständig seinen einfachen flötenden Gesang vernehmen, wogegen das Weibchen soviel wie möglich sich verbirgt. Das Nest steht am Boden in oder an stacheligem Gestrüppe, gewöhnlich sehr versteckt, ist nachlässig gebaut, aus dürren Pflanzenstengeln und Blättern sperrig zusammengefügt, im Inneren mit feinen Würzelchen, Hälmchen, Blattfasern und Pferdehaaren ausgelegt und enthält in der ersten Hälfte des Mai fünf bis sieben Eier, welche vierundzwanzig Millimeter lang, achtzehn Millimeter dick, auf bleich bläulichgrünem Grunde mit deutlicheren oder verwaschenen aschgrauen, grünlichen oder röthlichgrauen Flecken gezeichnet sind. In Persien sammeln sich nach der Brutzeit tausende und andere tausende von Kappenammern, streichen, gefürchtet ärger noch als die Heuschrecken, von Ort zu Ort und beginnen, lange vor ihrem Wegzuge schon, die Felder zu plündern.
Außer den vorstehend geschilderten Ammern haben noch mehrere Arten der Unterfamilie Deutschland oder wenigstens Europa besucht. Es sind die folgenden: Der in Ostsibirien heimische Fichtenammer ( Emberiza leucocephala, pythiornis, albida und Banaparti), welcher, größer als der Goldammer, am Kopfe, mit Ausnahme einerwWeißen Platte, grauschwarz, übrigens, bis auf einen weißen Zügelstreifen, tief zimmetrothbraun, am Halse hinten grau, vorn weiß, auf dem Oberkörper und am Kropfe zimmetrostroth, auf den Untertheilen weiß gefärbt und oberseits durch dunkle Schaftstriche und fahle Säume der Federn gezeichnet ist, der ebenfalls Ostsibirien entstammende Goldbrauenammer ( emberiza chrysophrys und chlorophrys, Citrinell chrxsophrys), welcher, kleiner als der Goldammer, auf dem schwarzen Kopfe durch einen weißlichen Mittel- und je einen goldgelben Brauenstreifen, auf der rostbraunen Oberseite durch breite, an der weißen Kehle durch schmälere schwarze Schaftflecke, auf den weißen, seitlich bräunlichen Untertheilen durch braune Schaftstriche geschmückt ist, und der in der Wüste lebende Streifenammer ( Emberiza striolata, Fringrilla, Fringillaria und Polymitra striolata), dessen vorwaltend zimmetrothbraunes Gefieder auf dem Kopfe in Aschgrau übergeht und hier oberseits sechs, aus dunklen Schaftstrichen gebildete, gleichlaufende Längsstreisen zeigt.
Amerika ist die Heimat von ungefähr einhundertundzwanzig bunten, ammerartig gezeichneten Finken mit schlankem, kegelförmigem, geradspitzigem, auf der Firste wenig gebogenem, zierlichem Schnabel, hochläufigen und langzehigen, mit großen Nägeln, zumal spornartig gestreckter Hinterklaue bewehrten Füßen, mittellangen Flügeln, welche sich durch die sehr langen Armschwingen anszeichnen, und verschieden langem Schwänze: der Ammerfinken ( Passerellinae).
Sie leben viel auf dem Boden und bewegen sich hier ganz nach Art der Ammern. Einige Arten sind Waldvögel, welche die offenen Triften meiden, andere hausen in wasserreichen Gegenden, an Flußufern, andere auf Feldern und Wiesen, einige sogar am Meere, und einzelne endlich vertreten in der Neuen Welt die Stelle unserer Sperlinge.

Bäffchenammerfink ( Zonotrichia albicollis). 2/3 natürl. Größe.
Den Norden Amerikas belebt der Bäffchenammerfink oder Weißhalssperling ( Zonotrichia albicollis und pennsylvanica, Fringilla albicollis und pennsylvanica, Passer pennsylvanicus), Vertreter der Bindenammerfinken ( Zocotrichia), deren Merkmale in dem schlank kegelförmigen, spitzigen, im Mundwinkel herabgezogenen Schnabel, dem kräftigen hochläufigen, langzehigen und mit großen, wenig gebogenen Krallen bewehrten Fuße, dem kurzen Fittige, in welchem die zweite und dritte Schwinge die Spitze bilden, und dem ziemlich langen, mäßig gerundeten oder sanft ausgekerbten Schwanze zu suchen sind. Seine Länge beträgt hundertundsiebzig, die Breite zweihundertunddreißig, die Fittiglänge fünfundsiebzig, die Schwanzlänge achtundsiebzig Millimeter. Von dem schwarzen Ober- und Hinterkopfe heben sich eine schmale, weißliche Mittellinie und ein breiter, über den Zügeln gelber, hinter dem Auge unterseits schwarz begrenzter Brauenstreifen ab; Backen und Ohrgegend sind aschgrau, Kinn und Kehle weiß, unterseits von einer undeutlichen, schmalen, dunkeln Linie begrenzt, die Untertheile, mit Ausnahme des bräunlichgrauen Kropfes und der rostbräunlichen Seiten, weiß, letztere dunkel längsgestrichelt, die Obertheile und Flügeldeckfedern rostbraun, Mantel und Schulterfedern mit schwarzen Schaftflecken und gelblichen Außensäumen, die Bürzelfedern fahl rostbraun, die Schwingen und Steuerfedern olivenbraun mit schmalen rostfählen, die hinteren Armschwingen und deren Deckfedern mit breiten rostbraunen Außensäumen geziert. Der Augenring ist nußbraun, der Oberschnabel hornbrann, der Unterschnabel lichtblau, der Fuß fleischfarben. Die Weibchen sind matter gefärbt; bei Jungen und Männchen im Winterkleide ist der Augenbrauen- wie der über den Kopf laufende Streifen rostfahl und das Weiß der Kehle minder scharf begrenzt. Die Länge beträgt siebzehn, die Breite dreiundzwanzig, die Fittiglänge acht, die Schwanzlänge acht Centimeter.
Der Vogel verbreitet sich über alle östlichen Staaten Nordamerikas, ist im Norden des Landes aber nur Zug-, im Süden nur Wintervogel. »Dieser niedliche Fink«, sagt Audubon, »ist ein Gast in Louisiana und in allen übrigen südlichen Staaten; denn er verweilt hier bloß kurze Zeit. Er erscheint im Anfange des September und verschwindet im März wieder. In den mittleren Staaten verweilt er länger. Plötzlich sieht man alle Hecken und Zäune, welche die Felder umgeben, die Büsche und andere passende Oertlichkeiten bedeckt von Gesellschaften dieser Vögel, welche zwischen dreißig und fünfzig Stück zählen und zusammen in bester Eintracht leben. Von den Hecken fliegen sie auf den Boden und hüpfen und arbeiten hier herum, kleine Grassämereien aufsuchend. Bei dem ersten Warnungslaute fliegt der ganze Schwarm wieder der Hecke zu und verbirgt sich hier im dichtesten Theile. Einen Augenblick später hüpft einer nach dem anderen auf die höheren Wipfelzweige hinauf, und beginnt seinen zwar kurzen, aber außerordentlich lieblichen Gesang. In den Tönen liegt eine Sanftheit, welche ich nicht beschreiben kann: ich vermag nur zu sagen, daß ich oft mit Entzücken gelauscht habe. Sofort nach dem Singen kehrt jeder auf den Boden zurück. So geht es den ganzen Tag über. Mit Anbruch des Tages stoßen unsere Finken einen schärferen, mehr schrillenden Ton aus, welchen man durch die Silbe ›Twit‹ wiedergeben könnte, und mitten in der Nacht noch habe ich diesen Ton vernommen, gleichsam zum Beweise, daß alles sich wohl befindet. An warmen Tagen fliegt ein solcher Schwarm auch in die Wälder und sucht sich dort Futter an den Ranken des wilden Weines, nimmt hier eine Beere weg, welche der Winter übrig gelassen, oder sonst etwas; niemals aber entfernen sie sich gänzlich von ihren Lieblingsdickichten. Mit Beginn des Frühlings verläßt der Vogel den Süden, um nach Norden zu wandern.« Das Nest steht regelmäßig auf dem Boden, aber auf sehr verschiedenen Oertlichkeiten, bald unter einem kleinen Busche, bald in einem sumpfigen Dickichte, bald am Fuße eines alten Baumes, bald auch Wohl in einer Höhlung zwischen Gewurzel, ist sehr groß, tief und innen geräumig, aus Moos oder grobem Grase errichtet, innen mit feineren Halmen, Haar, auch Wohl einigen Federn oder Pflanzenfasern ausgekleidet und enthält vier bis sieben, zweiundzwanzig Millimeter lange, fünfzehn Millimeter dicke Eier, welche auf grünlichweißem Grunde überall mehr oder minder dicht mit fuchsrothen oder rostbraunen Flecken gezeichnet sind. Das Männchen ist im Juni, seiner Fortpflanzungszeit, äußerst lebhaft und singt sehr fleißig die einzige Strophe seines Liedes, welches aus zwölf verschiedenen, vom Volke oft in erheiternder Weise übertragenen Tönen besteht und ohne allen Wechsel abgesungen wird, so daß er zuletzt sehr eintönig wirkt.
Hier und da erlegt oder fängt man den Bäffchenammerfink, um sein leckeres Fleisch zu verspeisen, oder um ihn im Käfige zu halten. In diesem gewährt er aus dem Grunde Vergnügen, weil er im Frühlinge, wie in der Heimat gewohnt, auch des Nachts zu singen pflegt.
Der kleine, fast kegelförmige, nur an der Spitze gebogene Schnabel, der ziemlich hochläufige, kurzzehige, mit mittellangen, aber kräftigen Nägeln bewehrte Fuß, der kurze Flügel, unter dessen Schwingen die zweite die Spitze bildet, der mäßig lange, sanft ausgeschweifte, seitlich gerundete, schmale Schwanz und die düstere Färbung des Gefieders sind die Merkmale der Schneeammerfinken ( Junco), als deren Vertreter der Winterammerfink oder Schneevogel der Amerikaner ( Junco hyemalis, Fringilla hiemalis, hudsonia und nivalis, Niphaea, Emberiza und Struthus hyemalis oder hiemalis) Erwähnung finden mag, weil er auch einmal auf Island vorgekommen sein soll. Seine Länge beträgt hundertundfunfzig, die Breite zweihundertundzwanzig, die Fittiglänge neunundsiebzig, die Schwanzlänge sünfundsiebzig Millimeter. Die Kopf- und Obertheile sind düster schiefergrau, die Untertheile von der Brust an weiß, die Schwingen und deren Deckfedern dunkelbraun, außen verwaschen bräunlich gesäumt, die Schwanzfedern braunschwarz, die beiden äußeren weiß, die dritte jederseits mit einem länglichen weißen Schaftfleck ausgestattet. Der Augenring ist dunkelbraun, der Schnabel röthlich hornweiß, der Fuß fleischfarben. Die nördlichen Vereinigten Staaten bis in den arktischen Kreis hinauf beherbergen den Winterammerfinken. Er gehört zu den gemeinsten Arten seiner Familie und kommt im größten Theile Nordamerikas wenigstens zeitweilig häufig vor. »Ich habe«, sagt Wilson, »vom Norden Maines bis Georgia das Land durchwandert und ungefähr eintausendachthundert Meilen zurückgelegt; aber ich erinnere mich keines Tages und kaum einer Meile, ohne daß ich Scharen dieser Vögel, zuweilen solche von vielen tausenden, gesehen hätte, und alle anderen Reisenden, mit denen ich gesprochen habe, bestätigten mir dasselbe: auch sie hatten überall diese Vögel gefunden.« Er ist ein Bewohner der Gebirge und des Nordens, erscheint in den Vereinigten Staaten zu Ende des Oktober und verläßt dieselben wieder gegen Ende des April. Eines schönen Morgens sieht man ihn plötzlich in Menge da, wo man am Tage vorher keinen einzigen bemerkte. Anfänglich hält er sich in kleinen Trupps von zwanzig bis dreißig Stück zusammen und treibt sich an Waldrändern, Hecken und Zäunen umher; später vereinigt er sich zu größeren Scharen und, namentlich vor Stürmen, zu Flügen von tausenden. So lange der Boden noch unbedeckt ist, nährt er sich von Grassämereien, Beeren und Kerbthieren, nicht selten in Gesellschaft von Baumhühnern, wilden Truthühnern, auch wohl Eichhörnchen, welche mit ihm demselben Futter nachgehen. Wenn aber Schnee gefallen ist und seine Futterplätze bedeckt sind, erscheint er im Gehöfte des Bauern, längs der öffentlichen Wege und schließlich auch in den Straßen der Stadt, begibt sich vertrauensvoll unter den Schutz des Menschen und wird tagtäglich grausam getäuscht, d. h. zu Hunderten weggefangen, doch auch von Gutherzigen gefüttert und unterstützt. Zutraulich läßt er den Fußgänger und Reiter nahe an sich vorüberziehen und fliegt höchstens dann auf, wenn er fürchtet, von dem Vorbeigehenden verletzt zu werden. Mit beginnendem Frühlinge verläßt er Städte und Dörfer, um seinen lieben Bergen oder seinem heimatlichen Norden zuzufliegen.
Mit Vögeln seines Gelichters vereinigt sich der Winterfink selten. Höchstens in den Dörfern schlägt er sich mit dem sogenannten Singsperlinge und anderen Verwandten in Flüge zusammen; aber auch dann noch hält er sich gesondert von dem großen Haufen. Die Nacht verbringt er auf Bäumen sitzend oder aber nach Art der Sperlinge in Höhlungen, welche er zufällig findet oder in den Getreidehaufen selbst sich anlegt. Audubon versichert, daß eine gewisse Förmlichkeit unter ihnen herrsche, und daß keiner zu große Vertraulichkeit leiden möge. Augenblicklich sind die kleinen Schnäbel geöffnet und die Flügel ausgebreitet, wenn ein Fremder zu nahe kommt; die Augen funkeln, und ein abweisender Ton wird ausgestoßen, um den Störenfried zu bedeuten. In seinen Bewegungen ähnelt er unserem Sperlinge. Er hüpft leicht über den Boden dahin, fliegt schnell und zeigt bei eifersüchtigen Kämpfen mit seinesgleichen große Geschicklichkeit.
Bald nach seiner Ankunft in der eigentlichen Heimat schreitet der Winterfink zur Fortpflanzung. Die Männchen kämpfen heftig unter einander, jagen sich, fliegend, hin und her, breiten dabei Schwingen und Schwanz weit aus und entfalten so eine eigentümliche und überraschende Pracht. Zu gleicher Zeit geben sie ihren einfachen, aber angenehmen Gesang zum besten, in welchem einige volle, lang gezogene Töne die Hauptsache sind; Gerhardt nennt ihn ein Gezwitscher, wie das junger Kanarienvögel. Die Paare suchen sich sodann einen geeigneten Nistplatz aus, am liebsten eine Bergwand, welche dicht mit Buschwerk bestanden ist, und bauen sich hier, immer auf dem Boden, aus Rindenschalen und Gras ihr Nest, dessen innere Wandung mit feinem Moose, Pferde- und anderen Haaren ausgekleidet wird. Die vier Eier sind etwa zwanzig Millimeter lang, sechzehn Millimeter dick und auf gilblichweißem Grunde dicht mit kleinen röthlichbraunen Flecken gezeichnet. Ueber den Antheil, welchen das Männchen am Brutgeschäfte nimmt, finde ich keine Angabe; dagegen wird erwähnt, daß beide Eltern ihre ausgeflogenen Jungen noch längere Zeit führen, sorgsam bewachen und bei Gefahr durch einen eigenthümlichen Laut warnen.
Gefangene Winterammerfinken gelangen zuweilen in unsere Käfige, sind aber nicht im Stande, für sich einzunehmen.
In der nächsten Unterfamilie vereinigen wir die Finken im engeren Sinne ( Fringillinae), etwa zweihundertunddreißig Arten, mit verschieden gestaltetem, meist aber schlankem, kegelförmigem, ausnahmsweise auch sehr kräftigem, auf der Firste fast immer geradem, ungekerbtem Schnabel und seitlich gelegenen Nasenlöchern, mittelhochläufigen Füßen, langen Flügeln, unter deren Schwingen die zweite mit der dritten die längsten zu sein pflegen, mittellangem Schwanze und mehr oder minder reichem, je nach Geschlecht und Alter meist verschiedenfarbigem Gefieder.
Die Finken bewohnen die Alte Welt, ohne jedoch in der Neuen gänzlich zu fehlen, verbreiten sich über alle Gebiete und vereinigen in sich fast alle Eigentümlichkeiten ihrer ganzen Familie.
Die Edelfinken ( Fringilla), welche wir als die am höchsten stehenden Glieder der Gesammtheit ansehen, haben einen gestreckten Bau, mittellangen, rein kegel- oder kreiselförmigen Schnabel, dessen oberer Theil gegen die Spitze hin ein wenig sich neigt, und dessen Schneiden etwas eingezogen erscheinen, kurzläufige und schwachzehige, mit dünnen, schmalen, aber spitzigen Nägeln bewehrten Füße, verhältnismäßig lange Flügel, in denen die zweite, dritte und vierte Schwinge die Spitze bilden, und mittellangen, in der Mitte seicht ausgeschnittenen Schwanz.
Der Edel- oder Buchfink, Wald-, Garten-, Sprott-, Spreu-, Roth-, Schild-, Schlagfink ( Fringilla coelebs, nobilis, hortensis und sylvestris, Passer spiza, Struthus coelebs), ist auf der Stirn tiefschwarz, auf Scheitel und Nacken schieferblau, auf dem Mantel röthlichbraun, auf Oberrücken und Bürzel zeisiggrün; Zügel und Augenkreise, Wangen, Kehle und Gurgel sind licht rostbraun, welche Färbung auf Kropf und Brustseiten in Fleischröthlich, auf der Brustmitte in Röthlichweiß, auf Bauch und Unterschwanzdecken in Weiß übergeht, die Handschwingen schwarz, mit Ausnahme der drei ersten an der Wurzel weiß, die letzten Armschwingen außen schmal hellgelb gesäumt und braungelb gekantet, die kleinsten Deckfedern dunkel schieferblau, die großen schwarz, mit breitem weißen Ende, wodurch eine breitere und eine schmalere Flügelbinde gebildet werden, die Schwingen unterseits glänzend grau, innen silberweiß gesäumt, die Unterflügeldeckfedern weiß, am Flügelrande schwarz geschuppt, die mittleren Schwanzfedern tief schiefergrau, gelblich gekantet, die übrigen schwarz, die beiden äußersten innen mit großem weißen Keilfleck, welcher auf der äußersten auch die Außenfahne größtentheils einnimmt, alle Steuerfedern, mit Ausnahme der äußersten weißen, unterseits schwarz. Der Augenring ist hellbraun, der Schnabel im Frühjahre blau, im Herbste und Winter röthlichweiß, der Fuß schmutzig fleischfarben. Beim Weibchen sind Kopf und Nacken grünlichgrau, ein Augenbrauenstreifen, Zügel, Kinn und Kehle weißbräunlich, die übrigen Obertheile olivengraubraun, die Untertheile hellgrau. Die Länge beträgt hundertfünfundsechzig, die Breite zweihundertachtundsiebzig, die Fittiglänge achtundachtzig, die Schwanzlänge fünfundsiebzig Millimeter.
Mit Ausnahme der nördlichsten Länder ist der Edelfink in ganz Europa eine gewöhnliche Erscheinung, im Süden während des Sommers jedoch nur im Gebirge zu finden. Außerdem bewohnt er einzelne Theile Asiens und erscheint im Winter einzeln in Nordafrika.
In den Atlasländern vertritt ihn der sehr ähnliche, aber etwas größere Maurenfink ( Fringilla spodiogenys, spodiogena und africana), welcher einmal auch in Südfrankreich erlegt worden sein soll. Bei ihm sind Kopf, Augen- und Schultergegend bläulich aschgrau, die Obertheile olivengrün, die Untertheile blaß weinroth, seitlich graulich, die Handschwingen schwarz, außen in der Wurzelhälfte schmal, in der Endhälfte etwas breiter weiß, innen breit lichtgrau gesäumt, die vorderen Armschwingen an der Wurzel, die hinteren fast ganz weiß, die kleinen Flügeldecken weiß, die großen weiß mit schwarzem Mittelbande, die übrigen Theile im wesentlichen wie bei unserem deutschen Vogel gefärbt.
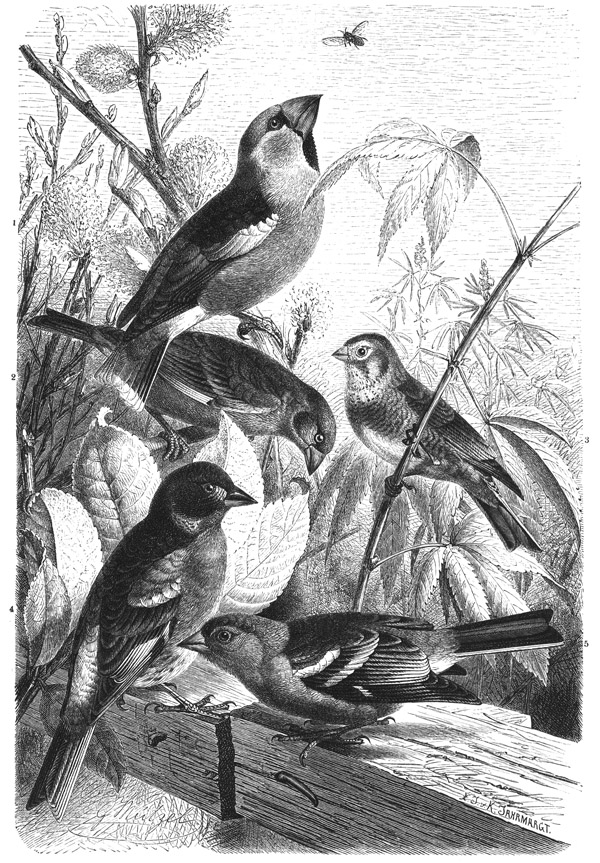
Deutsche Finken
1 Kernbeißer, 2 Grünling, 3 Hänfling, 4 Edel- und 5 Bergfink.
In Deutschland gibt es wenige Gegenden, in denen der Edelfink nicht zahlreich auftritt. Er bewohnt Nadel- wie Laubwälder, ausgedehnte Waldungen wie Feldgehölze, Baumpflanzungen oder Gärten und meidet eigentlich nur sumpfige oder nasse Strecken. Ein Paar lebt dicht neben dem anderen; aber jedes wahrt eifersüchtig das erkorene Gebiet und vertreibt aus demselben jeden Eindringling der gleichen Art. Erst wenn das Brutgeschäft vorüber, sammeln sich die einzelnen Paare zu zahlreicheren Scharen, nehmen unter diese auch andere Finken- und Ammerarten auf, wachsen allgemach zu starken Flügen an und streifen nun gemeinschaftlich durch das Land. Vom Anfange des September an sammeln sich die reiselustigen Vögel in Flüge; im Oktober haben sich die gedachten Herden gebildet, und zu Ende des Monats verschwinden sie, bis auf wenige in der Heimat überwinternde Männchen, allmählich aus unseren Gauen. Dann nehmen sie in Südeuropa und in Nordwestafrika Besitz von Gebirg und Thal, von Feld und Garten, Busch und Hecken, sind überall zu finden, überall häufig, aber auch überall in Gesellschaft, zum Zeichen, daß sie hier nicht in der Heimat, sondern nur als Wintergäste leben. Wenn der Frühling im Süden beginnt, wenden sie sich wieder heimwärts. Man hört dann den hellen, kräftigen Schlag der Männchen noch geraume Zeit ertönen; bald aber wird es still und öde da, wo hunderttausende versammelt waren, und schon zu Anfange des März sind die Wintergäste bis auf die Weibchen verschwunden. Die Finken wandern nämlich, wenigstens auf dem Rückzuge, nach Deutschland, in getrennten Scharen, die Männchen besonders und zuerst, die Weibchen um einen halben Monat später. Selten kommt es vor, daß beide Geschlechter fortwährend zusammen leben, also auch zusammen reisen. Bei schönem Wetter erscheinen in Deutschland die ersten Männchen bereits zu Ende des Februar; die Hauptmasse trifft im März bei uns ein, und die Nachzügler kommen erst im April zurück.
Jedes Männchen sucht den alten Wohnplatz wieder auf und harrt sehnsüchtig der Gattin. Wenn diese eingetroffen ist, beginnen beide sofort die Anstalten zum Nestbaue. Die Wiege für die erste Brut pflegt fertig zu sein, noch ehe die Bäume sich völlig belaubt haben. Beide Gatten durchschlüpfen, emsig suchend, die Kronen der Bäume, das Weibchen mit großem Ernste, das Männchen unter lebhaften Bewegungen sonderbarer Art und Hintansetzung der dem Finken bei aller Menschenfreundlichkeit sonst eigenen Vorsicht. Jenes beschäftigt zumeist die Sorge um das Nest, dieses fast ausschließlich seine Liebe und kaum minder die Eifersucht. Endlich ist der günstigste Platz zur Aufnahme des Nestes gefunden: ein Gabelzweig im Wipfel, ein alter knorriger Ast, welcher bald von dichtem Laube umgeben sein wird, ein abgestutzter Weidenkopf oder sogar, obwohl nur selten, das Strohdach eines Hauses. Das Nest selbst, ein Kunstbau, ist fast kugelrund, nur oben abgeschnitten. Seine dicken Außenwände werden aus grünem Erdmoose, zarten Würzelchen und Hälmchen zusammengesetzt, außen aber mit den Flechten desselben Baumes, auf dem es steht, überzogen, und diese durch Kerbthiergespinste miteinander verbunden, so daß die Außenwände täuschende Ähnlichkeit mit einem Astknorren erhalten. Das Innere ist tief napfförmig und sehr weich mit Haaren und Federn, Pflanzen- und Thierwolle ausgepolstert. So lange der Nestbau währt und das Weibchen brütet, schlägt der Fink fast ohne Unterbrechung während des ganzen Tages, und jedes andere Männchen in der Nähe erwidert den Schlag seines Nachbars mit mehr als gewöhnlichem Eifer; beide Nebenbuhler im Liede erhitzen sich gegenseitig, und es beginnt nun ein tolles Jagen durch das Gezweige, bis der eine den anderen im buchstäblichen Sinne des Wortes beim Kragen gepackt hat und, unfähig noch zu fliegen, mit ihm wirbelnd zum Boden herabstürzt. Bei solchen Kämpfen setzen die erbitterten Vögel ihre Sicherheit oft rücksichtslos aufs Spiel, sind blind und taub gegen jede Gefahr. Endet der Kampf mit Schnabel und Klaue, so beginnt das Schlagen von neuem, wird immer heftiger, immer leidenschaftlicher, und wiederum stürmen die beiden gegen einander an, nochmals wird mit scharfen Waffen gefochten. So ist die Brutzeit des Edelfinken nichts als ein ununterbrochener Kampf. Das Weibchen legt fünf bis sechs kleine, achtzehn Millimeter lange, vierzehn Millimeter dicke, zartschalige Eier, welche auf blaß blaugrünlichem Grunde mit bleich röthlichbraunen, schwach gewellten und mit schwarzbraunen Punkten verschiedener Größe besetzt zu sein pflegen, in Form und Zeichnung aber vielfach abändern. Die Zeit der Bebrütung währt vierzehn Tage; das Weibchen brütet hauptsächlich, das Männchen löst es ab, so lange jenes, Nahrung suchend, das Nest verlassen muß. Die Jungen werden von beiden Eltern ausschließlich mit Kerbthieren groß gefüttert, verlangen auch nach dem Ausfliegen noch eine Zeitlang der elterlichen Fürsorge, gewöhnen sich aber bald daran, ihre Nahrung selbst zu erwerben. Als unmündige Kinder ließen sie ein sonderbar klingendes »schilkendes« Geschrei vernehmen, als Erwachsene bedienen sie sich des Locktones der Alten. Diese schreiten schon wenige Tage, nachdem die Erziehung ihrer Jungen beendet, zu einer zweiten Brut. Beide Eltern lieben letztere ungemein. Sie schreien kläglich, wenn ein Feind dem Neste naht, und geben ihrer Angst durch die verständlichsten Geberden Ausdruck. Naumann versichert, daß das Männchen mehr um die Eier, das Weibchen mehr um die Jungen besorgt sein solle; ich habe diesen Unterschied in der Liebe zu der Brut noch nicht wahrgenommen. Ungeachtet der Anhänglichkeit und Zärtlichkeit gegen die Jungen weicht das Edelfinkenpaar in gewisser Hinsicht von anderen Finken nicht unwesentlich ab. Wenn man junge Hänflinge aus dem Neste nimmt und in ein Gebauer steckt, darf man sicher sein, daß die Alten sich auch dann noch in der Fütterung ihrer Kinder nicht stören lassen; die Edelfinken dagegen lassen unter gleichen Umständen ihre Jungen verhungern. »Dies hat«, sagt Naumann, »mancher unerfahrene Finkenfreund, welcher sich durch die alten Vögel die Mühe des Selbstaufziehens ersparen wollte, bitter erfahren müssen. Sorge um eigene Sicherheit und Mißtrauen scheinen hier über die elterliche Liebe zu siegen.« Doch kommen, wie derselbe Forscher ebenfalls mittheilt, rühmliche Ausnahmen auch bei Edelfinken vor.
Der Fink ist ein munterer, lebhafter, geschickter, gewandter und kluger, aber heftiger und zänkischer Vogel. Während des ganzen Tages fast immer in Bewegung, verhält er sich nur zur Zeit der größten Mittagshitze etwas ruhiger. Auf den Aesten trägt er sich aufgerichtet, auf der Erde mehr wagerecht; auf dem Boden geht er halb hüpfend, halb laufend, auf den Zweigen gern in seitlicher Richtung; im Fluge durchmißt er weite Strecken in bedeutender, kurze in geringer Höhe, schnell und zierlich flache Wellenlinien beschreibend und vor dem Aufsitzen mit gebreiteten Schwingen einen Augenblick schwebend. Seine Lockstimme, das bekannte »Pink« oder »Fink«, wird sehr verschieden betont und erhält dadurch mannigfache Bedeutungen. Im Fluge läßt er häufiger, als das Pink, ein gedämpftes, kurzes »Güpp, güpp« vernehmen; bei Gefahr warnt er durch ein zischendes »Siih«, auf welches auch andere Vögel achten; in der Begattungszeit zirpt er; bei trübem Wetter läßt er ein Knarren vernehmen, welches die Thüringer Knaben durch das Wort »Regen« übersetzen. Der Schlag besteht aus einer oder zwei regelmäßig abgeschlossenen Strophen, welche vielfach abändern, mit größter Ausdauer und sehr oft, rasch nacheinander wiederholt, vorgetragen, von Liebhabern genau unterschieden und mit besonderen Namen belegt werden. Die Kunde dieser Schläge ist zu einer förmlichen Wissenschaft geworden, welche jedoch ihre eigenen Priester verlangt und einem nicht in deren Geheimnisse eingeweihten Menschen immer dunkel bleiben wird. Es gibt gewisse Gegenden in dem Gebirge, wo gedachte Wissenschaft mehr gepflegt wird als jede andere. Berühmt sind die Thüringer, die Harzer und die Oberösterreichischen Finkenliebhaber wegen ihrer außerordentlichen Kenntnis der betreffenden Schläge. Während das ungeübte Ohr nur einen geringen Unterschied wahrnimmt, unterscheiden diese Leute mit untrüglicher Sicherheit zwischen zwanzig und mehr verschiedenen Schlägen, deren Namen bei Unkundigen Lächeln erregen, aber doch meist recht gut gewählt und zum Theil Klangbilder des Schlages selbst sind. Früher schätzte man vorzüglich schlagende Finken überaus hoch und bezahlte sie mit fast fabelhaften Summen; gegenwärtig ist die Liebhaberei dafür im Ersterben.
Der Edelfink verursacht irgendwie nennenswerthen Schaden höchstens in Forst- und Gemüsegärten, indem er hier auf frisch besäeten Beeten die oben aufliegenden Samen wegfrißt. Zwar beschuldigt man ihn außerdem, durch Auslesen der ausgefallenen Buchen- und Nadelholzsamen dem Walde empfindlich zu schaden, glaubt aber wohl selbst nicht an die Thatsächlichkeit solcher Behauptung. Er verzehrt Sämereien verschiedener Pflanzen, hauptsächlich die des Unkrautes, ernährt seine Brut und während der Nistzeit sich selbst aber ausschließlich von Kerbthieren, zumeist solchen, welche unseren Nutzbäumen schaden. So wird schlimmstenfalls aller ihm zur Last gelegte Schaden durch den ihm zuzusprechenden Nutzen ausgewogen. Man sollte ihn hegen und pflegen, nicht aber schonungslos verfolgen, wie es leider noch immer hier und da geschieht. Die Liebhaber, welche Finken für ihr Gebauer fangen, sind es nicht, welche deren Bestand verringern; die Herdsteller aber, welche tausende mit einem Male vernichten, thun der Vermehrung dieser anmuthigen Vögel empfindlichen Abbruch.
Der nächste Verwandte unseres Finken ist der Bergfink, Wald-, Baum-, Laub-, Buch-, Tannen-, Mist-, Koth-, Winter-, Roth-, Gold-, Quätschfink, Quäker, Wäckert, Kegler, Zetscher, Zerling und Böhmer ( Fringilla montifringilla, lulensis, flammea, septentrionalis und media, Struthus montifringilla). Seine Länge beträgt einhundertundsechzig, die Breite zweihundertundsechzig, die Fittiglänge neunzig, die Schwanzlänge sechsundsechzig Millimeter. Kopf, Nacken und Mantel, Wangen und obere Halsseiten sind tiefschwarz, bläulich glänzend, die Bürzelfedern in der Mitte reinweiß, an den Seiten schwarz, Kehle und Brust gelblich überflogen, Zügel, Kinn und Bauchseiten gelblichweiß, letztere schwarz gefleckt, die Unterschwanzdecken rostgelb, die Schwingen braunschwarz, außen, die vier vordersten ausgenommen, schmal gelbweiß gesäumt und an der Wurzel mit einem hellweißen Flecke ausgestattet, die Schulterfedern gelblich rostfarben, die kleinen Flügeldeckfedern etwas lichter, die mittleren schwarz, am Ende gelblichweiß, die großen schwarz mit langen, scharf abstechenden gelbrothen Endkanten und Spitzen, die Schwanzfedern in der Endhälfte weiß, gelblich umsäumt, innen mit weißen Keilflecken. Der Augenring ist dunkelbraun, der Schnabel licht blauschwarz, im Herbste wachsgelb, an der Spitze schwärzlich, der Fuß rothbraun. Beim Weibchen sind Kopf und Nacken grünlichgrau, die Obertheile olivengraubraun, die Unterteile hellgrau. Nach der Mauser werden die lebhaften Farben durch gelbbraune Federränder verdeckt.
Das Verbreitungsgebiet des Bergfinken erstreckt sich über den hohen Norden der Alten Welt, vom neunundfunfzigsten Breitengrade an nach den Polen zu, soweit der Baumwuchs reicht. Von hier aus durchstreift und durchzieht er im Winter ganz Europa bis Spanien und Griechenland oder Asien bis zum Himalaya und kommt auf diesem Zuge sehr häufig zu uns. Er rottet sich bereits im August in Scharen zusammen, treibt sich in den nächsten Monaten in den südlichen Gegenden seiner Heimatsländer umher und wandert nun allgemach weiter nach dem Süden hinab. Bei uns erscheint er zu Ende des September; in Spanien trifft er wenige Tage später ein, jedoch nicht in derselben Häufigkeit und Regelmäßigkeit wie bei uns. Gebirge und zusammenhängende Waldungen bestimmen die Richtung seiner Reise, falls solche nicht durch Scharen anderer Finken, mit denen er sich gern vermischt, einigermaßen abgeändert wird. In Deutschland begegnet man den Bergfinken, regelmäßig mit Edelfinken, Hänflingen, Ammern, Feldsperlingen und Grünlingen vereinigt, in Wäldern und auf Feldern. Eine Baumgruppe oder ein einzelner hoher Baum im Felde wird zum Sammelplatze, der nächstgelegene Wald zur Nachtherberge dieser Scharen. Von hier aus durchstreifen sie, Nahrung suchend, die Felder. Hoher Schneefall, welcher ihnen ihre Futterplätze verdeckt, treibt sie aus einer Gegend in die andere. Ihr Zug ist unregelmäßig, durch zufällige Umstände bedingt.
Der Bergfink hat mit seinem edlen Verwandten viele Ähnlichkeit. Auch er ist als einzelner Vogel zänkisch, jähzornig, bissig und futterneidisch, so gesellig er im übrigen zu sein scheint. Die Scharen theilen gemeinsam Freud und Leid, die einzelnen unter ihnen liegen sich ohne Unterlaß in den Federn. Hinsichtlich seiner Bewegung ähnelt der Bergfink dem Edelfinken sehr; im Gesange steht er tief unter ihm. Sein Lockton ist ein kurz ausgestoßenes »Jäckjäck« oder ein lang gezogenes »Quäk«, welchem zuweilen noch ein kreischendes »Schrüig« angehängt wird, der Gesang ein erbärmliches Gezirpe ohne Wohlklang, Regel und Ordnung, eigentlich nichts weiter als eine willkürliche Zusammenfügung der verschiedenen Laute. Wie alle nordländischen Wandervögel, zeigt er sich anfangs vertrauensselig und dreist, wird aber doch durch Verfolgung bald gewitzigt und oft sehr scheu.
In der Heimat bewohnt der Bergfink Nadelwaldungen, zumal solche, welche mit Birken untermischt sind, oder Birkenwaldungen selbst, tritt aber keineswegs ebenso häufig auf wie unsere Edelfinken unter gleichen Umständen, sondern vereinzelt sich oft so, daß man lange nach ihm suchen muß. Jedes Paar grenzt sein Brutgebiet ab; die Männchen kommen aber auch während der Brutzeit noch zeitweilig zusammen, um friedlich miteinander zu verkehren. In einzelnen Waldungen habe ich sie außerordentlich vertrauensvoll, in anderen auffallend scheu gefunden. Im übrigen gleicht ihr Betragen dem, welches wir im Winter zu beobachten gewohnt sind, in jeder Beziehung. Besonders anziehend erscheinen sie auch in der Zeit ihrer Liebe nicht. Das Nest ähnelt dem unseres Edelfinken, ist aber stets dickwandiger und außen nicht bloß mit Moosen, sondern sehr häufig auch mit Birkenschalen, innen mit feiner Wolle und einzelnen Federn ausgekleidet, durch letztere, welche am oberen Rande eingebaut zu sein pflegen, zuweilen halb verdeckt. Die fünf bis acht Eier, welche einen Längsdurchmesser von siebzehn bis fünfundzwanzig und einen Querdurchmesser von dreizehn bis vierzehn Millimeter haben, unterscheiden sich durch etwas grünlichere Grundfärbung von denen des Verwandten.
Oelhaltige Sämereien verschiedener Pflanzen und im Sommer außerdem Kerbthiere bilden die Nahrung auch dieses Finken.
Man jagt den Bergfinken bei uns hauptsächlich seines wohlschmeckenden, wenn auch etwas bitteren Fleisches halber und fängt ihn namentlich auf den Finkenherden oft in großer Menge. Bei seiner Unerfahrenheit werden ihm auch andere Fallen aller Art leicht verderblich.
Hoch oben auf den Alpengebirgen der Alten Welt, von den Pyrenäen an bis nach Sibirien hin, im Sommer immer über der Grenze des Holzwuchses, lebt ein unserem Edelfinken verwandter Vogel, der Schnee- oder Steinfink ( Montifringilla nivalis und glacialis, Fringilla nivalis und saxatilis, Plectrophanes fringilloides, Emberiza, Chionospina, Orites, Geospiza und Leucosticte nivalis). Er unterscheidet sich von den vorstehend beschriebenen Arten durch den langen, gekrümmten, spornartigen Nagel der Hinterzehe, die langen Flügel und die gleichartige Befiederung beider Geschlechter, und wird deshalb als Vertreter einer besondern gleichnamigen Sippe ( Montifringilla) angesehen. Seine Länge beträgt etwa zwanzig, die Breite sechsunddreißig, die Fittiglänge elf, die Schwanzlänge acht Centimeter. Oberkopf, Wangen, Hinter- und Seitenhals sind licht aschgrau, die Mantelfedern kaffeebraun, lichter gekantet, die Bürzelfedern in der Mitte schwarz, weißlich oder bräunlich gewellt, seitlich weiß, Kehle und Gurgel schwarz, Brustseiten und Weichen licht gelblichaschgrau, Kinn, Brust und Bauchmitte schmutzigweiß, die Schenkelfedern lichtgrau, der After und die Unterschwanzdeckfedern weiß, letztere mit kleinen dunkelbraunen Endflecken gezeichnet, die ersten sieben Handschwingen schwarz, außen und am Ende bräunlichweiß gesäumt, die achte Schwinge an der Wurzel und außen schwarz, übrigens wie alle anderen, mit Ausnahme der letzten kaffeebraunen, schneeweiß, Flügelrand, kleinere, mittlere und fast alle großen Flügeldeckfedern ebenso, die hintersten wie die Schulterfedern dunkelbraun, mit lichtbraunen Kanten, die Mittelschwanzfedern schwarz, außen weiß gesäumt, alle übrigen schneeweiß. Das Auge ist dunkelbraun, der Schnabel schieferschwarz, im Herbste und Winter wachsgelb, an der Spitze immer schwarz, der Fuß schwarz. Beim Weibchen ist das Weiß im Flügel weniger ausgedehnt. Nach der Mauser im Herbste sind alle dunklen Farben durch lichtere Federränder theilweise verdeckt.
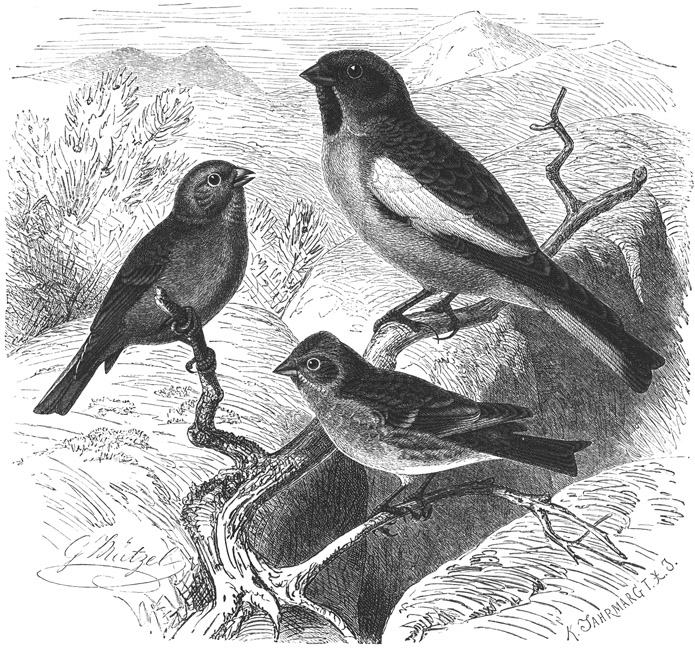
Citronfink ( Citrinella alpina), Schneefink ( Montifringilla nivalis) und Bergleinfink ( Linaria rufescens). ½ natürl. Größe.
Unsere Alpen, die Karpathen, der Kaukasus, die persischen Hochgebirge und der Himalaya beherbergen den Schneefinken. Fast ebenso zähe wie das Alpenschneehuhn, hängt er, laut Stölker, an dem höheren Gürtel des Gebirges. Arger Schneefall muß stattgefunden haben und strenge Kälte eingetreten sein, bevor er sich entschließt, die tieferen Thäler zu besuchen. Im Vorwinter geschieht dies weit seltener noch als im Nachwinter, weil den wettergestählten Vogel Schnee und Kälte so lange nicht behelligen, als noch Futtervorrath vorhanden ist. »Eher noch als er«, sagt Girtanner, »kommt die Flüelerche zu uns herab; ich erinnere mich bloß eines einzigen Schneefinken, welcher hier in St. Gallen erlegt wurde. Die bitterste Noth zwingt ihn, zu Thal zu fliegen. Ob er auch im allerstrengsten Winter, wenn in der Höhe nur Schnee, Eis und Sturmwind die Herrschaft haben, wenn selbst Mauerläufer und Flüelerche, Bartgeier und Schneehuhn ihr Heimatsrecht in jenen höchsten Höhen aufgeben, noch in seinem eigentlichen Wohngebiete verharrt, weiß ich nicht, kann mir aber kaum denken, daß dies so sei, da mir nicht möglich ist festzustellen, was er dort oben zu fressen finden sollte.« Auch während des strengsten Winters entfernt er sich kaum vom Gebirge, und Fälle, daß er wirklich auf deutsches Gebiet sich verirrt hat, gehören daher zu den größten Seltenheiten. Im Laufe des Sommers lebt er nur in dem höchsten Alpengürtel, unmittelbar unter der Grenze des ewigen Schnees, während der Brutzeit paarweise, nach derselben in Trupps und Flügen, meist am Rande der Halden, woselbst er rasch über die einzelnen Felsen trippelt, zeitweise mit den Genossen sich erhebt und unter leisem »Jüp, jüp« eine Strecke weit fliegt, aber bald wieder sich niederläßt und ebenso eifrig wie vorher weiter nach Nahrung sucht. In Angst gesetzt zirpt er kläglich, und bei Gefahr warnt er durch ein schmetterndes »Gröo«. Sein Gesang, welchen man im Freien nur während der Fortpflanzungszeit vernimmt, wird aus allen diesen Lauten zusammengesetzt und von den Kennern als der schlechteste aller Finkengesänge bezeichnet; er ist kurz, rauh, hart und unangenehm stark. In seinen Bewegungen erinnert er mehr an Schneeammer und Lerche als an den Edelfinken, fliegt auch wie jene sehr leicht und schwebend; aufgescheucht hebt er sich gewöhnlich in bedeutende Höhe, kehrt aber oft, nachdem er einen weiten Umkreis beschrieben, fast genau auf dieselbe Stelle zurück. Vor dem Menschen scheut er sich nicht, und wenn er bei Ankunft eines solchen entflieht, geschieht es meist wohl nur deshalb, weil ihn die ungewohnte Erscheinung schreckte. Auf den Bergstraßen kommt er im Winter regelmäßig vor die Häuser und fliegt dort, wo er des Schutzes sicher ist, furchtlos in die Wohnungen aus und ein; in der ungastlichen Tiefe zeigt er sich anfänglich so vertrauensselig, daß er der Tücke des Menschen nur allzuleicht zum Opfer fällt; Verfolgung aber witzigt binnen kurzem auch ihn.
Schon im April, meist aber erst zu Anfange des Mai, schreitet der Schneefink zur Fortpflanzung. Er brütet am liebsten in den Spalten steiler, senkrechter Felswände, zuweilen auch in Mauerritzen oder unter den Dachplatten einzelner Gebäude, gleichviel, ob solche bewohnt sind oder leer stehen. Das Nest, ein dichter und großer Bau, wird aus feinen Halmen zusammengetragen und sorgsam mit Wolle, Pferdehaaren, Schneehuhnfedern und dergleichen ausgefüttert. Die Eier, welche die unseres Edelfinken an Größe übertreffen, sind schneeweiß. Beide Eltern füttern gemeinschaftlich und zwar hauptsächlich mit Larven, Spinnen und Würmchen ihre Jungen groß. Haben sie mehr in der Tiefe gebrütet, so führen sie die ausgeflogenen Jungen baldmöglichst zu den Gefilden des »ewigen Schnees« empor. Hier wie während des Winters bilden verschiedene Sämereien ihre Nahrung, und wie es scheint, leiden sie auch in der armen Jahreszeit keinen Mangel. In den Hospizen werden sie regelmäßig gefüttert und sammeln sich deshalb oft in Scharen um diese gastlichen Häuser.
Gefangene gewöhnen sich ohne Umstände im Käfige ein, nehmen mit allerlei passendem Futter vorlieb und erwerben sich durch ruhiges und verträgliches Wesen, Geselligkeit und Liebenswürdigkeit, Anspruchslosigkeit und Dauerhaftigkeit die Zuneigung jedes Pflegers.
Unser Grünling, Grün-, Hirsen-, Hanf- und Kutvogel, Grün- und Rappfink, Grünhanferl, Grünesen, Grinzling, Grönnig, Wonitz, Schwunsch, Schaunsch, Schaunz, Tutter etc. ( Ligurinus chloris, chloroticus und aurantiiventris, Chlorospiza chloris und chlorotica, Chloris hortensis, pinetorum, flavigaster und aurantiiventris, Passer, Loxia, Fringilla, Serinus und Coccothraustes chloris), Vertreter der Sippe der Grünfinken ( Chloris), kennzeichnet sich durch kräftigen Bau, kurzkegelförmigen, an den eingezogenen Laden scharfschneidigen Schnabel, kurzzehige Füße, mittellange Flügel, unter deren Schwingen die drei vordersten die Spitzen bilden, und ziemlich kurzen, in der Mitte seicht ausgeschnittenen Schwanz. Seine Länge beträgt einhundertfünfundzwanzig, die Breite zweihundertundsechzig, die Fittiglänge dreiundachtzig, die Schwanzlänge sechzig Millimeter. Die vorherrschende Färbung ist ein angenehmes Olivengelbgrün; Stirnrand, Augenstreifen, Hinterbacken, Kinn und Oberkehle sind lebhafter und mehr gelb, Ohrgegend, Nacken, Bürzel, Oberschwanzdecken und die unteren Seiten aschgrau verwaschen, Unterbrust, Bauch, Unterschwanzdecken und Flügelrand lebhaft citrongelb, die den After umgebenden Federn weiß, die Handschwingen schwarz, an den Spitzen schmal grau gesäumt, die ersten sechs außen bis zum Spitzendrittel hoch citrongelb, die Armschwingen und deren Deckfedern schwarz, außen aschgrau, die übrigen Oberflügeldecken olivengelbgrün, alle Schwingen innen an der Wurzel weiß gerandet, die Schwanzfedern, mit Ausnahme der beiden mittelsten, in der Wurzelhälfte citrongelb, im übrigen schwarz. Der Augenring ist dunkelbraun, der Schnabel wie der Fuß röthlichgrau. Das Weibchen ist minder lebhaft gefärbt, auf dem Rücken braungrau verwaschen, auf der Mitte der Unterbrust und des Bauches weiß; die Armschwingen und deren Deckfedern sind außen röthlichbraun gesäumt. Junge Vögel sind oberseits olivengelbbraun, undeutlich dunkler gestreift, Kopfseiten, Bürzel und ganze Unterseite blaßgelblich, schmal rostbräunlich längsgestrichelt.
Mit Ausnahme der nördlichsten Gegenden Europas fehlt der Grünling nirgends in diesem Erdtheile, und ebenso verbreitet er sich über Nordwestafrika und Kleinasien bis zum Kaukasus. Sehr häufig ist er in Südeuropa, namentlich in Spanien, aber auch bei uns keineswegs selten. Er bewohnt am liebsten fruchtbare Gegenden, wo kleine Gehölze mit Feldern, Wiesen und Gärten abwechseln, findet sich in allen Augegenden in Menge, hält sich in unmittelbarer Nähe bewohnter Gebäude auf, meidet aber die Wälder. Bei uns ist er bedingungsweise Wander-, in Südeuropa Standvogel. Wahrscheinlich entstammen diejenigen, welche bei uns überwintern, dem Norden.
Nur auf der Wanderschaft schlägt sich der Grünling mit verwandten Vögeln in zahlreiche Flüge zusammen, so mit Edel- und Buchfinken, Feldsperlingen, Goldammern, Bluthänflingen und anderen. Sonst lebt er paar- oder familienweise. Er wählt ein kleines Gehölz oder einen Garten zum Standorte, sucht in ihm einen dicht belaubten Baum zum Schlafplatze aus und streift von hier aus nach Nahrung umher. Während des Tages sieht man ihn hauptsächlich auf dem Boden, wo er allerhand Sämereien aufliest. Bei Gefahr flüchtet er dem nächstbesten Baume zu und verbirgt sich im Gelaube der Krone. So plump er erscheint, so munter und rasch ist er. Im Sitzen trägt er den Leib gewöhnlich wagerecht und die Federn locker; oft aber richtet er sich so auf und legt das Gefieder so glatt an, daß man ihn kaum erkennt. Sein Gang ist hüpfend, aber nicht ungeschickt, sein Flug ziemlich leicht, bogenförmig, weil die Schwingen bald stark ausgebreitet, bald sehr zusammengezogen werden, vor dem Niedersetzen stets schwebend. Ohne Noth fliegt er ungern weit, obwohl es ihm nicht darauf ankommt, auch längere Strecken in einem Zuge zurückzulegen. Beim Auffliegen läßt er gewöhnlich seinen Lockton, ein kurzes »Tschick« oder »Tscheck«, vernehmen, welches zuweilen vielmals nacheinander wiederholt wird. Der Laut der Zärtlichkeit ist ein ungemein sanftes, jedoch immerhin weit hörbares »Zwui« oder »Schwunsch«. Dasselbe wird auch als Warnungsruf gebraucht, dann aber gewöhnlich mit einem sanften hellen Pfeifen begleitet. Da, wo der Grünling sich sicher weiß, ist er sehr wenig scheu, in Gesellschaft anderer aber oft sehr vorsichtig. »Bei Annäherung eines Menschen«, sagt mein Vater, »fliegen immer die zunächst auf der Erde sitzenden auf, ziehen die übrigen mit sich fort und lassen sich bald wieder nieder. So muß man einen Schwarm Viertelstunden weit verfolgen, ehe man einen sicheren Schuß auf mehrere thun kann.« Eigentlich vertrauensselig ist der Grünling nie, kommt beispielsweise niemals, auch wenn die ärgste Noth ihn bedrückt, in das Gehöft.
Sämereien der verschiedensten Pflanzen, auch giftige, vor allem aber ölige, Rübsamen, Leindotter, Häderich, Hanfsamen und dergleichen, bilden seine Nahrung. Er liest sie nach Art der Edelfinken von der Erde auf, und nur, wenn tiefer Schnee seinen Tisch verdeckt, versucht er auch, solche auszuklauben oder nimmt Wacholder- und Vogelbeeren an und beißt die Buchnüsse auf, um des Kernes habhaft zu werden. In Gegenden, wo Hanf gebaut wird, kann er zuweilen recht schädlich werden; außerdem belästigt er vielleicht noch im Gemüsegarten, nützt dafür aber durch Auflesen und Aufzehren des Unkrautsamens wahrscheinlich mehr, als er schadet.
Der Grünling pflegt zweimal, in guten Sommern wohl auch dreimal zu brüten. Schon vor der Paarung läßt das Männchen seinen einfachen Gesang fortwährend vernehmen und steigt dabei gelegentlich, beständig singend, schief nach oben empor, hebt die Flügel so hoch, daß ihre Spitzen sich fast berühren, schwenkt hin und her, beschreibt einen oder mehrere Kreise und flattert nun langsam wieder zu dem Baume herab, von welchem es sich erhob. Nebenbuhler vertreibt es nach hartnäckigen Kämpfen. Das Nest wird auf Bäumen oder in hohen Hecken, zwischen einer starken Gabel oder dicht am Stamme angelegt und je nach den Umständen aus sehr verschiedenen Stoffen zusammengebaut. Dürre Reiserchen und Würzelchen, Quecken, trockene Halme und Graswurzeln bilden die Unterlage, auf welche eine Schicht feinerer Stoffe derselben Art, untermischt mit grünem Erdmoose oder Flechten, auch wohl mit Wollklümpchen, zu folgen pflegt. Zur Ausfütterung der Nestmulde dienen einige äußerst zarte Würzelchen und Hälmchen, auf und zwischen denen Pferde-, Hirsch- und Rehhaare liegen, vielleicht auch kleine Flöckchen Thierwolle eingewebt sind. Der Bau steht an Schönheit dem Neste des Edelfinken weit nach, ist tiefer als eine Halbkugel, nicht sehr fest und dicht, aber doch hinlänglich gut gebaut. Zu Ende des April findet man das erste, im Juni das zweite, und wenn noch eine Brut erfolgt, zu Anfange des August das dritte Gelege. Es besteht aus vier bis sechs Eiern von zwanzig Millimeter Längs- und funfzehn Millimeter Querdurchmesser, welche sehr bauchig, dünn und glattschalig und auf bläulichweißem oder silberfarbenem Grunde, besonders am stumpfen Ende mit bleichrothen, deutlichen oder verwaschenen Fleckchen und Pünktchen bedeckt sind. Das Weibchen brütet allein, sitzt sehr fest auf dem Neste, wird inzwischen von dem Männchen ernährt und zeitigt die Jungen in ungefähr vierzehn Tagen. Beide Eltern theilen sich in die Aufzucht der Brut und füttern diese zunächst mit geschälten und im Kropfe erweichten Sämereien, später mit härteren Nahrungsstoffen derselben Art. Schon wenige Tage nach dem Ausfliegen werden die Jungen ihrem Schicksale überlassen, vereinigen sich mit anderen ihrer Art, auch wohl mit verwandten jungen Finken, streifen mit diesen längere Zeit umher und schließen sich dann den Eltern, welche inzwischen die zweite oder dritte Brut beschäftigt hat, wieder an.
Unsere kleineren Raubthiere und ebenso Eichhörnchen, Haselmäuse, Krähen, Elstern, Heher und Würger zerstören viele Nester, fangen auch die Alten weg, wenn sie ihrer habhaft werden können. Gleichwohl nimmt der Bestand bei uns eher zu als ab.
Als Verbindungsglied zwischen Grünfinken und Zeisigen mag der Citronfink, Citronzeisig, Zitrinchen und Ziprinchen ( Citrinella alpina, brumalis und serinus, Fringilla, Spinus, Chrysomitris, Cannabina und Chlorospiza citrinella, Bild S. 299), gelten. Die von ihm vertretene Sippe der Citronzeisige ( Citrinella) unterscheidet sich nur durch den etwas kürzeren und dickeren Schnabel von den Zeisigen. Stirn, Vorderkopf und die Gegend um das Auge, Kinn und Kehle sind schön gelbgrün, die Untertheile lebhafter gelb, Hinterkopf, Nacken, Hinterhals, Ohrgegend und Halsseiten grau, Mantel und Schultern auf düster olivengrünem Grunde durch verwaschene, dunkle Schaftstriche gezeichnet, die Bürzelfedern schön citrongelb, die oberen Flügel- und Schwanzdecken olivengrün, die Seiten des Unterleibes grünlichgrau, die unteren Schwanzdecken blaßgelb, die Schwingen braunschwarz, außen schmal grün, an der Spitze fahlgrau, die letzten Armschwingen außen gelbgrün gesäumt, an der Spitze grau gefleckt, die Deckfedern der Armschwingen gelbgrün, ihre Wurzeltheile aber schwarz, so daß eine schmale, dunkle Flügelbinde entsteht, die Schwanzfedern schwarz, außen schmal grünlich, innen, wie auch die Schwingen, weißlich gesäumt. Das Auge ist tiefbraun, der Schnabel fleischbräunlich, der Fuß gelbbräunlich. Das kleinere Weibchen ist minder lebhaft und mehr grau gefärbt. Die Länge beträgt einhundertundzwanzig, die Breite zweihundertunddreißig, die Fittiglänge achtzig, die Schwanzlänge fünfundfunfzig Millimeter.
Der Citronfink ist ein Gebirgsvogel, welcher die Westalpen und Kleinasien, in Deutschland ständig auch den Schwarzwald bewohnt, aber nur an einzelnen Stellen zahlreich auftritt. Wie es scheinen will, hat er sich von Italien, woselbst er am häufigsten vorkommt, über Tirol und die Schweiz verbreitet und erst neuerdings im badischen Schwarzwalde angesiedelt, fehlt dagegen den Ostalpen noch gänzlich. In den Schweizer Alpen bewohnt er nur die oberen Waldungen, im badischen Schwarzwalde die Hochrücken, namentlich die Waldränder oder Weiden, meidet aber einzeln stehende Berggipfel ebenso wie das Innere von Waldungen. In der Schweiz wird er, so gern er hoch im Gebirge emporsteigt, durch Unwetter bald in die Tiefe herabgedrückt und verweilt dann hier, bis die Hochthäler und sonnigen Halden schneefrei sind und ihn ernähren können. Im Schwarzwalde verläßt er im Winter ebenfalls seine Aufenthaltsorte und steigt in die sonnigen Schluchten der Thaleingänge herab, thut dies aber nur bei wirklich schlechtem Wetter und findet sich schon zu Anfang des Mai wieder auf seinen Brutplätzen ein, ob auch dort der Boden mit Schnee bedeckt sein sollte. Von den Alpen aus mag er eine Wanderung antreten; im Schwarzwalde scheint er mehr Strichvogel zu sein. Alle Forscher, welche ihn eingehend beobachten konnten, schildern ihn als einen munteren und lebhaften Vogel, welcher in beständiger Bewegung ist, und dabei ununterbrochen lockt und singt. Bei schlechter Witterung kaum wahrnehmbar, läßt er, laut Schütt, an sonnigen und windstillen Tagen seinen klagenden Lockton »Güre, güre, bitt, bitt« häufig hören und macht sich dadurch sehr bemerklich, ist in der Regel aber ziemlich scheu und deshalb schwer zu beobachten. Der Gesang besteht, nach Alexander von Homeyer, aus drei Theilen, von denen der eine an das Lied des Girlitzes, der andere an das des Stieglitzes erinnert, und der dritte ungefähr mitteninne steht. »Der Stieglitz singt und schnarrt, der Girlitz lispelt und schwirrt, der Citronzeisig singt und klirrt. Der Ton des ersteren ist hell, laut und hart, des zweiten schrillend, des letzten voll, weich und klangvoll. Die Locktöne ›Ditae ditae wit‹ oder ›Ditaetätett‹ sind weich und nicht laut; der Ruf ›Ziüb‹ ist glockenrein und von außerordentlichem Wohlklange. Der Citronzeisig also hat einen eigenthümlich klirrenden Gesang, in welchem Stieglitz- und Girlitzstrophen wechseln und ineinander übergehen, gehört jedoch nicht zu den vorzüglichen Sängern des Finkengeschlechtes, sondern zu denen zweiten Ranges.«
Je nach der Lage des Brutgebietes und der in ihm herrschenden Witterung beginnt das Paar im April oder spätestens im Mai mit dem Baue des Nestes. Letzteres steht auf Bäumen, bald höher, bald niedriger, im Schwarzwalde, nach Schütt, immer auf etwa sechs Meter hohen Fichten, am Stamme und nahe am Wipfel im dichtesten Astwerke, besteht aus Würzelchen, Bartmoos und Pflanzenfasern und ist mit Pflanzenwolle und Federn ausgefüttert. Die vier oder fünf Eier ähneln denen des Stieglitzes, sind aber kleiner und zartschaliger, etwa funfzehn Millimeter lang, zwölf Millimeter dick und auf hellgrünem Grunde ziemlich gleichmäßig, gegen das dicke Ende hin oft kranzartig mit violett braunröthlichen und schwarzbraunen Punkten bedeckt. Die Jungen werden von beiden Eltern gefüttert, locken gedehnt »Zi-be, zi-be«, sitzen lange im Neste, fliegen aber, sobald man dieses berührt, gleich jungen Zaunkönigen davon und suchen ihr Heil im Moose und Heidelbeergestrüppe. Gegen den Herbst hin vereinigen sie und ihre Eltern sich mit anderen und bilden Flüge von vierzig bis fünfzig Stück, welche meist auf jungen Schlägen am Boden dem Gesäme nachgehen und sich von Nahrung versprechenden Orten schwer vertreiben lassen. So hielt sich in der Schweiz ein sehr starker, über hundert Stück zählender Trupp während eines Winters stets in der Nähe des Bahnhofes von Chur auf und nährte sich während dieser Zeit von dem Samen der Melde. Im Sommer liebt der Vogel den Samen des Löwenzahnes, gleichviel ob derselbe bereits gereift oder noch weich ist, und gewinnt denselben, indem er sich nach Stieglitzart an die Samenkrone hängt, oder liest vom Boden andere Sämereien auf, nimmt auch sehr gern Knospen und weiche Blattspitzen zu sich.
Seine Ernährung im Käfige verursacht wenig Schwierigkeiten; gleichwohl hält er sich schlecht und steht deshalb als Stubenvogel den Zeisigen wie dem Stieglitze nach.
Die Zeisige ( Chrysomitris) kennzeichnen sich durch langen, feinspitzigen, oben sanft gewölbten Schnabel, mit kurzen Nägeln besetzte Zehen und verhältnismäßig lange Flügel.
Unser Zeisig ( Chrysomitris spinus, Fringilla spinus und fasciata, Spinus viridis, alnorum, medius, betularum und obscurus, Acanthis, Emberiza, Linaria, Serinus und Carduelis spinus) ist auf dem ganzen Oberkopfe und dem Nacken sowie an Kinn und Oberkehle schwarz, auf Hinterhals, Mantel und Schultern gelbgrün, dunkel längsgestrichelt; ein Augenbrauenstreifen, die vorderen Backen, Kehle, Halsseiten, Kropf und Oberbrust sind schön olivengelb, Unterbrust, Bauch und Seiten fast weiß, die unteren Schwanzdecken gelb und wie die Schenkelseiten schwarz gestrichelt, die Bürzelfedern olivengelb, die Oberschwanzdeckeu grün, die Schwingen braunschwarz, von der vierten an außen im Wurzeltheile gelb, übrigens schmal gelbgrün gesäumt, die letzten Armschwingen außen breit grüngelb, an der Spitze weißlich gesäumt, die Flügeldeckfedern olivengrün, die der Armschwingen olivengelb, an der Wurzel aber schwarz, weshalb eine schwarze Querbinde ersichtlich wird, die Schwanzfedern gelb, am Ende schwarz, die beiden Mittelfedern braunschwarz, außen grün gesäumt. Das Auge ist tiefbraun, der Schnabel fleischfarben, an der Spitze schwärzlich, der Fuß braun. Beim Weibchen sind die Federn des Oberkopfes und der Oberseite grünlichbraun, die der Unterseite schmutzigweiß, durch dunkle Schaftflecke, diese durch schwärzliche Schaftstriche gezeichnet, Flügel und Schwanz merklich blasser als beim Männchen, die oberen Flügeldecken am Ende weißlich, weshalb zwei lichte Querbinden über den Flügeln entstehen. Die Länge beträgt einhundertundzwanzig, die Breite zweihundertundzwanzig, die Fittiglänge fünfundfunfzig, die Schwanzlänge fünfundvierzig Millimeter.
Das Verbreitungsgebiet des Zeisigs umfaßt ganz Europa und Asien, so weit es bewaldet ist, nach Norden hin bis zur Breite Mittelnorwegens. In Deutschland ist er ein Strichvogel, welcher außer der Brutzeit weit im Lande umherstreift, unser Vaterland aber nur selten verläßt; in nördlichen Ländern wandert er und gelangt dann häufig zu uns, um Herberge während des Winters zu nehmen. Während des Sommers bewohnt er die Nadelwälder bergiger Gegenden, brütet hier und beginnt von ihnen aus seine Streifereien. In gewissen Wintern erscheint er zu tausenden in den Dörfern oder in unmittelbarer Nähe derselben; in anderen Wintern sieht man hier kaum einzelne. Baumlose Gegenden meidet er, hält sich auch fast beständig in den obersten Kronzweigen der Bäume auf.
Der Zeisig ist, wie Naumann sagt, »immer munter, flink und keck, hält sein Gefieder stets schmuck, obgleich er dasselbe meistens nicht anlegt, bewegt sich schnell hin und her, wendet und dreht oft den Hinterleib hinüber und herüber, hüpft, steigt und klettert vortrefflich, kann sich verkehrt an die Spitzen schwankender Zweige hängen, an senkrechten, dünnen Ruthen ungemein schnell auf- und abhüpfen und gibt in alle dem den Meisen wenig nach. Sein Sitz auf Zweigen ist höchst verschieden, und nirgends hat er lange Ruhe, wenn er nicht beim Fressen ist. Auch auf der Erde hüpft er leicht und schnell, ob er dies gleich, so lange es gehen will, zu vermeiden sucht«. Sein Flug ist wogend, schnell und leicht, er scheut sich deshalb nicht, weite Räume zu überfliegen und steigt zu bedeutenden Höhen empor. Der Lockton klingt wie »Trettet« oder wie »Tettertettet« und »Di, di« oder »didilei«. Mit letzteren Tönen beginnt das Männchen gewöhnlich auch seinen Gesang, ein nicht eben ausgezeichnetes, aber doch gemüthliches Gezwitscher, welchem als Schluß ein lang gezogenes »Dididlidlideidää« angehängt wird. Er ist arglos und zutraulich, gesellig furchtsam, friedfertig und im gewissen Grade leichtsinnig, verschmerzt wenigstens bald den Verlust seiner Freiheit. Als Stubenvogel empfiehlt er sich sehr. Aeußerst gelehrig, eignet er sich bald allerlei belustigende Kunststücke an, macht kaum nennenswerthe Ansprüche an das Futter, verträgt sich mit allen übrigen Vögeln, in deren Gesellschaft er leben muß, wird seinem Herrn rücksichtslos zugethan, gewöhnt sich, frei aus- und einzufliegen, hört und folgt auf den Ruf und brütet unter sorgsamer Pflege ebenso leicht wie irgend ein anderer seiner Freiheit beraubter Vogel.
Sämereien mancher Art, hauptsächlich Baumgesäme, junge Knospen und Blätter, während der Brutzeit aber Kerbthiere, bilden die Nahrung. Die Jungen werden ausschließlich mit letzteren, zumal mit Räupchen, Blattläusen etc., aufgefüttert und bald nach dem Ausfliegen in Gärten und Obstpflanzungen geführt, weil diese reicher an Kerbthieren zu sein pflegen als die tieferen Wälder.
»Die Erlenzeisige« sagt mein Vater, welcher die ersten eingehenden Beobachtungen über das Brutgeschäft veröffentlicht hat, »paaren sich im April. Das Männchen singt dann sehr laut und fliegt dabei flatternd in der Luft umher. Dieses kleine Thierchen sieht dann groß aus, schlägt die Flügel sehr stark, breitet den Schwanz aus und flattert in Kreisen und Bogen in einer beträchtlichen Höhe umher. Dieses geschieht oft fern vom Brutorte, zuweilen in den Gärten, von denen, welche keine Weibchen bekommen können, bis in den Sommer hinein. Das Weibchen verhält sich hierbei ganz ruhig, bleibt aber in der Nähe des Männchens, schnäbelt sich hernach mit ihm und streicht mit ihm umher. Man findet gewöhnlich mehrere Paare zusammen, welche friedlich neben einander Sämereien auflesen. Will das Weibchen betreten sein, dann kauert es sich auf einen Ast oder auf die Erde hin, zittert mit den Flügeln und gibt einen pispernden Ton von sich, welcher dem junger Zaunsänger nicht unähnlich, aber schwach klingt. Bald nach der Begattung beginnt das Bauen des Nestes, nachdem das Weibchen einen schicklichen Platz dazu ausgesucht hat. Und in der That muß man über die Klugheit erstaunen, mit welcher die Stelle zum Zeisigneste gewählt wird! Ich habe es nur auf Fichten und Tannen und eines auf einer Föhre gesehen; sie standen alle weit vorn, einige fast auf der Spitze der Aeste, und so verborgen, daß man sich über die Meinung, ein Zeisignest sei unsichtbar, nicht zu verwundern braucht. Eines davon war auf einem Fichtenaste voller Flechten so angebracht, daß man nur von oben, wo es aber durch einen darüber liegenden Ast gedeckt war, an der Vertiefung es erkennen konnte; von unten und von der Seite war wegen der Flechten durchaus nichts davon zu bemerken. Die, welche nahe an die Spitzen der Aeste gebaut waren, standen so in dichten Zweigen, daß mein Steiger, welchem ich den Ast ganz genau bezeichnet hatte, das Nest in einer Entfernung von sechzig Centimeter nicht sah und schon den Baum wieder verlassen wollte, als ich ihm rieth, die Zweige aus einander zu legen; nun erst erkannte er ein Nest in den Nadeln. Es ist daher gar nicht unmöglich, daß jemand ein Zeisigpaar bauen sieht und beim Besteigen des Baumes das Nest nicht bemerkt, woraus dann das Märchen mit dem unsichtbar machenden Steinchen entstanden ist. Dazu kommt, daß ein Zeisignest zehn bis fünfundzwanzig Meter hoch und fast immer weit vom Stamme entfernt steht, was das Entdecken und Erreichen desselben sehr erschwert. Die Unsichtbarkeit ist also in gewisser Hinsicht gar nicht zu leugnen; denn wer die Erlenzeisige nicht bauen oder füttern sieht, wird nie ein Nest entdecken. Das Bauen des letzteren geht schnell von statten. Bei zwei Paaren, welche ich beobachtete, baute auch das Männchen mit, und da beide Gatten miteinander flogen, so wartete gewöhnlich der eine, bis der andere das Nest wieder verlassen hatte. Beide brachen dürre Zweige zur Unterlage ab und rissen das Moos unten an den Baumstämmen los; sie trugen ganze Schnäbel voll. Sonderbar sah es aus, wenn sie etwas Schafwolle zum Neste bereiteten: sie zupfen diese, indem sie mit dem einen Fuße darauf treten, so lange herum, bis sie ganz aufgelockert ist. Ich habe sie fast den ganzen Vormittag und auch in den Nachmittagsstunden sehr emsig bauen sehen. Bei den anderen Paaren, welche ich zu beobachten Gelegenheit hatte, baute bloß das Weibchen; das Männchen flog aber beständig neben ihm her. Sie sind beim Bauen gar nicht schüchtern und lassen sich ganz in der Nähe betrachten; gleichwohl haben sie die Gewohnheit, daß sie ein angefangenes Nest oft verlassen und an einem frischen arbeiten. Ich sah ein Pärchen dieser Vögel hoch auf einer Tanne bauen; zwei Tage darauf kam ich wieder an die Stelle und bemerkte nicht ohne Verwunderung, daß dasselbe Weibchen tief unten auf der nämlichen Tanne an einem Neste arbeitete. Diese eigene Gewohnheit der Erlenzeisige vermehrt die Schwierigkeit, ein Nest mit Eiern zu erhalten, gar sehr. Im Juni 1819 hatte ich drei Nester dieses Vogels gefunden; aber alle drei wurden verlassen, ebenso eines, welches mein Steiger entdeckt hatte. Daß der Erlenzeisig das Wasser sehr liebt, zeigt sich auch bei der Wahl des Nestplatzes. Alle drei Nester, welche ich im Juni 1819 fand, hatten Wasser in der Nähe: zwei eine große Pfütze und eines einen Teich; ein anderes stand nicht fern von einem Waldbache. Die Zeit des Legens ist verschieden. Wir haben ein Mal zu Anfang des Mai schon flügge Junge gesehen; die meisten jedoch trifft man im Anfange des Juli an, so daß die Legezeit in den Anfang des Juni fällt. Die Nester weichen einigermaßen von einander ab, bestehen aber im wesentlichen äußerlich aus dürren Reisern, sodann aus Baummoos und Fichtenflechten, Schafwolle und dergleichen, welche Stoffe durch Raupengespinste fest mit einander verbunden werden, und sind inwendig mit Würzelchen, Pflanzenwolle, Flechtenfasern, Moosstengeln, Grasblättchen und Federn dicht ausgefüttert. Ihre Wandungen sind sehr dick, und der Napf ist ziemlich tief. Die fünf bis sechs Eier sind nach Gestalt, Größe und Farbe verschieden, gewöhnlich etwa sechzehn Millimeter lang, dreizehn Millimeter dick und auf weißblaulichem oder bleich grünblauem Grunde mit mehr oder minder deutlichen Punkten, Flecken und Adern gezeichnet. Das Weibchen brütet allein, wird währenddem vom Männchen aus dem Kropfe gefüttert und zeitigt die Brut binnen dreizehn Tagen. An der Aufzucht der Jungen betheiligen sich beide Eltern. Der Zeisig hat von vielen Feinden zu leiden; denn seine Arglosigkeit und Geselligkeit wird ihm Menschen und Raubthieren gegenüber oft zum Verderben.
Der allbekannte Stieglitz oder Distelzeisig, Kletterrothvogel, Gold- oder Jupitersfink, Trun, Stachlitz, Stachlick, Sterlitz, Gelbflügel ( Carduelis elegans, auratus, germanicus und septentrionalis, Fringilla carduelis und ochracea, Passer, Spinus und Acanthis duelis), Vertreter einer gleichnamigen, artenarmen, in der Alten Welt heimischen Sippe ( Carduelis), kennzeichnet sich durch kreiselförmigen, sehr gestreckten und spitzigen, ein wenig abwärts gebogenen, an den Schneiden etwas eingezogenen Schnabel, kurze, stämmige, langzehige, mit wenig gebogenen, aber scharfen Nägeln bewehrten Füße, spitzige Flügel, unter deren Schwingen die fünf ersten die längsten sind, mittellangen, schwach ausgeschnittenen Schwanz und lockeres Gefieder. Letzteres ist sehr bunt. Ein schmales Band rings um den Schnabel, Zügel, Scheitelmitte und Hinterkopf sind tiefschwarz, Stirn, Hinterwangen und Kehle hoch karminroth, Schläfe und Wangen weiß, Nacken, Schultern und Rücken gelblich-, Kropf und Brustseiten hell röthlichbraun, Gurgel, Bürzel und die noch nicht genannten Untertheile weiß, die Schwingen tiefschwarz, im Wurzeldrittel, mit Ausnahme der ersten, außen hochgelb und vor der Spitze durch ein nach hinten sich vergrößerndes, weißliches Schildchen geziert, unterseits dunkelgrau, silberweiß gekantet, die kleinen Oberflügeldecken tiefschwarz, die mittleren und großen hellgelb, die Steuerfedern tiefschwarz, die äußersten innen mit länglich weißem Flecke, die übrigen an der Spitze mit weißen Schildchen geschmückt. Das Auge ist nußbraun, der Schnabel röthlichweiß, an der Spitze schwarz, der Fuß bläulich fleischfarben. Beide Geschlechter ähneln sich täuschend, und nur ein sehr geübter Blick unterscheidet an der etwas bedeutenderen Größe, dem ein wenig mehr verbreiteten Roth im Gesichte und einem tieferen Schwarz auf reinerem Weiß am Kopfe das Männchen von dem Weibchen. Den Jungen fehlt das Roth und Schwarz am Kopfe; ihr Oberkörper ist auf bräunlichem Grunde dunkel, der Unterkörper auf weißem Grunde braun gefleckt. Die Länge beträgt dreizehn, die Breite zweiundzwanzig, die Fittiglänge sieben, die Schwanzlänge fünf Centimeter.
Vom mittleren Schweden an findet sich der Stieglitz in ganz Europa, aber auch auf Madeira, den Kanarischen Inseln, in Nordwestafrika und in einem großen Theil Asiens, von Syrien an bis nach Sibirien hinauf. Auf Cuba ist er verwildert. Innerhalb dieses Verbreitungskreises scheint er nirgends zu fehlen, nimmt auch mit gesteigertem Obstbaue an Menge zu, bequemt sich überhaupt verschiedenen Verhältnissen trefflich an, kommt aber keineswegs überall in gleicher Häufigkeit vor. In einzelnen Gegenden ist er selten, in anderen sieht man ihn in zahlreichen Flügen. Bolle traf ihn auf Canaria, ich fand ihn in Andalusien und Kastilien in starken Schwärmen; andere Beobachter sahen ihn in Griechenland in Menge. In Deutschland schart er sich zu Herbstes Anfang und zieht dann zuweilen in Gesellschaften im Lande umher, welche mehrere Hunderte zählen. Diese Massen pflegen sich gegen den Winter hin in kleinere Trupps aufzulösen, welche dann wochenlang zusammenleben. Als Brutorte sind Gegenden zu betrachten, in denen der Laubwald vorherrscht oder Obstbau getrieben wird. Waldbewohner im strengeren Sinne ist der Stieglitz nicht; denn lieber noch als in zusammenhängenden Beständen siedelt er sich in Gärten oder Parks, an Straßen, auf Angern oder Wiesen und ähnlichen Orten an, und hier pflegt er auch zu brüten.
Der Stieglitz ist höchst anmuthig, in allen Leibesübungen wohl bewandert, unruhig, gewandt, klug und listig, hält sich zierlich und schlank und macht den Eindruck, als ob er seiner Schönheit sich bewußt wäre. Als wahrer Baumvogel kommt er nur ungern auf den Boden herab und bewegt sich hier auch ziemlich ungeschickt; dagegen klettert er trotz einer Meise, hängt sich, wie die Zeisige, geschickt von unten an die dünnsten Zweige und arbeitet minutenlang in solcher Stellung. Sein Flug ist leicht und schnell, wie bei den meisten Finken wellenförmig, und nur dann schwebend, wenn der Vogel sich niederlassen will. Zum Ruhen bevorzugt er die höchsten Spitzen der Bäume oder Gesträuche, hält sich aber niemals lange an einem und demselben Orte auf, weil sich seine Unruhe immer geltend macht. Dem Menschen gegenüber zeigt er sich stets vorsichtig, scheu aber nur dann, wenn er bereits Nachstellungen erfahren hat. Mit anderen Vögeln lebt er in Frieden, läßt jedoch einen gewissen Muthwillen an ihnen aus. Seine Lockstimme wird am besten durch seinen Namen wiedergegeben; denn dieser ist nichts anderes, als ein Klangbild der Silben »Stiglit« »Pickelnit« und »Pickelnick ki kleia«, welche er im Sitzen wie im Fliegen vernehmen läßt. Ein sanftes »Mai« wird als Warnungsruf gebraucht, ein rauhes »Rärärärä« ist das Zeichen unangenehmer Erregung. Die Jungen rufen »Zif litzi zi« etc. Das Männchen singt, obgleich die einzelnen Töne denen des Bluthänflings an Klang und Fülle nachstehen, laut und angenehm, mit viel Abwechselung und so fröhlich, daß der Liebhaber den Stieglitz namentlich auch seines Gesanges halber hoch in Ehren hält. In der Gefangenschaft singt er fast das ganze Jahr; im Freien schweigt er nur während der Mauser und bei sehr schlechtem Wetter.
Die Nahrung besteht in Gesäme mancherlei Art, vorzüglich aber in solchem der Birken, Erlen und nicht minder der Disteln im weitesten Sinne, und man darf deshalb da, wo Disteln oder Kletten stehen, sicher darauf rechnen, ihn zu bemerken. »Nichts kann reizender sein«, sagt Bolle, »als einen Trupp Stieglitze auf den schon abdorrenden Distelstengeln sich wiegen und aus der weißen Seite ihrer Blütenköpfe die Samen herauspicken zu sehen. Es ist dann, als ob die Pflanzen sich zum zweiten Male und mit noch farbenprächtigeren Blumen, als die ersten es waren, geschmückt hätten.« Der Vogel erscheint auf den Distelbüschen, hängt sich geschickt an einen Kopf an und arbeitet nun eifrig mit dem langen, spitzen Schnabel, um sich der versteckten Samenkörner zu bemächtigen. Im Sommer verzehrt er nebenbei Kerbthiere, und mit ihnen füttert er auch seine Jungen groß. Er nützt also zu jeder Jahreszeit, durch Verminderung des schädlichen Unkrautes nicht minder als durch Wegfangen der Kerbthiere. Strenge Beurtheiler seiner Thaten beschuldigen ihn freilich, durch leichtfertiges Arbeiten an den Samenköpfen der Disteln diese verbreiten zu helfen, vergessen dabei aber, daß der Wind auch ohne Stieglitz der eigentliche Urheber solcher Unkrautverbreitung ist, und thun dem zierlichen Vogel somit entschieden Unrecht.
Das Nest, ein fester, dicht zusammengefilzter Kunstbau, steht in lichten Laubwäldern oder Obstpflanzungen, oft in Gärten und unmittelbar bei den Häusern, gewöhnlich in einer Höhe von sechs bis acht Meter über dem Boden, wird am häufigsten in einer Astgabel des Wipfels angelegt und so gut verborgen, daß es von unten her erst dann gesehen wird, wenn das Laub von den Bäumen fällt. Grüne Baumflechten und Erdmoos, feine Würzelchen, dürre Hälmchcn, Fasern und Federn, welche Stoffe mit Kerbthiergespinsten verbunden werden, bilden die äußere Wandung, Wolllagen aus Distelflocken, welche durch eine dünne Lage von Pferdehaaren und Schweinsborsten in ihrer Lage erhalten werden, die innere Auskleidung. Das Weibchen ist der eigentliche Baumeister, das Männchen ergötzt es dabei durch fleißigen Gesang, bequemt sich aber nur selten, bei dem Baue selbstthätig mitzuwirken. Das Gelege enthält vier bis fünf zart- und dünnschalige Eier, welche durchschnittlich sechzehn Millimeter lang, zwölf Millimeter dick und auf weißem oder blaugrünlichem Grunde sparsam mit violettgrauen Punkten bedeckt, am stumpfen Ende aber kranzartig gezeichnet sind. Selten findet man diese Eier früher als im Mai, und wahrscheinlich nisten die Paare nur einmal im Laufe des Sommers. Das Weibchen brütet allein und zeitigt die Eier binnen dreizehn bis vierzehn Tagen. Die zarten Jungen werden mit kleinen Kerbthierlarven, die größeren mit Kerbthieren und Sämereien gefüttert, die ausgeflogenen noch lange von den Eltern geleitet und geführt. Wie der Hänfling, so füttert auch der Stieglitz seine Kinder groß, wenn sie vor dem Ausfliegen in einen Käfig eingesperrt wurden.
Auch die auf den Norden der Alten Welt beschränkten Hänflinge ( Cannabina) gelten als Vertreter einer besonderen Sippe, ihr echt kegelförmiger, runder, kurzer, scharf zugespitzter Schnabel, die ziemlich langen, schmalen, spitzigen Flügel und der am Ende gabelförmig ausgeschnittene, scharfeckige Schwanz als Kennzeichen derselben.
Unser Blut- oder Rothhänfling, Rubin, Rothkopf, Rothbrüster, Mehl- und Krauthänfling, Hemperling, Hanfvogel oder Hanffink, Hanfer, Artsche ( Cannabina linota, major, minor, pinetorum und arbustorum, Linaria cannabina und linota, Fringilla cannabina, linota und argentatorensis, Linota cannabina, Passer cannabina und papavorina), ist auf der Stirne und in der Augengegend braungelblichweiß, auf dem Scheitel prachtvoll karminroth, auf den hinteren Kopfseiten und dem Halse aschgrau, röthlichgelb gestrichelt, auf Hinterrücken und Schultern zimmetbraun, jede Feder hier dunkler geschäftet und lichter gekantet, auf dem Unterrücken weißbräunlich, auf dem Bürzel schmutzigweiß; Kehle und Gurgel sind bräunlichweiß, durch dunkelgraue Striche und längere Flecke gezeichnet, Brustmitte, Bauch und untere Schwanzdecken weiß, die Brustseiten lebhaft karminroth, die Weichen licht zimmetfarbig, die schwarzen Handschwingen außen und innen schneeweiß, an der Spitze lichtbräunlich, die schwarzbraunen Armschwingen lichter und breiter hellzimmetfarbig gesäumt, die zimmetbraunen Schultern und Oberflügeldecken am Ende rostgelblich gekantet, die Schwanzfedern schwarz, mit Ausnahme der beiden mittelsten lichtbraun gesäumt, auf beiden Seiten hellweiß gekantet, die Oberschwanzdecken schwarz und weiß gesäumt, die Unterschwanzdecken weiß. Der Augenring ist dunkelbraun, der Schnabel bleigrau, an der Wurzel dunkler, der Fuß röthlichgrau. Die Länge beträgt einhundertunddreißig, die Breite zweihundertunddreißig, die Fittiglänge dreiundsiebzig, die Schwanzlänge fünfundfunfzig Millimeter.
Der Bluthänfling bewohnt ganz Europa, Kleinasien und Syrien und erscheint auf dem Zuge in Nordwestafrika, selten aber in Egypten. In Deutschland ist er überall häufig, am gemeinsten vielleicht in hügeligen Gegenden. Hohe Gebirge meidet er, ausgedehnte Waldungen nicht minder.
Im hohen Norden Europas vertritt ihn der Berghänfling, Steinhänfling, Gelbschnabel, Quitter, Greinerlein, Felsfink ( Cannabina flavirostris, montium, media, und microrhynchos, Fringilla flavirostris und montium, Linaria flavirostris und montium, Linota flavirostris und montium, Acanthis montium). Oberkopf, Schultern und Rücken sind braungelb, streifig schwarzbraun gefleckt, Nacken und Halsseiten etwas heller, die Bürzelfedern schmutzig purpurroth, Augenbrauenstreifen und die Gegend unter dem Auge, den bräunlichen Zügel begrenzend, dunkelroth, gelblich überflogen, die Wangen nach hinten bräunlich gefleckt, die Kehlfedern dunkel rostgelb, Kropf- und Brustseiten heller, mit schwarzen Längsflecken gezeichnet, Brustmitte und Bauch gelblichweiß bis weiß, die Schenkel rostgelblich, die Schwingen außen rothbraun, die vier vordersten mit schmalen bräunlichweißen, die folgenden mit breiten schneeweißen Säumen, alle mit breiten weißen Endkanten geziert, die Oberflügeldecken dunkelbraun, rostgelblichbraun gekantet und die größten auch an der Spitze rostgelblichweiß gesäumt, die Steuerfedern braunschwarz, die mittleren mit lichtbraunen, die übrigen außen mit weißen Säumen geschmückt. Der Augenring ist braun, der Schnabel hell wachsgelb, im Frühjahre citrongelb, der Fuß horngrau. Dem Weibchen fehlt das Roth auf dem Bürzel. Die Länge beträgt einhundertunddreißig, die Breite zweihundertfünfundzwanzig, die Fittiglänge dreiundsiebzig, die Schwanzlänge fünfundsechzig Millimeter.
Unter unseren Finken gehört der Hänfling zu den liebenswürdigsten und anmuthigsten, abgesehen von seiner Gesangskunst, welche ihn zu einem der beliebtesten Stubenvögel stempelt. »Der Bluthänfling«, sagt mein Vater, welcher ihn sehr eingehend beschrieben hat, »ein gesellschaftlicher, munterer, flüchtiger und ziemlich scheuer Vogel, ist außer der Brutzeit immer in kleinen und großen Flügen bei einander; selbst während der Brutzeit habe ich mehrere zusammen gesehen. Im Herbste, gewöhnlich schon im August, schlagen sich die Bluthänflinge in große Herden zusammen, so daß ich bis hundert und mehr in einem Zuge beobachtet habe. Im Winter mischen sie sich unter die Grünlinge, auch unter Edel- und Bergfinken, Feldsperlinge und Goldammer. Im Frühjahre sondern sie sich nach der Paarung von einander ab, brüten aber oft in friedlicher Nähe neben einander. Merkwürdig ist, wie sehr dieser Vogel selbst während der Brutzeit hin- und herstreicht. In meinem Garten singt im Frühjahre und Vorsommer fast alle Morgen ein Bluthänfling, welcher eine Viertelstunde weit davon sein Nest hat. So lange das Weibchen nicht über den Eiern oder Jungen sitzt, fliegt es mit dem Männchen umher. Deswegen sieht man sie dann immer beisammen. Wie treu sich beide Gatten lieben, habe ich oft mit Bedauern bemerkt: wenn ich ein Männchen oder Weibchen von einem Paare geschossen hatte, flog das übrig gebliebene, ängstlich lockend, lange in der Nähe herum und wollte sich nicht von dem Orte trennen, ohne den treuen Gatten mitzunehmen. Ebenso zärtlich lieben sie ihre Eier und Jungen; sie lassen sich bei den letzteren sehr leicht fangen. Der Flug ist leicht, ziemlich schnell, in Absätzen und schwebend, besonders wenn der Vogel sich setzen will, oft im Kreise sich herumdrehend. Oft nähert sich der Hänfling im Fluge dem Boden, so daß man glaubt, er wolle sich niederlassen; er erhebt sich aber nicht selten wieder und fliegt eine große Strecke weiter. Auf der Erde hüpft er ziemlich geschickt herum. Wenn er auf Bäumen singt, sitzt er gewöhnlich auf der höchsten Spitze oder auf einem einzeln stehenden Aste; dies thut er auch auf Büschen, besonders auf Fichten- und Tannenbüschen; überhaupt sitzt er gern auf dem Wipfel, auch wenn er nicht singt.«
Lockstimme und Gesang werden von meinem Vater als ganz bekannt vorausgesetzt, und er sagt deshalb ferner nur, daß der Hänfling den Gesang sitzend und fliegend hören lasse, vom März an bis in den August hinein, und daß die Jungen gleich nach ihrer Herbstmauserung und an schönen Wintertagen im November und December eifrig singen. Ich habe also hier einiges hinzuzufügen. Die Lockstimme des Hänflings ist ein kurzes, hartes »Gäck« oder »Gäcker«, welches häufig mehrmals schnell hintereinander ausgestoßen wird. Ihm wird oft ein wohlklingendes »Lü« zugefügt, zumal wenn die Vögel etwas verdächtiges bemerken. Der Gesang, einer der besten, welchen ein Fink überhaupt vorträgt, fängt gewöhnlich mit dem erwähnten »Gäckgäck« an; diesen Lauten werden aber flötende, klangvolle Töne beigemischt und sie wie jene mit viel Abwechselung und Feuer vorgetragen. Jung eingefangene Männchen lernen leicht Gesänge anderer Vögel nachahmen oder Liedchen nachpfeifen, fassen aber leider auch unangenehme Töne auf und werden dann zu unleidlichen Stümpern. Mein Vater erwähnt eines Bluthänflingmännchens, welches den Schlag des Edelfinken täuschend nachahmte, und eines anderen, welches den Zeisiggesang vollständig erlernt hatte; Naumann berichtet von solchen, welche die Lieder der Stieglitze, Lerchen und selbst den Schlag der Nachtigallen vortrugen.
Bereits im April schreitet der Hänfling zum Nestbaue, und während des Sommers nistet er mindestens zwei-, gewöhnlich aber dreimal. Das Nest wird am liebsten in Vor- oder Feldhölzern, aber auch in einzelnen Büschen, meist niedrig über dem Boden, angelegt, besteht äußerlich aus Reiserchen, Würzelchen und Grasstengeln, Heidekraut und dergleichen, welche Stoffe nach innen zu immer feiner gewählt werden und so gleichsam eine zweite Lage bilden, und ist in der Mulde vorzugsweise mit Thier- und Pflanzenwolle, namentlich aber auch Pferdehaar, ausgelegt. Das Gelege enthält vier bis fünf Eier von siebzehn Millimeter Längs- und dreizehn Millimeter Querdurchmesser, welche auf weißbläulichem Grunde mit einzelnen blaßrothen, dunkelrothen und zimmetbraunen Punkten und Strichelchen gezeichnet sind. Sie werden vom Weibchen allein in dreizehn bis vierzehn Tagen ausgebrütet, die Jungen aber, namentlich die der letzten Brut, von beiden Eltern gemeinschaftlich mit vorher im Kropfe erweichten Sämereien aufgefüttert. Während das Weibchen auf dem Neste sitzt, kommt das Männchen oft herbeigeflogen und singt von einem der nächsten Bäume herab sehr eifrig. Im Gegensatze zu den Edelfinken leben die Hänflinge auch wahrend der Brutzeit in Frieden zusammen. Die Männchen mehrerer nahe beieinander brütenden Weibchen machen ihre Ausflüge nicht selten gemeinschaftlich und singen dann auch, ohne sich zu zanken, zusammen neben den Nestern.
Von einem Pärchen, welches unter den Augen meines Vaters brütete, erzählt dieser folgendes: »Ich entdeckte das Nest, als die Jungen kielten, und hatte viele Gelegenheit, das Betragen der Alten und Jungen genau zu beobachten. Die letzteren saßen ruhig im Neste und ließen, so lange sie noch keine Federn hatten, ihre Stimme nur hören, wenn die Alten geflogen kamen oder sie fütterten. Als sie befiedert waren, verhielten sie sich ganz ruhig, selbst wenn sie Nahrung bekamen. Sie wurden ziemlich schnell flügge. Eines Tages, als sie völlig befiedert waren, flatterten sie alle mit den Flügeln und versuchten die Bewegungen mit denselben bis gegen Abend; am Morgen darauf, und zwar mit Tagesanbruch, waren sie alle ausgeflogen. Sie hielten sich nun in der Nähe des Nestes in dicht belaubten Bäumen verborgen und waren bald da, bald dort, bis sie sich mit den Alten entfernten. Diese gewährten mir außerordentliche Freude; sie waren so zahm, daß sie sich im Füttern der Jungen nicht stören ließen, wenn ich in der Laube saß, selbst nicht, wenn mehrere Personen darin sprachen. Sie fütterten ihre Jungen stets in Zwischenräumen von zwölf bis sechzehn Minuten, kamen immer zusammen geflogen, setzten sich auf einen über die Laube emporragenden Apfelbaum, lockten ganz leise und flatterten nun dem Neste zu. Sie näherten sich ihm jedesmal von einer und derselben Seite und gaben jedem Jungen etwas in den Kropf, so daß nie einer derselben verkürzt wurde. Das Männchen fütterte immer zuerst, und wenn dieses fertig war, kam das Weibchen; das erstere wartete, bis jenes den Kropf geleert hatte, und dann flogen beide miteinander fort, wobei sie gewöhnlich ihren Lockton hören ließen. Ein einziges Mal kam das Weibchen allein, und ein einziges Mal fütterte es die Jungen früher als das Männchen. Ehe das Weibchen das Nest verließ, reinigte es dasselbe von dem Unrathe der Jungen, warf aber den Koth derselben nicht herab, sondern verschluckte ihn und spie ihn fern vom Neste wieder aus. Das Männchen unterzog sich dieser Reinigung nicht; ein einziges Mal nur sah ich, daß es den Koth der Jungen aufnahm. Als die Jungen ausgeflogen waren, hielten sich die Alten immer in ihrer Nähe auf und führten sie noch lange Zeit.«
Das Hänflingspaar verläßt seine Eier nur äußerst selten, seine Jungen nie; die Alten füttern diese vielmehr auch dann noch groß, wenn man sie mit dem Neste in einen Käfig sperrt. Dies geschieht häufig, um sich die Mühe des Selbstauffütterns zu ersparen, und meines Wissens ist noch kein Fall vorgekommen, daß die alten Hänflinge sich dadurch hätten abhalten lassen, ihren elterlichen Pflichten Genüge zu leisten. Man kann das Elternpaar nach und nach durch die Jungen aus ihrem eigentlichen Wohngebiete weglocken, indem man den Bauer, in welchem letztere eingesperrt sind, allgemach weiter und weiter von der ursprünglichen Brutstelle entfernt, vielleicht seinem Wohnhause nähert. Doch hat dies Auffütternlassen der Jungen den einen Nachtheil, daß letztere wild und scheu bleiben, während diejenigen, welche man selbst groß zieht, bald ungemein zahm werden.
Der Hänfling ernährt sich fast ausschließlich von Sämereien, wird aber demungeachtet nirgends als erheblich schädlich angesehen, es sei denn, daß man ihm Uebergriffe auf Kohl-, Rüben-, Salatsämereien und andere Nutzpflanzen unseres Gartens, welche er sich allerdings zuweilen zu Schulden kommen läßt, ungebührlich hoch anrechnen wolle. Unkraut liefert ihm wohl die Hauptmasse seiner Mahlzeiten. Er frißt die Samen von Wegebreit, Löwenzahn, die Sämereien aller Kohl-, Mohn-, Hanf- und Rübsenarten und namentlich Grasgesäme,
Mit Recht gilt der Hänfling als einer der beliebtesten Stubenvögel, Er ist anspruchslos wie wenig andere, befreundet sich nach kurzer Gefangenschaft innig mit seinem Gebieter und singt fleißig und eifrig fast das ganze Jahr hindurch. Im Zimmer echter Liebhaber fehlt er selten,
An die Hänflinge erinnern, den Zeisigen ähneln die Leinfinken ( Linaria). Ihr Schnabel ist sehr gestreckt, kreiselförmig, an der dünnen Spitze seitlich zusammengedrückt, der obere Theil etwas über den anderen vorgezogen; die kleinen, runden Nasenlöcher liegen an der Schnabelwurzel und werden von ziemlich langen, dichten Borstenfedern rings umgeben; die Füße sind stark und kurz, ihre äußeren und mittleren Zehen hinten verwachsen und alle mit großen, stark gebogenen, scharf zugespitzten Nägeln bewehrt, die Flügel mittellang, aber spitzig, in ihnen die drei ersten Schwingen die längsten, die mittellangen Schwanzfedern endlich in der Mitte merklich verkürzt, weshalb der Schwanz einen ziemlich tiefen Ausschnitt zeigt. In dem sehr reichen Gefieder herrscht ein mattes Braun vor; Kopf und Oberkopf der Männchen sind jedoch stets mehr oder minder lebhaft roth gefärbt.
Der Leinfink, Flachsfink, Birken-, Berg-, Flachs- und Meerzeisig ( Linaria rubra, vulgaris, alnorum, agrorum, betularum, robusta, canigularis, dubia, assimilis, leuconotos, septentrionalis, flavirostris und pusilla, Aegiothus linarius und fuscescens, Fringilla, Passer, Spinus, Cannabina, Acanthis und Linota linaria), ist die am häufigsten bei uns erscheinende Art der Gruppe. Der Stirnrand und die Borstenfederchen der Nasenlöcher sind dunkel braungrau, Zügel und ein länglichrunder Fleck an Kinn und Oberkehle braunschwarz, Stirn und Scheitel lebhaft dunkel karminroth, die Federn dieser Stellen an der Wurzel grauschwarz, Hinterkopf und die übrigen Obertheile matt rostbraun, dunkelbraun längs gestreift, die Bürzelfedern blaß karminroth, seitlich weißfahl gesäumt und fahlbraun geschäftet, die oberen Schwanzdecken dunkelbraun, seitlich fahlweiß gesäumt, Backen und Ohrgegend rostbraun, dunkler gestrichelt, die vorderen Backen, Kehle, Kropf und Brustseiten karminroth, die Federn der Kehlmitte schmal weißlich gesäumt, die übrigen Untertheile weiß, die Seiten blaß rostbräunlich, mit breiten, verwaschenen, dunklen Längsstreifen, die Schwingen tiefbraun, außen schmal braun, die letzten Armschwingen breiter und heller gesäumt, die Deckfedern der Armschwingen und die der größten Reihe am Ende breit rostweiß gerandet, wodurch zwei helle Flügelbinden entstehen, die Schwanzfedern tiefbraun, außen schmal rostweißlich, innen breit weiß gesäumt. Das Auge ist dunkelbraun, der Oberschnabel hornblau, der Unterschnabel gelb, der Fuß graubraun. Die Weibchen und jungen Vögel zeigen nur schwache Spuren des Karminrothes auf Brust und Bürzel; Kropf und Brust erscheinen daher rostbräunlich und sind durch dunkle Schaftflecke gezeichnet; die rothe Kopfplatte ist kleiner und matter. Die Länge beträgt dreizehn, die Breite zweiundzwanzig, die Fittiglänge sieben, die Schwanzlänge sechs Centimeter.
Das Verbreitungsgebiet umfaßt den kalten Gürtel beider Welten, soweit der Baumwuchs reicht. Von hier aus wandert der Leinfink alljährlich in südlichere Gegenden hinab und erscheint dabei zuweilen in unschätzbarer Menge auch in Deutschland.
In den Alpen ersetzt ihn der Bergleinfink, Rothzeisel oder Rothleinfink ( Linaria rufescens und minor, Acanthis, Aegiothus, Linacanthis und Linota rufescens, Bild S. 299). Bei ihm sind Hinterkopf, Halsseiten, Rücken, Bürzel und Seiten auf gelblich rostbraunem Grunde mit dunkelbraunen Längsflecken geziert, Zügel und Kehlfleck schwarzbraun, Stirne und Vorderscheitel dunkel karminroth, Gurgel, Oberbrust und Bürzel blaß rosenroth, infolge der weißen Ränder der Federn schwach graulich gesperbert, die übrigen Untertheile weißlich, mit Rosenroth überhaucht, die unteren Schwanzdecken schwärzlich in die Länge gefleckt, die Flügel und Schwanzfedern schwärzlichbraun, außen schmal schmutzigweiß gesäumt, die letzten Armschwingen, Schulterfedern und die großen Flügeldeckfedern breit lehmfarbig umrandet, wodurch zwei deutliche Flügelbinden entstehen. Das Auge ist dunkelbraun, der Schnabel gelblich, an der Spitze und an den Kanten dunkel, der Fuß schwarz. Die Länge beträgt einhundertundfunfzehn, höchstens einhundertundzwanzig Millimeter.
Das Brutgebiet dieser Art, über deren ständiges Auftreten in den Alpen wir erst durch Tschusi Kunde erhalten haben, umfaßt einerseits Schottland, andererseits die östlichen, insbesondere die Salzburger Alpen, woselbst er, beispielsweise bei Tamsweg im Lungau, nicht selten brütet.
Der Langschnabelleinfink ( Linaria Holboelli, Acanthis und Aegiothus Holboelli) gleicht in Färbung und Größe dem Leinfinken, unterscheidet sich aber durch den ansehnlich größeren, namentlich bedeutend längeren und gestreckteren, lebhaft orangegelben, auf dem Firstenrücken schwarzen Schnabel, welcher von den Federchen der Nasenlöcher höchstens zu einem Drittel bedeckt wird.
Das Vaterland dieser Art, welche von einzelnen Vogelkundigen kaum als Abart betrachtet wird, ist Grönland, von wo aus der Vogel zuweilen in namhafter Anzahl nach Europa wandert.
Der Grauleinfink ( Linaria borealis und canescens, Fringilla borealis, Aegiothus canescens und exilipes, Linota canescens und Hornemanni, Acanthis borealis und canescens) endlich steht dem Hänfling an Größe nicht nach, ist im allgemeinen dem Leinfinken ähnlich gefärbt, aber stets merklich heller, weil die rostbräunlichen Federsäume letzterer Art bei ihm mehr ins Blaßweiße ziehen. Der Bürzel wie die Untertheile sind fast einfarbig weiß, letztere an den Seiten nur mit sehr wenigen feinen, dunklen Schaftstrichen gezeichnet, Kehle, Kropf und Brust des Männchens im Winter und Frühlinge schwach karminrosaroth verwaschen. Die Federchen der Nasenlöcher bedecken mehr als die Wurzelhälfte des Schnabels; letzterer erscheint daher auffallend kurz und höher als lang. Das Auge ist dunkelbraun, der Oberschnabel hornschwarz, der Unterschnabel im Winter gelb, der Fuß dunkelbräunlich.
Das Brutgebiet des Grauleinfinken reicht von der Petschora an durch Nordasien und Amerika hindurch bis Grönland; aber auch er erscheint in strengen Wintern zuweilen, immer jedoch nur selten, in mehr oder minder zahlreichen Flügen bei uns in Deutschland.
Erst wenn man die ungeheueren Birkenwaldungen des hohen Nordens durchwandert oder mindestens gesehen hat, begreift man, warum der Leinfink, auf dessen Lebensschilderung ich mich beschränken darf, nicht in jedem Winter in derselben Häufigkeit bei uns erscheint. Nur wenn im Norden der Birkensamen nicht gerathen ist, und er Mangel an Nahrung erleidet, sieht er sich genöthigt, nach südlicheren Gegenden hinabzustreifen. So zahlreich auch die Massen sein mögen, welche zuweilen bei uns vorkommen: ungleich größere Mengen verweilen jahraus jahrein in ihrer Heimat; denn die Ansprüche, welche der Birkenzeisig an das Leben stellt, werden ihm im Norden viel besser als bei uns gewährt. Hunderte und tausende von Geviertkilometern sind Birkenwaldungen, und es muß schon ein besonders ungünstiger Sommer gewesen sein, wenn diese Waldungen ihren Kindern nicht hinlängliche Nahrung mehr bieten.
Der Birkenzeisig ist in demselben Grade an jene Waldungen gebunden wie der Kreuzschnabel an den Nadelwald. Er findet in ihm zur Winterszeit Sämereien und in den Sommermonaten, während er brütet, Kerbthiere, namentlich Mücken, in größter Menge. Ich begegnete ihm in Nordwestsibirien selten, in Skandinavien, nördlich von Tromsö, dagegen recht häufig, und zwar in kleinen Familien mit seinen vielleicht vor wenigen Tagen erst dem Neste entschlüpften Jungen, welche er eifrig mit Kerbthieren fütterte. Aber es war nicht leicht, ihn zu beobachten, und es wurde mir unmöglich, die von meinem Vater sehnlichst gewünschten Nestjungen zu erbeuten; denn die Wälder waren dermaßen mit Mücken erfüllt, daß eine Jagd auf die harmlosen Vögel Beschwerden und Qualen im Gefolge hatte, von denen man bei uns zu Lande keine Ahnung gewinnen kann. Gerade da, wo ich die Birkenzeisige fand, war jeder Baum und jeder Busch von Mückenwolken umhüllt, und der Mensch, welcher sich in diese Wolken wagte, wurde augenblicklich von Hunderttausenden dieser Quälgeister angefallen und so gepeinigt, daß er alle Jagdversuche sobald als nur möglich wieder aufgab. So viel aber wurde mir klar, daß unser Vogel hier während des Sommers seine Nahrung mit spielender Leichtigkeit sich erwirbt, und daß es sonderbar kommen muß, wenn er auch im Winter nicht genug zu leben haben sollte. Mücken im Sommer für alt und jung, Birkensamen im Winter: mehr braucht unser Fink zum Leben nicht.
Die eben geschilderten Umstände erklären, daß wir über das Sommerleben noch äußerst dürftig unterrichtet sind. Bald nach seiner Ankunft am Brutorte vereinzelt sich der sonst so gesellige Vogel mehr oder weniger, um zum Nisten zu schreiten. Im mittleren Skandinavien wählt er hoch gelegene Waldungen der Gebirge zur Brutstätte, im Norden siedelt er sich ebensowohl in der Höhe wie der Tiefe an, vorausgesetzt, daß die Birke den vorherrschenden Bestand bildet. Das Nest steht meist niedrig über dem Boden auf einer der hier buschartigen Birken, kommt in der Bauart dem unseres Hänflings am nächsten, ist napfförmig und besteht aus feinen Zweiglein, welche den Unterbau, Halmen, Moos, Flechten und Haaren, welche die Wandung, sowie endlich aus Federn, welche die innere Auskleidung bilden. Die drei bis fünf, höchstens sechs, etwa siebzehn Millimeter langen, vierzehn Millimeter dicken Eier, welche man kaum vor der Mitte des Juni findet, sind auf lichtgrünem Grunde düster roth und hellbraun gefleckt und gepunktet. Das Männchen singt, laut Collett, während der Brutzeit sehr eifrig und zwar meist im Fliegen, brütet wahrscheinlich abwechselnd mit dem Weibchen und trägt gemeinsam mit diesem den Jungen als alleinige Atzung allerlei Kerbthiere zu. Erwähnenswerth dürfte noch sein, daß der Vogel auch während der Brutzeit die ihm eigene Unstetigkeit insofern bethätigt, als er in manchen Jahren an einzelnen Brutorten ungemein zahlreich und dann meist auch gesellig, an anderen wiederum nur spärlich und einzeln auftritt.
Inwiefern sich das Fortpflanzungsgeschäft der übrigen Arten von der vorstehend geschilderten unterscheidet, bleibt späteren Beobachtern zu erforschen übrig. Lübbert, welcher im Glatzer und Riesengebirge Leinfinken noch während des Sommers sah und von einem Pärchen Eier erhalten zu haben glaubte, kann nur den Bergleinfink meinen. Ihn dürfen wir wohl auch unter die deutschen Brutvögel zählen, seitdem wir erfuhren, daß Jocher Nester von ihm in den Salzburger Alpen fand.
Im ebenen und hügeligen Deutschland erscheint der Leinfink zu Anfang des November als Wintergast, manchmal in sehr großer Menge und nicht immer in solchen Jahren, welche auch bei uns mit einem strengen Winter beginnen. Er vereinigt sich gewöhnlich mit dem Zeisige und streift mit diesem dann, den Gebirgen nachgehend, im Lande hin und her, nachts hohe, dicke Dornhecken zur Herberge erwählend. Wagner versichert, gesehen zu haben, daß aus einem seiner Flüge gegen Abend viele kopfunterst sich in den Schnee stürzten, um hier zu übernachten, will bei dieser Gelegenheit auch mehrere von ihnen aus dieser ihrer Nachtherberge hervorgezogen haben. Während seines Aufenthaltes in der Fremde ernährt sich der Leinfink zwar vorzugsweise von Birken- und Erlengesämen, sonst aber von fast allen übrigen kleinen ölhaltigen Sämereien, welche er auch in den Stoppelfeldern zusammenliest. Zumal in den ersten Wochen seines Aufenthaltes bei uns zeigt er sich als ein Geschöpf, welches die Tücke des Menschen noch nicht kennen gelernt hat, erscheint ohne Scheu in den Dörfern und sucht sich in unmittelbarer Nähe des Menschen sein Futter, läßt sich auch durch das Getreibe seines Erzfeindes nicht im geringsten stören. Erst wiederholte Verfolgung macht ihn vorsichtig; eigentlich scheu aber wird er nie.
Der Erlenzeisig ist ein ebenso harmloser als unruhiger, gewandter, munterer Gesell. Im Klettern geschickter als seine sämmtlichen Verwandten, wetteifert er nicht bloß mit dem Kreuzschnabel, sondern auch mit dem beweglichen Volke der Meisen. Birken, deren fadenähnliche Zweige von einer Schar der niedlichen Vögel bedeckt sind, gewähren einen prächtigen Anblick. Hier hängt und klettert die ganze Gesellschaft in den verschiedensten Stellungen auf und nieder und klaubt sich aus den Samenzäpfchen eifrig Nahrung aus. Auch auf dem Boden hüpft er geschickt umher. Sein Flug ist schnell, wellenförmig, vor dem Aufsitzen schwebend. Bei dem Ueberfliegen baumloser Strecken streicht der Schwarm gern in ziemlich bedeutender Höhe dahin, wogegen er sich in baumreichen Gegenden selten mehr als nöthig erhebt. Die Lockstimme ist ein wiederholt ausgestoßenes »Tschettschek«, welches namentlich beim Auffliegen aus aller Kehlen ertönt; ihr wird häufig ein zärtliches »Main« angehängt. Der Gesang besteht wesentlich aus diesen beiden Lauten, welche durch ein ungeordnetes Gezwitscher verbunden und durch einen trillernden Schluß beendet werden.
Wirklich liebenswürdig zeigt sich der Birkenzeisig gegen andere seiner Art und Verwandte. Eine Schar, welche sich einmal zusammenfand, trennt sich nicht mehr und ruft den einzelnen, welcher nur wenig sich entfernte, ängstlich herbei. Er bekundet aber auch Anhänglichkeit an die Zeisige und mischt sich, in Ermangelung dieser passenden Genossen, unter Hänflinge und Feldsperlinge. Mit allen diesen Vögeln lebt er in tiefstem Frieden; Zank und Streit kennt er überhaupt nicht.
Im Käfige geht das niedliche Vögelchen ohne alle Umstände ans Futter, wird auch in kürzester Zeit ungemein zahm, begnügt sich mit einfacher Nahrung, erfreut durch seine Beweglichkeit und die Kletterkünste, schließt sich anderen kleinen Vögeln bald innig an und liebkost sie auf die verschiedenste Weise. Seine Geselligkeit wird ihm dem Vogelsteller gegenüber regelmäßig zum Verderben; denn hat man erst einen gefangen, so kann man sich anderer, welche jener herbeilockt, leicht bemächtigen. Den ersten pflegt man in Thüringen zu »titschen« oder, wie man in Anhalt sagt, zu »kikeln«, das heißt mit einer Leimruthe zu fangen, welche man an einer langen, biegsamen Stange oder Gerte befestigt hat und dem Vogel, während er frißt, auf das Gefieder schnellt. Auf dem Finkenherde fängt man Birkenzeisige in Menge, nicht selten auch diejenigen noch, welche beim Zuschlagen der Netze glücklich entrannen, aus Liebe zu ihren gefangenen Gefährten aber nochmals herbeikommen und in den Netzen sich verwickeln. In manchen Gegenden werden sie leider noch immer für die Küche gefangen.
Die Sperlinge ( Passer) sind kräftig gebaute, kurzleibige Finken mit mittellangem, starkem, etwas kolbigem Schnabel, stämmigen, durch kurze, schwache Nägel bewehrten Füßen, stumpfen Flügeln, unter deren Schwingen die zweite bis vierte die Spitze bilden, kurzem oder höchstens mittellangem, am Ende kaum eingekerbtem Schwanze und reichem Gefieder.
Die uns bekannteste Art der Sippe ist der Haussperling, Hof-, Rauch-, Faul- und Kornsperling, Sparling, Sperk, Sparr, Sperr, Spatz, Dieb, Lüning, Leps, Haus- und Mistfink etc. ( Passer domesticus, indicus und tingitanus, Fringilla domestica, Pyrgita domestica, pagorum, rustica, valida, minor, brachyrhynchos, intercedens, cahirina, pectoralis, castanea, castanotus und melanorhyncha). Vorderkopf und Scheitelmitte sind bräunlichgrau, die Federn mit verwaschenen, rothbraunen Spitzensäumen, ein breiter, vom Auge über die Schläfen- und Halsseiten bis in den Nacken ziehender Streifen und letzterer selbst kastanienbraun, Mantel und Schultern heller, mit breiten schwarzen Längsstrichen, die Mantelfedern mit zimmetrothen Außensäumen, die bräunlichgrauen Bürzel- und Schwanzdeckfedern mit röthlichen Spitzen geziert, ein kleiner Fleck am hinteren Augenrande, Backen, Ohrgegend und obere Halsseiten weiß, Zügel, Augenrand und Mundwinkelgegend sowie ein großer schildförmiger, Kinn, Kehle und Kopfgegend deckender Fleck schwarz, die übrigen Untertheile weiß, seitlich aschgraulich, die Schwingen schwarzbraun, außen rostbraun gesäumt, innen verwaschen heller gerandet, die Armschwingendeckfedern braunschwarz, mit breiten, zimmetbraunen Außensäumen, die oberen Flügeldecken kastanienbraun, die der größten Reihe an der Wurzel schwarz, am Ende weiß, wodurch eine Flügelquerbinde entsteht, die Schwanzfedern endlich dunkelbraun. Das Auge ist braun, der Schnabel schwarz, im Winter hellgrau und an der Spitze dunkel, der Fuß gelbbräunlich. Beim Weibchen sind die Obertheile rostfahlbraun, auf dem Mantel schwarz in die Länge gestrichelt, ein vom Augenrande über die Schläfen herabziehender Streifen rostgelblichweiß, Backen, Halsseiten und die Untertheile graubräunlich, Kinn, Brust, Bauchmitte und Aftergegend heller, mehr schmutzigweiß, die unteren Schwanzdecken rostfahlbräunlich; die Schwingendeckfedern zeigen rostfahlbraune Außenränder und diejenigen, welche die Flügelbinde bilden, schmutzigweiße Spitzen. Der Schnabel ist hornbräunlich. Junge Vögel ähneln den Weibchen. Die Länge beträgt einhundertundsechzig, die Breite zweihundertundfunfzig, die Fittiglänge fünfundsiebzig, die Schwanzlänge siebenunddreißig Millimeter.
Der Heimatskreis des Haussperlings erstreckt sich über fast ganz Europa und den größten Theil Asiens, nach Norden hinauf, soweit Ansiedelungen reichen, nach Süden hin bis Nordafrika, Palästina, Kleinasien, Indien und Ceylon. Außerdem ist er eingebürgert worden in Australien und Nordamerika, auf Java und Neuseeland.
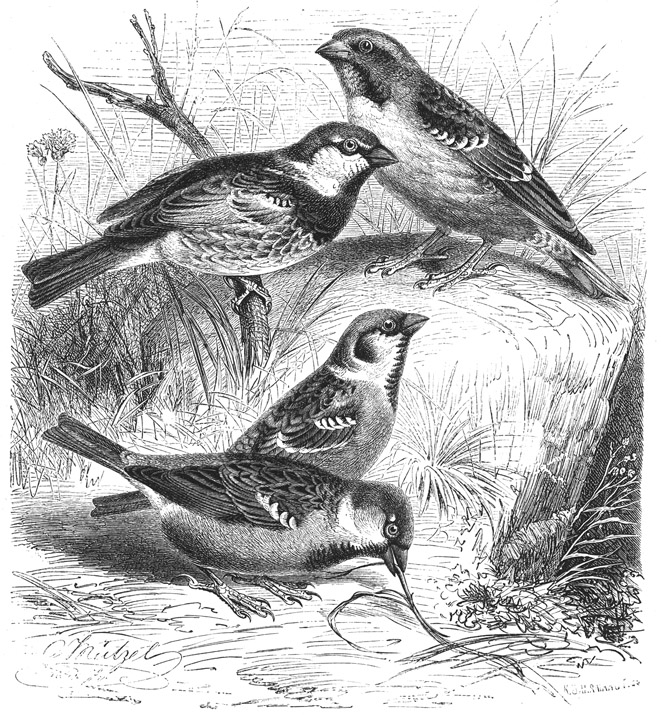
Halsband-, Stein-, Haus- und Feldsperling ( Passer hispaniolensis, Petronia stutta, Passer domesticus und montanus). ½ natürl. Größe.
In Südosteuropa, Kleinasien, Palästina, Syrien und den Ländern am Rothen Meere vertritt ihn der Rothkopfsperling ( Passer italiae und cisalpinus, Fringilla italiae und cisalpina, Pyrgita italica und cisalpina), in Größe und allgemeiner Färbung ihm gleich, durch den einfarbig rothen Oberkopf und Nacken, den schwarzen, mit breiteren, graulichen Endsäumen gezierten Kropfschild, einen schmalen weißen Strich über dem Zügel und die graulichbraunen Bürzel- und Oberschwanzdeckfedern unterschieden.
Bezeichnend für den Sperling ist, daß er überall, wo er vorkommt, in innigster Gemeinschaft mit dem Menschen lebt. Er bewohnt die volksbewegte Hauptstadt wie das einsame Dorf, vorausgesetzt, daß es von Getreidefeldern umgeben ist, fehlt nur einzelnen Walddörfern, folgt dem vordringenden Ansiedler durch alle Länder Asiens, welche er früher nicht bevölkerte, siedelt sich, von Schiffen ausfliegend, auf Inseln an, woselbst er früher unbekannt war, und verbleibt den Trümmern zerstörter Ortschaften als lebender Zeuge vergangener glücklicherer Tage. Standvogel im vollsten Sinne des Wortes, entfernt er sich kaum über das Weichbild der Stadt oder die Flurgrenze der Ortschaft, in welcher er geboren wurde, besiedelt aber ein neu gegründetes Dorf oder Haus sofort und unternimmt zuweilen Versuchsreisen nach Gegenden, welche außerhalb seines Verbreitungsgebietes liegen. So erscheinen am Varanger-Fjord fast alljährlich Sperlingspaare, durchstreifen die Gegend, besuchen alle Wohnungen, verschwinden aber spurlos wieder, weil sie das Land nicht wirtlich finden. Aeußerst gesellig, trennt er sich bloß während der Brutzeit in Paare, ohne jedoch deshalb aus dem Gemeinverbande zu scheiden. Oft brütet ein Paar dicht neben dem anderen, und die Männchen suchen, so eifersüchtig sie sonst sind, auch wenn ihr Weibchen brütend auf den Eiern sitzt, immer die Gesellschaft von ihresgleichen auf. Die Jungen schlagen sich sofort nach ihrem Ausfliegen mit anderen in Trupps zusammen, welche bald zu Flügen anwachsen. Sobald die Alten ihr Brutgeschäft hinter sich haben, finden auch sie sich wieder bei diesen Flügen ein und theilen nunmehr mit ihnen Freud und Leid. So lange es Getreide auf den Feldern gibt oder überhaupt, so lange es draußen grün ist, fliegen die Schwärme vom Dorfe aus alltäglich mehrmals nach der Flur hinaus, um dort sich Futter zu suchen, kehren aber nach jedem Ausfluge wieder ins Dorf zurück. Hier halten sie ihre Mittagsruhe in dichten Baumkronen oder noch lieber in den Hecken, und hier versammeln sie sich abends unter großem Geschreie, Gelärme und Gezänke, entweder auf dicht belaubten Bäumen oder später in Scheunen, Schuppen und anderen Gebäuden, welche Orte ihnen zur Nachtherberge werden müssen. Im Winter bereiten sie sich förmliche Betten, weich und warm ausgefütterte Nester nämlich, in denen sie sich verkriechen, um gegen die Kälte sich zu schützen. Zu gleichem Zwecke wählen sich andere Schornsteine zur Nachtherberge, ganz unbekümmert darum, daß der Rauch ihr Gefieder berußt und schwärzt.
So plump der Sperling auf den ersten Blick erscheinen mag, so wohl begabt ist er. Er hüpft schwerfällig, immerhin jedoch noch schnell genug, fliegt mit Anstrengung, unter schwirrender Bewegung seiner Flügel, durch weite Strecken in flachen Bogenlinien, sonst geradeaus, beim Niedersitzen etwas schwebend, steigt, so sehr er erhabene Wohnsitze liebt, ungern hoch, weiß sich aber trotz seiner anscheinenden Ungeschicklichkeit vortrefflich zu helfen. Geistig wohl veranlagt, hat er sich nach und nach eine Kenntnis des Menschen und seiner Gewohnheiten erworben, welche erstaunlich, für jeden schärferen Beobachter erheiternd ist. Ueberall und unter allen Umständen richtet er sein Thun auf das genaueste nach dem Wesen seines Brodherrn, ist daher in der Stadt ein ganz anderer als auf dem Dorfe, wo er geschont wird, zutraulich und selbst zudringlich, wo er Verfolgungen erleiden mußte überaus vorsichtig und scheu, verschlagen immer. Seinem scharfen Blicke entgeht nichts, was ihm nützen, nichts, was ihm schaden könnte; sein Erfahrungsschatz bereichert sich von Jahr zu Jahr und läßt zwischen Alten und Jungen seiner Art Unterschiede erkennen, wie zwischen Weisen und Thoren. Ebenso, wie mit dem Menschen, tritt er auch mit anderen Geschöpfen in ein mehr oder minder freundliches Verhältnis, vertraut oder mißtraut dem Hunde, drängt sich dem Pferde auf, warnt seinesgleichen und andere Vögel vor der Katze, stiehlt dem Huhne, unbekümmert um die ihm drohenden Hiebe, das Korn vor dem Schnabel weg, frißt, falls er es thun darf, mit den verschiedenartigsten Thieren aus einer und derselben Schüssel. Ungeachtet seiner Geselligkeit liegt er doch beständig mit anderen gleichstrebenden im Streite, und wenn die Liebe, welche bei ihm zur heftigsten Brunst sich steigert, sein Wesen beherrscht, kämpft er mit Nebenbuhlern so ingrimmig, daß man glaubt, ein Streit auf Leben und Tod solle ausgefochten werden, obschon höchstens einige Federn zum Opfer fallen. Nur in einer Beziehung vermag der uns anziehende Vogel nicht zu fesseln. Er ist ein unerträglicher Schwätzer und ein erbärmlicher Sänger. »Schill, schelm, piep«, seine Locktöne, vernimmt man bis zum Ueberdrusse, und wenn eine zahlreiche Gesellschaft sich vereinigt hat, wird ihr gemeinschaftliches »Tell, tell, silb, dell, dieb, schilk« geradezu unerträglich. Nun läßt zwar der Spatz noch ein sanftes »Dürr« und »Die« vernehmen, um seinem Weibchen Gefühle der Zärtlichkeit auszudrücken; sein Gesang aber, in welchem diese Laute neben den vorher erwähnten den Haupttheil bilden, kann trotzdem unsere Zustimmung nicht gewinnen, und der heftig schnarrende Warnungsruf: »Terr« oder der Angstschrei bei plötzlicher Noth: »Tell, terer, tell, tell, tell« ist geradezu ohrenbeleidigend. Trotzdem schreit, lärmt und singt der Sperling, als ob er mit der Stimme einer Nachtigall begabt wäre, und schon im Neste schilpen die Jungen.
Da der Spatz durch sein Verhältnis zum Menschen sein ursprüngliches Loos wesentlich verbessert und seinen Unterhalt gesichert hat, beginnt er bereits frühzeitig im Jahre mit dem Nestbaue und brütet im Laufe des Sommers mindestens drei-, wenn nicht viermal. Aeußerst brünstig, oder, wie der alte Geßner sagt, »über die Maßen vnkeusch«, bekundet das Männchen sein Verlangen durch eifriges Schilpen, und gibt das Weibchen seine Willfährigkeit durch allerlei Stellungen, Zittern mit den Flügeln und ein überaus zärtliches »Die, die, die« zu erkennen. Hierauf folgt die Begattung oder wenigstens ein Versuch, sich zu begatten, darauf nach kurzer Zeit neue Liebeswerbung und neue Gewährung. Das Nest wird nach des Ortes Gelegenheit, meist in passenden Höhlungen der Gebäude, ebenso aber in Baumlöchern, Schwalbennestern, im Unterbaue der Storchhorste und endlich mehr oder minder frei im Gezweige niederer Gebüsche oder hoher Bäume angelegt, je nach diesen Standorten verschieden, immer aber liederlich gebaut, so daß es nur als unordentlich zusammengetragener Haufen von Stroh, Heu, Werch, Borsten, Wolle, Haaren, Papierschnitzeln und dergleichen bezeichnet werden darf, innerlich dagegen stets dick und dicht mit Federn ausgefüttert. Wenn es frei auf Bäumen steht, ist es oben überdeckt, wenn es in Höhlen angelegt wurde, bald geschlossen, bald unbedacht. Bei einigermaßen günstiger Witterung findet man bereits im März das vollzählige Gelege, welches aus fünf bis sechs, ausnahmsweise wohl auch sieben bis acht, dreiundzwanzig Millimeter langen und sechzehn Millimeter dicken, zarten, glattschaligen, in Färbung und Zeichnung sehr abweichenden, meist auf bräunlichbläulich oder röthlichweißem Grunde braun und aschgrau gefleckten, bespritzten und bepunkteten Eiern besteht. Beide Eltern brüten wechselweise, zeitigen die Brut in dreizehn bis vierzehn Tagen, füttern sie zuerst mit zarten Kerbthieren, später mit solchen und vorher im Kropfe aufgequellten Körnern, endlich hauptsächlich mit Getreide und anderen Sämereien, auch wohl mit Früchten groß, führen sie nach den Ausflügen noch einige Tage, um sie für das Leben vorzubereiten, verlassen sie sodann und treffen bereits acht Tage, nachdem jene dem Neste entflogen, zur zweiten Brut Anstalt. Wird einer der Gatten getödtet, so strengt sich der andere um so mehr an, um die hungrige Schar zu ernähren; vermag ein Junges das Nest nicht zu verlassen, so füttern es die Eltern, so lange es seiner Freiheit entbehrt.
Ueber Nutzen und Schaden des Sperlings herrschen sehr verschiedene Ansichten; doch einigt man sich neuerdings mehr und mehr zu der Meinung, daß der auf Kosten des Menschen lebende Schmarotzer dessen Schutz nicht verdient. In den Straßen der Städte und Dörfer verursacht er allerdings keinen Schaden, weil er sich hier wesentlich vom Abfalle ernährt; auf großen Gütern, Kornspeichern, Getreidefeldern und in Gärten dagegen kann er empfindlich schädlich werden, indem er dem Hausgeflügel die Körnernahrung wegfrißt, das gelagerte Getreide brandschatzt und beschmutzt, in den Gärten endlich die Knospen der Obstbäume abbeißt und später auch die Früchte verzehrt. In Gärten und Weinbergen ist er daher nicht zu dulden. Der wesentlichste Schaden, welchen er verursacht, besteht übrigens, wie Eugen von Homeyer richtig hervorhebt, darin, daß er die allernützlichsten Vögel, namentlich Staare und Meisen, verdrängt und den Sängern den Aufenthalt in solchen Gärten, welche er beherrscht, mehr oder weniger verleidet. Ob man wirklich den Schaden jedes durchwinterten Sperlingspaares und seiner Jungen zu zwei bis drei Mark veranschlagen darf, wie Eugen von Homeyer gethan, bleibe dahingestellt; nach den Untersuchungen dieses trefflichen Forschers aber muß man sich wohl oder übel zu der Ansicht bekehren, daß der Sperling der für ihn früher auch von mir erbetenen Nachsicht und Duldung nicht würdig ist.
Zum Käfigvogel eignet sich der Sperling nicht, obwohl er sehr zahm werden kann. Die Dienerin eines meiner Kärntner Freunde zeigte mir mit Stolz ihren Schützling und Liebling, einen Spatz, welcher nicht nur frei umher und aus- und einfliegen, sondern sich auch gestatten durfte, unter ihrem Busentuche zu ruhen und zu schlafen.
Von einzelnen wird der Halsbandsperling, Weiden- oder Sumpfsperling ( Passer hispaniolensis, salicarius und salicicola, Fringilla hispaniolensis, Pyrgita hispaniolensis, hispanica, salicaria, arcuata, aegyptiaca und orientalis, Bild S. 315), als ständige Abart unseres Haussperlings betrachtet; er aber unterscheidet sich nicht allein durch die Färbung, sondern auch durch die Lebensweise so erheblich, daß an seiner Artselbständigkeit nicht gezweifelt werden darf. Seine Länge beträgt einhundertundsechzig, die Breite zweihundertundfunfzig, die Fittiglänge fünfundsiebzig, die Schwanzlänge sechzig Millimeter. Die Oberseite des Kopfes, Schläfe und Nacken sind kastanienrothbraun, die Zügel und eine schmale Linie unter den Augen, Mantel und Schultern schwarz, letztere mit breiten, aber meist verdeckten rostgilblichen Außenrändern der Federn gezeichnet, die Bürzelfedern schwarz, fahl umrandet, eine schmale Linie vom Nasenloche bis zur Augenbraue, Backen, Ohrgegend und obere Halsseiten weiß, Kinn, Kehle und Kropf bis auf die unteren Halsseiten schwarz, die Federn hier durch schmale grauliche Endsäume geziert, »einem aufgelösten, in schwarze Perlen zerfließenden Halsbande vergleichbar«, die übrigen Untertheile und die unteren Flügeldecken gelblich fahlweiß, seitlich mit breiten schwarzen Schaftstrichen gezeichnet, die Schwingen dunkelbraun, außen schmal, die Armschwingen breiter rostfahlbraun gesäumt, die Oberflügeldecken lebhaft rothbraun, die größten an der Wurzel schwarz, übrigens weiß, wodurch eine leuchtende Querbinde entsteht, die Schwanzfedern dunkelbraun, außen schmal fahl gesäumt. Der Augenring ist erdbraun, der Schnabel hornschwarz, im Winter licht hornfarben, der Fuß bräunlich. Das Weibchen ähnelt dem des Haussperlings, ist aber bedeutend heller, unterseits gilblichweiß, zeigt auf der Kehle einen verwaschenen, schwärzlichgrauen Fleck und auf Brust und Seiten undeutliche, schmale dunkle Längsstriche.
Der Halsbandsperling findet sich, so viel bis jetzt bekannt, in Spanien, Griechenland, im Norden Afrikas und auf den nordwestlichen Inseln des Erdtheils sowie auch in gewissen Theilen Asiens, jedoch vorzugsweise, in Spanien und Egypten nur in Gegenden, welche reich an Wasser sind. Er ist kein Haussperling, sondern ein echter Feldsperling, welcher bloß zufällig in der Nähe menschlicher Wohnungen vorkommt. Diese meidet er zwar nicht, sucht sie aber niemals auf, wie der Haussperling es immer zu thun pflegt. Gerade in Spanien und Egypten, wo der zuletzt genannte Vogel ebenso häufig vorkommt wie bei uns zu Lande, hat man Gelegenheit, das durchaus verschiedene Betragen beider Arten vergleichend zu beobachten. Der Hausspatz ist auch dort treuer Genosse des Menschen; der Sumpfsperling bekümmert sich nicht um ihn und sein Treiben. Flußthäler, Kanäle und sumpfige Feldstrecken, wie der Reisbau sie verlangt, sagen ihm besonders zu, und hier tritt er in außerordentlich starken Banden auf. In Spanien fand ich ihn im Thale des Tajo sehr zahlreich, aber immer nur in unmittelbarer Nähe des Flusses; in Egypten sah ich ihn im Delta und in der Niederung bei Fajum häufiger als irgend einen anderen Vogel. Dasselbe beobachteten Savi, Bolle, Hansmann, Graf von der Mühle und Alexander von Homeyer in Sardinien, auf den Kanaren, in Griechenland und in den Atlasländern. Doch wissen wir, daß der Halsbandsperling durch die Dattelpalme sich bewegen läßt, der wasserreichen Niederung untreu und förmlich zum Hausvogel zu werden. »Palmenkronen«, sagt Bolle, »allen übrigen als Wohn- und Niststätte vorziehend, haben eben diese Bäume, welche der Landmann um seine Wohnung zu pflanzen liebt, ihn zuerst mit der Nachbarschaft des Herrn der Schöpfung vertraut gemacht.« Für Egypten kann ich diese Angabe durchaus bestätigen. Dort findet sich der Sumpfsperling allerdings ebenfalls auf den Palmen in und um die Dörfer, während er diejenigen Ortschaften, welche keine Palmen haben, entschieden meidet. Aber ich muß hierbei bemerken, daß für Egypten Palmen allein dem Sumpfsperling nicht zu genügen scheinen; denn in Oberegypten und Nubien, wo die Dattelpalme ausgedehnte Wälder bildet, fehlt der Vogel gänzlich. »Auf den Kanarischen Inseln«, fährt Bolle fort, »hebt kaum irgendwo eine Palme ihr Haupt zum Himmel empor, ohne daß einige Sperlingspaare sich in den Zwischenräumen der unteren Blattstiele angebaut hätten, und man nicht von weitem schon ihr lärmendes Geschrei vernähme. Wo Palmenhaine sind, wohnen diese Vögel scharenweise in unglaublicher Menge. Da es schwer hält und ziemlich viel Geduld und Geschicklichkeit erfordert, die hohen, mastengleich aufstrebenden Stämme zu besteigen, so bringen sie ihre Bruten meist in Sicherheit auf: daher ihre bedeutende Vermehrung. Die nistenden Paare sehen furchtlos den Thurmfalken sich dicht neben ihnen auf den Blattstielen der Wedel niederlassen; ihr Zirpen und Zwitschern mischt sich in das schrille Rasseln des Windes, der die lederartigen, steifen Wedel an einander schlägt. Hin und wieder an von feuchteren Luftströmungen getroffenen Stellen, nicht selten z. B. in der Vega von Canaria, pflanzt die Natur um ihre Brutstätten einen schwebenden Garten, reizender und eigenthümlicher, als ihn Semiramis je besessen. Die Winde füllen nämlich einzelne Stellen zwischen den Wedeln allmählich mit Staub und Erde an, der Regen sickert hindurch, und bald blüht und grünt es dort oben, in schwindelnder Höhe, von rosenrothen Cinerarien, fein zerschlitzten Farnen mit goldbraunem Rhizome, baumartigen Semperviven und anderem mehr. Diese Fälle sind jedoch nicht häufig und wiederholen sich nur an besonders günstig gelegenen Oertlichkeiten. Bei weitem die Mehrzahl behilft sich auf einfachere Weise: ja, ich habe sie in zwei Fällen sich dazu entschließen sehen, ihrem Lieblingsbaume untreu zu werden, und zwar beide Male um schnöden Gewinnes oder, schonender zu reden, des lieben Brodes willen. Die große und reich bebaute Hacienda Maspamolas, im äußersten Süden Canarias gelegen, hat keine Palmen, wohl aber ausgedehnte Kornfelder und gewaltige Tennen, auf denen der Weizenertrag reicher Ernten von Ochsen, Pferden und Maulthieren mit den Füßen ausgetreten wird. Dergleichen Tennen sind ein Sammelplatz vieler körnerfressenden Vögel, welche sich massenhaft daselbst einfinden, um in dem zertretenen Strohe nach übrig gebliebenem Getreide zu suchen. Der Ueberfluß an Nahrung hat nun auch die Sperlinge hierher eingeladen, und sie brüten jetzt gesellschaftlich, wie die unserigen das in dicht verzweigten Bäumen oft genug zu thun pflegen, in den Orangenkronen des Gartens oder auch hin und wieder in einzelnen Mauerlöchern, welche gar nicht einmal sehr hoch zu sein brauchen.« An einer anderen Stelle sah Bolle Halsbandsperlinge, welche sich zu Hunderten unter dem Dache einer Kirche angesiedelt hatten.
Es ist nicht eben leicht, im übrigen das Betragen des Sumpfsperlings zu schildern: denn er ähnelt dem Haussperlinge in seinem Leben und Treiben sehr. Doch muß ich Homeyer beistimmen, wenn er sagt, daß der Flug unserer Vögel schneller ist als der unseres Spatzes, und namentlich, daß sich der Sumpfsperling im Fluge dicht geschlossen hält, was kein anderer Sperling thut. In Egypten bildet er, wenn er von den Reisfeldern aufschwirrt, förmliche Wolken. Die einzelnen Vögel fliegen so dicht neben einander, daß man mit einem einzigen Schusse Massen herabdonnern kann. Ich selbst erbeutete aus einem auffliegenden Schwarme mit einem Doppelschusse sechsundfunfzig Stück und verwundete vielleicht noch ein paar Dutzend mehr. Auch die Stimme unterscheidet den Halsbandsperling von seinem hausliebenden Verwandten; ich fühle mich aber außer Stande, diesen Unterschied mit Worten auszudrücken. Homeyer, welcher hierfür entschieden ein feineres Ohr besitzt als ich, gibt an, daß sie stärker, reiner und wohl auch mannigfaltiger sei als das bekannte Geschelte des Haussperlings, daß ihr aber auch wieder einzelne, dem letzteren eigenthümliche Laute fehlen. »Eine große Verschiedenheit derselben«, sagt er, »ist aus bekannten Gründen bei allen Sperlingen überhaupt nicht zu erwarten; doch glaube ich, der Stimme nach unseren Vogel sicherer vom Hausspatze unterscheiden zu können als manche andere nahe stehenden Finken, so z. B. die hiesigen Kreuzschnäbel, welche dennoch als unbestrittene Arten betrachtet werden. Ich kann insofern genau über diesen Unterschied urtheilen, als ich zwei Halsbandsperlinge aus Algerien, einen Haus- und einen Feldsperling zusammen im Käfige halte.« In geistiger Hinsicht dürfte der Halsbandsperling seinem Vetter wohl ziemlich gleichkommen. Mir ist aufgefallen, daß der erstere immer scheuer und ängstlicher war als der Hausspatz, wahrscheinlich bloß aus dem Grunde, weil dieser sich inniger mit dem Menschen vertraut gemacht hat.
Auf den Kanarischen Inseln und in Egypten beginnt die Brutzeit des Halsbandsperlings im Februar, spätestens zu Anfang des März. Im Delta waren in den angegebenen Monaten alle Palmenkronen mit vielen Dutzenden dicht nebeneinanderstehenden Nestern bedeckt und ebenso alle Höhlungen in den Stämmen dieser Bäume von nistenden Halsbandsperlingen bevölkert. Wie seine Verwandten benutzt auch er den Unterbau eines großen Raubvogelhorstes gern zur Niststätte. Das Nest unterscheidet sich von dem unseres Haussperlings nicht: es ist ein ebenso liederlicher und willkürlicher Bau, wie ihn der Hausspatz aufzutragen und zu schichten pflegt. Die Eier ähneln denen unseres Feldsperlings in so hohem Grade, daß diejenigen, welche ich mitbrachte, von den tüchtigsten Kennern mit Feldsperlingseiern verwechselt werden konnten. Im Mai ist die erste Brut bereits selbständig geworden, und die Alten schreiten dann zu einer zweiten und vielleicht später noch zu einer dritten.
Der Sumpfsperling ist nirgends beliebt, und man hat auch wohl Grund zu einer ungünstigen Meinung über ihn. In den Reisfeldern Egyptens verursacht er, seiner erstaunlichen Menge wegen, erheblichen Schaden; in dem ärmeren Palästina, wo er ebenfalls ungemein häufig auftritt, hat er sich die bitterste Feindschaft zugezogen; in den Lustgärten und beschatteten Spazierwegen Canarias fordert er ernsteste Abwehr heraus. Gefangene, welche sich im wesentlichen nach Art des Haussperlings benehmen, finden wohl auch nur in besonders thierfreundlichen Menschen Liebhaber.
In Mittel- und Nordeuropa, ganz Mittelasien und ebenso in Nordafrika lebt neben dem Hausspatz ein anderes Mitglied der Familie, der Feldsperling, Holz-, Wald-, Weiden-, Nuß-, Rohr-, Berg-, Braun-, Roth-, Ringel-Sperling, -Spatz oder -Fink (Passer montanus, campestris, montaninus und arboreus, Fringilla montana und campestris, Pyrgita montana, campestris und septentrionalis, Bild S. 315). Seine Länge beträgt einhundertundvierzig, seine Breite zweihundertundfünf, die Fittiglänge fünfundsechzig, die Schwanzlänge fünfundfunfzig Millimeter. Oberkopf, Schläfen und Nacken sind matt rothbraun, die Zügel, ein Strich unter den Augen, ein Fleck auf der hinteren Ohrgegend, ein solcher am Mundwinkel und ein breiter, latzartiger auf Kinn und Kehle schwarz, die Backen und oberen Halsseiten weiß, die Untertheile bräunlichweiß, in der Mitte heller, seitlich fahlbräunlich, die Unterschwanzdeckfedern ebenso, weißlich umrandet, Hinterhals, Mantel und Schultern auf rostrothem Grunde mit breiten, schwarzen Längsstrichen gezeichnet, Bürzel und obere Schwanzdecken rostfahlbraun, die Schwingen schwarzbraun, außen schmal, die Armschwingen breiter und etwas lebhafter rostfahl gesäumt, die Armschwingendecken fast an der ganzen Außenfahne rostroth, an der Spitze weißlich, die Flügeldeckfedern dunkel rothbraun, die größten derselben an der Wurzel schwarz, übrigens weiß, wodurch eine Querbinde entsteht, die Schwanzfedern braun, außen schmal fahl gesäumt. Das Auge ist dunkelbraun, der Schnabel schwarz, der Fuß röthlich hornfarben. Beim Weibchen ist der schwarze Ohrfleck ein wenig kleiner.
Der Feldsperling ist in Mitteleuropa allerorten häufig, in Südwesteuropa sehr selten, in ganz Mittelasien überaus gemein, selbst noch auf Malakka und Java heimisch, dringt bis in den Polarkreis vor, ersetzt am unteren Ob, in China, Japan, auf Formosa und in Indien den Haussperling und ist in Australien wie auf Neuseeland mit Erfolg eingebürgert worden. Abweichend von unserem Spatz, bevorzugt er bei uns zu Lande und ebenso in Westsibirien das freie Feld und den Laubwald Dörfern und Städten. Zu den Wohnungen der Menschen kommt er im Winter; im Sommer hingegen hält er sich da auf, wo Wiesen mit Feldern abwechseln, und alte, hohle Bäume geeignete Nistplätze ihm gewähren. Hier lebt er während der Brutzeit paarweise, gewöhnlich aber in Gesellschaften. Diese streifen in beschränkter Weise im Lande hin und her, mischen sich unter Goldammer, Lerchen, Finken, Grünlinge, Hänflinge und andere, besuchen die Felder oder, wenn der Winter hart wird, die Gehöfte des Landmannes und zertheilen sich in Paare, wenn der Frühling beginnt.
In seinem Wesen ähnelt der Feldsperling seinem Verwandten sehr, ist aber, weil ihm der innige Umgang mit den Menschen mangelt und Gelegenheit zur Ausbildung fehlt, nicht so klug als dieser. Er trägt sein Gefieder knapp, ist keck, ziemlich gewandt und fast immer in Bewegung. Sein Flug ist leichter, der Gang auf dem Boden geschickter, der Lockton kürzer, gerundeter als der seines Vetters, demungeachtet jedoch ein echtes Sperlingsgeschrei, welches nicht verkannt werden kann.
Vom Herbste bis zum Frühlinge bilden Körner und Sämereien, im Sommer Raupen, Blattläuse und anderes Ungeziefer die Nahrung des Feldspatzes. Auf Weizen- und Hirsefeldern richtet er zuweilen Schaden an; dagegen läßt er die Früchte und die keimenden Gartenpflanzen unbehelligt. Seine Jungen füttert er mit Kerbthieren und mit milchigen Getreidekörnern auf.
Die Brutzelt beginnt im April und währt bis in den August; denn auch der Feldspatz brütet zwei- bis dreimal im Jahre. Das Nest, welches immer in Höhlungen, vorzugsweise in Baumlöchern, seltener in Feldspalten, oder an entsprechenden Stellen in Gebäuden, in Ungarn regelmäßig auch in dem Unterbaue großer Raubvogel-, zumal Adlerhorste steht, gleicht in seiner Bauart der Brutstätte seines Verwandten. Das Gelege besteht aus fünf bis sieben Eiern, welche denen des Haussperlings sehr ähneln, aber etwas kleiner, durchschnittlich neunzehn Millimeter lang und vierzehn Millimeter dick sind. Männchen und Weibchen brüten abwechselnd und zeitigen die Eier in dreizehn bis vierzehn Tagen. Nicht selten paart sich der Feldsperling mit seinem Verwandten und erzeugt mit diesem Junge, welche, wie man annimmt, wiederum fruchtbar sind. Im Nestkleide ähneln diese Blendlinge jungen Hausspatzen, sind aber dunkler auf dem Kopfe und durch den schwarzgrauen Fleck an der Kehle ausgezeichnet. In solchen Mischlingsehen pflegt der männliche Gatte gewöhnlich ein Feldsperling, der weibliche ein Hausspatz zu sein.
Auf Finkenherden wird dieser Spatz oft in Menge gefangen, aber auch durch Vogelleim, Schlingen und Dohnen, durch Schlaggarne und Fallen anderer Art leicht berückt. Die übrigen Feinde sind dieselben, welche dem Haussperlinge nachstreben.
Durch gedrungenen Bau und sehr kräftigen, kreiselförmigen, an den Schneiden etwas eingedrückten, vorn kolbig zugewölbten, aber doch spitzigen Schnabel, starke Füße, verhältnismäßig schmale und spitzige Flügel, unter deren Schwingen die zweite und dritte die längsten und deren hintere Schwungfedern am Ende ausgerandet sind, den kurzen, am Ende fast geraden Schwanz und das eigenthümliche, bei beiden Geschlechtern gleiche Gefieder unterscheiden sich die Felsensperlinge ( Petronia) von ihren Verwandten.
Der Steinsperling, Bergsperling, Steinfink ( Petronia stulta, rupestris, saxorum, brachyrhynchos, macrorhynchos und brevirostris, Fringilla petronia, stulta und bononiensis, Passer stultus, sylvestris, petronia und bononiensis, Pyrgita petronia und rupestris, Coccothraustes petronia, Bild S. 315), ist oberseits hell erdbraun, ein breiter Streifen, welcher von den Nasenlöchern über das Auge bis in den Nacken zieht, dunkelbraun, ein dazwischen auf der Mitte des Kopfes verlaufender hellbraun, nach dem Nacken zu in fahl gelbbräunlich übergehend, ein Zügelstreifen, welcher hinter und über dem Auge beginnt, über die Schläfen sich herabzieht und unterseits von einem dunkelbraunen begrenzt wird, licht fahlgrau, der Mantel dunkelbraun, durch breite, bräunlichweiße Längsflecke streifig gezeichnet, das obere Schwanzdeckgefieder an der Spitze fahlweiß, das der Backen und Halsseiten einfarbig erdbräunlich, das der Unterseite gelblichweiß, fahlbraun gesäumt, wodurch auf Kropf, Brust und namentlich den unteren Seiten braune Längsstreifen entstehen, ein länglichrunder Querfleck auf der Kehlmitte hellgelb, das Unterschwanzdeckgefieder braun mit breiten gelblichweißen Enden; die Schwingen sind dunkelbraun, außen und an der Spitze mit bräunlichen, an den ersten Handschwingen sich verbreiternden, an den Armschwingen noch mehr zunehmenden und ins Bräunliche übergehenden Säumen; die letzten Armschwingen auch mit einem großen, fahlweißen, spitzen Flecke geziert, die Deckfedern der Schwingen dunkelbraun, außen schmal weiß gesäumt, die größte Reihe der gleich gefärbten Flügeldecken am Ende breit fahlweiß umrandet, wodurch eine Querbinde entsteht, alle Schwingen am Rande der Innenfahne fahlbräunlich, die Schwanzfedern tiefbraun, gegen die Wurzel zu heller, an der Spitze der Innenfahne mit einem großen weißen Flecke geschmückt, die äußersten Federn jederseits außen fahlweiß, die übrigen schmal gelblich olivenfarben gesäumt. Das Auge ist dunkelbraun, der Schnabel ölgelb, der Oberschnabel dunkler, der Fuß röthlich hornfarben. Das im ganzen gleich gefärbte Weibchen unterscheidet sich durch kleineren Kehlfleck. Die Länge beträgt einhundertundsechzig, die Breite zweihundertundneunzig, die Fittiglänge neunzig, die Schwanzlänge sechsundfunfzig Millimeter.
Das Verbreitungsgebiet des Steinsperlings umfaßt Mittel- und Südeuropa, einschließlich Maderas, Nordwestafrika mit Einschluß der Kanaren, Südwest- und Westasien, Ostsibirien und Afghanistan. In Deutschland, woselbst er durchaus nicht zu den häufigen Vögeln gehört, findet man ihn einzeln in felsigen Gegenden oder als Bewohner alter verfallener Gebäude, namentlich Ritterburgen, so auf der Lobedaburg bei und in den Felsen der Umgegend von Jena, hier und da im Harze, an der Mosel und am Rheine. Von Südfrankreich an tritt er regelmäßiger auf, und in Spanien, Algerien, auf den Kanarischen Inseln, in Süditalien, in Griechenland, Dalmatien, Montenegro, Palästina und Kleinasien zählt er unter die gemeinen Vögel des Landes, bewohnt hier alle geeigneten Orte, Dörfer und Städte ebensowohl wie die einsamsten Felsthäler, und bildet nach Art seiner Verwandten sogar Siedelungen. In Spanien traf ich ihn mit Sicherheit in jeder steilen Wand des Mittelgebirges, aber auch in jedem alten Schlosse an. Auf Canaria sind, wie Bolle uns mittheilt, Thürme und sehr hohe Gebäude innerhalb der Städte sein Lieblingsaufenthalt. Er meidet also den Menschen keineswegs, bewahrt sich aber unter allen Umständen seine Freiheit. In die Straßen der Städte und Dörfer kommt er nur höchst selten herab, fliegt vielmehr regelmäßig nach der Flur hinaus, um hier Nahrung zu suchen. Scheu und Vorsicht bekundet er stets. Er will auch da, wo er wenig mit dem Menschen zusammenkommt, nichts mit diesem zu thun haben.
In seinen Bewegungen unterscheidet sich der Steinsperling wesentlich von seinen Verwandten. Er fliegt schnell, mit schwirrenden Flügelschlägen, schwebt vor dem Niedersetzen mit stark ausgebreiteten Flügeln und erinnert viel mehr an den Kreuzschnabel als an den Spatz. Auf dem Boden hüpft er ziemlich geschickt umher; im Sitzen nimmt er eine kecke Stellung an und wippt häufig mit dem Schwanze. Sein Lockton ist ein schnalzendes, dreisilbiges »Giüib«, bei welchem der Ton auf die letzten Silben gelegt wird, der Warnungsruf ein sperlingsartiges »Errr«, welches man jedoch auch sofort erkennen kann, der Gesang ein einfaches, oft unterbrochenes Zwitschern und Schwirren, welches in mancher Hinsicht an das Lied des Gimpels erinnert, jedoch nicht gerade angenehm klingt.
Die Fortpflanzungszeit fällt in die letzten Frühlings- und ersten Sommermonate. In Spanien beginnt sie wahrscheinlich schon im April; ich fand aber die meisten Nester erst in den Monaten Mai bis Juli. Bei uns zu Lande hält es sehr schwer, Beobachtungen über das Brutgeschäft anzustellen, in Südeuropa ist dies selbstverständlich leichter. Hier nistet der Steinsperling in den Höhlungen steiler Felswände, in Mauerspalten, unter den Ziegeldächern der Thürme und hohen Gebäude, und zwar gewöhnlich in zahlreichen Gesellschaften. Es ist aber auch da, wo er häufig lebt, nicht eben leicht, dem Neste beizukommen; denn der Standort wird unter allen Umständen mit größter Vorsicht gewählt, und der Süden bietet in seinen zerrissenen Gebirgsschluchten der günstigen Orte so viele, daß der kluge Vogel niemals in Verlegenheit kommt. Das Nest, welches mein Vater zuerst beschrieb, hat mit anderen Sperlingsnestern Ähnlichkeit, besteht aus starken Halmen, Baumbast, Tuch, Leinwand, welche Stoffe liederlich zusammengeschichtet werden, und ist innerlich mit Federn, Haaren, Wollflocken, Raupengespinst, Pflanzenfasern und dergleichen ausgefüttert. Die Eier, fünf bis sechs an der Zahl, sind größer als gewöhnliche Sperlingseier, einundzwanzig Millimeter lang, funfzehn Millimeter dick, auf grauem oder schmutzigweißem Grunde, am stumpfen Ende meist dichter als an der Spitze, asch- und tiefgrau oder schieferfarben gefleckt und gestrichelt. Noch ist es nicht mit Sicherheit festgestellt, ob beide Geschlechter abwechselnd brüten; dagegen weiß man gewiß, daß die Eltern sich in die Mühe der Erziehung ihrer Kinder redlich theilen. Die ausgeflogenen Jungen scharen sich mit anderen ihrer Art zu namhaften Flügen und schweifen dann bis zum Herbste ziellos in der Flur hin und her, während die Eltern zur zweiten und vielleicht zur dritten Brut schreiten. Erst nach Beendigung des Brutgeschäftes vereinigen auch sie sich wiederum zu größeren Gesellschaften.
Hinsichtlich der Nahrung gilt höchst wahrscheinlich dasselbe, was wir von den übrigen Sperlingen erfahren haben. Während des Sommers verzehren die Steinsperlinge vorzugsweise Kerbthiere, im Winter Sämereien, Beeren und dergleichen. Auf den Landstraßen durchwühlen sie nach Art der Feld - und Haussperlinge den Mist nach Körnern.
Nur in Gegenden, wo unsere Vögel häufig sind, kann man sich ihrer ohne große Mühe bemächtigen. In Spanien werden sie schockweise auf den Markt gebracht. Man fängt sie dort mit Hülfe von Lockvögeln unter Netzen oder auf den mit Leimrüthchen überdeckten Bäumen. Die Jagd mit dem Feuergewehre hat immer ihre Schwierigkeiten; denn der kluge Vogel, welchen nur ein Balgforscher »stultus« nennen konnte, merkt sehr bald, wenn er verfolgt wird, und seine angeborene Scheu steigert sich dann aufs höchste. Mit Recht hebt mein Vater als Eigenthümlichkeit hervor, daß er an dem Orte, wo er Nachtruhe hält, am allerscheuesten ist. Man muß, um sich seiner zu bemächtigen, förmlich anstehen und sich vor einem Fehlschusse wohl in Acht nehmen. Dies gilt auch für Spanien, wo wir uns oft vergebens bemühten, die schlauen Vögel zu überlisten, und trotz aller Uebung im Jagen derartigen Wildes meist mit leeren Händen den Rückweg antreten mußten.
In der Gefangenschaft verursacht der Steinsperling wenig Mühe, gewährt aber viel Vergnügen. Er wird bald zutraulich, verträgt sich mit anderen Vögeln vortrefflich, erfreut durch die Anmuth seines Betragens und schreitet bei geeigneter Pflege auch wohl zur Fortpflanzung.
Ein Spatz, nicht aber ein Weber, wie gewöhnlich angenommen wird, ist der Siedelsperling (Philetaerus socius und lepidus, Loxia socia, Euplectes lepidus), Vertreter einer gleichnamigen Sippe. Sein Schnabel ist gestreckt kegelförmig, seitlich zusammengedrückt, auf der Firste sanft gebogen, an dem oberen Schneidenrande ausgeschweift, der Fuß kräftig, kurzläufig, langzehig und mit dicken Schuppen bekleidet, der Flügel ziemlich lang und spitzig, in ihm die zweite Schwinge die längste, der Schwanz breit, kurz und gerade abgeschnitten. Die Federn des Oberkopfes sind braun, die der übrigen Oberseite etwas dunkler, schmal fahlbraun umrandet, die des Nackens und der Halsseiten noch dunkler und merklich heller als jene umrandet, Zügel, Gegend am Mundwinkel, Kinn und Kehle schwarz, Kropfseiten und übrige Unterteile blaß fahlbräunlich, einige Federn an den Schenkelseiten schwarz, hell fahlbraun umsäumt, Schwingen und Steuerfedern, Flügeldeck-, Bürzel- und obere Schwanzdeckfedern dunkelbraun, erstere außen, letztere ringsum fahlbraun gesäumt. Der Augenring hat dunkelbraune, der Schnabel wie der Fuß blaßbraune Färbung. Die Länge beträgt dreizehn, die Fittiglänge acht, die Schwanzlänge fünf Centimeter.
Das Innere Südafrikas ist das Vaterland, Großnamakaland der Brennpunkt des Verbreitungsgebietes des Siedelsperlings. Schon die älteren Reisenden erwähnen dieses Vogels. »Im Lande der Namaken«, sagt Patterson in seiner zu Ende des vorigen Jahrhunderts erschienenen Reisebeschreibung, »gibt es Mimosenwälder, welche viel Gummi liefern und deren Zweige die vornehmste Nahrung der Girafen sind. Ihre ausgebreiteten Aeste und ihr platter Stamm schützen eine Art Vögel, die sich in Herden versammeln, vor den Schlangen, welche sonst ihre Eier vernichten würden. Die Art, wie sie ihre Nester errichten, ist höchst merkwürdig. Achthundert bis tausend sind unter einem gemeinschaftlichen Dache, welches einem mit Stroh bedeckten Hause gleicht, einen großen Ast mit seinen Zweigen bedeckt und über die eigentlichen, klumpenweise darunter sich befindlichen Nester hängt, so daß weder eine Schlange noch ein anderes Raubthier dazu kommt. In ihrem Kunstfleiße scheinen sie den Bienen zu gleichen. Sie sind den ganzen Tag beschäftigt, Gras herbei zu holen, woraus der wesentlichste Theil ihres Gebäudes besteht, und welches sie zum Ausbessern und Ergänzen gebrauchen. Ohne Zweifel vermehren sie jährlich die Nester, so daß die Bäume, welche diese schwebenden Städte tragen, sich biegen. Unten daran sieht man eine Menge Eingänge, deren jeder zu einer Straße führt, an deren Seiten sich die Nester befinden, ungefähr fünf Centimeter von einander. Sie leben wahrscheinlich von den Samen des Grases, womit sie das Nest bauen.«
Diese Schilderung, welche im ganzen richtig ist, wurde von A. Smith vervollständigt: »Das Auffällige der Naturgeschichte dieser Vögel«, sagt er, »ist der gesellige Bau ihrer Nester unter einem Dache. Wenn sie einen Nistplatz gefunden und den Bau der Nester angefangen haben, beginnen sie gemeinschaftlich das allen dienende Dach zu errichten. Jedes Pärchen baut und bedacht sein eigenes Nest, aber eines baut dicht neben das andere, und wenn alle fertig sind, glaubt man nur ein Nest zu sehen, mit einem Dache oben und unzähligen kreisrunden Löchern auf der Unterseite. Zum zweiten Male werden dieselben Nester nicht zum Brüten benutzt, sondern dann unten an die alten neue angehängt, so daß nun Dach und alte Nester die Bedeckung der neuen bilden. So nimmt die Masse von Jahr zu Jahr an Größe und Gewicht zu, bis sie endlich zu schwer wird, den Ast, an welchem sie hängt, zerbricht und herabfällt.«
Solche Ansiedelungen findet man gewöhnlich auf großen, hohen Bäumen; wo diese jedoch nicht vorkommen, wird wohl auch die baumartige Aloë benutzt. Das Gelege besteht aus drei bis vier bläulichweißen, am dickeren Ende fein braun getüpfelten Eiern. Ob nur das Weibchen brütet oder darin vom Männchen unterstützt wird, ist zur Zeit noch unbekannt. Die Jungen werden mit Kerbthieren groß gezogen. Nach der Ansicht von Ayres dienen die Nester auch als Schlafräume.

Siedelsperling (Philetaerus socius). ¾ natürl. Größe.
Lebende Siedelsperlinge werden uns leider nicht zugeführt; mir ist deshalb auch keine Angabe über ihr Betragen in der Gefangenschaft bekannt.
Der Kernbeißer, Kirschfink, Kirschknacker, Kirschschneller, Kirschkern-, Stein-, Nuß- und Bollenbeißer, Dickschnabel, Finkenkönig, Klepper, Leske, Lysblicker etc. (Coccothraustes vulgaris, deformis, atrigularis, europaeus, fagorum, cerasorum, planiceps, flaviceps und minor, Loxia und Fringilla coccothraustes), bildet mit seinen Verwandten eine sehr ausgezeichnete, nach ihm benannte Sippe (Coccothraustes), welche durch sehr kräftigen, gedrungenen Bau, ungemein großen, dicken, völlig kreiselförmigen, an den etwas gebogenen, scharfen Schneiden wenig eingezogenen, vor der Spitze des Oberschnabels undeutlich ausgeschnittenen Schnabel, kleine, rundliche, an der Schnabelwurzel liegende, mit Borsten, Federchen und Härchen bekleidete Nasenlöcher, kurze, aber kräftige und stämmige, mit mittellangen, scharfspitzigen Krallen bewehrte Füße, verhältnismäßig breite Flügel, unter deren Schwingen die dritte die Spitze bildet, und deren hintere vor dem stumpfen Ende auf der Außenfahne hakig ausgeschweift sind, während die Innenfahnen einen Ausschnitt zeigen, sehr kurzen, in der Mitte deutlich ausgeschnittenen Schwanz und dichtes und weiches Gefieder sich auszeichnet. Die Länge beträgt achtzehn, die Breite einunddreißig, die Fittiglänge zehn, die Schwanzlänge sechs Centimeter. Stirn und Vorderscheitel sind braungelb, Oberkopf und Kopfseiten gelbbraun, ein schmaler Stirnstreifen, Zügel und Kehle schwarz, Nacken und Hinterhals aschgrau, der Oberrücken chokolade-, der Unterrücken hell kastanienbraun, Kropf und Brust schmutzig grauroth, der Bauch grauweiß, Aftergegend und Unterschwanzdecken reinweiß, die Schwingen, mit Ausnahme der beiden letzten braunschwarzen, metallischblau glänzend, innen mit einem weißen Flecke an der Wurzel geziert, die Armschwingen grau gesäumt, die kleinen Oberflügeldecken dunkel chokoladebraun, die mittleren weiß, die größten vordersten schwarz, die hintersten schön gelbbraun, die mittleren Schwanzfedern an der Wurzel schwarz, in der Endhälfte außen gelbbraun, am Ende weiß, die übrigen an der Wurzel schwarz, innen in der Endhälfte weiß, die beiden äußersten außen schwarz, alle am Ende weiß gesäumt. Das Auge ist grauroth, der Schnabel im Frühlinge blau, im Herbste horngelb, der Fuß fleischfarben. Beim Weibchen ist der Oberkopf hell gelblichgrau, die Unterseite grau, der Oberflügel großentheils gilblich. Im Jugendkleide sind Kehle und Zügel dunkel braungrau, Kropf und Hals hellgelb, Scheitel, Wangen und Hinterkopf dunkel rostgelb, Nacken, Halsseiten und Gurgel lehmgelb, die Federn graulichgelb umrandet, die des Mantels matt braungelb, der Kehle hellgelb, des Oberhalses graugilblich, die der übrigen Untertheile schmutzigweiß, seitlich ins Rostfarbene ziehend, überall mit halbmondförmigen, dunkelbraunen Querflecken gezeichnet.
Als Heimat des Kernbeißers sind die gemäßigten Länder Europas und Asiens anzusehen. Seine Nordgrenze erreicht er in Schweden und in den westlichen und südlichen Provinzen des europäischen Rußlands. In Deutschland sieht man ihn oft auch im Winter, wahrscheinlich aber bloß als Gast, welcher aus dem nördlicheren Europa gekommen ist, wogegen die bei uns lebenden Brutvögel regelmäßig wandern. In Südeuropa erscheint er nur auf dem Zuge. So durchstreift er Spanien und geht bis nach Nordwestafrika hinüber. In Sibirien findet er sich von dem Quelllande des Amur bis zur europäischen Grenze als Sommervogel. Bei uns ist er hier häufig, dort seltener, aber überall bekannt, weil er auf seinen Streifereien allerorten sich zeigt und jedermann auffällt. Er wählt zu seinem Sommeraufenthalte hügelige Gelände mit Laubwaldungen und hohen Bäumen, auf denen er sich, falls er nicht in eine benachbarte Kirschenpflanzung plündernd einfällt oder im anstoßenden Felde auf dem Boden sich zu schaffen macht, den ganzen Tag über verweilt und ebenso die Nacht verbringt. In Südrußland gehört er, laut Radde, zu denjenigen Vögeln, welche sich mit der Zeit an solche Steppengegenden gewöhnen, wo nach und nach Bäume und Sträuche gepflanzt werden. Nach der Brutzeit streift er mit seinen Jungen im Lande umher und kommt bei dieser Gelegenheit auch in die Kirsch- und Gemüsegärten herein. Zu Ende des Oktober oder im November beginnt er seine Wanderschaft, im März kehrt er wieder zurück; einzeln aber kommt er auch viel später an: so habe ich ihn am ersten Mai bei Madrid auf dem Zuge beobachtet.
Der Kernbeißer ist, wie sein Leibesbau vermuthen läßt, ein etwas plumper und träger Vogel. Er pflegt lange auf einer und derselben Stelle zu sitzen, regt sich wenig, bequemt sich auch erst nach einigem Besinnen zum Abstreichen, fliegt nur mit Widerstreben weit und kehrt beharrlich zu demselben Orte zurück, von welchem er verjagt wurde. Im Gezweige der Bäume bewegt er sich ziemlich hurtig, auf der Erde dagegen, dem schweren Leibe und den kurzen Füßen entsprechend, ungeschickt; auch sein Flug ist schwerfällig und rauschend, erfordert unaufhörliche Flügelbewegungen, beschreibt seichte Bogenlinien und geht nur vor dem Aufsitzen in Schweben über, fördert aber trotzdem rasch. Nicht im Einklange hiermit stehen seine geistigen Fähigkeiten. Er ist ein sehr vorsichtiger und listiger Gesell, welcher seine Feinde bald kennen lernt und mit Schlauheit auf seine Sicherung Bedacht nimmt. »Er fliegt ungern auf«, sagt mein Vater, »wenn man sich ihm nähert, ist aber auch beim Fressen immer so auf seiner Hut, daß er jede Gefahr sogleich bemerkt und ihr dadurch zu entgehen sucht, daß er sich im dichten Laube verbirgt oder, wenn dieses nicht vorhanden ist, flüchtet. Er weiß es recht gut, wenn er sich hinlänglich versteckt hat; denn dann hält er sehr lange aus, was nur selten der Fall ist, wenn er frei sitzt. Wenn die Bäume belaubt sind, kann man ihn lange knacken hören, ehe man ihn zu sehen bekommt. Er verbirgt sich so gut, daß ich ihn zuweilen durch Steinwürfe auf andere Bäume gejagt habe, weil ich seiner durchaus nicht ansichtig werden konnte. Wenn er aufgescheucht wird, setzt er sich fast immer auf die Spitzen der Bäume, um jede ihm drohende Gefahr von weitem bemerken zu können. Mit seiner List verbindet er eine große Keckheit. In meiner Jugend stellte ich einstmal einem Kirschkernbeißer, welcher in den Gärten meines Vaters gleich vor dem Fenster des Wohnhauses Kohlsamen fraß, acht Tage lang nach, ehe ich ihn erlegte; so scheu und klug war dieser Vogel. Er schien das Feuergewehr recht gut zu kennen.« Wenn eine Gesellschaft Kernbeißer auf Kirschbäumen sitzt, ist sie freilich leichter zu berücken, obwohl auch dann die Alten noch immer vorsichtig sind, sich möglichst lange lautlos verhalten und erst beim Wegfliegen ihre Stimme vernehmen lassen. In der Fremde ist er ebenso scheu als in der Heimat: er traut den Spaniern und Arabern nicht mehr als seinen deutschen Landsleuten.
Am liebsten verzehrt der Kirschkernbeißer die von einer harten Schale umgebenen Kerne verschiedener Baumarten. »Die Kerne der Kirschen und der Weiß- und Rothbuchen«, schildert mein Vater, »scheint er allen anderen vorzuziehen. Er beißt die Kirsche ab, befreit den Kern von dem Fleische, welches er wegwirft, knackt ihn auf, läßt die steinige Schale fallen und verschluckt den eigentlichen Kern. Dies alles geschieht in einer halben, höchstens ganzen Minute und mit so großer Gewalt, daß man das Aufknacken auf dreißig Schritte weit hören kann. Mit dem Samen der Weißbuche verfährt er auf ähnliche Weise. Die von der Schale entblößten Kerne gehen durch die Speiseröhre gleich in den Magen über, und erst wenn dieser voll ist, wird der Kropf mit ihnen angefüllt. Wenn die Bäume von den ihnen zur Nahrung dienenden Sämereien entblößt sind, sucht er sie auf der Erde auf; deshalb steht man ihn im Spätherbste und Winter oft auf dem Boden umherhüpfen. Außerdem frißt er auch Kornsämereien gern, geht deshalb im Sommer oft in die Gemüsegärten und thut an den Sämereien großen Schaden. Es ist kaum glaublich, wie viel ein einziger solcher Vogel von den verschiedenen Kohl- und Krautarten zu Grunde richten kann.« Im Winter geht er, ebenfalls nur der Kerne wegen, fleißig auf die Vogelbeerbäume. Außerdem verzehrt er Baumknospen und im Sommer sehr oft auch Kerbthiere, besonders Käfer und deren Larven. »Nicht selten«, berichtet Naumann, »fängt er die fliegenden Maikäfer in der Luft und verzehrt sie dann, auf einer Baumspitze sitzend, stückweise, nachdem er zuvor Flügel und Füße derselben als ungenießbar weggeworfen hat. Ich habe ihn auch auf frisch gepflügte Aecker, wohl einige hundert Schritt vom Gebüsche, fliegen, dort Käfer auflesen und seinen Jungen bringen sehen.«
Je nachdem die Witterung günstig oder ungünstig ist, nistet der Kernbeißer ein- oder zweimal im Jahre, im Mai und im Anfange des Juli. Jedes Paar erwählt sich ein umfangreiches Nistgebiet und duldet in diesem kein anderes seiner Art. »Das Männchen hält deshalb immer oben auf den Baumspitzen Wache und wechselt seinen Sitz bald auf diesen, bald auf jenen hohen Baum, schreit und singt dabei und zeigt außerordentliche Unruhe.« Schwirrende und scharfe Töne, welche dem wie »Zi« oder »Zick« klingenden Locktone sehr ähnlich sind, bilden den Gesang, welcher von dem Männchen stundenlang unter allerlei Wendungen und Bewegungen des Leibes vorgetragen wird. Das nicht gerade dickwandige, aber doch recht gut gebaute, ansehnlich breite und daher leicht kenntliche Nest steht hoch oder tief, auf schwachen oder dünnen Zweigen, gewöhnlich aber gut versteckt. Seine erste Unterlage besteht aus dürren Reisern, starken Grashalmen, Würzelchen und dergleichen, die zweite Lage aus gröberem oder feinerem Baummoose und Flechten, die Ausfütterung aus Wurzelfasern, Schweinsborsten, Pferdehaaren, Schafwolle und ähnlichen Stoffen. Die drei bis fünf Eier sind vierundzwanzig Millimeter lang, siebzehn Millimeter dick, ziemlich bauchig und auf schmutzig oder grünlich und gelblich aschgrauem Grunde mit deutlichen und verwaschenen braunen, schwarzbraunen, dunkel aschgrauen, hell- und ölbraunen Flecken, Strichen und Aederchen gezeichnet, um das stumpfe Ende herum am dichtesten. Das Weibchen brütet mit Ausnahme der Mittagsstunden, um welche Zeit es das Männchen ablöst. Die Jungen werden von beiden Eltern gefüttert, sehr geliebt und noch lange nach dem Ausfliegen geführt, gewartet und geatzt; denn es vergehen Wochen, bevor sie selbst im Stande find, die harten Kirschkerne zu knacken.
Der Kernbeißer macht sich dem Obstgärtner sehr verhaßt; denn der Schaden, welchen er in Kirschpflanzungen anrichtet, ist durchaus nicht unbedeutend. »Eine Familie dieser Vögel«, sagt Naumann, »wird mit einem Baume voll reifer Kirschen bald fertig. Sind sie erst einmal in einer Anpflanzung gewesen, so kommen sie gewiß immer wieder, so lange es daselbst noch Kirschen gibt, und alles Lärmen, Klappern, Peitschenknallen und Pfeifen hält sie nicht gänzlich davon ab; alle aufgestellten Scheusale werden sie gewohnt. Schießen ist das einzige Mittel, sie zu verscheuchen, und dies darf nicht blind geschehen, sonst gewöhnen sie sich auch hieran. Die gewöhnlichen sauren Kirschen sind ihren Anfällen am meisten ausgesetzt. In den Gemüsegärten thun sie oft großen Schaden an den Sämereien und in den Erbsenbeeten an den grünen Schoten. Sie zerschroten dem Jäger seine Beeren auf den Ebereschbäumen und richten anderen Unfug an. Weit weniger Schaden würden sie thun, wären sie nicht so unersättliche Fresser, und hätten sie nicht die Gewohnheit, einzelne Bäume, Beete und Pflanzungen immer wieder und so lange heimzusuchen, bis sie solche ihrer Früchte oder Samen gänzlich beraubt haben.« Es ist daher kein Wunder, daß der Mensch sich dieser ungebetenen Gäste nach Kräften zu erwehren sucht und Schlinge und Leimruthe, Netz, Falle und Dohne, das Feuergewehr und andere Waffen gegen sie in Anwendung bringt.
Gefangen, gewöhnt sich der Kernbeißer bald ein, nimmt mit allerlei Futter vorlieb, wird auch leicht zahm, bleibt aber immer gefährlich, weil er, erzürnt, empfindlich um sich und in alles beißt, was ihm vor den Schnabel kommt. Mein Vater sah einen gezähmten Kernbeißer im Besitze eines Studenten der edeln Musenstadt Jena, welcher in Folge dieser Eigenschaft von den Freunden des Vogelliebhabers oft betrunken gemacht wurde. Dies gelang sehr leicht. Die lustigen Gesellen füllten eine unten ausgeschnittene Federspule mit Bier und hielten sie dem Kernbeißer vor. So oft dieser in den offenen Theil der Spule gebissen hatte, richteten sie letztere aufrecht, so daß das Bier in den Schlund des Kernbeißers lief. Dieses Verfahren brauchte man nur einige Male zu wiederholen, und der dickköpfige Geselle war so betrunken, daß er beim Herumhüpfen taumelte.
Kernbeißer mit Hakenschnabel, kurzen Flügeln und langem Schwanze sind die Papageifinken (Pytilinae). Der Schnabel ist gewöhnlich sehr stark, dick, bauchig kegelförmig, die Spitze des Oberschnabels hakig über die des unteren gebogen und hinter dem Haken ausgekerbt, der Mundrand mehr oder weniger eingezogen, schwach winkelig, der kräftige Fuß hochläufig und langzehig, die erste Schwinge des Fittigs stets beträchtlich verkürzt, die dritte neben der vierten in der Regel am längsten, der lange Schwanz meist zugerundet, seltener abgestutzt oder ausgeschnitten, das Gefieder voll, weich, ohne Metallglanz, oft einfarbig grau oder grünlich olivengrau, seltener rothgelb oder schwarz und noch seltener durch lebhafte Farbenfelder ausgezeichnet.
Südamerika insbesondere muß als die Heimat dieser Vögel betrachtet werden; in Nordamerika kommen verhältnismäßig wenige Arten vor. Sie haben in ihrem Wesen viel mit unseren Kernbeißern, aber auch manches mit den Gimpeln gemein, bewohnen mehr die Gebüsche und Vorwälder als den eigentlichen Urwald und fressen harte Sämereien, Beeren und Kerbthiere. Die meisten sind klanglose Geschöpfe, von denen man höchstens kurze Locktöne hört, andere hingegen berühmt wegen ihrer Lieder und deshalb hochbeliebte Stubenvögel.
»Einst, im August«, erzählt Audubon, »als ich mich mühselig längs der Ufer des Mohawkflusses dahinschleppte, überkam mich die Nacht. Ich war wenig bekannt in diesem Theile des Landes und beschloß deshalb, da zu übernachten, wo ich mich gerade befand. Der Abend war schön und warm; die Sterne spiegelten sich wieder im Flusse; von fern her schallte das Murmeln eines Wasserfalles. Mein kleines Feuer war unter einem Felsen bald angezündet, und ich lag neben ihm hingestreckt. In behaglicher Ruhe, mit geschlossenen Augen, ließ ich meinen Gedanken freien Lauf und befand mich in einer geträumten Welt. Da plötzlich drang mir in die Seele der Abendgesang eines Vogels, so klangvoll, so laut, wegen der Stille der Nacht, daß der Schlaf, welcher sich bereits auf meine Lider herabgesenkt hatte, wieder von hinnen floh. Niemals hat der Wohllaut der Töne mich mehr erfreut. Er bebte mir durchs Herz und machte mich glückselig. Fast hätte ich meinen mögen, daß selbst die Eule durch den süßen Wohllaut erfreut war; denn sie blieb still diese Nacht. Lange noch, nachdem die Töne verklungen waren, freute ich mich über sie, und in dieser Freude schlief ich ein.«
Der Vogel, von welchem der dichterische Forscher so begeistert spricht, ist der Rosenbrustknacker ( Hedymeles ludovicianus, Loxia ludoviciana, rosea und obscura, Coccothraustes ludovicianus und rubricollis, Coccoborus ludovicianus, Fringilla, Guiraca und Goniaphaea ludoviciana), Vertreter der Sippe der Singknacker ( Hedymeles), deren Merkmale in dem kurzen, mehr oder minder dicken, ausnahmsweise auch ungewöhnlich starken Kegelschnabel, dessen oberer Scheidenrand am Mundwinkel eckig herabgebogen ist, den verhältnismäßig kleinen und schwachen Füßen, den langen Flügeln, unter deren Schwingen die zweite, dritte und vierte die Spitze bilden, dem kurzen, gerade abgeschnittenen Schwanze und dem reichen, derben Gefieder zu suchen sind. Die Länge beträgt achtzehn, die Breite neunundzwanzig, die Fittiglänge neun, die Schwanzlänge sieben Centimeter. Oberseite, Flügel, Schwanz, Kinn und Oberkehle sind schwarz, die übrigen Untertheile, mit Ausnahme eines breiten, winkelig bis zur Brustmitte herabgezogenen scharlachrothen Kropfschildes, weiß, Bauch und Schenkelseiten mit einzelnen schwarzen Strichen gezeichnet, die Handschwingen in der Wurzelhälfte auf beiden Fahnen, die Armschwingen, deren Deckfedern sowie die größten oberen Flügeldecken am Ende weiß, die Achseln und unteren Flügeldecken scharlachroth, die äußeren Schwanzfedern innen in der Endhälfte weiß. Der Augenring ist nußbraun, der Schnabel blaßgelb, der Fuß graulichbraun. Beim Weibchen sind die Obertheile erdbraun, durch dunklere Schaftstriche, Kopf und Brust gelbbräunlich, durch dunklere Längsstriche gezeichnet, ein Längsstreifen auf dem Scheitel, ein breiter Augenbrauenstreifen und der Zügel weiß, die Kopfseiten, Schwingen und Steuerfedern braun, die Armschwingen, deren Deckfedern und die größten Oberflügeldecken am Ende weiß, die Unterflügeldeckfedern orangefarben.
Das Verbreitungsgebiet umfaßt den Osten der Vereinigten Staaten, nördlich bis zum Saskatchewan, westlich bis Nebraska, das Wandergebiet auch Mittelamerika, bis Neugranada herab. Innerhalb der angegebenen Länder tritt der Vogel jedoch nicht regelmäßig und immer nur einzeln auf. Häufig ist er im südlichen Indiana, im nördlichen Illinois und im westlichen Iowa; in Massachusetts scheint er allmählich zuzunehmen.
»Ich habe«, fährt Audubon fort, »diesen prachtvollen Vogel in den unteren Theilen von Louisiana, Kentucky und Cincinnati im März, wenn er ostwärts zog, oft beobachtet. Er flog dann in bedeutender Höhe und setzte sich nur zuweilen auf die Spitze des höchsten Baumes im Walde, als ob er ein wenig ruhen wolle. Ich habe ihn auf seiner Wanderschaft verfolgt, in Pennsylvanien, New York und anderen östlichen Staaten, durch die britischen Provinzen von Neubraunschweig und Neuschottland bis Neufundland, wo er häufig Brutvogel ist; aber niemals sah ich ihn in Labrador und ebensowenig an der Küste von Georgia oder Karolina, obgleich er hier in den Gebirgen vorkommt. Längs der Ufer des Schuylkillflusses, zwanzig oder dreißig Meilen von Philadelphia, traf ich ihn zu Ende des Mai in zahlreicher Menge, ebenso in den großen Fichtenwäldern desselben Staates, noch häufiger aber in New York und vorzugsweise längs des prächtigen Flusses, dessen ich oben gedachte, oder am Ontario und Eriesee. Sein Flug ist hart, geradeaus, aber gefällig. Wandernd streicht er hoch über die Wälder dahin und stößt ab und zu einen hellen Ton aus, während er zu schweigen pflegt, wenn er sich niedergelassen hat. Dies geschieht gegen Sonnenuntergang, und zwar wählt er sich immer den höchsten Baumwipfel, auf welchem er sich aufrecht und steif hält, so lange er hier verweilt. Nach wenigen Minuten senkt er sich gewöhnlich in ein Dickicht hernieder, um in ihm die Nacht zu verbringen.« Die Nahrung besteht in Grassämereien und Beeren, im Frühlinge auch in Knospen und zarten Blüten. Nebenbei jagt er Kerbthiere, nicht selten im Fluge.

Kardinal ( Cardinalis virginianus) und Rosenbrustknacker ( Hedymeles ludovicianus). 5/8 natürl. Größe.
Das Nest fand Audubon vom Ende des Mai an bis zum Juli in den obersten Zweiggabeln niederer Büsche oder höherer Bäume, am liebsten auf solchen, welche ein Gewässer beschatten. Es besteht aus trockenen Baumzweigen mit dazwischen verwobenen Blättern und Rindenstücken der wilden Rebe und ist innen mit zarten Würzelchen und Roßhaaren ausgekleidet. Vier bis fünf Eier von ungefähr sechsundzwanzig Millimeter Längs- und achtzehn Millimeter Querdurchmesser, blaugrüner Grundfärbung und röthlichbrauner und graublauer über das ganze Ei verteilter, gegen das stumpfe Ende einen Kranz bildender Fleckung bilden das Gelege. Beide Geschlechter brüten, wie es scheint, nur einmal im Jahre. Die Jungen werden zuerst mit Kerbthieren, später mit im Kropfe aufgequellten Sämereien gefüttert. Erst im dritten Lebensjahre legen sie das Kleid ihrer Eltern an.
Unter den Amerikanern gilt der Rosenbrustknacker für einen der besten und unermüdlichsten Sänger. Sein Lied ist reich an Weisen und höchst wohllautend; die einzelnen Töne sind voll und klar. Bei guter Witterung singt er während der Nacht, wie Nuttall sagt: »mit all den verschiedenen, ergreifenden Tönen der Nachtigall, bald schmetternd, laut, klar und voll, bald klagend und hierauf wieder lebhaft und endlich zart, süß und gehalten«. Besagter Berichterstatter glaubt, daß er von keinem anderen amerikanischen Singvogel, mit alleiniger Ausnahme der Spottdrossel, übertroffen werde, geht hierin aber offenbar zu weit. Das Gepräge des Gesanges ist das der Klage, gleichsam der Ausdruck der Wehmuth, und ein solches Lied kann zuletzt geradezu zur Verzweiflung bringen. Demungeachtet zählt der Rosenbrustknacker zu den guten Sängern und außerdem zu den dauerhaftesten Käfigvögeln.
Der auch in Europa wohlbekannte Kardinal oder Rothvogel ( Cardinalis virginianus, Loxia, Fringilla, Coccothraustes und Pytilus cardinalis, Bild S. 329) vertritt eine andere, durch etwas gestreckten Leib, kurzen, kräftigen und spitzigen, an der Wurzel sehr breiten, auf der Firste gekrümmten, oben in der Mitte stark ausgebuchteten Schnabel, kurze Flügel, langen, in der Mitte ausgeschweiften Schwanz sowie endlich einen aufrichtbaren Schopf gekennzeichnete Sippe. Seine Länge beträgt zwanzig, die Breite sechsundzwanzig, die Fittiglänge sieben, die Schwanzlänge acht Centimeter. Die vorherrschende Färbung des Gefieders ist ein lebhaftes Scharlachroth, Mantel, Schultern und Bürzel sind düsterer, die Federn am Ende schmal verloschen graufahl gesäumt, die Zügel, ein schmales Augenrändchen, Kinn und Oberkehle schwarz, die Schwingen dunkel scharlachroth, im Spitzendrittel braun, die letzten Armschwingen außen fahlbraun gesäumt, die Schwanzfedern dunkel scharlachroth, unterseits glänzend. Der Augenring ist rothbraun, der Schnabel roth, der Unterschnabel an der Wurzel schwarz, der Fuß braun. Beim Weibchen sind der Vorderkopf und die Oberseite rehbraun, die Unterteile gelbbraun, am lebhaftesten auf Kopf, Brust und Bauch, die Haube, die Außenfahne der Schwingen, die Deckfedern und der Schwanz düster scharlachroth, Kinn und Kehle grauschwärzlich.
Das Verbreitungsgebiet umfaßt die südlichen Vereinigten Staaten, Mejiko und Kalifornien. In gelinden Wintern verweilt er jahraus, jahrein an demselben Orte; bei strengerer Witterung wandert er. Wegen seines prachtvollen Gefieders fällt er schon von weitem in die Augen und bildet eine wahre Zierde des Waldes. Nach Prinz von Wied hält er sich am Tage gern in den dichtverworrenen Zweigen der Schlingpflanzen auf und streift von hier aus nach den benachbarten Feldern und Gärten; man begegnet ihm daher ebensowohl in der Nachbarschaft der Städte als im tiefsten und einsamsten Walde. »Ihr seht ihn«, sagt Audubon, »in unseren Feldern, Baumgängen und Gärten, ja oft genug im Inneren unserer südlichen Städte und Dörfer: es ist sogar ein seltener Fall, daß man in einen Garten kommt, ohne einen der rothen Vögel zu gewahren. Aber wo er auch sein mag, er ist überall willkommen, der Liebling jedermanns, so glänzend ist sein Gefieder, so reich sein Gesang.« Während des Sommers lebt er paarweise, im Herbste und Winter dagegen in kleinen Gesellschaften. Bei strenger Kälte kommt er, wenn er im Lande bleibt, nicht selten in das Gehöft des Bauern und pickt hier vor der Scheuer mit Sperlingen, Tauben, Schneevögeln, Ammerfinken und anderen Gesäme auf, dringt in offene Ställe und Böden oder sucht an den Einhegungen der Gärten und Felder nach Nahrung. Mit seinem dicken Schnabel weiß er die harten Körner des Mais geschickt zu zerkleinern, Hafer zu enthülsen und Weizen zu zermalmen; in einem benachbarten Heuschober oder einem dichtwipfeligen Baume findet er eine geeignete Nachtherberge, und so übersteht er den Winter ziemlich leicht. Unruhig und unstet, hält er so sich nur minutenlang an einer und derselben Stelle auf, sonst hüpft und fliegt er hin und her, auf dem Boden mit ziemlicher Geschicklichkeit, im Gezweige mit großer Gewandtheit. Der Flug ist hart, schnell, ruckweise und sehr geräuschvoll, wird aber ungern weit ausgedehnt. Wechselseitiges Ausbreiten und Zusammenlegen, Zucken und Wippen des Schwanzes begleitet ihn, wie alle übrigen Bewegungen. Wenn er wandert, reist er theilweise zu Fuße, hüpft und schlüpft von Busch zu Busch und fliegt von einem Walde zum anderen.
Während der Paarzeit stürzen sich die Männchen mit Wuth auf jeden Eindringling in ihr Gehege, folgen ihm unter schrillem Geschrei von Busch zu Busch, fechten heftig in der Luft mit ihm und ruhen nicht eher, als bis der Fremde ihr Gehege verlassen hat. Innig ist die Anhänglichkeit der Gatten. »Als ich«, sagt Audubon, »gegen Abend eines Februartages das Männchen eines Paares im Stellbauer gefangen hatte, saß am anderen Morgen das Weibchen dicht neben dem Gefangenen, und später fing es sich auch noch.« Der Nistplatz ist ein Busch oder ein Baum nahe am Gehöfte, inmitten des Feldes, am Waldrande oder im Dickichte. Nicht selten findet man das Nest in unmittelbarer Nähe eines Bauernhauses und oft nur wenige Meter entfernt von dem eines Spottvogels. Es besteht aus trockenen Blättern und Zweigen, namentlich stacheligen Reisern, welche mit Halmen und Rebenschlingen verbunden, innen aber mit zarten Grashalmen ausgelegt sind. Vier bis sechs Eier von schmutzigweißer Farbe, über und über mit olivenbraunen Flecken gezeichnet, bilden das Gelege. Sie haben Aehnlichkeit in der Färbung mit denen der Kalanderlerche oder mit denen unseres gemeinen Haussperlings, ändern aber sehr ab: Gerhardt versichert, daß man fast niemals ein Gelege finde, in welchem alle von gleicher Färbung wären. In den nördlicheren Staaten brütet das Paar selten mehr als einmal, in den südlichen zuweilen dreimal im Jahre. Die Jungen werden nur wenige Tage von ihren Eltern geführt, dann aber ihrem Schicksale überlassen.
Allerlei Körner, Getreide- und Grassämereien, Beeren und wahrscheinlich auch Kerbthiere bilden die Nahrung. Im Frühlinge verzehrt er die Blüten des Zuckerahorns, im Sommer Holderbeeren, nebenbei jagt er eifrig nach Käfern, Schmetterlingen, Heuschrecken, Raupen und anderen Kerbthieren. Nach Wilson soll Mais seine Hauptnahrung sein, und er außerdem den Kirschen, Aepfeln und Beeren der Kerne wegen sehr nachgehen.
Die amerikanischen Forscher rühmen ziemlich einstimmig den Gesang; wir hingegen finden nicht, daß dieser begeistern könne. »Die Töne des Kardinals«, sagt Wilson, »sind denen der Nachtigall vollständig gleich. Man hat ihn oft ›Virginische Nachtigall‹ genannt, und er verdient seinen Namen wegen der Klarheit und Verschiedenheit seiner Töne, welche ebenso wechselnd als klangvoll sind.« In gleichem Sinne spricht sich Audubon aus. »Der Gesang ist zuerst laut und klar und erinnert an die schönsten Töne des Flageolets; mehr und mehr aber sinkt er herab, bis er gänzlich erstirbt. Während der Zeit der Liebe wird das Lied dieses prachtvollen Sängers mit großer Macht vorgetragen. Er ist sich seiner Kraft bewußt, schwellt seine Brust, breitet seinen rosigen Schwanz, schlägt mit seinen Flügeln und wendet sich abwechselnd zur Rechten und zur Linken, als müsse er sein eigenes Entzücken über die wundervollen Töne seiner Stimme kundgeben. Von neuem und immer von neuem werden diese Weisen wiederholt; denn der Vogel schweigt nur, um Luft zu schöpfen. Man hört ihn lange, bevor die Sonne den Himmel im Osten vergoldet, bis zu der Zeit, wenn das flammende Gestirn Licht und Wärme herniedersendet und alle Vögel zu zeitweiliger Ruhe zwingt; sobald die Natur aber wieder aufathmet, beginnt der Sänger von neuem und ruft, als habe er niemals seine Brust angestrengt, das Echo wach in der ganzen Nachbarschaft, ruht auch nicht eher, als bis die Abendschatten um ihn sich verbreiten. Tag für Tag verkürzt der Rothvogel das langweilige Geschäft des brütenden Weibchens, und von Zeit zu Zeit stimmt auch dieses mit ein mit der Bescheidenheit ihres Geschlechtes. Wenige von uns verweigern diesem ansprechenden Sänger den Zoll der Bewunderung. Wie erfreulich ist es, wenn bei bedecktem Himmel Dunkel die Wälder deckt, so daß man meint, die Nacht sei schon hereingebrochen, wie erfreulich, plötzlich die wohlbekannten Töne dieses Lieblingsvogels zu vernehmen! Wie oft habe ich mich dieses Vergnügens erfreut, und wie oft möchte ich mich dessen noch erfreuen!«
Auch ich will gern zugestehen, daß der Gesang eines alten guten Kardinals zu den besten zählt, welche man aus dem Schnabel eines Körnerfressers hören kann, und sich ebensowohl durch die Reinheit und Fülle der Töne wie durch Verschiedenheit und Mannigfaltigkeit der Strophen auszeichnet, darf aber nicht verschweigen, daß derselbe Vogel durch fortwährendes Ausstoßen des scharfen Locktones »Zitt«, welcher einigermaßen an den der Drossel erinnert, im allerhöchsten Grade unangenehm werden kann. Als Sänger im freien Walde mag die »Virginische Nachtigall« alle Lobsprüche verdienen, als Stubenvogel nimmt sie, obwohl sie sich nicht allzuselten auch im Käfige fortpflanzt, doch immer nur einen untergeordneten Rang ein.
Auf die Papageifinken will ich, eine andere, ausschließlich in Amerika heimische Unterfamilie überspringend, die Gimpel (Pyrrhulinae) folgen lassen. Bezeichnend für sie sind der kurze, dicke, allseitig gewölbte Schnabel mit kleinen Haken am Oberkiefer, der kurze und mittelstarke Fuß, der mittellange, stumpfspitzige Flügel, der meist kurze, wenig ausgeschnittene Schwanz und das mehr oder minder lange und weiche, gewöhnlich sehr zart gefärbte Gefieder.
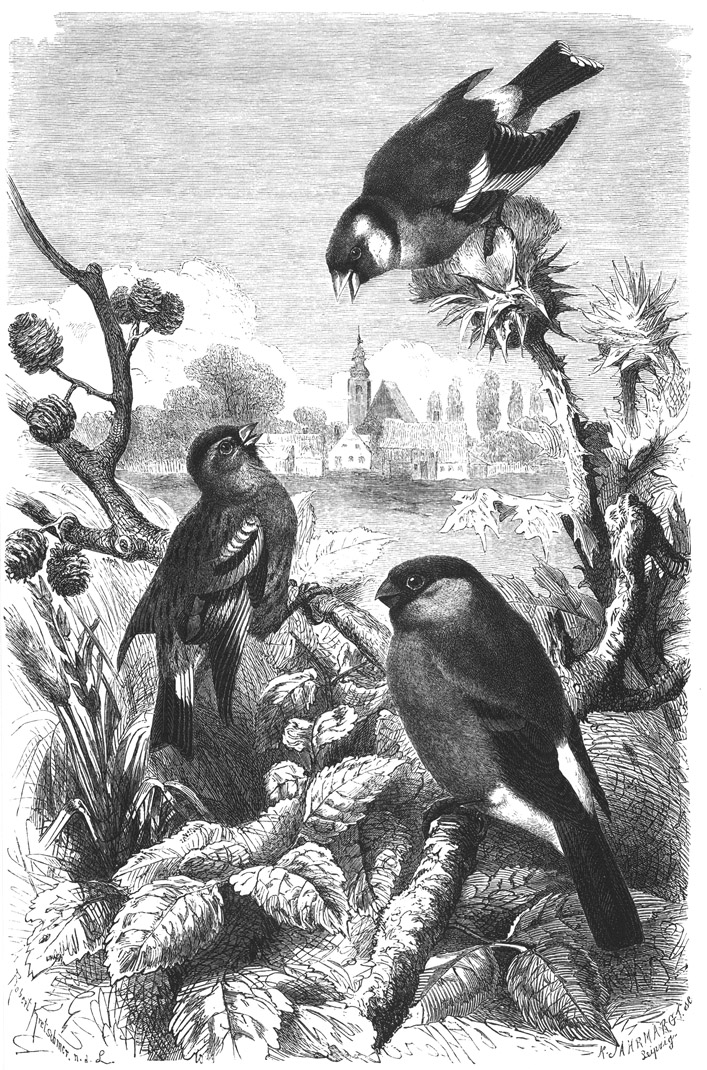
Zeisig, Stieglitz und Gimpel.
Mit Ausnahme Australiens verbreiten sich die Gimpel über alle Erdtheile, gehören jedoch hauptsächlich dem gemäßigten und kalten Gürtel an. Waldungen und Gebüsche, Gärten und einzelne Bäume, Felsen und Wüsten sind ihre Wohnsitze; Körner und Sämereien, Knospen und Blattspitzen bilden ihre Nahrung. In ihren Bewegungen meist ziemlich ungeschickt, mit wenigen Ausnahmen auch als Sänger keineswegs hervorragend, stehen sie anderen Finken durchschnittlich nach, ohne daß man jedoch irgend eine ihrer Begabungen als verkümmert bezeichnen könnte.
Einige Naturforscher zählen die Girlitze (Serinus) zu den Finken, andere zu den Gimpeln, woraus hervorgeht, daß sie als Mittelglieder zwischen beiden angesehen werden dürfen. Ihr Schnabel ist klein, kurz, dick und stumpfspitzig, oben wenig gewölbt, an den bogenförmigen Schneiden eingezogen, vor der Spitze seicht ausgeschnitten, der Fuß ziemlich kurzläufig und nicht eben langzehig, mit kleinen, flach gebogenen, aber spitzigen Nägeln bewehrt, der Flügel mäßig lang und spitzig, in ihm die zweite und dritte Schwinge die längsten, der Schwanz mittellang und am Ende ziemlich tief eingeschnitten.
Der in Deutschland heimische Vertreter der Sippe ist der Girlitz (Serinus hortulanus, flavescens, brumalis, orientalis, meridionalis, islandicus und occidentalis, Fringilla serinus und islandica, Pyrrhula und Dryospiza serinus). Seine Länge beträgt einhundertfünfundzwanzig, seine Breite zweihundertundzehn, seine Fittiglänge siebenundsechzig, seine Schwanzlänge funfzig Millimeter. Die vorherrschende Färbung des Gefieders ist ein schönes Grün; Hinterkopf, Rücken und Schultern sind grüngelb, durch verwaschene schwärzliche Längsflecke gezeichnet, die Stirne, ein Augenstreifen und ein Nackenring, der Bürzel und die Untertheile blaß goldgelb, nach dem Bauche zu sich lichtend und auf den Unterschwanzdecken in Weiß übergehend, die Brust und Bauchseiten mit großen, dunkelschwarzen Längsflecken gezeichnet, die Handschwingen schwarzbraun, außen schmal grünlichgelb und an der Spitze weißlich gesäumt, die Armschwingen ebenso, aber breiter gesäumt und gekantet, die Schulterfedern sehr breit grünlichweiß gesäumt und gekantet, die kleinen Oberflügeldeckfedern zeisiggrün, die großen weißlich gesäumt und mit breitem weißgelbem Spitzensaume geziert, wodurch ein lichter Querstreifen über dem Flügel gebildet wird, die Steuerfedern braunschwarz, innen weißlich-, außen grünlichgelb gesäumt. Der Augenring ist hellbraun, der Schnabel horngrau, unterseits röthlichgrau, der Fuß gelblich fleischfarben. Bei dem kleineren Weibchen ist das der Hauptfärbung nach grüngelbe Gefieder fast überall mit schwarzen Längsflecken gezeichnet. Die Jungen ähneln den Weibchen, unterscheiden sich aber durch sehr blasse, fast weißliche Grundfärbung.
Ursprünglich im Süden Europas und in Kleinasien heimisch, hat sich der Girlitz allmählich nach Norden hin verbreitet, thut dies auch gegenwärtig noch und bürgert sich, weiter und weiter vorschreitend, in Gebieten ein, in denen er vor einem Menschenalter vollständig fehlte. In den letztvergangenen zwanzig Jahren hat er sich fast den ganzen österreichischen Kaiserstaat erobert und ebenso in derselben Zeit in Schlesien, Franken und Thüringen angesiedelt, ist im Jahre 1877 auch in der Mark erschienen und wird sich hier wahrscheinlich ebenso gut seßhaft machen, als er dies anderswo gethan hat.
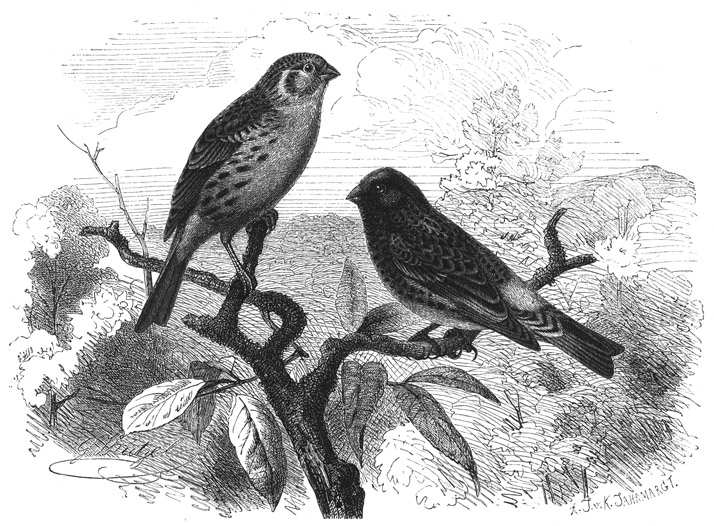
Girlitz und Goldstirngirlitz ( Serinus hortulanus und pusillus). ½ natürl. Größe.
Im Taurus gesellt sich ihm der von hier und dem Kaukasus an über Persien und Turkestan bis Ladak verbreitete, auch in Südosteuropa vorkommende Goldstirngirlitz ( Serinus pusillus und aurifrons, Passer pusillus, Fringilla pusilla und rubrifrons, Emberiza aurifrons und auriceps, Oraegithus pusillus, Pyrrhula und Metoponia pusilla), welcher, der etwas längeren Flügel halber, auch wohl als Vertreter einer besonderen Untersippe, der Zeisiggirlitze ( Oraegithus), angesehen wird. Seine Länge beträgt etwa elf, die Fittiglänge sieben, die Schwanzlänge fünf Centimeter. Das Gefieder ist auf dem Vorderkopfe dunkel orangeroth, am übrigen Kopfe und Halse sowie auf der Oberbrust düster bräunlichschwarz, auf dem Rücken, den Brust- und Bauchseiten ebenso, jede Feder aber breit hellgelb umrandet, auf dem Bürzel orangegelb, auf dem Bauche gelb, in den Weichen schwarz längs gestrichelt; die Handschwingen sind braungrau, außen schmal citrongelb, die Schulterfedern schwarzbraun, breit gilblichweiß gesäumt und am Ende weißlich umrandet, die Oberflügeldecken goldbräunlich, die größeren am Ende weiß gesäumt, wodurch eine Flügelbinde entsteht, die Schwanzfedern schwarzbraun, außen citrongelb gesäumt und wie die dunkleren Oberschwanzdecken weiß umrandet, die Unterschwanzdecken weiß. Die Iris ist braun, der Schnabel schwarz, der Fuß schwarzbraun. Dem minder lebhaft gefärbten Weibchen fehlt das Schwarz am Kopfe.
Bei uns zu Lande ist der Girlitz ein Wandervogel, welcher regelmäßig im Frühjahre, und zwar in den letzten Tagen des März oder in den ersten Tagen des April erscheint und bis in den Spätherbst verweilt. In ganz Südeuropa streicht er während des Winters höchstens von einem Orte zum anderen, ohne jedoch eine wirkliche Wanderung zu unternehmen. Hier tritt er überall häufiger auf als in Deutschland, bevölkert jede Oertlichkeit und fehlt selbst ziemlich hohen Berggipfeln nicht. Baumgärten, in deren Nähe Gemüsepflanzungen sind, sagen ihm am meisten zu; deshalb findet er sich in Deutschland an einzelnen Stellen sehr häufig, während er an anderen, nahe liegenden nicht vorkommt.
Der Girlitz ist ein schmucker, lebendiger und anmuthiger Vogel, immer munter und gutgelaunt, gesellig und friedliebend, so lange die Liebe nicht trennt, vereinzelt und zum Kampfe treibt. Die ersten Ankömmlinge bei uns sind stets Männchen; die Weibchen folgen später nach. Erstere machen sich sogleich durch ihren Gesang und ihr unruhiges Treiben bemerkbar, setzen sich auf die höchsten Baumspitzen, lassen die Flügel hängen, erheben den Schwanz ein wenig, drehen sich beständig nach allen Seiten und singen dabei sehr eifrig. Nur wenn der Frühling kalt, windig oder regnerisch ist, verändert sich die Sache; »dann macht das Vögelchen«, wie Alexander von Homeyer sagt, »ein ganz anderes Gesicht. Es hält sich niedrig, um Schutz gegen die Witterung zu finden, und lockt nur hier und da leise und verstohlen aus einem Strauche heraus oder trippelt der Nahrung halber auf der Erde neben einem Meldenstrauche, ohne bei seiner schlechten Laune viel Wesens und Lärm zu machen. So kann es bei anhaltend ungünstiger Witterung kommen, daß schon viele Girlitze vorhanden sind, ohne daß man viel von ihnen sieht, während sie dann bei dem ersten Sonnenscheine in Unzahl von allen hohen Bäumen herabsingen.« Je näher die Begattungszeit kommt, um so eifriger trägt der Vogel sein Liedchen vor, und um so sonderbarer geberdet er sich. Nicht genug, daß er mit den zärtlichsten Tönen um Liebe bittet, er legt sich auch wie ein Kukuk platt auf einen Ast, sträubt die Kehlfedern, wie ein balzender Hahn, breitet den Schwanz weit aus, dreht und wendet sich, erhebt sich plötzlich, steigt in die Luft, flattert, ungleichmäßig schwankend, fledermausartig um den Baum, wirft sich bald nach der einen, bald nach der anderen Seite und kehrt dann auf den früheren Sitzplatz zurück, um seinen Gesang fortzusetzen. Andere Männchen in der Nähe wecken die Eifersucht des Sängers; dieser bricht plötzlich ab und stürzt sich erbost auf den Gegner; letzterer entflieht in behendem Fluge: und so jagen sich beide wüthend längere Zeit umher, durch die belaubten Bäume hindurch oder auch sehr nahe über den Boden hinweg, wobei sie ohne Unterbrechung ihren Zorn durch ein helles »Sisisi« bekunden. Erst nach langwierigem Kampfe, und wenn das Weibchen brütet, endet dieser Zank und Streit. Den Gesang vergleicht Hoffmann treffend mit dem Gesange der Heckenbraunelle und deutet an, daß der einzige Unterschied, welcher zwischen beider Liedern bemerkt wird, wohl nur auf den dickeren Finkenschnabel zurückzuführen sei, welcher die Töne selbst verhärtet. Ausgezeichnet kann man das Lied gerade nicht nennen: es ist zu einförmig und enthält zu viel schwirrende Klänge; doch muß ich gestehen, daß es mich immer angesprochen hat. Der Name »Hirngritterl« ist gewissermaßen ein Klangbild desselben.
Das Nest, ein kleiner, dem unseres Edelfinken am meisten ähnelnder Kunstbau, ist ziemlich verschieden zusammengesetzt, zuweilen fast nur aus dünnen Würzelchen, zuweilen aus Halmen, Gras und Heu erbaut, und innen äußerst fein und weich mit Haaren und Federn ausgelegt. Es steht bald höher, bald tiefer, immer aber möglichst verborgen im dichten Gezweige eines Busches oder Baumes. Nach Hoffmann soll der Girlitz eine ganz besondere Vorliebe für den Birnbaum zeigen und auf diesem, wo es nur immer angeht, sein Nest anlegen; er brütet aber auch auf Apfel- und Kirsch- oder auf Nadelbäumen, und nach den neueren Beobachtungen nicht minder auf Schwarzholz, zeigt sich überhaupt in dieser Beziehung nicht wählerisch. In Spanien zieht er Citronen- und Apfelsinenbäume allen übrigen vor, bindet sich jedoch keineswegs an sie allein. Das Gelege enthält vier bis fünf kleine, stumpfbauchige, sechzehn Millimeter lange, zwölf Millimeter dicke Eier, welche auf schmutzigweißem oder grünlichem Grunde überall, am stumpfen Ende jedoch mehr als an der Spitze, mit mattbraunen, rothen, rothgrauen, purpurschwarzen Punkten, Flecken und Schnörkeln gezeichnet sind. In Spanien fand ich vom April bis zum Juli fortwährend frisch gelegte Eier; in Deutschland beginnt die Brutzeit um die Mitte des April. Höchst wahrscheinlich macht ein und dasselbe Paar mindestens zwei Bruten im Jahre. So lange das Weibchen brütet, wird es von dem Männchen aus dem Kropfe gefüttert. »Wenn es nun Hunger hat«, sagt Hoffmann, »so ruft es das Männchen, und zwar mit demselben Tone, welchen dieses bei seinen Minnekämpfen hören läßt, nur etwas leiser.« Es brütet sehr fest und bleibt ruhig sitzen, wenn tagelang Feld- oder Gartenarbeiten unter seinem Neste versehen werden. Nach ungefähr dreizehn Tagen sind die Eier gezeitigt und die Jungen ausgeschlüpft. So lange sie im Neste sitzen, verlangen sie durch ein leises »Zickzick« oder »Sittsitt« nach Nahrung. Gegen das Ende ihres Wachsthums hin werden sie sehr unruhig, und oft fliegen sie früher aus, als sie sollten. Die Eltern füttern sie eine Zeitlang noch eifrig, auch wenn man sie in einen Bauer kerkert und diesen in der Nähe des Nestplatzes aufhängt. Nach der Brutzeit gesellen sich die vereinzelten Paare nebst ihren Jungen den früher ausgeflogenen und gescharten, vereinigen sich auch wohl mit Stieglitzen, Hänflingen, Feldsperlingen und anderen Familienverwandten, treten mit letzteren jedoch nicht in engeren Verband, sondern bewahren sich stets eine gewisse Selbständigkeit. Diese Schwärme streifen fortan im Lande umher und suchen gemeinsam ihre Nahrung, welche fast nur aus feinen Sämereien und Pflanzenschossen besteht, ohne dem Menschen irgendwie lästig zu werden.
Bei uns zu Lande wird der Girlitz, von den kleinen Raubthieren und einzelnen Liebhabern abgesehen, nicht befehdet, in Spanien dagegen auf den sogenannten Sperlingsbäumen zu tausenden gefangen und verspeist. Man überzieht Esparto, ein hartbinsiges Gras, mit Vogelleim, streut dasselbe massenhaft auf einzeln stehende, den Finkenschwärmen zu Ruhesitzen dienende Feldbäume und erzielt oft überraschende Erfolge. Von den zahlreichen Finkenschwärmen, welche sich auf solchem Baume niederlassen, entgeht zuweilen kaum der vierte Theil den verrätherischen Ruthen; und nicht allein der Girlitz, sondern auch andere Finken, ja selbst Adler, fallen dem Fänger zum Opfer. Im Käfige ist unser Vögelchen recht angenehm, dauert jedoch nicht so gut aus, als man von vornherein annehmen möchte.
»Dreihundert Jahre sind verflossen«, sagt Bolle, »seit der Kanarienvogel durch Zähmung über die Grenzen seiner wahren Heimat hinausgeführt und Weltbürger geworden ist. Der gesittete Mensch hat die Hand nach ihm ausgestreckt, ihn verpflanzt, vermehrt, an sein eigenes Schicksal gefesselt und durch Wartung und Pflege zahlreich auf einander folgender Geschlechter so durchgreifende Veränderungen an ihm bewirkt, daß wir jetzt fast geneigt sind, mit Linné und Brisson zu irren, indem wir in dem goldgelben Vögelchen das Urbild der Art erkennen möchten und darüber die wilde, grünliche Stammart, welche unverändert geblieben ist, was sie von Anbeginn her war, beinahe vergessen haben. Das helle Licht, in dem der zahme Kanarienvogel vor uns steht, die genaue und erschöpfende Kenntnis, welche wir von seinen Sitten und Eigenthümlichkeiten besitzen, scheint neben der Entfernung, in welcher der wilde von uns lebt, die Hauptursache der ziemlich geringen Auskunft zu sein, welche wir über letzteren besitzen.«
Es bedurfte eines Bolle, um das Freileben des Kanarienvogels zu schildern. Alle Naturforscher vor ihm, Alexander von Humboldt allein ausgenommen, berichten uns wenig oder, wenn überhaupt etwas, wahres und falsches so verquickt, daß es schwer hält, das eine von dem anderen zu trennen. Erst Bolle's Schilderung, welche ich nachstehend im Auszuge wiedergebe, bietet uns ein ebenso treues als farbenreiches Bild des wichtigen Vogels. Unser Forscher fand diesen auf den fünf Waldinseln der Kanarischen Gruppe, Gran Canaria, Teneriffa, Gomera, Palma und Ferro, glaubt aber, daß derselbe früher noch auf mehreren anderen, jetzt entwaldeten Inseln vorgekommen sein mag, ebenso wie er auf Madeira und den Inseln des Grünen Vorgebirges heimisch ist. Auf den genannten Eilanden lebt er überall, wo dicht wachsende Bäume mit Gestrüpp abwechseln, vorzugsweise längs der mit üppigem Grün umsäumten Wasserbetten jener Inseln, welche während der Regenzeit Bäche sind, während der trockenen Zeit aber versiegen, nicht minder häufig in den Gärten um die Wohnungen des Menschen. Seine Verbreitung erstreckt sich von der Meeresküste bis zu über fünfzehnhundert Meter unbedingter Höhe im Gebirge hinauf. Wo die Bedingungen zu seinem Wohlbefinden gegeben, ist er überall häufig, in den Weinbergen der Inseln gemein, auch in Kieferbeständen, welche die Abhänge des Gebirges bekleiden, nicht selten; nur das Innere des schattigen Hochwaldes, dessen Ränder er noch bevölkert, scheint er zu meiden.
Der wilde Kanarienvogel, welcher auch in seiner Heimat von Spaniern und Portugiesen » Canario« genannt wird ( Serinus canarius, Fringilla und Crithagra canaria), ist merklich kleiner und gewöhnlich auch etwas schlanker, als derjenige, welcher in Europa gezähmt unterhalten wird. Seine Länge beträgt zwölf bis dreizehn Centimeter, die Fittiglänge zweiundsiebzig, die Schwanzlänge sechzig Millimeter. Beim alten Männchen ist der Rücken gelbgrün mit schwärzlichen Schaftstrichen und sehr breiten, hell aschgrauen Federrändern, welche beinahe zur vorherrschenden Färbung werden, der Bürzel gelbgrün, das Oberschwanzdeckgefieder aber grün, aschgrau gerandet; Kopf und Nacken sind gelbgrün mit schmalen grauen Rändern, die Stirne und ein breiter Augenstreifen, welcher nach dem Nacken zu kreisförmig verläuft, grünlich goldgelb, ebenso Kehle und Oberbrust, die Halsseiten dagegen aschgrau. Die Brustfärbung wird nach hinten hin heller, gilblicher; der Bauch und die Untersteißfedern sind weißlich, die Schultern schön zeisiggrün, mattschwarz und blaßgrünlich gebändert, die schwärzlichen Schwungfedern schmal grünlich, die schwarzgrauen Schwanzfedern weißlich gesäumt. Der Augenring ist dunkelbraun; Schnabel und Füße sind bräunlich fleischfarben. Bei dem Weibchen sind die Obertheile braungrau, mit breiten schwarzen Schaftstrichen, die Federn des Nackens und Oberkopfes ebenso gefärbt, am Grunde aber hellgrün, die Stirnfedern grün, die Zügel grau, die Wangen theils grüngelb, theils aschblaugrau, die Schulter- und kleinen Oberflügelfedern licht gelbgrün, die großen Flügeldecken wie die Schwingen dunkelfarbig, grünlich gesäumt, Brust und Kehle grünlich goldgelb, ihrer weißgrauen Federränder halber aber weniger schön als bei dem alten Männchen, Unterbrust und Bauch weiß, die Körperseiten bräunlich mit dunkleren Schaftstrichen. Das Nestkleid ist bräunlich, an der Brust ins Ockergelbe spielend, mit sehr wenig und schwachem Citrongelb an Wangen und Kehle.
Die Nahrung besteht größtentheils, wenn nicht ausschließlich, aus Pflanzenstoffen, feinem Gesäme, zartem Grün und saftigen Früchten, namentlich Feigen. »Wasser ist für den Kanarienvogel gebieterisches Bedürfnis. Er fliegt oft, meist gesellig, zur Tränke und liebt das Baden, bei welchem er sich sehr naß macht, im wilden Zustande ebenso sehr als im zahmen.

Wilder Kanarienvogel ( Serinus canaris). 2/3 natürl. Größe.
»Paarung und Nestbau erfolgen im März, meist erst in der zweiten Hälfte desselben. Nie baute der Vogel in den uns zu Gesicht gekommenen Fällen niedriger als zwei Meter über dem Boden, oft in sehr viel bedeutender Höhe. Für junge, noch schlanke Bäumchen scheint er besondere Vorliebe zu hegen und unter diesen wieder die immergrünen oder sehr früh sich belaubenden vorzüglich gern zu wählen. Der Birn- und der Granatbaum werden ihrer vielfachen und doch lichten Verästelung halber sehr häufig, der Orangenbaum seiner immer dunkeln Krone wegen schon seltener, der Feigenbaum, wie man versichert, niemals zur Brutstätte ausersehen. Das Nest wird sehr versteckt angebracht; doch ist es, namentlich in Gärten, vermöge des vielen Hin- und Herfliegens der Alten und ihres nicht großen Nistgebietes unschwer zu entdecken. Wir fanden das erste uns zu Gesicht gekommene in den letzten Tagen des März 1856 inmitten eines verwilderten Gartens der Villa Orotava, auf einem etwa vier Meter hohen Buchsbaume, welcher sich über einer Myrtenhecke erhob. Es stand, nur mit dem Boden auf den Aesten ruhend, in der Gabel einiger Zweige und war unten breit, oben sehr eng mit äußerst zierlicher Rundung, nett und regelmäßig gebaut, durchweg aus schneeweißer Pflanzenwolle zusammengesetzt und nur mit wenigen dürren Hälmchen durchwebt. Das erste Ei wurde am dreißigsten März, dann täglich eines hinzu gelegt, bis die Zahl von fünfen beisammen war, welches die regelmäßige Zahl des Geleges zu sein scheint, obwohl wir in anderen Fällen nur drei bis vier Eier, nie aber mehr als fünf, in einem Neste gefunden haben. Die Eier sind blaß meergrün und mit röthlichbraunen Flecken besäet, selten beinahe oder ganz einfarbig. Sie gleichen denen des zahmen Vogels vollkommen. Ebenso hat die Brutzeit durch die Zähmung keine Veränderung erlitten; sie dauert beim wilden Kanarienvogel ebenfalls ungefähr dreizehn Tage. Die Jungen bleiben im Neste, bis sie vollständig befiedert sind, und werden noch eine Zeitlang nach dem Ausfliegen von beiden Eltern, namentlich aber vom Vater, aufs sorgsamste aus dem Kropfe gefüttert. Die Anzahl der Bruten, welche in einem Sommer gemacht werden, beträgt in der Regel vier, mitunter auch nur drei.«
Sämmtliche Nester, welche Bolle beobachtete, waren auf gleich saubere Weise aus Pflanzenwolle zusammengesetzt; in einzelnen fand sich kaum ein Grashalm oder Rindenstückchen zwischen der glänzenden Pflanzenwolle. »Das Männchen sitzt, während das Weibchen brütet, in dessen Nähe, am liebsten hoch auf noch unbelaubten Bäumen, im ersten Frühlinge gern auf Akazien, Platanen oder echten Kastanien, Baumarten, deren Blattknospen erst spät sich öffnen, oder auch auf dürren Zweigspitzen, wie sie die Wipfel der in Gärten und in der Nähe der Wohnungen so allgemein verbreiteten Orangen nicht selten aufzuweisen haben. Von solchen Standpunkten aus läßt es am liebsten und längsten seinen Gesang hören.
»Es ist viel über den Werth des Gesanges geredet worden. Von einigen überschätzt und allzuhoch gepriesen, ist er von anderen einer sehr strengen Beurtheilung unterzogen worden. Man entfernt sich nicht von der Wahrheit, wenn man die Meinung ausspricht, die wilden Kanarienvögel sängen wie in Europa die zahmen. Der Schlag dieser letzteren ist durchaus kein Kunsterzeugnis, sondern im großen ganzen geblieben, was er ursprünglich war. Einzelne Theile des Gesanges hat die Erziehung umgestalten und zu glänzenderer Entwickelung bringen, andere der Naturzustand in größerer Frische und Reinheit bewahren mögen: das Gepräge beider Gesänge aber ist noch jetzt vollkommen übereinstimmend und beweist, daß, mag ein Volk auch seine Sprache verlieren können, eine Vogelart dieselbe durch alle Wandlungen äußerer Verhältnisse unversehrt hindurchträgt. So weit das unbefangene Urtheil. Das befangene wird bestochen durch die tausend Reize der Landschaft, durch den Zauber des Ungewöhnlichen. Was wir vernehmen, ist schön; aber es wird schöner noch und klangreicher dadurch, daß es nicht im staubigen Zimmer, sondern unter Gottes freiem Himmel erschallt, da, wo Rosen und Jasmin um die Cypresse ranken und die im Raume verschwimmenden Klangwellen das Harte von sich abstreifen, welches an dem meist in zu großer Nähe vernommenen Gesange des zahmen Vogels tadelnswerth erscheint. Und doch begnügt man sich nicht, mit dem Ohre zu hören; unvermerkt vernimmt man auch durch die Einbildungskraft, und so entstehen Urtheile, welche später bei anderen Enttäuschungen hervorrufen. So wenig wie alle Hänflinge und Nachtigallen oder alle zahmen Kanarienvögel gleich gute Schläger sind, darf man dies von den wilden fordern. Auch unter ihnen gibt es stärkere und schwächere; das aber ist unsere entschiedene Ansicht, die Nachtigallentöne oder sogenannten Rollen, jene zur Seele dringenden tiefen Brusttöne, haben wir nie schöner vortragen hören als von wilden Kanarienvögeln und einigen zahmen der Inseln, die bei jenen in der Lehre gewesen. Nie werden wir in dieser Hinsicht die Leistungen eines wundervoll hochgelben Männchens von Gran Canaria, welches wir als Geschenk eines Freundes eine Zeitlang besaßen, zu vergessen im Stande sein. Am meisten möge man sich hüten, den Naturgesang des Kanarienvogels nach dem oft stümperhaften sehr jung gefangener, welche im Käfige ohne guten Vorschläger aufwuchsen, zu beurtheilen.
»Der Flug des Kanarienvogels gleicht dem des Hänflings. Er ist etwas wellenförmig und geht meist in mäßiger Höhe von Baum zu Baum, wobei, wenn der Vogel schwarmweise fliegt, die Glieder der Gesellschaft sich nicht dicht aneinander drängen, sondern jeder sich in einer kleinen Entfernung von seinem Nachbar hält und dabei einen abgebrochenen, oft wiederholten Lockruf hören läßt. Die Scharen, in welche sie sich außer der Paarungszeit zusammenthun, sind zahlreich, lösen sich aber den größten Theil des Jahres hindurch in kleinere Flüge auf, welche an geeigneten Orten ihrer Nahrung nachgehen und sehr häufig längere Zeit auf der Erde verweilen, vor Sonnenuntergang aber gern wieder sich zusammenschlagen und eine gemeinschaftliche Nachtherberge suchen.
»Der Fang dieser Thierchen ist sehr leicht; zumal die Jungen gehen fast in jede Falle, sobald nur ein Lockvogel ihrer Art daneben steht: ein Beweis mehr für die große Geselligkeit der Art. Ich habe sie in Canaria sogar einzeln in Schlagnetzen, deren Locker nur Hänflinge und Stieglitze waren, sich fangen sehen. Gewöhnlich bedient man sich, um ihrer habhaft zu werden, auf den Kanaren eines Schlagbauers, welcher aus zwei seitlichen Abtheilungen besteht, den eigentlichen Fallen mit aufstellbarem Trittholze, getrennt durch den mitten inne befindlichen Käfig, in welchem der Lockvogel sitzt. Dieser Fang wird in baumreichen Gegenden, wo Wasser in der Nähe ist, betrieben und ist in den frühen Morgenstunden am ergiebigsten. Er ist, wie wir aus eigener Anschauung wissen, ungemein anziehend, da er dem im Gebüsche versteckten Vogelsteller Gelegenheit gibt, die Kanarienvögel in größter Nähe zu beobachten und sich ihrer anmuthigen Bewegungen und Sitten ungesehen zu erfreuen. Wir haben auf diese Weise binnen wenigen Stunden sechzehn bis zwanzig Stück, eines nach dem anderen, fangen sehen; die Mehrzahl davon waren indeß noch unvermauserte Junge. Besäße man, was nicht der Fall ist, auf den Inseln ordentlich eingerichtete Vogelherde, so würde der Ertrag natürlich noch ein weit lohnenderer sein.
»Wir haben Kanarienwildlinge genug in der Gefangenschaft beobachtet und mitunter deren ein bis anderthalb Dutzend auf einmal besessen. Der Preis junger, bereits ausgeflogener Vögel pflegt in Santa Cruz, wenn man mehrere auf einmal nimmt, etwa fünfundzwanzig Pfennige für das Stück zu betragen. Frisch gefangene alte Männchen werden mit einer Mark bezahlt. In Canaria sind, trotz der daselbst herrschenden größeren Billigkeit, die Preise um vieles höher, was allein schon hinreichen würde, ihre größere Seltenheit dort darzuthun. Es sind unruhige Vögel, welche längere Zeit brauchen, ehe sie ihre angeborene Wildheit ablegen, und sich, besonders in engen Käfigen zu mehreren zusammengesperrt, das Gefieder leicht zerstoßen. Sie schnäbeln sich sehr gern unter einander, und die jungen Männchen geben sich binnen kurzem durch fortgesetztes lautes Zwitschern zu erkennen. Kaum gibt es einen weichlicheren Körnerfresser. Man verliert die meisten an Krämpfen, deren zweiter oder dritter Anfall mit dem Tode zu endigen pflegt. Die wilden Hähnchen gehen mit großer Leichtigkeit Verbindungen mit der gezähmten Art ein und werden äußerst treue, liebevolle Gatten, welche nicht aufhören, die Dame ihres Herzens aufs zärtlichste zu füttern, meist sogar die Nacht auf dem Neste derselben sitzend zuzubringen. Sie bieten jedem anderen Vogel, welcher ihnen zu nahe kommt, die Spitze; ja ein älteres Männchen, dem beim Kampfe mit einem Grünlinge von diesem doppelt stärkeren Gegner der Beinknochen durchbissen worden war, hörte in diesem beklagenswerthen Zustande nicht auf, durch schmetternden Gesang seinem Widersacher aufs neue den Handschuh vor die Füße zu schleudern und konnte nur durch rasche Entfernung aus dem Gesellschaftsbauer gerettet werden. Die Mischlinge beider Arten heißen in Teneriffa Verdegais und werden besonders hoch geschätzt. Wir haben von einer hochgelben Mutter gefallene gesehen, die sich durch große Schönheit und ganz ungewöhnliche Zeichnung empfahlen. Sie waren am Oberleibe dunkelgrün, unten von der Kehle an rein goldgelb gefärbt. Diese Vögel galten für etwas außerordentliches und seltenes. In den Hecken, die auf den Kanaren von zahmen und wilden angelegt werden, befolgt man den Grundsatz einem Männchen letzterer Art seiner großen Thatkraft wegen stets zwei Weibchen zu gesellen.«
Eine Schilderung des zum Hausthiere gewordenen Kanarienvogels muß ich an dieser Stelle versagen, darf dies wohl auch unbedenklich thun, da in den letzten Jahren so viel über Kanarienvögel, Kanarienzucht und Kanarienhandel geschrieben worden ist, daß ich meine Leser mit dem zum Ueberdrusse abgehandelten Gegenstande nicht behelligen will.
Ein durch auffallende Schönheit von dem allgemeinen Gepräge abweichender Wüstenvogel mag als Vertreter der Felsengimpel ( Erythrospiza) gelten. Ihn und seine artenarme Sippschaft kennzeichnen der kurze, dicke, oben und unten gewölbte, an den Schneiden eingezogene Schnabel, die kurzen, schwächlichen, ziemlich langzehigen Füße, die langen Flügel, unter deren Schwingen die erste die längste ist, und der kurze, in der Mitte ausgeschnittene Schwanz.
Der Wüstengimpel, Wüstenfink, Wüstentrompeter, Moro ( Erythrospiza githaginea, Fringilla githaginea und thebaica, Pyrrhula githaginea und Payraudaei, Carpodacus crassirostris und Payraudaei, Serinus und Bucanetes githagineus), trägt ein prachtvoll gefärbtes, wie aus Atlasgrau und Rosenroth gemischtes Gefieder. Das Roth gewinnt mit vorschreitendem Alter an Ausdehnung und Stärke und tritt im Frühlinge, wann das Gefieder den höchsten Grad der Ausfärbung erreicht, am vollendetsten auf, so daß es dann den purpurnen Schmelz der unsere Saaten schmückenden Radeblume, welche dem Vogel seinen wissenschaftlichen Namen lieh, an Schönheit weit hinter sich zurückläßt. Gegen den Herbst hin verblaßt es zusehends und ähnelt dann mehr dem Weibchen, dessen Hauptfärbung ein gesättigtes Gelbroth ist. Mannigfache Farbenabstufungen sind zu bemerken: einzelne Männchen erscheinen wie in Blut getaucht, andere sind wüstengrau. Der rothe Farbstoff beschränkt sich nicht auf das Gefieder allein, sondern breitet sich auch über die Oberhaut des Körpers, so daß ein gerupfter Wüstentrompeter als eine wahre kleine »Rothhaut« erscheint. Scheitel und Nacken sind auch im Hochzeitskleide rein aschgrau mit seidenartigem Glanze, Schultern und Rücken mehr oder weniger bräunlich aschgrau mit röthlichem Anfluge, die größeren Flügeldecken blaßbräunlich, breit rosenroth gerandet, die Schwingen und Steuerfedern dunkel braungrau, an der äußersten Fahne karminroth, an der inneren weißlich gesäumt, an der Spitze licht gerandet. Das Weibchen ist am ganzen Oberleibe bräunlichgrau, auf der Unterseite heller grau, röthlich überflogen, auf dem Bauche schmutzig weiß. Die Länge beträgt dreizehn, die Breite zweiundzwanzig, die Fittiglänge neun, die Schwanzlänge fünf Centimeter.
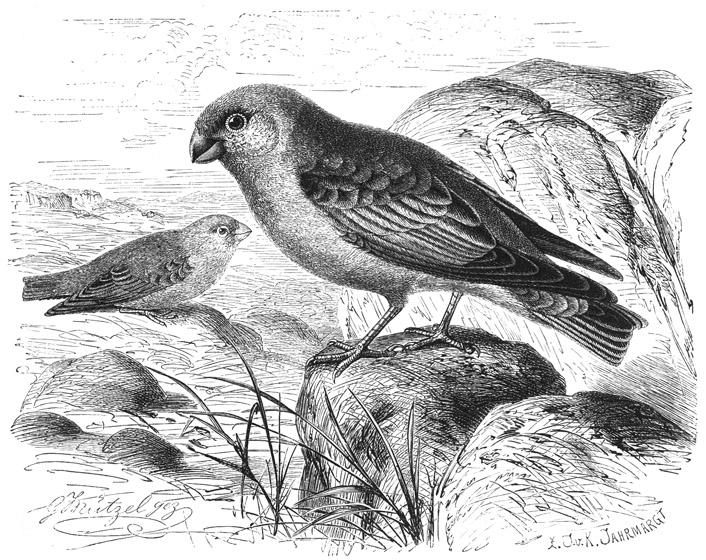
Wüstengimpel (Erythrospiza githaginea). 5/6 natürl. Größe.
Wer die Wohnsitze dieses Gimpels kennen lernen will, muß der Wüste zuwandern; denn ihr ausschließlich, aber ihr im weitesten Sinne, gehört der Vogel an. Bolle fand ihn als häufigen Brutvogel auf den Kanarischen Inseln, und zwar vorzugsweise auf Lanzarote, Fuertaventura und Gran Canaria; ich traf ihn nicht minder häufig in dem größten Theile Oberegyptens und Nubiens bis gegen die Steppen hin, wo er allgemach verschwindet, begegnete ihm aber auch vereinzelt in dem wüstenhaften Arabien; außerdem verbreitet er sich über Persien und Sind. Von seiner Heimat aus besucht er jeden Winter als Gast die Insel Malta, hat sich auch auf die griechischen Inseln, in die Provence und bis nach Toscana verflogen. Die Oertlichkeit, welche er bevorzugt, muß vor allem baumlos und von der heißen Sonne beschienen sein. »Der schüchterne Vogel«, sagt Bolle, welcher auch ihn eingehender als jeder andere vor ihm geschildert hat, »will sein Auge frei über die Ebene oder das Hügelgelände schweifen lassen. Was er vorzieht, sind die dürrsten und steinigsten Orte, wo der in der Mittagshitze aufsteigende Luftstrom über verbranntem Gesteine zittert. Nur wenig Gras, im Sommer verdorrt und gelb gebleicht, darf zwischen den Steinen hervorragen, nur hin und wieder niederes Gestrüppe zerstreut der Erde entsprießen, damit dem Wüstengimpel wohl sei an einer Stelle. Da lebt er denn, mehr Geröll- als Felsenvogel, ein Dickschnäbler mit den Sitten eines Steinschmätzers, stets gesellig, wenn die Sorgen der Fortpflanzung ihn nicht vereinzeln, familienweise oder in kleinen Truppen. Von Stein zu Stein tanzt das muntere Vögelchen, oder es gleitet in meist niedrigem Fluge dahin. Selten vermag der Blick, es weit in die Landschaft hinaus zu verfolgen; denn das röthlichgraue Gefieder der Alten verschmilzt so unmerkbar mit der gleichartigen Färbung der Steine und mehr noch der blattlosen Euphorbienstämme und Zweige wie das Isabell der Jungen mit dem fahlen Gelb von Sand, Tuffstein oder Kalk. Gar bald würden wir seine Spur verlieren, wenn nicht die Stimme, welche eine der größten Merkwürdigkeiten des Vogels ist, unser Wegweiser, ihn aufzusuchen, würde. Horch! ein Ton, wie der einer kleinen Trompete schwingt durch die Luft: gedehnt, zitternd, und wenn unser Ohr ein feines ist und wir gut gehört haben, werden wir diesem seltsamen Klange vorhergehend oder unmittelbar nach ihm ein paar leise, silberhelle Noten vernommen haben, welche glockenrein durch die stille Wüste hinklangen. Oder es sind sonderbar tiefe, dem Gequake des kanarischen Laubfrosches nicht unähnliche, nur weniger rauhe Silben, welche, hastig wiederholt, hinter einander ausgestoßen und mit fast gleichen, aber schwächeren Lauten, bauchrednerisch, als kämen sie aus weiter Ferne, beantwortet werden. Nichts ist wohl mißlicher, als Vogeltöne durch Buchstaben wiedergeben zu wollen: beim Moro dürfte es vorzugsweise schwierig sein. Es sind eben Stimmen aus einer besonderen, für sich bestehenden Sphäre, welche man vernommen haben muß, um sich eine richtige Vorstellung davon zu machen. Niemand wird einen wirklichen Gesang von einem Vogel so beschaffener Gegenden erwarten. Die erwähnten, abenteuerlichen Klänge, denen er oft noch eine Reihenfolge krähender und schnurrender anhängt, vertreten bei ihm die Stelle eines solchen. Sie passen in ihrer Seltsamkeit so vollkommen zu der gleichfalls ungewöhnlichen Umgebung, daß man ihnen stets freudig lauscht und auf sie horcht, sobald sie schweigen. Da, wo das Erdreich aus nichts als Flugsand besteht, verschwindet der Moro. Er ist nicht dazu gemacht, wie ein Brachhuhn oder wie ein Wüstenläufer über den Sand zu laufen. Auch steiles, felsiges Gebirge scheint er nicht gerade aufzusuchen; desto mehr liebt er jene öden, schwarzen Lavaströme voll gletscherartig klaffender Risse und Schlünde, auf denen kaum ein Hälmchen grünt, die ihn aber durch die sicheren Schlupfwinkel, welche sie in ihren Höhlungen darbieten, anzulocken scheinen. Nie sieht man den Wüstengimpel auf einen Baum oder Strauch sich niederlassen. In bewohnteren Gegenden sind diese Vögel ziemlich scheu; da aber, wo die Einsamkeit und das Schweigen der Wüste sie umgibt, noch recht zutraulich, am meisten die Jungen, welche man oft unvermuthet auf einem Steine neben sich sitzen und einem mit den munteren schwarzen Aeugelein ins Gesicht schauen sieht.«
Ganz ähnlich ist es in den Nilländern. Hier belebt der Wüstengimpel von Siut an stromaufwärts die felsigen Ufer des Nils, und zwar an manchen Stellen in erstaunlicher Menge. Da, wo die Wüste bis an das Stromthal herantritt, darf man sicher sein, ihm zu begegnen. In Nord- und Mittelnubien fällt er wie unsere Finken in Flügen von fünfzig bis sechzig Stück auf den Feldern ein oder streicht auf ihnen und zwischen dem Gebirge umher. Je wilder und zerklüfteter die Felsen sind, um so sicherer ist er zu finden. In der eigentlichen Wüste begegnet man ihm auch, jedoch fast ausschließlich in der Nähe der Brunnen. Hier ist er gewöhnlich der häufigste Vogel oder theilt mit den kleinen Wüstenlerchen und Wüstenammern das arme Gebiet.
Gefangen gehaltene Wüstengimpel, welche Bolle pflegte, waren sanft, friedlich, gesellig und verträglich, keck und anmuthig. Sie riefen und antworteten sich gegenseitig fortwährend, bald mit schönen und hellen, aber kurzen, bald mit lang gedehnten, dröhnenden Trompetentönen, bald mit reinen und leisen Lauten, welche an den Klang eines Silberglöckchens erinnerten, bald mit ammerartigem Geschnarre. Dem quakenden Tone »Kä, kä, kä«, welchen sie am häufigsten wiederholen, antwortet in der Regel ein viel tieferer, leise und kurz ausgestoßener. Diese bald rauh, fast krächzend, bald flötend klingenden, immer aber höchst ausdrucksvoll vorgetragenen Silben drücken durch ihre Verschiedenheit jede Aenderung in der Gemüthsstimmung des Vogels aus. Selten hört man ein zwar unzusammenhängendes, aber langes Geplauder wie das kleiner Papageien; sie rufen auch, kakelnd wie Hühnchen, »Kekek, kekek«, drei- bis viermal hinter einander. Ein lautes »Schal, schal« ist der Ausdruck des Erstaunens oder Mißtrauens beim Anblicke ungewohnter Dinge. Am lautesten trompeten die Männchen (die Weibchen haben diesen Ton überhaupt nicht) im Frühlinge. Dabei legen sie den Kopf ganz nach hinten über und richten den weit geöffneten Schnabel gerade in die Höhe. Die leiseren Töne werden mit geschlossenem Schnabel hervorgebracht. Beim Singen, auch sonst zur Paarungszeit, führen sie die erheiterndsten Bewegungen aus. Sie tanzen förmlich um einander herum und treiben sich scharf, wenn sie in erregter Stimmung sind. Bei der Verfolgung des Weibchens nehmen die Hähnchen nicht selten mit senkrecht emporgerichtetem Körper und weit ausgebreiteten Flügeln die Figur eines Wappenbildes an. Es scheint dann, als seien sie im Begriffe, den Gegenstand ihrer Zärtlichkeit in die offenen Arme zu schließen.
Die Nahrung des Vogels besteht in der Freiheit fast oder ganz ausschließlich aus verschiedenen Sämereien, vielleicht auch aus grünen Blättern und Knospen; Kerbthiere scheint er zu verschmähen. Wasser ist ihm Bedürfnis. »Wie spärlich, trüb und lau auch die Quelle rinnt, sie muß durch einen, wenn auch meilenweiten Flug täglich einmal wenigstens erreichbar sein.« Er erscheint morgens und nachmittags in Gesellschaften an der Tränke, trinkt viel und in langen Zügen und badet sich dann wohl auch in seichterem Wasser.
Im März beginnt die Brutzeit. Die männlichen Vögel haben ihr Prachtkleid angelegt und sich mit dem erkorenen Weibchen vom Fluge getrennt, sind jedoch nicht aus dem Verbande der Gesammtheit geschieden. Vereint sieht man die verschiedenen Pärchen aus den zerklüfteten Felsen sitzen; lauter und öfter als sonst erdröhnt der lang gezogene Trompetenton des Männchens, und lerchenartig umgeht dieses das Weibchen. Obgleich ich am Nile die Paare Baustoffe eintragen sah, wollte es mir doch nicht gelingen, mehr zu entdecken. Auch Bolle hat, so vielfach er sich nach dem Neste umgeschaut, keines auffinden können, wohl aber von den Ziegenhirten der gedachten Inseln erfahren, daß die Wüstengimpel in den Schlünden der Lavamassen oder auf der Erde unter großen überhängenden Steinen nisten; Tristram nur berichtet, daß das Nest ausschließlich aus feinen Würzelchen und schmiegsamen Halmen besteht. Die drei bis vier Eier sind etwa achtzehn Millimeter lang, zwölf Millimeter dick und auf blaß meergrünem Grunde mit rothbraunen Pünktchen und Flecken gezeichnet, welche am spitzigen Ende sehr vereinzelt, auch übrigens zerstreut stehen, gegen das stumpfe Ende hin aber einen aus feinen Schnörkeln, Zickzacklinien und großen hell rothbraunen, an den Rändern verwaschenen Flecken gebildeten Kranz zu zeigen Pflegen.
Gefangene Wüstengimpel sind, weil man sie in ihrer Heimat nicht verfolgt, seltene Erscheinungen in unseren Käfigen. Ihr Betragen ist höchst anmuthig, ihre Anspruchslosigkeit ebenso bemerkenswerth wie ihre leichte Zähmbarkeit. Bolle's Pfleglinge schritten mehrmals zur Brut und erzielten kräftige Junge.
Während die Felsengimpel nur in dürren Einöden hausen, bewohnen die Rosengimpel ( Carpodacus) im Gegentheile wasserreiche Oertlichkeiten. Die wenigen Arten dieser Sippe kennzeichnen sich durch verhältnismäßig schmächtigen, aus der Firste aber immer noch merklich gewölbten, seitlich ausgebauchten, an den bogenförmigen Schneiden eingezogenen, mit der Spitze über den ebenfalls gebogenen Untertheil vorragenden Schnabel, kräftige, mittellangzehige Füße, welche durch stark gekrümmte, spitzige, seitlich zusammengedrückte Nägel bewehrt werden, mäßig lange Flügel, unter deren Schwingen die drei ersten, unter sich annähernd gleichlangen Schwingen die Spitze bilden, mittellangen, innen schwach ausgeschnittenen Schwanz und prachtvoll purpurrothe Färbung des Gefieders der Männchen.
Der Karmingimpel, Karminhänfling oder Brandfink, »Tuti« der Hindu ( Carpodacus erythrinus, Pyrrhula erythrina, Fringilla erythrina und incerta, Loxia cardinalis, rosea und erythraea, Coccothraustes erythrina und rosea, Linaria erythrina, Erythrothorax erythrina, rubrifrons und ruber, Erythrospiza erythrina und rosea, Chlorospiza incerta, Haemorrhous roseus, Pyrrhulinota rosaecolor und roseata, Propasser sordidus), ist vorherrschend karminroth, auf dem Hinterhalse und Rücken braungrau, durch dunklere, karminroth überhauchte Flecke gezeichnet, auf dem Bauche, den Schenkeln und unteren Schwanzdeckfedern schmutzigweiß; die dunkelbraunen Schwingen sind außen rostgelblichweiß gesäumt, die Schulterfedern hellbräunlich umrandet und karminroth überflogen, die Steuerfedern graubraun und etwas lichter, die Oberschwanzdecken karminroth gesäumt. Beim Weibchen ist anstatt des Karminroth Fahlgraubraun vorherrschend und die Zeichnung aus dunkleren Längsflecken hergestellt. Das Auge ist braun, der Schnabel licht-, der Fuß dunkel hornfarben. Die Länge beträgt sechzehn, die Breite sechsundzwanzig, die Fittiglänge acht, die Schwanzlänge sechs Centimeter.
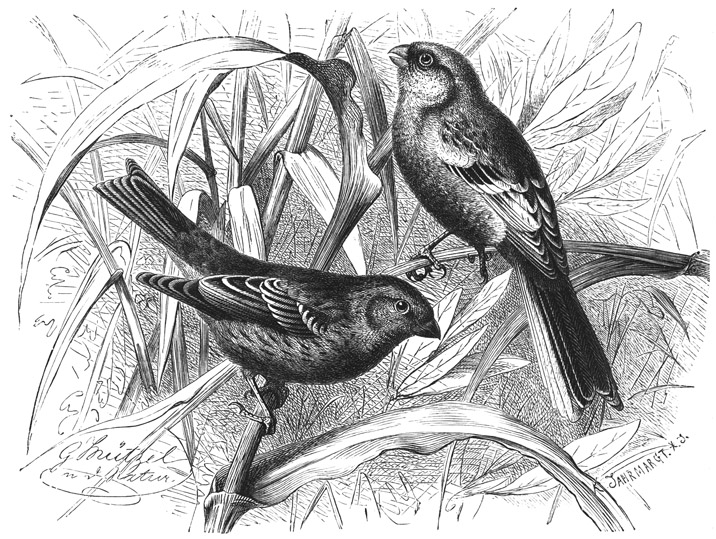
Karmingimpel ( Carpodacus erythinus) und Meisengimpel ( Uragus sibiricus). ½ natürl. Größe.
In Europa bewohnt der Karmingimpel ständig nur den Osten, insbesondere Galizien, Polen, die Ostseeprovinzen, Mittel- und Südrußland, außerdem aber ganz Mittelasien vom Ural an bis Kamtschatka. Von hier aus wandert er regelmäßig nach Süden hinab, durch China bis Indien und durch Turkestan bis Persien, erscheint ebenso nicht allzuselten in Ostdeutschland, hat in Schlesien und Schleswig gebrütet und ist wiederholt in Mittel-, West- und Süddeutschland, Holland, Belgien, Frankreich, England und Italien beobachtet worden. Auf seinen Brutplätzen trifft er um die Mitte des Mai, frühestens zu Ende des April, ein und verläßt sie im September wieder. Zu seinem Aufenthalte wählt er sich mit Vorliebe dichte Gebüsche in der Nähe eines Gewässers, auch wohl mit Rohr und Gebüsch bestandene Brüche, beschränkt denselben jedoch nicht auf Niederungen, sondern kommt auch im Hügellande und selbst im Gebirge bis über zweitausend Meter unbedingter Höhe vor. Häufig ist er nirgends, wird vielmehr überall einzeln beobachtet und bildet während des Sommers niemals zahlreiche Schwärme.
Unmittelbar nach seiner Ankunft vernimmt man seinen ungemein anziehenden, wechselreichen und klangvollen Gesang, welcher zwar an den Schlag des Stieglitzes, Hänflings und Kanarienvogels erinnert, aber doch so eigenartig ist, daß man ihn mit dem keines anderen Finken verwechseln kann. Dieser Gesang ist ebenso reichhaltig als wohllautend, ebenso sanft als lieblich, zählt überhaupt zu den besten, welche dem Schnabel eines Finken entklingen. In Kamtschatka hat man, wie Kittlitz uns mittheilt, diesem Liede sinnreich einen russischen Text untergelegt: »Tschewitscha widäl«. (Ich habe die Tschewitscha gesehen!) »Tschewitscha heißt aber die größte der dortigen Lachsarten, der geschätzteste von allen Fischen des Landes und somit das vornehmste Nahrungsmittel der Einwohner; sie kommt ungefähr mit dem Vogel zugleich in Kamtschatka an. Jener Gesang wird nun so gedeutet, als ob er die Ankunft des Lachses verkünde, und der Karmingimpel ist sonach in einem Lande, dessen Bewohner sich hauptsächlich von Fischen ernähren, nicht nur der Verkündiger der schönen Jahreszeit, sondern auch des sie begleitenden Erntesegens.« In der That hört man den russischen Worten ähnelnde Laute mit besonderer Betonung oft in den Strophen des Gesanges. Während des Vortrages zeigt sich das Männchen gewöhnlich frei auf der Spitze des Busches, in welchem oder in dessen Nähe das Nest steht, sträubt die Federn des Scheitels und der Brust, als wolle es die volle Pracht seines Gefieders entfalten, verschwindet sodann und trägt noch einige Strophen in gleichsam gemurmelter Weise im Inneren des Busches vor, erscheint aber nach kurzer Frist wiederum, um seinen Gesang von neuem zu erheben. Seine Bewegungen erinnern an die des Hänflings, welchem er auch hinsichtlich seiner Rastlosigkeit ähnelt.
Die Nahrung besteht in Gesäme aller Art, welche der Karmingimpel ebensowohl von höheren Pflanzen wie vom Boden aufliest, auch wohl in Blätterknospen und zarten Schößlingen. Nebenbei nimmt er, mindestens im Gebauer, Ameisenpuppen und andere thierische Stoffe zu sich. In der Winterherberge ernährt er sich von den Samen der Bambusen und des Röhrichtes, hält sich daher fast ausschließlich da auf, wo diese Pflanzen wachsen und wird in Indien geradezu »Rohrspatz« genannt. Hier wie in der Heimat fliegt er auch in die Felder, fügt jedoch den Nutzpflanzen nirgends erheblichen Schaden zu.
Das Nest, welches gewöhnlich in Schwarzdorn-, überhaupt aber in dichten und stacheligen Büschen, höchstens zwei Meter über dem Grunde, errichtet wird, ähnelt, laut Taczanowski, dem der Dorngrasmücke, ist aus feinen, schmiegsamen Halmen, Stengeln und Würzelchen zusammengesetzt und innen mit noch zarteren Stoffen derselben Art, Blütenrispen und einzelnen Haaren ausgelegt, im ganzen aber sehr lose und locker gebaut. Fünf, seltener sechs, durchschnittlich zwanzig Millimeter lange, funfzehn Millimeter dicke, sehr zartschalige, auf prachtvoll blaugrünem Grunde spärlich, nur gegen das stumpfe Ende hin dichter, braungelb, schwarzbraun oder röthlich gefleckte und gestrichelte Eier bilden das Gelege, welches in den letzten Maitagen vollzählig zu sein pflegt. Während das Weibchen brütet, singt das Männchen noch so feurig als je zuvor, oft aber ziemlich weit entfernt vom Neste, zu welchem es jedoch oft zurückkehrt. Bei Gefahr warnt es das Weibchen mit einem Tone, welcher dem Warnungsrufe des Kanarienvogels ähnelt und beiden Geschlechtern gemeinsam ist. Mit dem Flüggewerden der Jungen verstummt sein Gesang, und damit ändert sich auch sein Betragen. Stumm und verborgen, vorsichtig dem nahenden Menschen ausweichend, treibt sich fortan alt und jung im dichten Gebüsche umher, bis die Zeit der Abreise herankommt und eine Familie nach der anderen unbemerkt die Heimat verläßt.
Gefangene Karmingimpel sind höchst angenehme Vögel, ihre Färbung aber so hinfällig wie die keines anderen in ähnlicher Farbenschönheit prangenden Finken. Sie verlieren Glanz und Tiefe der Färbung schon, wenn sie mit der Hand berührt werden, und erhalten durch die nächste Mauser ein geradezu mißfarbiges Kleid, dauern auch selten mehrere Jahre im Käfige aus.
Von den Rosengimpeln hat man neuerdings eine ebenfalls in Asien vorkommende Art dieser Familie, den Meisengimpel ( Uragus sibiricus, Loxia sibirica, Pyrrhula sibirica, caudata und longicaudata, Carpodacus sibiricus, Bild S. 343), getrennt und zum Vertreter der Langschwanzgimpel ( Uragus) erhoben. Der Schnabel ist verhältnismäßig schwach und sein Oberkiefer nur wenig über den unteren gebogen, der Fuß schwach, der Flügel, unter dessen Schwingen die vierte die Spitze bildet, stumpf, der Schwanz dagegen körperlang und stufig, in der Mitte aber ausgeschnitten, das Gefieder endlich seidigweich. Das alte Männchen ist prachtvoll rosenroth, silbergrau überflogen, eine Stirnbinde hoch rosenroth, der Rücken dunkler, weil hier die Schaftstriche deutlicher hervortreten und nur eine rothe Federkante übrig lassen, der Bürzel hoch karminroth; Kopf und Kehle sind weißlich, atlasglänzend, besonders nach der Mauser, welche überhaupt dem ganzen Vogel ein lichteres Kleid verleiht, weil alle frischen Federn ziemlich breite weiße Säume tragen, welche erst nach und nach abgenutzt werden. Jede einzelne Feder ist am Grunde dunkelgrau, sodann blaß karminroth und licht gerandet. Die kleinen Oberdeckfedern und Schulterfedern sind auf der Außenfahne und am Ende weiß oder mindestens weiß gerandet, die drei äußersten Steuerfedern bis auf die dunklen Schäfte und einen dunkeln Rand am Grunde der Innenfahne, welcher nach der Mitte des Schwanzes zu an den einzelnen Federn größer wird, ebenfalls weiß, die mittleren nur weiß gerandet. Das Weibchen ist hell olivenfarben oder graugrün. Die Länge beträgt achtzehn, die Fittiglänge acht, die Schwanzlänge neun Centimeter.
Der Meisengimpel, welcher sich zuweilen nach Südosteuropa, selbst bis nach Ungarn verfliegen soll, bewohnt sumpfige, mit Rohr bestandene Gegenden Ostasiens, namentlich Ostsibirien, Ostchina und die Mandschurei, außerdem Ostturkestan. Radde fand ihn während des ganzen Jahres am mittleren Amur. Im Spätherbste rotten sich die Paare zu Banden von zehn bis dreißig Stück zusammen und streichen, wobei sie stets einsilbig pfeifende Töne vernehmen lassen. »Bei Irkutsk stellen sich diese Züge erst zu Ende des September in größerer Anzahl ein. Dort werden sie sammt Meisen, Kreuzschnäbeln, Gimpeln und Schneeammern von Vogelstellern gefangen; sie halten sich aber meist nur kurze Zeit im Bauer und verlieren die ihnen eigene Lebhaftigkeit dann fast gänzlich. Bis gegen den November hin trifft man sie am häufigsten auf dem Durchzuge an. Später werden die einzelnen Paare seßhaft und bewohnen mit den Dompfaffen dicht bestrauchte Bachufer, halten sich auch gern in der Nähe des Getreides da auf, wo solches gestapelt wird, wie dies auf Halden in lichten Waldgegenden zu geschehen pflegt. Am Onon traf der sibirische Gimpel im September mit dem Seidenschwanze zusammen; hier belebte er die Inseln. Im Bureja-Gebirge ließen sich größere Banden erst zu Ende des September sehen. Sie waren, wie immer, außerordentlich munter. Niemals flogen sie gleichzeitig, vielmehr immer einzeln; dabei lockten sie fleißig. Der Flug geschieht in sehr flachen Bogen; die Flügel verursachen ein leises Schnurren.« In Daurien tritt unser Vogel häufig auf. Laut Dybowski, welchem wir die eingehendsten Mittheilungen über seine Lebensweise verdanken, verweilt er hier während des Sommers auf südlich gelegenen Berghängen und bezieht erst im Spätfrühlinge die Niederungen, zumal die dichten Haine, welche Flüsse, Bäche und Quellen der Steppe umgeben.
In der ersten Hälfte des Juni beginnt der Meisengimpel mit dem Baue seines Nestes. Dieses steht auf Zwergbirken, selten auf Weiden- und Lärchenbäumchen, regelmäßig anderthalb bis zwei Meter über dem Boden und immer möglichst nahe am Hauptstamme, ist so künstlich gebaut, als ein dickschnäbeliger Vogel überhaupt vermag, erinnert an das Nest des Gartensängers und besteht aus verschiedenartigen dürren, an der Sonne gebleichten Halmen, welche mit Nessel-, Weiden- und anderen Pflanzenfasern durchwebt, innerlich aber mit feinem Grase, Pferde-, Reh- und Hasenhaaren, manchmal auch Federn, zierlich und sauber ausgepolstert werden. Vier, seltener drei oder fünf, neunzehn Millimeter lange, vierzehn Millimeter dicke, denen des Karmingimpels ähnliche, sehr schöne Eier, welche auf tief blaugrünem Grunde spärlich, nur am dicken Ende dichter, mit bräunlichen Flecken und Strichen gezeichnet sind, bilden das Gelege. Während des Nestbaues läßt das Männchen seinen leisen, jedoch angenehmen Gesang verlauten. Bei Annäherung eines Menschen warnt er das Weibchen durch einen pfeifenden Laut, infolgedessen letzteres dem Neste sofort entfliegt und sich entfernt. Verweilt man in der Nähe des Nestes, so kehrt es nach geraumer Zeit zwar wiederum zurück, legt aber auch jetzt seine Scheu nicht ab. Sucht der Kukuk sein Nest heim, so zerstört es letzteres selbst und benutzt die Stoffe zum Aufbaue eines neuen; verliert es das Gelege oder die Brut, so verläßt es sogleich die Gegend.
Die Urbilder der Unterfamilie ( Pyrrhula), welche wir Waldgimpel nennen wollen, sind kräftig gebaute Finken, mit großem, kurzem, dickkolbigem, seitlich stark gewölbtem, gegen die Spitze hin etwas zusammengedrücktem, vorn in einen kurzen Haken auslaufendem Schnabel, kurzen, mittellangzehigen Füßen, ziemlich stumpfen Flügeln, unter deren Schwingen die zweite, dritte und vierte die Spitze bilden, ziemlich langem, in der Mitte seicht ausgeschnittenem Schwanze und dichtem, weichem, je nach dem Geschlechte verschieden gefärbtem Gefieder.
Unser Gimpel, Blut-, Roth-, Gold-, Loh-, Laub- und Quitschfink, Rothgimpel, Rothschläger, Rothvogel, Dompfaff, Domherr, Pfäfflein, Gumpf, Giker, Lübich, Lüff, Luh, Lüch, Schnil, Schnigel, Hale, Bollenbeißer, Brommeis ( Pyrrhula europaea, vulgaris, rufa, peregrina, germanica und pileata, Fringilla pyrrhula), ist auf dem Oberkopfe und an der Kehle, auf Flügeln und Schwanz glänzend dunkelschwarz, auf dem Rücken aschgrau, auf dem Bürzel und dem Unterbauche weiß, auf der ganzen übrigen Unterseite aber lebhaft hellroth. Das Weibchen unterscheidet sich leicht durch die aschgraue Färbung seiner Unterseite und die weniger lebhaften Farben überhaupt. Den Jungen fehlt die schwarze Kopfplatte. Der Flügel ist in allen Kleidern durch zwei graulichweiße Binden geziert, welche in der Gegend des Handgelenkes verlaufen. Als Spielarten kommen weiße oder schwarze und bunte Gimpel vor. Die Länge beträgt siebzehn, die Breite achtundzwanzig, die Fittiglänge neun, die Schwanzlänge sechs Centimeter.
Der Gimpel bewohnt, mit Ausnahme des Ostens und Nordens, ganz Europa, den Süden unseres heimatlichen Erdtheils jedoch nur als Wintergast. Im Osten und Norden Europas und ebenso in ganz Mittelasien wird er vertreten durch den Großgimpel ( Pyrrhula major, rubricilla und coccinea, Loxia pyrrhula), welcher sich zwar einzig und allein durch bedeutendere Größe, aber so ständig unterscheidet, daß man die zuerst von meinem Vater ausgesprochene Trennung beider Arten anerkennen muß. Der Großgimpel brütet noch in Preußen und Pommern, nicht aber im Westen Deutschlands, erscheint hier auch nur während des Zuges; der Gimpel wiederum kommt schon in Pommern nicht mehr vor. Die eine wie die andere Art, auf deren Trennung ich im nachfolgenden nicht weiter Rücksicht nehmen will, ist streng an den Wald gebunden und verläßt ihn, so lange sie Nahrung findet, gewiß nicht. Erst wenn der Winter den Gimpel aus seiner Wohnstätte vertreibt, kommt er gesellschaftsweise in Obstpflanzungen und Gärten der Dörfer oder in Feldgebüsche, um hier nach den wenigen Beeren und Körnern zu suchen, welche andere Familienverwandte ihm noch übrig gelassen haben. Zu Anfang des Striches sieht man oft nur Männchen, später Männchen und Weibchen unter einander. So lange nicht besondere Umstände zu größeren Wanderungen nöthigen, bleibt er im Vaterlande; unter Umständen dehnt er seine Wanderungen bis nach Südspanien oder Griechenland aus. Er wandert meist bei Tage und fliegt womöglich von einem Walde zum anderen.
»Der Name Gimpel«, sagt mein Vater, »ist als Schimpfwort eines als beschränkt zu bezeichnenden Menschen allbekannt und läßt auf die Dummheit unseres Vogels schließen. Es ist nicht zu leugnen, daß er ein argloser, den Nachstellungen der Menschen keineswegs gewachsener Gesell ist: er läßt sich leicht schießen und fangen. Doch ist seine Dummheit bei weitem nicht so groß als die der Kreuzschnäbel; denn obgleich der noch übrige Theil einer Gesellschaft nach dem Schusse, welcher einen Vogel dieser Art tödtet, zuweilen auf oder neben dem Baume, auf welchem sie erst saß, wieder Platz nimmt: so weiß ich doch kein Beispiel, daß auf den Schuß ein gesunder Gimpel sitzen geblieben wäre, was allerdings bei den Kreuzschnäbeln zuweilen vorkommt. Wäre der Gimpel wirklich so dumm, als man glaubt, wie könnte er Lieder so vollkommen nachpfeifen lernen? Ein hervorstechender Zug bei ihm ist die Liebe zu seinesgleichen. Wird einer von der Gesellschaft getödtet, so klagen die anderen lange Zeit und können sich kaum entschließen, den Ort, wo ihr Gefährte geblieben ist, zu verlassen; sie wollen ihn durchaus mitnehmen. Dies ist am bemerkbarsten, wenn die Gesellschaft klein ist. Diese innige Anhänglichkeit war mir oft rührend. Einst schoß ich von zwei Gimpelmännchen, welche in einer Hecke saßen, das eine; das andere flog fort, entfernte sich so weit, daß ich es aus den Augen verlor, kehrte aber doch wieder zurück und setzte sich in denselben Busch, in welchem es seinen Gefährten verloren hatte. Aehnliche Beispiele könnte ich mehrere anführen.
»Der Gang unseres Gimpels ist hüpfend, auf der Erde ziemlich ungeschickt. Auf den Bäumen ist er desto gewandter. Er sitzt auf ihnen bald mit wagerecht stehendem Leibe und angezogenen Fußwurzeln, bald aufgerichtet mit weit vorstehenden Füßen, und hängt sich oft unten an die Zweige an. Seine lockeren und langen Federn legt er selten knapp an, und deswegen sieht er gewöhnlich viel größer aus, als er ist. Im Fluge, vor dem Fortfliegen, gleich nach dem Aufsetzen und beim Ausklauben der Samenkörner oder Kerne trägt er sich schlank und schön; im Käfige läßt er die Federn fast immer etwas hängen. Ein Baum voll Gimpel gewährt einen prächtigen Anblick. Das Roth der Männchen sticht im Sommer gegen das Grün der Blätter und im Winter gegen den Reif und Schnee herrlich ab. Sie scheinen gegen die Kälte ganz unempfindlich zu sein; denn sie sind im härtesten Winter, vorausgesetzt, daß es ihnen nicht an Nahrung fehlt, sehr munter. Ihr ungemein dichtes Gefieder schützt sie hinlänglich. Dieses hat auch auf den Flug großen Einfluß; denn er ist leicht, aber langsam, bogenförmig und hat mit dem des Edelfinken einige Ähnlichkeit. Wie bei diesem ist das starke Ausbreiten und Zusammenziehen der Schwingen sehr bemerkbar. Vor dem Niedersetzen schweben sie oft, stürzen sich aber auch zuweilen mit stark nach hinten gezogenen Flügeln plötzlich herab. Der Lockton, welchen beide Geschlechter hören lassen, ist ein klagendes ›Jüg‹ oder ›Lüi‹ und hat im Thüringischen unserem Vogel den Namen ›Lübich‹ verschafft. Er wird am häufigsten im Fluge und im Sitzen vor dem Wegfliegen oder kurz nach dem Aufsetzen ausgestoßen, ist, nachdem er verschieden betont wird, bald Anlockungs-, bald Warnungsruf, bald Klageton. Er wird jedesmal richtig verstanden. Man sieht hieraus, wie fein die Unterscheidungsgabe bei den Vögeln sein muß, da die Veränderungen des Locktones, welche vom Menschen oft kaum zu bemerken sind, in ihren verschiedenen Bedeutungen stets richtig aufgefaßt werden. Der Gesang des Männchens ist nicht sonderlich; er zeichnet sich namentlich durch einige knarrende Töne aus und läßt sich kaum gehörig beschreiben. In der Freiheit ertönt er vor und in der Brutzeit, in der Gefangenschaft fast das ganze Jahr.«
Baum- und Grassämereien bilden die Nahrung des Gimpels; nebenbei verzehrt er die Kerne mancher Beerenarten und im Sommer viele Kerbthiere. Den Fichten-, Tannen- und Kiefersamen kann er nicht gut aus den Zapfen herausklauben und liest ihn deshalb gewöhnlich vom Boden auf. Die Kerne der Beeren trennt er mit großer Geschicklichkeit von dem Fleische derselben, welches er als ungenießbar wegwirft. Im Winter erkennt man das Vorhandensein von Gimpeln unter beerentragenden Bäumen leicht daran, daß der Boden unten mit den Ueberbleibseln der Beeren wie besäet ist. Doch geht der Vogel nur im Nothfalle an solches Futter und zieht ihm immer die Sämereien vor. Zur Beförderung der Verdauung liest er Sandkörner auf. Durch Abbeißen der Knospen unserer Obstbäume kann er lästig werden; da er jedoch nirgends in namhafter Menge auftritt, fällt der durch ihn verursachte Schaden kaum ins Gewicht, es sei denn, daß einmal ein Flug in einen kleinen Garten einfallen und hier längere Zeit ungestört sein Wesen treiben sollte.
In gebirgigen Gegenden, wo große Strecken mit Wald bestanden sind und dieser heimliche, wenig besuchte Dickichte enthält, nistet der Gimpel regelmäßig. Ausnahmsweise siedelt er sich auch in Parks und großen Gärten an. So brütet ein Paar alljährlich in dem Epheu, welcher das Gärtnerhäuschen eines Parkes in Anhalt umrankt; andere hat man in Auwaldungen gefunden. Das Nest steht auf Bäumen, gewöhnlich in geringer Höhe, entweder in einer Gabel des höheren Buschholzes, oder auf einem Seitenästchen dicht am Baumschafte, besteht äußerlich aus dürren Fichten-, Tannen- und Birkenreischen, auf welchen eine zweite Lage äußerst feiner Wurzelfasern und Bartflechten folgen, und ist innerlich mit Reh- und Pferdehaaren oder auch nur mit zarten Grasblättchen und feinen Flechtentheilen ausgefüttert. Zuweilen wird der inneren Wandung auch wohl Pferdehaar oder Schafwolle beigemischt. Im Mai findet man vier bis fünf verhältnismäßig kleine, etwa einundzwanzig Millimeter lange, funfzehn Millimeter dicke, rundliche, glattschalige Eier, welche auf bleichgrünlichem oder grünlichbläulichem Grunde mattviolette oder schwarze Flecke und rothbraune Punkte, Züge und Schnörkel zeigen. Das Weibchen zeitigt die Eier binnen zwei Wochen und wird, so lange es auf dem Neste sitzt, von dem Männchen ernährt. Beide Eltern theilen sich in die Erziehung ihrer Kinder, welche sie äußerst zärtlich lieben und mit Lebensgefahr zu vertheidigen suchen. Die Jungen erhalten anfänglich Kerbthiere, später junge Pflanzenschößlinge und allerhand im Kropfe erweichte Sämereien und schließlich hauptsächlich die letzteren. Auch nach dem Ausfliegen werden sie noch längere Zeit von den Eltern geführt, falls diese nicht zur zweiten Brut schreiten.
Im Gebirge nimmt man die jungen Gimpel, noch ehe sie flügge sind, aus dem Neste, um sie zu erziehen und zu lehren. Je früher man den Unterricht beginnen kann, um so günstiger ist das Ergebnis. Auf dem Thüringer Walde werden jährlich Hunderte junger Gimpel erzogen und dann durch besondere Vogelhändler nach Berlin, Warschau, Petersburg, Amsterdam, London, Wien, ja selbst nach Amerika gebracht. Der Unterricht beginnt vom ersten Tage ihrer Gefangenschaft an, und die hauptsächlichste Kunst desselben besteht darin, daß der Lehrer selbst das einzuübende Lied möglichst rein und immer gleichmäßig vorträgt. Man hat versucht, mit Hülfe von Drehorgeln zu lehren, aber wenig Erfolg erzielt. Selbst die Flöte kann nicht leisten, was ein gut pfeifender Mund vorträgt. Einzelne lernen ohne sonderliche Mühe zwei bis drei Stückchen, während andere immer Stümper bleiben; einzelne behalten das Gelehrte zeitlebens, andere vergessen es namentlich während der Mauser wieder. Auch die Weibchen lernen ihr Stücklein, obwohl selten annähernd so voll und rein wie die Männchen. Von diesen werden einzelne zu wirklichen Künstlern. »Ich habe«, sagt mein Vater, »Bluthänflinge und Schwarzdrosseln manches Lied nicht übel pfeifen hören; aber dem Gimpel kommt an Reinheit, Weichheit und Fülle des Tones kein deutscher Vogel gleich. Es ist unglaublich, wie weit er gebracht werden kann. Er lernt oft die Weisen zweier Lieder und trägt sie so flötend vor, daß man sich nicht satt daran hören kann.« Abgesehen von der Gabe der Nachahmung, zeichnet sich der Gimpel vor allen übrigen Finken durch leichte Zähmbarkeit, unbegrenzte Anhänglichkeit und unvergleichliche Hingabe an seinen Pfleger aus, tritt mit diesem in ein inniges Freundschaftsverhältnis, jubelt in dessen Gegenwart, trauert in dessen Abwesenheit, stirbt sogar im Uebermaße der Freude wie des Kummers, welchen ihm sein Herr bereitet. Ohne besondere Mühe kann er zum Aus- und Einfliegen gewöhnt werden, brütet auch leicht im Käfige, vereinigt also eine Reihe vortrefflicher Eigenschaften in sich.
Vertreter der letzten Sippe der Unterfamilie, welche wir in Betracht ziehen können, ist der Hakengimpel, Finscher, Hakenkreuzschnabel, Hakenkernbeißer oder Hakenfink, Fichtenhacker, Hartschnabel, Finscherpapagei, Parisvogel und Krabbenfresser ( Pinicola enucleator, rubra und americana, Loxia enucleator, flamingo und psittacea, Corythus enucleator, canadensis, angustirostris, splendens und minor, Enucleator angustirostris und minor, Fringilla, Strobilophaga, Pyrrhula und Coccothraustes enucleator). Der Leib ist kräftig, der Schnabel allseitig gewölbt, der Oberschnabel jedoch stark hakig übergebogen, an den Schneiden etwas geschweift; die Füße sind verhältnismäßig kurz, aber stark, die Zehen kräftig, die Krallen groß; die Flügel, unter deren Schwingen die zweite und dritte die Spitze bilden, reichen in der Ruhe bis zum dritten Theile des Schwanzes herab; dieser ist ziemlich lang und in der Mitte ausgeschnitten; das Gefieder endlich zeichnet sich durch seine Dichtigkeit und eigenartige Farbenschönheit aus. Bei den alten Männchen ist ein schönes Johannisbeerroth die vorherrschende Färbung, bei den einjährigen Männchen und Weibchen spielt die Farbe mehr in das Gilbliche; die Kehle ist lichter gefärbt, und der Flügel wird durch zwei weiße Querbinden geziert. Die einzelnen Federn sind am Grunde aschgrau, längs des Schaftes schwärzlich, an der Spitze johannisbeerroth oder bezüglich rothgelb und in der Mitte hier und da dunkler gefleckt, an den Rändern dagegen gewöhnlich etwas lichter gesäumt, wodurch eine wolkige Zeichnung entsteht, die Schwingen und Steuerfedern schwärzlich, heller gerandet. Das Auge ist dunkelbraun, der Schnabel schmutzigbraun, an der Spitze schwärzlich, der Unterschnabel lichter als der obere, der Fuß graubraun. Die Länge beträgt zweiundzwanzig, die Breite fünfunddreißig, die Fittiglänge zwölf, die Schwanzlänge acht Centimeter.
Alle hochnordischen Länder der Erde sind als die Heimat des schönen und auffallenden Vogels zu bezeichnen. Soweit man weiß, kommt der Hakengimpel nirgends häufig vor, lebt vielmehr während des Sommers paarweise und einzeln in einem ausgedehnten Gebiete und schart sich erst im Herbste. Die dann gebildeten Flüge schweifen während des ganzen Winters in den nordischen Waldungen umher, nähern sich auch wohl einsam stehenden Gehöften und kehren mit Beginn des Frühjahres wieder auf ihre Brutplätze zurück. Einzelne Hakengimpel erscheinen als Wandervögel, wenn auch nicht alljährlich, so doch fast in jedem strengen Winter im nordöstlichen Deutschland und ebenso in den Ostseeprovinzen, Nordrußland und den entsprechenden Landstrichen Nordasiens und Amerikas; zahlreiche Schwärme dagegen kommen unregelmäßig bis zu uns herab: denn nur dann, wenn besondere Ereignisse eintreten, namentlich bedeutender Schneefall, sie zum Wandern in südlichere Gegenden veranlassen, geschieht es, daß die Flüge mit anderen sich zusammenschlagen und demgemäß sehr zahlreiche Schwärme auftreten. In den Jahren 1790, 1795, 1798 und 1803 erschienen die Hakengimpel in so großer Anzahl in den Ostseeländern, daß in der Gegend von Riga allein längere Zeit allwöchentlich etwa tausend Paare gefangen werden konnten; in den Jahren 1821, 1822, 1832, 1844 und 1878 fanden sie sich in Preußen in unschätzbarer Menge ein; in den Jahren 1845, 1856, 1863, 1870 und 1871 traten sie hier wie in Pommern in geringerer Anzahl auf. Weiter nach Norden hin beobachtet man sie allwinterlich in solchen Gegenden, welche sie im Sommer nicht beherbergen; in Mittel- und Süddeutschland dagegen zählen sie ebenso wie in Holland, Belgien, Frankreich und England zu den seltensten Erscheinungen.
Diesen unfreiwilligen Wanderungen in die südlich ihres Vaterlandes gelegenen Gegenden verdanken wir den größten Theil der Kunde, welche wir von ihrem Betragen besitzen. Die Scharen, welche bei uns ankommen, zeigen sich als höchst gesellige Vögel, halten sich bei Tage truppweise zusammen, streifen gemeinschaftlich umher, gehen gemeinsam auf Nahrung aus und suchen vereint nachts den Schlafplatz auf. Auch in der Fremde bilden die ihnen vertrauten Nadelwaldungen ihren bevorzugten Aufenthalt, und namentlich diejenigen, in denen das Unterholz aus Wacholder besteht, scheinen von ihnen gern ausgesucht zu werden. In den Laubhölzern finden sie sich weit seltener; baumlose Ebenen durchfliegen sie so eilig als möglich. Anfangs zeigen sie sich in der Fremde als harmlose, zutrauliche Vögel, als Thiere, welche die Tücke des Menschen noch nicht erfahren haben. Sie bleiben ruhig sitzen, wenn der Beobachter oder der Jäger sich dem Baume naht, auf welchem sie sich versammelt haben, schauen dem Schützen dummdreist ins Rohr und lassen es, gleichsam verdutzt, geschehen, wenn dieser einen um den anderen von ihnen wegfängt oder vom Baume herabschießt, ohne an Flucht zu denken. Man hat mit Erfolg versucht, einzelnen, welche sich gerade mit Fressen beschäftigten, an langen Ruthen befestigte Schlingen über den Kopf zu ziehen, überhaupt erfahren, daß auch die plumpesten Fanganstalten gegen sie angewandt werden dürfen. Von ihrer rührenden Anhänglichkeit zu ihren Gefährten erzählen alle, welche sie in der Freiheit beobachten konnten. So fing man auf einem Vogelherde von einer Gesellschaft, welche aus vier Stück bestand, drei auf einen Zug und bemerkte zu nicht geringem Erstaunen, daß auch der Freigebliebene freiwillig unter das Netz kroch, gleichsam in der Absicht, das Geschick der übrigen zu theilen. Doch würde man irren, wenn man dieses Gebaren als einen Beweis geistiger Beschränktheit auffassen wollte; denn Erfahrung witzigt auch sie und macht sie ebenso mißtrauisch, scheu und vorsichtig, als sie, laut Collett, am Brutplatze zu sein pflegen.
In seinem Benehmen erinnert der Hakengimpel vielfach an die Kreuzschnäbel. Er zeigt sich durchaus als Baumvogel, welcher im Gezweige wohl heimisch, auf dem Boden hingegen fremd ist. In den Kronen der Bäume klettert er sehr geschickt von einem Aste zum anderen, hüpft auch mit Leichtigkeit über ziemlich weite Zwischenräume; die Luft durcheilt er fliegend ziemlich schnell, nach Art der meisten Finken weite Bogenlinien beschreibend und nur kurz vor dem Aufsitzen schwebend; auf dem Boden aber hüpft er, falls er überhaupt zu ihm herab kommt, mit plumpen Sprüngen einher. Der Lockton ist flötend und ansprechend, dem des Gimpels ähnlich, der Gesang, welcher auch während des ganzen Winters ertönt, mannigfach abwechselnd und wegen der sanften, reinen Flötentöne in hohem Grade anmuthend. Während der Wintermonate bekommt man von dem reichen Liede selten eine richtige Vorstellung; der Vogel singt dann leise und abgerissen; im Frühlinge aber, wenn die Liebe in ihm sich regt, trägt er sein Lied mit vielem Feuer kräftig und anhaltend vor, so daß er auch den, welcher die Leistungen der edelsten Sänger kennt, zu befriedigen versteht. In den tageshellen Sommernächten seiner eigentlichen Heimat singt er besonders eifrig, und wird deshalb in Vorland der – Nachtwächter genannt. Sein Wesen ist sanft und friedfertig, sein Benehmen gegen den Gatten hingebend und zärtlich im allerhöchsten Grade.
In der Freiheit nährt sich der Hakengimpel von den Samen der Nadelbäume, welche er zwischen den geöffneten Schuppen der Zapfen hervorzieht oder von den Aesten und Zweigen und bezüglich vom Boden aufliest; außerdem nimmt er verschiedene andere Sämereien oder Beeren mancherlei Art gern an und betrachtet Baumknospen oder Grünzeug überhaupt als Leckerbissen. In den Sommermonaten wird er nebenbei vielleicht von Kerbthieren, insbesondere von den in seiner Heimat so überaus häufigen Mücken, sich ernähren und mit ihnen wohl auch seine Jungen auffüttern; doch liegen hierüber, soviel mir bekannt, bestimmte Beobachtungen nicht vor.
Ueber die Fortpflanzung haben wir bisher nur dürftige Berichte erhalten; denn der Hakengimpel kommt im Sommer regelmäßig nicht südlich von Wermland und Dalarna vor. Doch hat er ausnahmsweise schon einmal mitten in Deutschland genistet und zwar zum Glück in unmittelbarer Nähe des Wohnortes unseres Naumann, dessen Vater die erste Beschreibung des Nestes geben konnte. Dasselbe stand in einem lichten Hartriegelstrauche auf einem kleinen Stämmchen, etwa anderthalb Meter hoch über dem Boden, so frei, daß man es schon von weitem bemerkte. Es war ziemlich leicht, kaum besser oder dichter als ein Grasmückennest, gebaut; dürre Pflanzenstengel und Grashalme bildeten die äußeren Wandungen; der innere Napf war mit einzelnen Pferdehaaren ausgelegt. Das Gelege bestand aus vier Eiern. Naumann beschreibt auch diese, jedoch, wie wir später erfahren haben, ungenügend. Sie sind etwa fünfundzwanzig Millimeter lang und zwanzig Millimeter dick, ähneln in Färbung und Zeichnung denen des Gimpels, haben eine schöne, blaßblaue Grundfarbe, sind am stumpfen Ende verwaschen rothbraun gewölkt und zeigen dort auch einzelne kastanienbraune Flecke. Nach Wolley's Befund steht das Nest in Lappland regelmäßig auf niedrigen Fichten, ungefähr vier Meter über dem Boden. Lange, dünne, schmiegsame Zweige bilden den manchmal äußerst locker verflochtenen Außenbau, feinere Wurzeln, Baumflechten und vielleicht auch Halme die dichtere, mit jenem zuweilen nur lose zusammenhängende innere Auskleidung. Das Gelege enthält regelmäßig vier Eier. Nach Naumanns Beobachtung brütet nur das Weibchen, wird aber währenddem von dem Männchen durch seine herrlichen Lieder unterhalten.
Gefangene Hakengimpel gewöhnen sich binnen wenig Stunden an den Käfig, gehen ohne Umstände an geeignetes Futter, werden bald ebenso zahm wie irgend ein anderer Gimpel, halten aber selten längere Zeit im Gebauer aus und verlieren bei der ersten Mauser in letzterem unwiederbringlich ihre prachtvolle Färbung.
Die letzte Unterfamilie ( Loxiinae) umfaßt nur die Kreuzschnäbel ( Loxia), gedrungen gebaute, großköpfige, etwas plumpe Finken. Ihr Schnabel ist sehr stark, dick, seitlich zusammengedrückt, an den Schneiden eingebuchtet, der obere Kiefer auf der schmalen Firste zugerundet, in eine lange Spitze ausgezogen und sanft hakenförmig abwärts gebogen, der untere, welcher den oberen an Stärke übertrifft, in einen ähnlichen Bogen umgekehrt nach oben gekrümmt und mit jenem bald auf der rechten, bald auf der linken Seite gekreuzt, der kurze, starke Fuß mit langen und kräftigen Zehen ausgerüstet und mit tüchtigen, bogig gekrümmten, spitzigen und doppelschneidigen Nägeln bewehrt, der Flügel ziemlich lang und schmal, in ihm die erste Schwinge über alle anderen verlängert, der Handtheil durch schmale und länglich zugerundete, der Armtheil durch breitere und ziemlich gerade abgeschnittene Schwingen ausgezeichnet, der Schwanz kurz und deutlich gegabelt, das Kleingefieder dicht, weich, je nach Alter und Geschlecht auffallend verschieden.
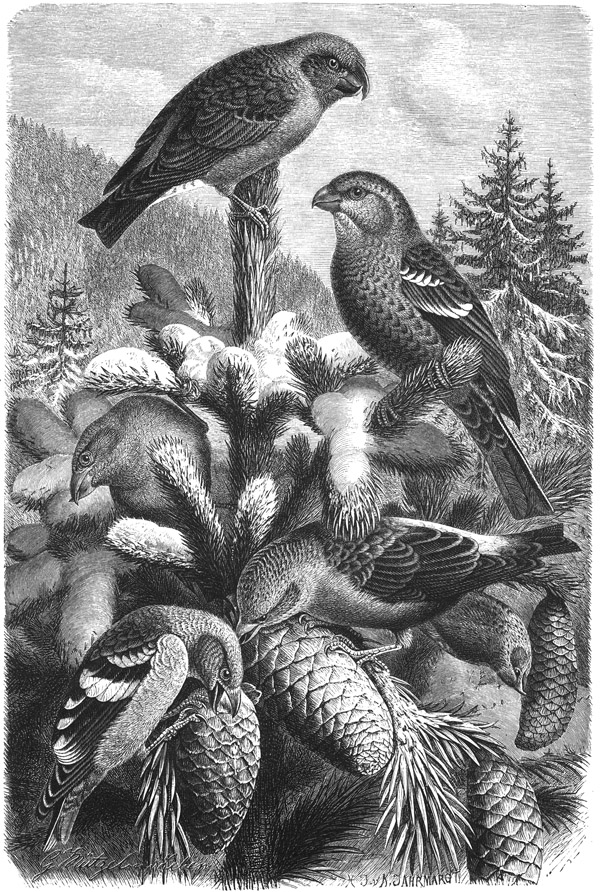
Kreuzschnäbel und Hakengimpel.
Die größte und kräftigste Art der Sippe ist der Kieferkreuzschnabel, Kiefer- oder Tannenpapagei, Krummschnabel und Roßkrinitz ( Loxia pityopsittacus, Crucirostra pityopsittacus, subpityopsittacus, pseudopityopsittacus, brachyrhynchos und intercedens). Seine Länge beträgt zwanzig, die Breite dreißig, die Fittiglänge elf, die Schwanzlänge sieben Centimeter. Der Schnabel ist auffallend stark, dick und hoch, oben und unten in einem fast vollständigen Halbkreise gekrümmt und nur wenig gekreuzt. Kopf, Kehle, Gurgel, Brust und Bauch sind mehr oder minder lebhaft roth, vorn hell mennigroth bis johannisbeerroth, auf den Backen graulich, auf der Kehle aschgrau überflogen, die Federn des Rückens grauroth, an der Wurzel grau und an der Spitze roth gesäumt, die des Bürzels lebhafter roth als das übrige Kleingefieder, die des unteren Bauches hell aschroth oder weißlich, grauröthlich überflogen, die Schwung-, Oberflügel-, Deck- und Steuerfedern grauschwarz, rothgrau gesäumt, die Unterschwanzdeckfedern weißgrau, dunkler gestrichelt und röthlich überflogen. Beim Weibchen sind Scheitel- und Rückenfedern tiefgrau, erstere grüngelb, letztere graugrün gerandet, Zügel und Vorderbacken licht-, Hinterbacken dunkelgrau, Nacken und Hinterhals graugrüngelb, die Untertheile, mit Ausnahme der lichtgrauen Kehle und der weißgrauen Brust und Bauchmitte, lichtgrau, durch breite grüngelbe Ränder geziert, die Schwingen und Steuerfedern grauschwarz, grünlich gesäumt, unterseits tiefgrau, die grauschwarzen Unterschwanzdeckfedern an der Spitze weiß. Beim jungen Vogel sind Kopf und Nacken grauschwarz, weißgrau gestrichelt, Zügel und Backen tiefgrau, die Federn des Rückens schwarzgrau, grüngrau gesäumt, die des Bürzels grüngelb, dunkel längsgestrichelt, die der Untertheile weißgrau mit helleren und dunkleren tiefgrauen Längsstreifen, die Schwung- und Schwanzfedern grauschwarzgrünlich oder lichtgrau gesäumt, die oberen Schwingdeckfedern an der Spitze lichtgrau, wodurch zwei schmale Binden auf den Flügeln gebildet werden.
Der Fichtenkreuzschnabel, Tannen- und Kreuzvogel, Krinitz ( Loxia curvirostra, europaea, balearica und albiventris, Crucirostra curvirostra, europaea, abietina, media, montana, pinetorum, paradoxa, macrorhynchos, 1ongirostris und balearica), ist kleiner, der Schnabel gestreckter und minder gekrümmt, seine sich kreuzende Spitze länger und niedriger als beim Kieferkreuzschnabel. Die Länge beträgt siebzehn, die Breite achtundzwanzig, die Fittiglänge neun, die Schwanzlänge sechs Centimeter. Kopf, Nacken und Unterkörper sind ebenso gefärbt wie bei jenem, die Backen hinten tief graubraun, die Federn des Unterbauches weißgrau, die Schwingen und Steuerfedern nebst ihren oberen Decken grauschwarz, röthlichgrau gesäumt, die Unterschwanzdecken schwarzgrau mit weißen röthlich überflogenen Spitzen. Beim Weibchen ist die Oberseite tief-, die Unterseite lichtgrau, jede Feder gelbgrün gerundet, der Bürzel grüngelb. Das Gefieder der Jungen ist oberseits schwarzgrau, grünlich gekantet, Unterseite weißlich, mit mehr oder minder deutlichem grünlichen Scheine, schwarzgrau in die Länge gefleckt.
Der Rothbindenkreuzschnabel ( Loxia, rubrifasciata, Crucirostra rubrifasciata), dessen Länge einhundertfünfundsiebzig und dessen Breite dreihundert Millimeter beträgt, unterscheidet sich vom Fichtenkreuzschnabel durch einen verdeckten grauen Ring im Nacken, schwarzbraune rothbespritzte Schultern und zwei breite rosenrothe, beim Weibchen graue, beim jungen Vogel gelbgraue, durch die Spitze der Oberdeckfedern gebildete Flügelbinden.
Der Weißbindenkreuzschnabel ( Loxia bifasciata, und taenioptera, Crucirostra bifasciata, trifasciata und orientalis) endlich ist kleiner als alle bisher genannten. Seine Länge beträgt sechzehn, die Breite siebenundzwanzig, die Fittiglänge neun, die Schwanzlänge sechs Centimeter. Die vorherrschende Färbung des Gefieders ist ein prachtvolles Johannisbeerroth, welches im Nacken und auf der Mitte der Unterseite in Grau übergeht. Die an der Spitze weißen, großen und kleinen Oberflügeldeckfedern bilden zwei breite Binden über die Flügel, die Schulterdeckfedern enden ebenfalls mit weißen Spitzen. Weibchen und Junge ähneln denen des Fichtenkreuzschnabels, tragen jedoch ebenfalls die weißen Binden auf den Flügeln.
Die Kreuzschnäbel gehören zu denjenigen Gliedern ihrer Klasse, welche mein Vater passend »Zigeunervögel« genannt hat. Wie das merkwürdige Volk, dessen Namen sie tragen, erscheinen sie plötzlich in einer bestimmten Gegend, verweilen hier geraume Zeit, sind vom ersten Tage an heimisch, liegen auch wohl dem Fortpflanzungsgeschäfte ob und verschwinden ebenso plötzlich, als sie gekommen. Ihre Wanderungen stehen in gewissem Einklange mit dem Samenreichthume der Nadelwaldungen, ohne daß man jedoch eine bestimmte Regel feststellen könnte. Demgemäß können sie unseren Schwarzwaldungen jahrelang fehlen und sie dann wieder in Menge bevölkern. Nur ihr Aufenthalt ist bestimmt, ihre Heimat unbegrenzt. Alle die genannten Arten sind Brutvögel Nordeuropas, aber auch solche ganz Nordasiens, soweit es bewaldet ist, und es ist nicht unwahrscheinlich, daß letztgenannter Erdtheil als ihre ursprüngliche Heimat betrachtet werden darf. Wenn in zusammenhängenden Waldungen der Fichten- und Kiefersamen wohl gerathen ist, hört man das allen Fängern wohlbekannte »Göp, göp, gip, gip« oder »Zock, zock« unserer Vögel oder vernimmt im günstigeren Falle auch den für viele sehr angenehmen Gesang des Männchens. Die Kreuzschnäbel sind angekommen und haben sich häuslich eingerichtet. Ist der Wald versprechend, so schreiten sie zur Fortpflanzung, ist dies nicht der Fall, so schweifen sie eine Zeitlang hin und her und siedeln sich an einem anderen, passenderen Orte an. Die günstigsten Stellen eines Waldes, welche zum längeren Aufenthalte erwählt werden sollen, sind bald ausgefunden und werden nun als abendliche Sammelplätze der über Tag hin- und herschweifenden Gesellschaften benutzt, somit also gewissermaßen zu dem eigentlichen Wohnsitze.
Alle Kreuzschnäbel, gesellige Thiere, welche während der Brutzeit zwar in Paare sich sondern, nicht aber auch aus dem Verbande scheiden, sind Baumvögel, welche nur im Nothfalle auf die Erde herabkommen, um dort zu trinken oder um einige abgefallene Zapfen noch auszunutzen. Sie klettern sehr geschickt, indem sie sich nach Papageienart mit den Schnabelspitzen anhalten und forthelfen, hängen sich kopfunterst oder kopfoberst mit Fuß und Schnabel am Zweige oder Zapfen an und verweilen ohne Beschwerde viele Minuten lang in dieser scheinbar so unbequemen Stellung, fliegen mit wechselsweise stark ausgebreiteten und dann plötzlich angezogenen Flügeln, wodurch der Flug Wellenlinien annimmt, schnell und verhältnismäßig leicht, obwohl nicht gern weit, steigen, wenn sie um die Liebe ihres Weibchens werben, flatternd über die Wipfel empor, halten sich schwirrend auf einer und derselben Stelle, singen dabei und senken sich hierauf schwebend langsam wieder zu dem gewöhnlichen Sitzplatze hernieder. Während des Tages, höchstens mit Ausnahme der Mittagsstunden, sind sie fast immer in Thätigkeit. Im Frühjahre, Sommer und Herbste streichen sie schon vor Tagesanbruch im Walde auf und nieder und von einem Gehölze oder von einem Berge zum anderen; im Winter dagegen, zumal wenn die Kälte stark ist, bleiben sie länger an dem Orte, welcher ihnen Nachtruhe gewährte, fliegen selten vor Sonnenaufgang umher, singen jedoch bereits am frühen Morgen, befinden sich um zehn Uhr vormittags in voller Thätigkeit, beginnen mit ihrer Mahlzeit, singen inzwischen, werden nach zwei Uhr mittags stiller, fressen aber bis gegen vier Uhr nachmittags und gehen nunmehr zur Ruhe. Zur Tränke begeben sie sich gegen Mittag, im Sommer schon gegen zehn oder elf Uhr vormittags. Sie bekümmern sich wenig oder nicht um die anderen Thiere des Waldes, ebensowenig um den Menschen, dem sie namentlich in den ersten Tagen nach ihrem Erscheinen deutlich genug beweisen, daß sie ihn noch nicht als Feind kennen gelernt haben. Man hat sich deshalb verleiten lassen, sie als sehr dumme Vögel zu betrachten, und unterstützt diese Meinung durch Beobachtungen, welche allerdings eine fast allzugroße Harmlosigkeit bekunden. Wenn man sie aber genauer kennen lernt, findet man bald heraus, daß auch sie durch Erfahrung klüger werden, überhaupt keineswegs so dumm sind, als sie aussehen. Ihr Fang und ihre Jagd verursachen wenig Schwierigkeiten, weil ihre Geselligkeit so groß ist, daß sie dieser zu Liebe ihre Freiheit oft rücksichtslos aufs Spiel setzen: dies jedoch spricht weniger für Mangel an Verstand als vielmehr für das gute Gemüth der wirklich liebenswürdigen Thiere. Das Männchen, dessen Weibchen eben erlegt wurde, bleibt zuweilen verdutzt oder traurig sitzen auf demselben Aste, von welchem der Gatte herabgeschossen wurde, oder kehrt, nach dem Gefährten suchend, wiederholt zu dem Orte der Gefahr zurück; wenn es aber wiederholt traurige Erfahrungen über die Tücke des Menschen machen mußte, zeigt es sich gewöhnlich sehr scheu. In Gefangenschaft werden alle Kreuzschnäbel bald rücksichtslos zahm. Sie vergessen schnell den Verlust ihrer Freiheit, lernen ihren Pfleger als Herrn und Gebieter kennen, legen alle Furcht vor ihm ab, lassen sich später berühren, auf dem Arme oder der Hand im Zimmer umhertragen und geben ihm schließlich durch entsprechendes Gebaren ihre warme Liebe kund. Diese Liebenswürdigkeit im Käfige hat sie allen, welche sie kennen, innig befreundet, und zumal die Gebirgsbewohner halten sie hoch in Ehren.
Die Lockstimme des Kieferkreuzschnabels, welche beide Geschlechter hören lassen, ist das bereits erwähnte »Göp, göp« oder »Gip, gip« und »Zock, zock«. »›Göp‹ wird im Fluge und im Sitzen ausgestoßen«, sagt mein Vater, dem wir die ausführlichste und beste Beschreibung der Kreuzschnäbel verdanken, »und ist ebensowohl ein Zeichen zum Aufbruche, als ein Ruf nach anderen Kreuzschnäbeln und ein Ton, um die Gesellschaft zusammenzuhalten: deswegen klingt dieses ›Göp‹ auch sehr stark; ›Gip, gip‹ drückt Zärtlichkeit aus und ist ein Ton, den beide Gatten einander im Sitzen zurufen; er ist so leise, daß man nahe beim Baume sein muß, um ihn zu vernehmen. Oft glaubt man beim Hören dieses Rufes, der Vogel sei sehr weit, und wenn man genau nachsieht, erblickt man ihn über sich. ›Zock‹ wird gewöhnlich von sitzenden Vögeln ausgestoßen, um die vorüberfliegenden zum Herbeikommen und Aufsitzen einzuladen; doch hört man es auch zuweilen von Kreuzschnäbeln im Fluge. Es klingt stark und voll und muß der Hauptruf bei einem Lockvogel sein. Die Jungen haben in ihrem Geschreie viele Aehnlichkeit mit den jungen Bluthänflingen; doch lassen sie bald das ›Göp‹, ›Gip‹ und ›Zock‹ der Alten vernehmen. Der Lockton des Fichtenkreuzschnabels, welchen er im Fluge, aber auch im Sitzen, hören läßt, ist ›Gip, gip‹, höher und schwächer als der des Kieferkreuzschnabels. Dieses ›Gip‹ ist Zeichen des Aufbruches, der Warnung und des Zusammenhaltens. Sitzen sie, und fängt einer stark ›Gip‹ zu schreien an, so sind die anderen alle aufmerksam und fliegen gewöhnlich sämmtlich mit fort, wenn sich der eine in Bewegung setzt. Wenn sie aber fressen, und es fliegen einige vorbei, welche diesen Lockton ausstoßen, so lassen sich die Fressenden gewöhnlich in ihrer Arbeit nicht stören und rufen nur selten ›Zock, zock‹ ihnen zu, was zum Niedersitzen einladet. Auch dieses ›Zock‹ klingt höher und heller, als beim Kieferkreuzschnabel, und lockt eigentlich an. Ist einer von dem anderen entfernt, und einer sitzt noch, so schreit dieser unaufhörlich ›Zock‹, um jenen zur Rückkehr zu vermögen. Sitzt einer auf der Spitze eines Baumes und will einen ganzen Flug zum Niedersetzen bewegen, so läßt er dieses ›Zock‹ sehr stark hören; im Fluge stoßen sie diesen Lockton selten aus. Beim Sitzen geben sie noch einen ganz leisen Ton zum besten, welcher fast wie das Piepen der kleinen Küchelchen klingt, wenn diese unter der Henne stecken. Dieser Ton hat mit dem des Kieferkreuzschnabels große Ähnlichkeit. Die Jungen schreien fast wie die jungen Kieferkreuzschnäbel, lassen aber auch ein Piepen vernehmen wie die Alten.« Der Gesang des Männchens spricht viele Menschen außerordentlich an. Gewöhnlich singt der Kieferkreuzschnabel besser als der Fichtenkreuzschnabel; das Lied beider ähnelt sich aber. Es besteht aus einer laut vorgetragenen Strophe, auf welche mehrere zwitschernde, schwache und nicht weit hörbare Töne folgen. In der Freiheit singen sie am stärksten, wenn das Wetter schön, heiter, still und nicht zu kalt ist; an windigen und stürmischen Tagen schweigen sie fast gänzlich. Während des Gesanges wählen sie sich fast regelmäßig die höchsten Spitzen der Wipfel, und nur während der Liebeszeit zwitschern und schwatzen sie auch im Fliegen. Die Weibchen singen zuweilen ebenfalls, aber leiser und verworrener als die Männchen. Im Käfige singen sie fast das ganze Jahr, höchstens mit Ausnahme der Mauserzeit.
Die Nahrung der Kreuzschnäbel besteht vorzugsweise aus den Sämereien der Waldbäume. Zur Gewinnung dieser Nahrung ist ihnen ihr starker und gekreuzter Schnabel unentbehrlich. Es erfordert große Kraft und viele Geschicklichkeit, die Kiefer- oder Fichtenzapfen aufzubrechen, um zu den wohl verborgenen Samen zu gelangen; beide aber besitzt der Kreuzschnabel in hohem Grade. Er kommt angeflogen, hängt sich an einen Zapfen an, so daß der Kopf nach unten zu stehen kommt, oder legt den Zapfen auf einen Ast und setzt sich darauf, oder beißt ihn ab, trägt ihn auf einen Ast und hält ihn mit den starken, langen und spitzigen Nägeln fest. »Sehr schön sieht es aus«, fährt mein Vater fort, »wenn ein Fichtenkreuzschnabel, ein so kleiner Vogel, einen mittelmäßig großen Fichtenzapfen von einem Baume auf den anderen trägt. Er faßt ihn mit dem Schnabel gewöhnlich so, daß seine Spitze gerade vorwärts gerichtet ist, und fliegt mit geringer Anstrengung zehn, auch zwanzig Schritte weit auf einen benachbarten Baum, um ihn auf diesem zu öffnen; denn nicht auf allen findet er Aeste, auf denen er die Zapfen bequem aufbrechen kann. Dieses Aufbrechen wird auf folgende Weise bewerkstelligt. Der Kreuzschnabel reißt, wenn der Zapfen fest hängt oder liegt, mit der Spitze der oberen Kinnlade die breiten Deckelchen der Zapfen in der Mitte auf, schiebt den etwas geöffneten Schnabel darunter und hebt sie durch eine Seitenbewegung des Kopfes in die Höhe. Nun kann er das Samenkorn mit der Zunge leicht in den Schnabel schieben, wo es von dem Flugblättchen und der Schale befreit und dann verschluckt wird. Sehr große Zapfen öffnet er nicht. Der über das Kreuz gebogene Schnabel ist ihm und seinen Gattungsverwandten beim Aufbrechen der Zapfen von höchster Wichtigkeit; denn einen solchen Schnabel braucht er nur wenig zu öffnen, um ihm eine außerordentliche Breite zu geben, so daß bei einer Seitenbewegung des Kopfes das Deckelchen mit der größten Leichtigkeit aufgehoben wird. Das Aufbrechen der Zapfen verursacht ein knisterndes Geräusch, welches zwar gering, aber doch stark genug ist, um von unten gehört zu werden. Die abgebissenen Zapfen werden vom Fichtenkreuzschnabel selten rein ausgefressen, wie dies bei den Kieferzäpfchen von seinen Gattungsverwandten geschieht, sondern oft ganz uneröffnet, oft halb oder zum dritten Theile eröffnet herabgeworfen. Dies geschieht selbst bei vollkörnigen Zapfen, aber nicht bloß von jungen Vögeln, wie Bechstein glaubt, sondern auch von alten; deswegen ist der Boden unter den Bäumen, auf welchen einige Kreuzschnäbel eine Zeitlang gefressen haben, zuweilen mit Zapfen bedeckt oder wenigstens bestreut. Wenn sie fortfliegen, lassen sie alle ihre Zapfen fallen. Sind die Zapfen an den Bäumen einzeln oder aufgefressen, dann suchen sie die heruntergefallenen auf und öffnen sie wie die an den Bäumen hängenden.« Der Fichtenkreuzschnabel geht selten an die weit schwerer aufzubrechenden Kieferzapfen, weil er zu der an ihnen erforderlichen Arbeit nicht die nöthige Kraft besitzt; der Kieferkreuzschnabel aber bricht auch Kieferzapfen ohne Mühe auf; denn er kann mit einem Male alle die Deckelchen aufheben, die über dem liegen, unter welchem er seinen Schnabel eingesetzt hat. Beide Arten brechen stets mit dem Oberkiefer auf und stemmen den unteren gegen den Zapfen; daher kommt es, daß bei dem Rechtsschnäbler immer die rechte, bei dem Linksschnäbler immer die linke Seite des Schnabels nach oben gehalten wird. In Zeit von zwei bis drei Minuten ist der Vogel mit einem Zapfen fertig, läßt ihn fallen, holt sich einen anderen und öffnet diesen. So fährt er so lange fort, bis sein Kropf gefüllt ist. An den auf dem Boden liegenden Zapfen erkennt man, daß der Wald Kreuzschnäbel beherbergt. Wenn letztere nicht gestört werden, bleiben sie stundenlang auf einem und demselben Baume sitzen und verlassen dann auch die Gegend, in welcher sie sich einmal eingefunden, wochenlang nicht. So lange sie Holzsamen auffinden, gehen sie kaum andere Nahrung an; im Nothfalle aber fressen sie Ahorn- und Hornbaum- oder Heinbuchensamen, auch wohl ölige Sämereien, und nebenbei jederzeit sehr gern Kerbthiere, namentlich Blattläuse, welche sie sich, auch in den Gärten und Obstpflanzungen der Walddörfer zusammenlesen.
Eine nothwendige Folge des vielfachen Arbeitens auf den harzreichen Aesten und Zapfen ist, daß sie sich oft in sehr unerwünschter Weise beschmutzen. Sie sind ebenso reinlich, wie die meisten übrigen Vögel, und putzen sich nach jeder Mahlzeit sorgfältig, um sich von den anhängenden Harztheilen zu reinigen, wetzen namentlich den Schnabel minutenlang auf den Aesten, vermögen aber nicht immer, ihr Gefieder so in Ordnung zu halten, als sie wohl wünschen, und oft kommt es vor, daß die Federn einen dicken Ueberzug von Harz erhalten. Der Leib der Kreuzschnäbel, welche längere Zeit ausschließlich Nadelholzsamen fraßen, wird von dem Harzgehalte so durchdrungen, daß er nach dem Tode längere Zeit der Fäulnis widersteht. »Das Fleisch«, sagt mein Vater, »erhält zwar einen eigenen, widrigen Geruch, aber es verwest nicht eigentlich. Nur muß man es vor den Fleischfliegen in Acht nehmen; denn wenn diese dazu kommen, legen sie ihre Eier daran, und die daraus hervorkommenden Maden durchwühlen und verzehren das Fleisch. Ich habe darüber mehrere Versuche angestellt und immer denselben Erfolg gefunden; ich habe einen vor mir liegen, welcher im Sommer in der größten Hitze geschossen wurde und doch alle Federn behalten hat; ich habe auch eine zwanzig Jahre alte Mumie gesehen.« Daß nur das in den Leib aufgenommene Harz die Ursache dieses eigenthümlichen Befundes ist, geht aus anderen Beobachtungen hervor; denn wenn der Kreuzschnabel sich einige Zeit von Kerbthieren genährt hat, verfällt sein Leib ebenso schnell der Verwesung, wie die Leiche anderer kleinen Vögel.
Eine Kreuzschnabelgesellschaft bildet zu jeder Zeit eine hohe Zierde der Waldbäume; am prächtigsten aber nimmt sie sich aus, wenn der Winter die Herrschaft führt und dicker Schnee auf den Zweigen liegt. Dann heben sich die rothen Vögelchen lebendig ab von dem düsteren Nadelgrün und dem weißen Schnee und wandeln den ganzen Wipfel zu einem Christbaume um, wie er schöner nicht gedacht werden kann. Zu ihrer ansprechenden Färbung gesellt sich ihr frisches, fröhliches Leben, ihre stille, aber beständige Regsamkeit, ihr gewandtes Auf- und Niederklettern, ihr Schwatzen und Singen, um jedermann zu fesseln.
Es ist bekannt, daß die Kreuzschnäbel in allen Monaten des Jahres nisten, im Hochsommer ebensowohl wie im eisigen Winter, wenn der Schnee dick auf den Zweigen liegt und alle übrigen Vögel des Waldes fast vollständig verstummt sind. Während des Nestbaues sondert sich die frühere Gesellschaft in einzelne Paare; jedes beweibte Männchen setzt sich auf die höchste Spitze des höchsten Baumes, singt eifrig, lockt anhaltend und dreht sich dabei unaufhörlich um sich selbst herum, in der Absicht, dem Weibchen in seiner ganzen Schönheit sich zu zeigen. Kommt dieses nicht herbei, so fliegt es auf einen anderen Baum und singt und lockt von neuem; nähert sich die spröde Gattin, so eilt es sofort hinter ihr her und jagt sie spielend unter piependem Rufen von Ast zu Ast. Der Kieferkreuzschnabel pflegt bei solcher Liebesbewerbung noch besondere Flugspiele auszuführen, erhebt sich mit zitternden Flügelschlägen, flattert und singt dabei, kehrt aber ebenso wie der Fichtenkreuzschnabel immer wieder auf denselben Baum zurück. Das Nest steht bald auf einem weit vorstehenden Aste und hier auf einer Gabel oder auf einem dicken Aste am Stamme, bald nahe am Wipfel, bald weit von ihm, immer jedoch so, daß Zweige vor oder über dem Neste hinlaufen, durch welche es gegen den darauf fallenden Schnee geschützt und zugleich möglichst versteckt ist. Es ist ein Kunstbau, welcher äußerlich aus dürren Fichtenreisern, Heidekraut, trockenen Grasstengelchen, der Hauptsache nach aber aus Fichtenflechten, Baum- und Erdmoos aufgeführt und innen mit einzelnen Federn, Grashälmchen und Kiefernnadeln ausgelegt wird. Die Wände sind ungefähr drei Centimeter dick und vortrefflich zusammengewebt; der Napf ist verhältnismäßig tief. »Ich hatte Gelegenheit«, sagt mein Vater, »ein Weibchen während des Nestbaues zu beobachten. Zuerst brach es die dürren Reiser ab und trug sie an Ort und Stelle, dann lief es auf den Aesten der benachbarten Bäume herum, um die Bartflechten zu suchen; es nahm davon jedesmal einen Schnabel voll, trug sie in das Nest und brachte sie in die gehörige Lage. Als die Rundung des Nestes fertig war, verweilte es länger darin und brachte alles durch Drücken mit der Brust und durch Drehen des Körpers in Ordnung. Es nahm fast alle Stoffe des Nestes von einem einzigen benachbarten Baume und war so emsig, daß es auch in den Nachmittagsstunden baute und in Zeit von zwei bis drei Minuten mit dem Herbeischaffen und Verarbeiten einer Tracht fertig war. Das Männchen blieb immer bei ihm, betrat es alle Tage, entweder auf den Aesten oder auf dem Neste, fütterte es, als es zu brüten oder doch das erste Ei zu wärmen anfing (denn sobald das erste Ei gelegt war, verließ es das Nest nicht mehr), sang beständig in seiner Nähe und schien es so für die Beschwerden des Bauens und Brütens, welche es nicht mit ihm theilen konnte, entschädigen zu wollen.« Das Gelege besteht aus drei bis vier verhältnismäßig kleinen, höchstens achtundzwanzig Millimeter langen, zweiundzwanzig Millimeter dicken Eiern, welche auf graulich- oder bläulichweißem Grunde mit verloschenen Flecken und Stricheln von blutrother, blutbräunlicher oder schwarzbrauner Färbung besetzt sind. Zuweilen stehen diese Fleckchen kranzartig an dem stumpfen Ende, zuweilen verbreiten sie sich über das ganze Ei; dieses aber ist, aller Aenderung ungeachtet, immer als Kreuzschnabel-Ei zu erkennen. Die sorgsame Mutter gibt sich dem Brutgeschäfte mit regem Eifer hin, während das Männchen auch seinerseits durch Atzung der Mutter die ihm zufallende Arbeit freudig übernimmt. Die Jungen, welche von den Eltern sehr geliebt werden, erhalten vom ersten Tage ihres Lebens an Fichten- oder Kiefernsamen zur Speise, zuerst solchen, welcher im Kropfe der Alten erweicht und bezüglich halb verdaut ist, später härteren, wachsen rasch heran und sind bald recht gewandt und munter, bedürfen aber länger als alle anderen Sperlingsvögel besonderer Pflege der Eltern, weil ihr Schnabel erst nach dem Ausfliegen zum Kreuzschnabel wird, sie also bis dahin nicht im Stande sind, Kiefer- oder Fichtenzapfen zu öffnen. Sie umlagern daher noch lange nach ihrem Ausfliegen die arbeitenden Alten, schreien ununterbrochen wie unartige Kinder, fliegen den Eltern eilig nach, wenn diese den Baum verlassen, oder locken so lange und so ängstlich, bis jene zurückkommen. Nach und nach gewöhnen die Alten sie ans Arbeiten. Zuerst werden ihnen deshalb halbgeöffnete Zapfen vorgelegt, damit sie sich im Aufbrechen der Schuppen üben; später erhalten sie die abgebissenen Zapfen vorgelegt, wie diese sind. Auch wenn sie allein fressen können, werden sie noch eine Zeitlang geführt, endlich aber sich selbst überlassen.
Jagd und Fang der Kreuzschnäbel verursachen keine Schwierigkeit. Die neu bei uns angekommenen lassen sich, ohne wegzufliegen, von dem Schützen unterlaufen, bleiben sogar oft dann noch auf demselben Baume sitzen, wenn einer oder der andere ihrer Gefährten herabgeschossen wurde. Der Fang ist, wenn man erst einen von ihnen berückte, noch leichter als die Jagd. In Thüringen nimmt man hohe Stangen, bekleidet sie oben buschartig mit Fichtenzweigen und befestigt an diesen Leimruthen. Die Stangen werden auf freien Blößen im Walde vor Tagesanbruch aufgestellt und ein Lockvogel im Bauer unten an ihnen befestigt. Alle vorüberfliegenden Kreuzschnäbel nähern sich wenigstens dieser Stange, um nach dem rufenden und lockenden Genossen zu schauen. Viele setzen sich auch auf den Busch und dabei gewöhnlich auf eine der Leimruthen.
Man darf wohl behaupten, daß der Nutzen, welchen die Kreuzschnäbel bringen, den geringen Schaden, welchen sie uns bereiten können, reichlich aufwiegt. Ganz abgesehen von dem Vergnügen, welches sie jedem Thierliebhaber gewähren, oder von der Zierde, welche sie im Winter dem Nadelbäumen verleihen, nützen sie entschieden dadurch, daß sie in samenreichen Jahren die überladenen Wipfel durch Abbeißen der Fichtenzapfen erleichtern und diese hierdurch erhalten. Neuerdings hat man auch sie als schädlich, mindestens forstschädlich, hinzustellen versucht, dabei aber wohl nur an die dürftigen Waldungen der armen Mark und anderer ebenso karger Gaue Deutschlands, nicht aber an die frischen Wälder unserer Mittelgebirge gedacht. Hier finden sie, wenn sie erscheinen, einen so überreich gedeckten Tisch, daß kein Forstmann die Zapfen, welche sie aufbrechen, ihnen nachrechnet oder mißgönnt.