
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
(Fortsetzung.)
Die Geier ( Vulturidae), deren Gesammtheit wir als Familie auffassen, sind die größten aller Raubvögel. Der Schnabel ist länger oder mindestens ebenso lang als der Kopf, gerade, nur vor der Spitze des Oberschnabels hakig herabgebogen, höher als breit, mit scharfen Schneiden und einer großen Wachshaut ausgerüstet, welche letztere ein Drittheil und bei schwächeren Arten sogar die Hälfte der Länge einnimmt. Ein eigentlicher Zahn fehlt immer, wird aber, wie bei den Adlern, durch eine hervorspringende Ausbuchtung der Schneide des Oberkiefers ersetzt. Bei einigen Arten kommen Hautwucherungen, namentlich kammartige Erhöhungen, auf dem Schnabel vor. Die Füße sind kräftig, die Zehen jedoch schwach, die Nägel kurz, wenig gebogen und immer stumpf, so daß die Fänge als Angriffswerkzeug wenig Bedeutung haben. Die Flügel sind außerordentlich groß, dabei aber, weil die vierte Schwinge die längste zu sein pflegt, breit und meist sehr abgerundet. Der Schwanz ist mittellang, zugerundet oder stark abgestuft und aus steifen Federn gebildet. Hinsichtlich des inneren Leibesbaues stimmen die Geier in allen wesentlichen Merkmalen mit den Falken überein; doch haben einige mehr Halswirbel als jene. Die Schwanzwirbel sind breiter, das Brustbein ist verhältnismäßig niedriger, die Armknochen sind länger als bei den Falken; der Schlund erweitert sich zu einem Kropfe von beträchtlicher Größe, welcher gefüllt wie ein Sack aus dem Halse hervortritt; der Vormagen ist groß.
Wir nennen die Geier unedle Raubvögel, weil ihre Begabungen als einseitige zu betrachten sind; falsch aber würde es sein, wollten wir unedel mit unvollkommen für gleichbedeutend halten. In gewisser Hinsicht müssen die Geier als sehr hochstehende Vögel angesehen werden. Ihre Begabungen sind theilweise ausgezeichnet. Sie halten sich lässig, auf dem Boden sitzend sehr niedrig, tragen die Flügel abstehend vom Leibe und ordnen das Gefieder nur selten mit einiger Sorgfalt; gehen zwar nicht anmuthig, aber ziemlich leicht, meist schrittweise und fliegen langsam, aber mit ungemeiner Ausdauer. Ihre Sinne wetteifern an Schärfe mit denen anderer gefiederten Räuber; ihr Gesicht namentlich reicht in Fernen, von denen wir kaum eine Vorstellung gewinnen; ihr Gehör, der nächstdem am höchsten entwickelte Sinn, ist sehr gut, ihr Geruch sicherlich schärfer als bei anderen Raubvögeln, obwohl durchgehends nicht so vortrefflich, wie man gefabelt hat, ihr Geschmack, ungeachtet der schmutzigen Nahrungsstoffe, welche sie zu sich nehmen, keineswegs verkümmert und ihr Gefühl, sei es, indem wir es als Empfindungs- oder indem wir es als Tastvermögen ansehen, nicht wegzuleugnen. Dagegen scheinen ihre Geistesfähigkeiten gering zu sein. Sie sind scheu, selten jedoch wirklich vorsichtig, jähzornig und heftig, aber nicht unternehmend und noch viel weniger kühn, gesellig, allein keineswegs friedfertig, bissig und böswillig, dabei aber feig; ihr Geist erhebt sich nicht einmal zur List. Sie lernen nach und nach gefährliche Menschen oder Thiere von ungefährlichen unterscheiden, gewinnen aber selten wirkliche Anhänglichkeit an ein anderes Geschöpf. Immer zeigen sie sich plump und roh in ihrem Auftreten. Eine merkwürdige Beharrlichkeit in dem, was sie einmal begonnen, ist ihnen eigen. Wir nennen sie träge, weil wir sie stundenlang in größter Ruhe regungslos an einem und demselben Orte verweilen sehen, könnten aber von ihnen, welche den größten Theil des Tages fliegend verbringen, auch das Gegentheil behaupten. Ihr Wesen ist ein Gemisch von den verschiedenartigsten und scheinbar sich widersprechenden Eigenschaften. Man ist versucht, sie als ruhige und stille Vögel anzusehen, während genauere Beobachtung doch ergibt, daß sie zu den leidenschaftlichsten aller Raubvögel gezählt werden müssen.
Erst wenn man die Art und Weise des Nahrungserwerbs der Geier kennt, lernt man sie verstehen. Der Name Raubvogel verliert bei ihnen einen Theil seiner Bedeutung. Wenige von ihnen und auch diese wahrscheinlich bloß ausnahmsweise, greifen lebende Thiere an, in der Absicht, sie zu tödten; für gewöhnlich sammeln sie einfach das auf, was ein günstiger Zufall ihnen überliefert. Sie bestatten die Leichen, welche sie finden, oder räumen den Unrath weg, welchen sie erspähen. Weil aber der Zufall nicht immer sich ihnen günstig zeigt und sie demzufolge oft tagelang Mangel leiden müssen, geberden sie sich beim Anblicke einer Beute, als müßten sie sich unter allen Umständen für gehabte Entbehrungen entschädigen und für kommende versorgen.
Vögel, welche wie sie sich ernähren, können nur in warmen oder in gemäßigten Gürteln der Erde hausen. Der reiche Süden zeigt sich freigebiger als der Norden, liefert auch den Geiern soviel, daß sie sich durchs Leben schlagen können. Mit Ausnahme Neuhollands beherbergen alle Erdtheile Geier. Die Alte Welt ist reicher an ihnen als die Neue, und die hier lebenden Arten sind außerdem noch hinsichtlich ihres Vorkommens weit mehr beschränkt als jene der östlichen Erdhälfte. Einige finden sich in annähernd gleich großer Menge in Europa, Asien und Afrika oder werden hier mindestens durch nahstehende Verwandte vertreten. Man begegnet ihnen in den heißen durchglühten Ebenen wie über den höchsten Zinnen der Gebirge der Erde. Sie sind es, welche, soviel bis jetzt bekannt, höher als alle anderen Vögel im Luftmeere emporsteigen; sie sind befähigt, die großartigsten Veränderungen des Luftdruckes ohne Beschwerde zu ertragen. Einige Arten nehmen im Gebirge ihren Stand und verlassen dasselbe nur ausnahmsweise, während andere wiederum ebene Gegenden in größerer Menge bewohnen als die Hochgebirge. Von einem eigentlichen Standorte ist übrigens bei ihnen kaum zu reden. Ihre ungeheueren Flugwerkzeuge befähigen sie, und die Eigenthümlichkeit ihres Nahrungserwerbes nöthigt sie, weitere Strecken zu durchstreifen, als irgend ein anderer Raubvogel sie durchfliegt. Bloß während der Fortpflanzungszeit bindet sie die Sorge um ihre Brut an ein und dasselbe Gebiet; während des übrigen Jahres führen sie mehr oder weniger ein Wanderleben. Mit vollster Wahrheit kann man von ihnen sagen, daß sie überall und nirgends zu finden sind. Sie erscheinen plötzlich massenhaft in Gegenden, wo man tage- und wochenlang nicht einen einzigen von ihnen wahrnahm, und verschwinden ebenso spurlos wieder, als sie gekommen. Die Nähe der menschlichen Wohnungen meiden nur einzelne Geier; andere finden gerade hier das tägliche Brod mit größerer Leichtigkeit als in Gegenden, in denen der Mensch, sozusagen, noch nicht zur Herrschaft gelangt ist. Für die Ortschaften Südasiens, Afrikas und Südamerikas sind gerade diese Raubvögel bezeichnende Erscheinungen.
Es wird die Lebensweise der Geier anschaulich machen, wenn ich einzelne von ihnen handelnd auftreten lasse. Ich darf dies um so eher thun, als ich die Geier nicht bloß in der Gefangenschaft, sondern auch in ihrem Freileben beobachtet habe und oft genug Zeuge ihres Auftretens gewesen bin.
Am südlichen Saume der Wüste liegt ein verendetes Kamel. Die Beschwerden der Wüstenreise haben es erschöpft; es erreichte, obgleich der Treiber ihm am vorigen Tage seine Last abnahm und es ledig neben den befrachteten Arbeitsgenossen einhergehen ließ, den Nil nicht mehr, sondern brach, vollständig entkräftet, auf Nimmerwiederaufstehen zusammen. Sein Herr ließ es, nachdem er mit nicht verhehltem Kummer über den durch seinen Tod erlittenen Verlust von ihm geschieden ist, unberührt liegen, weil sein Glaube ihm verbietet, das geringste von einem gestorbenen oder nicht unter den üblichen Gebräuchen getödteten Thiere zu verwenden.
Am nächsten Morgen liegt der Leichnam noch unversehrt auf seinem fahlen Sterbebette. Da erscheint ein Rabe über dem nächsten Bergesgipfel. Sein scharfes Auge erspäht das Aas; er schreit und nähert sich mit rascheren Flügelschlägen, kreist einigemal um das gefallene Thier, senkt sich dann herab und betritt, in nicht allzugroßer Entfernung von demselben den Boden, nähert sich ihm nunmehr rasch und umgeht es mehreremal mit bedächtigem Spähen. Andere Raben folgen seinem Beispiele, und bald ist eine ansehnliche Gesellschaft dieser allgegenwärtigen Vögel versammelt. Nunmehr finden sich auch andere Fleischfresser ein. Der überall vorhandene Schmarotzermilan und der kaum minder häufige Schmutzgeier ziehen Kreise über demselben, ein Raubadler nähert sich, mehrere Kropfstörche drehen in schwindelnder Höhe ihre Schraubenlinien über dem auch ihnen winkenden Gerichte. Aber noch fehlen die Vorleger der Speise. Die zuerst angekommene Gesellschaft nagt allerdings hier und da an dem gefallenen Thiere; dessen dicke Lederhaut ist jedoch den schwachen Schnäbeln viel zu fest, als daß sie sich größere Bissen abreißen könnten. Nur das eine nach oben gekehrte Auge konnte von einem Schmutzgeier aus seiner Höhle gezogen werden. Doch die Zeit, in welcher auch die großen Glieder der Familie auf Nahrung ausfliegen, kommt allmählich heran. Es ist zehn Uhr geworden; sie haben nun ausgeschlafen und ausgeträumt und einer nach dem anderen ihre Schlafplätze verlassen. Zuerst waren sie niedrig längs des Gebirges hingestrichen; da sie aber nichts genießbares ersehen konnten, stiegen sie in der Luft empor und erhoben sich zu einer unabsehbaren Höhe. In dieser ziehen sie ihre Kreise weiter; einer folgt dem anderen wenigstens mit den Blicken, steigt oder fällt mit ihm, wendet sich wie der Vorgänger nach dieser oder jener Seite. Von seinem Standpunkte aus kann er ein ungeheueres Gebiet sozusagen, mit einem Blicke überschauen, und das Auge ist so wundervoll scharf, daß ihm kaum etwas entgeht. Der Geier, welcher das Gewimmel in der Tiefe erblickt, gewinnt damit sofort ein klares Bild und erkennt, daß er das gesuchte gefunden. Nunmehr läßt er sich zunächst in einigen Schraubenwindungen tiefer herab, untersucht die Sache näher und zieht, sobald er sich überzeugt, plötzlich die gewaltigen Flügel ein. Sausend stürzt er Hunderte, vielleicht tausend Meter hernieder und würde zerschmettert werden, wenn er nicht rechtzeitig noch die Schwingen halb wieder ausbreitete, um den Fall aufhalten und die Richtung regeln zu können. Bereits in ziemlicher Entfernung von dem Boden strecken die schwerleibigen Arten die Ständer lang aus und senken sich sodann, noch immer außerordentlich rasch, schief nach unten hernieder, wogegen die leichter gebauten anscheinend mit der Gewandtheit und Zierlichkeit eines Falkens herniederkommen und durch verschiedene Schwenkungen, welche sie wechselseitig heben und senken, die Wucht des Falles zu mildern wissen. Von der Trägheit und Unbehülflichkeit, welche die Geier sonst an den Tag zu legen scheinen, ist jetzt nicht das geringste mehr zu bemerken; sie überraschen im Gegentheile durch eine Gewandtheit, welche man ihnen niemals zugetraut hätte.
Dem ersten Ankömmling folgen alle übrigen, welche sich innerhalb gewisser Grenzen befinden, rücksichtslos nach. Das Herabstürzen des ersteren ist für sie das Zeichen zur Mahlzeit. Sie eilen jetzt von allen Seiten herbei und lassen sich auf eigene Untersuchung nicht mehr ein. Man hört im Laufe einer Minute wiederholt das sausende Geräusch, welches sie beim Herabstürzen verursachen und sieht von allen Richtungen her rasch sich vergrößernde Körper herniederfallen, obgleich man wenige Minuten vorher die fast drei Meter klafternden Vögel auch nicht einmal als Pünktchen wahrgenommen hatte. Jetzt stört die Thiere nichts mehr. Sobald einer von ihnen an der Tafel sitzt, scheuen sie keine Gefahr; nicht einmal ein sichtbarer Jäger vertreibt sie. Sogleich nach Ankunft am Boden eilen sie mit wagerecht vorgestrecktem Halse, erhobenem Schwanze und halb ausgebreiteten, schleppenden Flügeln aus das Aas zu, und nunmehr bethätigen sie ihren Namen; denn Vögel, welche gieriger wären als sie, kann es nicht geben. Es gibt für sie keine Rücksicht mehr. Das kleinere Gesindel macht mit Ehrfurcht Platz; unter gleichstarken Arten erhebt sich wüthender Kampf und Streit. Von ihrem Arbeiten ein rechtes Bild zu gewinnen, ist schwer; das Gewimmel, das Streiten, Zanken, Kämpfen dabei läßt sich kaum schildern. Zwei bis drei Schnabelhiebe der starkschnäbeligen Geier zerreißen die Lederhaut des Aases, einige mehr die Muskellagen, während die leichter bewaffneten Arten ihren langen Hals, so weit sie können, in die Höhlen einschieben, um zu den Eingeweiden zu gelangen. Mit gieriger Hast wühlen sie zwischen diesen umher, und einer sucht den anderen fortwährend zu verdrängen, zu überbieten. Leber und Lunge werden selten herausgerissen, vielmehr in der Höhle selbst aufgefressen, die Därme hingegen herausgezogen, durch schwer zu beschreibendes Zurückhüpfen weiter und weiter herausgefördert und dann nach wüthendem Kampfe mit anderen stückweise verschlungen. Beständig stürzen noch hungrige Geier von oben herab unter die bereits schmausenden, in der bestimmten Absicht, sie womöglich von der köstlichen Tafel zu vertreiben, und wiederum gibt es neuen Kampf, neues Lärmen, Beißen und ingrimmiges Gezwitscher. Die schwächeren Gäste sitzen, während die großen Herren speisen, entsagend um die Gruppe, sind aber höchst achtsam auf den Hergang, weil sie wissen, daß ihnen von jenen doch zuweilen ein Bröcklein zugeworfen wird, natürlich ohne deren Willen, bloß in der Hitze des Gefechtes. Adler und Milane schweben auch wohl in der Höhe über der schmausenden Gesellschaft auf und nieder und stürzen sich, als ob sie auf fliegende Beute stoßen wollten, zwischen sie hinein, ergreifen mit den Fängen ein eben von den Geiern losgearbeitetes Fleischstück und entführen es, bevor letztere noch Zeit hatten, dem Frevel zu steuern.
Ein kleines Säugethier wird von solcher freßwüthigen Tischgesellschaft binnen wenigen Minuten bis auf den Schädel verzehrt; sogar von einem Rinde oder Kamele bleibt nach einer einzigen Mahlzeit wenig übrig. Die gesättigten entfernen sich nur mit Widerstreben von der Tafel.
Nicht überall und immer verläuft eine Geiermahlzeit so, wie ich eben geschildert. Schon in Südeuropa und noch mehr in ganz Afrika stellen sich da, wo Geier in der Nähe bewohnter Ortschaften ein Aas aufzuräumen haben, auf diesem noch andere hungrige Gäste ein. In allen südlichen Ländern sind die Hunde theilweise auf Aasnahrung angewiesen, und die wirklich herrenlosen unter ihnen können sich buchstäblich nur dann einmal satt fressen, wenn sie ein Aas fanden. Im tieferen Inneren Afrikas treten zu den Hunden noch die Marabus. Ihnen gegenüber haben die Geier oft schwere Kämpfe zu bestehen; der nagende Hunger aber macht sie dreist und den Gegnern furchtbar. Auch die größten Hunde werden vertrieben, so sehr sie knurren und die Zähne fletschen; denn jeder Geier erkennt in ihnen einen gefährlichen Beeinträchtiger des Gewerbes. Selbst der bissigste Hund vermag gegen die Geier nichts auszurichten. Wenn wirklich einer seiner Bisse ihm glückte, traf er höchstens eine der ausgebreiteten Schwingen, ohne den Vogel zu schädigen, wogegen dieser wie eine Schlange seinen Hals vorwirft und der gewaltige Schnabel da, wo er auftrifft, eine blutige Wunde zurückläßt. Anders verhält es sich mit den Marabus. Sie lassen sich auch von den Geiern nicht vertreiben, sondern schmettern mit ihren Keilschnäbeln rechts und links unter die Menge, bis diese ihnen Platz macht.
Unter Umständen kostet es den Geiern besondere Mühe, ihrer Mahlzeit sich zu versichern. Nach einer mündlichen Mittheilung Behns, welche durch Jerdon bestätigt wird, sind sie in Indien nicht selten auch die Bestatter der menschlichen Leichen. Die armen Hindu, nicht im Stande, die Kosten zu erschwingen, welche die Verbrennung eines ihrer Todten erfordert, begnügen sich, den Leichnam auf ein Strohlager zu betten und dieses anzuzünden, damit der Gestorbene des reinigenden Feuers wenigstens nicht gänzlich entbehre. Dann werfen sie den Todten, dessen Haut nur eben versengt ist, in den heiligen Ganges und überlassen es diesem, ihn dem Meere zuzutragen. Mit vorschreitender Verwesung treiben die Leichname auf der Oberfläche des Gewässers dahin und werden nunmehr den Geiern zugänglich. Einer oder der andere läßt sich auf dem schwimmenden Körper nieder, hält sich mit ausgebreiteten Schwingen im Gleichgewichte und beginnt zu fressen. Nach Behns Versicherung kommt es vor, daß der Geier in kluger Berechnung vermittels seiner ausgebreiteten Schwingen ein Segel bildet und den Leichnam einer niederen Sandbank zusteuert, bis er dort landet. Wenn dies geschehen, senken sich andere Geier hernieder, oder auch die Marabus finden sich ein, und die eigentliche Mahlzeit beginnt nun hier. Jerdon bemerkte einst einen Geier mitten im Strome, welcher wahrscheinlich von einem Leichnam herabgeworfen worden war und das Ufer durch Schlagen mit den Flügeln zu gewinnen suchte.
Bei quälendem Hunger mögen die Geier dann und wann auch lebende Thiere, namentlich erkranktes Herdenvieh, angreifen; wie es scheint, bevorzugen jedoch alle Arten Aas oder wenigstens Knochen jeder anderen Nahrung. Obenan stellen sie Aas der Säugethiere; doch verschmähen sie auch die Leichen der Vögel, Lurche und Fische nicht. Die kleineren Arten sind genügsamer als die größeren. Einzelne scheinen lange Zeit ohne Aas auskommen zu können: sie nähren sich von Knochen, andere hauptsächlich von dem Kothe der Menschen oder dem Miste der Thiere und erjagen nebenbei Kerfe und kleine täppische Wirbelthiere.
Nach beendigter Mahlzeit entfernen sich die Geier ungern weit von ihrer Tafel, bleiben vielmehr stundenlang in der Nähe der Walstatt sitzen und warten hier den Beginn der Verdauung ab. Geraume Zeit später begeben sie sich zur Tränke, und bringen auch hier wieder mehrere Stunden zu. Sie trinken viel und baden sich sehr oft. Freilich ist letzteres kaum einem Vogel nöthiger, als ihnen; denn wenn sie von ihrem Tische aufstehen, starren sie von Schmutz und Unrath; zumal die langhälsigen sind oft über und über blutig. Ist auch die Reinigung glücklich besorgt, so bringen sie gern noch einige Stunden in trägster Ruhe zu, setzen sich dabei entweder auf die Fußwurzeln und breiten die Schwingen aus, in der Absicht, von der Sonne sich durchwärmen zu lassen, oder legen sich platt auf den Sand nieder. Der Weg zum Schlafplatze wird erst in den Nachmittagsstunden angetreten. Ihre Nachtruhe nehmen sie entweder auf Bäumen oder auf steilen Felsenvorsprüngen, sehr gern namentlich auf Felsgesimsen, welche weder von oben noch von unten her Zugang gestatten. Einige Arten bevorzugen Bäume, andere Felsen zu ihren Ruheplätzen.
Vollgefressene Geier pflegen sich, wenn sie plötzlich aufgescheucht wurden, erst der in ihrem Kropfe aufgespeicherten Nahrung durch Ausbrechen zu entledigen, bevor sie sich fliegend erheben. Dasselbe thun die verwundeten. Man sieht es aber auch oft von den gefangenen, bei welchen letzteren man nebenbei beobachten kann, daß sie die ausgebrochene Nahrung gelegentlich wieder auffressen.
Der Flug wird durch einige rasch auf einander folgende und ziemlich hohe Sprünge eingeleitet; hierauf folgen mehrere ziemlich langsame Schläge mit den breiten Fittigen. Sobald die Vögel aber einmal eine gewisse Höhe erreicht haben, bewegen sie sich fast ohne Flügelschlag weiter, indem sie durch verschiedenes Einstellen der Flugwerkzeuge sich in einer wenig geneigten Ebene herabsenken oder aber von dem ihnen entgegenströmenden Winde wieder heben lassen. So schrauben sie sich, anscheinend ohne alle Anstrengung, in die ungeheueren Höhen empor, in denen sie dahinfliegen, wenn sie eine größere Strecke zurücklegen wollen. Ungeachtet dieser scheinbaren Bewegungslosigkeit ihrer Flügel ist der Flug ungemein rasch und fördernd.
In früherer Zeit hat man angenommen, daß es der Geruchssinn wäre, welcher die Geier bei Auffindung des Aases leite: meine Beobachtungen, welche durch die Erfahrungen anderer Forscher vollste Bestätigung finden, haben mich von dem Gegentheile überzeugt. Man glaubte sich berechtigt, anzunehmen, daß ein Geier den Aasgeruch meilenweit wahrnehmen könne, und fabelte in wahrhaft kindischer Weise, so daß man schließlich glauben machen wollte, der Geier rieche bereits einem Sterbenden den Tod ab. Meine Beobachtungen haben mich belehrt, daß die Geier auch auf Aas herabkommen, welches noch gänzlich frisch ist und keinerlei Ausdünstung verbreiten kann, daß sie auch bei starkem Luftzuge von allen Richtungen der Windrose herbeifliegen, sobald einer von ihnen ein Aas erspäht hat, auf einem verdeckten Aase dagegen erst dann erscheinen, wenn dasselbe von den Raben und Aasgeiern aufgefunden worden ist und deren Gewimmel sie aufmerksam gemacht hat. Ich glaube deshalb mit aller Bestimmtheit behaupten zu dürfen, daß das Gesicht der vorzüglichste und wichtigste ihrer Sinne, daß es das Auge ist, welches ihr Leben ermöglicht.
Die Geier horsten vor Beginn des Frühlings ihrer betreffenden Heimatsländer, demgemäß in Europa in den ersten Monaten unseres Jahres. Nur diejenigen Arten, welche selten vorkommen, gründen einzeln einen Horst; alle übrigen bilden Siedelungen. Sie erwählen eine geeignete Felswand oder einen entsprechenden Wald, und hier ist dann jeder passende Platz besetzt. Einige Arten horsten nur auf Felsen, andere bloß auf Bäumen, andere endlich auf dem flachen Boden. Die meisten dulden innerhalb ihrer Ansiedelung gänzlich verschiedene Vögel, Störche z. B., ohne sie irgendwie zu belästigen. Der Horst selbst ist, wenn er auf Bäumen steht, ein gewaltiger Bau, welcher im ganzen anderen Raubvögelhorsten entspricht. Armsdicke Knüppel bilden die Unterlage, feineres Reisig den Mittelbau, schwache Zweige und dünne Wurzeln, welche sehr oft mit Thierhaaren untermischt und regelmäßig mit solchen ausgekleidet werden, die Nestmulde. Steht er dagegen auf dem Boden einer Felshöhle oder eines Felsenvorsprunges, so ist er meist kaum noch Horst zu nennen. Daß die Geier möglichst unersteigliche Felsenwände oder Bäume zu ihrer Ansiedelung sich aussuchen, braucht kaum erwähnt zu werden. Da, wo sie sich vollständig sicher fühlen, ist dies nicht der Fall: im Inneren Afrikas z. B. horstet manche Art ohne Bedenken auf niederen, leicht zu erklimmenden Bäumen, welche man richtiger Sträucher nennen könnte. Das Gelege enthält ein bis zwei Eier von rundlicher Gestalt, rauhem Korn und graulicher oder gilblicher Grundfarbe, welche durch dunklere Schalenflecke, Punkte, Tüpfel und Schmitzen bezeichnet sind. Es ist wahrscheinlich, daß beide Geschlechter abwechselnd brüten; von einzelnen Arten weiß ich bestimmt, daß es der Fall ist. Wie lange die Brutzeit währt, hat man noch nicht ermittelt. Das Junge entschlüpft in einem wolligen Dunenkleide dem Eie, ist häßlich und hülflos im hohen Grade und braucht mehrere Monate, bevor es fähig wird, selbständig seine Wege durchs Leben zu wandeln. Beide Eltern lieben es sehr und vertheidigen es gegen schwächere Feinde, nicht aber ernstlich auch gegen den Menschen. Anfänglich wird der kleinen Mißgestalt halb verfaultes und im Kropfe der Eltern verdautes Aas in den Rachen gespieen, später kräftigere Kost in Menge zugetragen. Ihre Freßlust übertrifft, falls dies möglich, noch die Gier der ausgewachsenen Vögel. Nach dem Ausfliegen bedarf der junge Geier einige Wochen lang der Pflege, Führung und Lehre seiner Eltern; bald aber lernt er es, sich ohne diese zu behelfen, und damit ist der Zeitpunkt gekommen, wo angesichts eines Aases alle verwandtschaftlichen Gefühle ihr Ende erreichen.
Manche Gegner behelligen, wenig Feinde gefährden die Geier. Schmarotzer plagen sie; Adler, Falken, Krähen und andere geflügelte Quälgeister der Raubvögel stoßen auf sie herab und ärgern sie, sobald sie ihrer ansichtig werden; auf dem Aase kommen sie mit Hunden und Marabus in Streit. Der Mensch befehdet die großen Räuber, deren Nutzen er überall erkennt, nur dann, wenn sie vom Pfade der Tugend abweichen und, anstatt Todtengräber zu bleiben, auch einmal anderen Räubern ins Handwerk pfuschen. Geieradler und Kondor sind es, welche büßen müssen, was ihre Zunft nicht bloß, sondern was die gesammte fliegende Räuberwelt verschuldet hat. Die übrigen Arten werden mit einer beinahe heiligen Scheu betrachtet. Wahrer Freundschaft würdigt man sie nicht, und in den »Vermächtnissen reicher und wohlwollender Mahammedaner« werden sie wenigstens jetzt nicht mehr bedacht. Der Hindu sieht in ihnen, weil sie die Leichname seiner Todten verzehren, unzweifelhaft heilige Wesen; der Innerafrikaner läßt sie einfach gewähren, obwohl er sie keineswegs von jedem Verdachte an irgend welchen Uebelthaten freispricht.
Alle Geier sind harte Vögel, welche auch unserer strengsten Winterkälte trotzen können, weil sie gewohnt sind, bei ihrem Auf- und Niedersteigen die verschiedensten Wärmegrade zu ertragen, welche mit dem gemeinsten Futter sich begnügen, und wenn sie eine Zeitlang gut genährt wurden, tage-, ja wochenlang ohne Nahrung ausdauern, daher leicht in Gefangenschaft zu halten. Weitaus die meisten werden, auch wenn sie als alte Vögel unter die Herrschaft des Menschen kamen, bald zahm. Ihre Gleichgültigkeit hilft ihnen über so manches Elend, wie die Gefangenschaft es mit sich bringt, leicht hinweg. Einzelne freilich sehen längere Zeit in ihrem Wärter einen Feind, welchem sie gelegentlich tückisch ihre Kraft fühlbar zu machen suchen. Unterhaltend werden die Geier, wenn man sie in einem geräumigen Käfige mit anderen großen Raubvögeln zusammenbringt. Zwar sitzen sie auch jetzt noch den größten Theil des Tages über still und ruhig auf dem einmal gewählten Platze; doch fehlt es einer so bunten Gesellschaft selten an Gelegenheit zu Thaten und Handlungen. Namentlich die Fütterung bringt kaum beschreibliche Aufregung hervor. Mit allen Waffen wird gekämpft und zu jedem Mittel gegriffen, um sich des besten Bissens zu bemächtigen. Doch geht es auch hier wie überall: der mächtigste und gewandteste hat das größte Recht und beherrscht und übervortheilt die anderen. Vor allem sind es die Gänsegeier, welche sich bemerklich machen. Das Gefieder gesträubt, den langen Hals eingezogen, sitzen sie mit funkelnden Augen vor dem Fleische, ohne es anzurühren, aber augenscheinlich bedacht, es gegen jeden anderen zu vertheidigen. Der zusammengekröpfte Hals schnellt wie ein Blitz vor und nach allen Seiten hin, und jeder ihrer Genossen fürchtet sich, einen ihm zugedachten Biß zu erhalten. In solchen Augenblicken hat das Gebaren der Gänsegeier täuschende Aehnlichkeit mit der Art und Weise, wie eine Giftschlange sich zum Bisse anschickt. Ihre Unverschämtheit entrüstet selbstverständlich die anderen in hohem Grade und wird Ursache zu sehr heftigen Kämpfen. Nicht selten wird einer ohne seinen Willen mitten in das Kampfgewühl gezogen; die ganze Rotte fliegt, flattert und wälzt sich über ihn her, und er hat große Noth, wieder davon zu kommen. Daß ein solches Gefecht nicht ohne lebhaftes Zischen, kicherndes und gackerndes Schreien, Schnappen mit dem Schnabel und Fuchteln mit den Flügeln vorübergeht, daß es mit anderen Worten, einen Höllenlärm erregt, braucht nicht erwähnt zu werden. In solchen Augenblicken gewährt eine Geiergesellschaft im Käfige ein höchst unterhaltendes und fesselndes Schauspiel.
In den letzten Jahren ist es wiederholt vorgekommen, daß gefangene Geier im Käfige genistet haben. Sie erbauten sich einen den Umständen nach günstig gelegenen Horst, belegten ihn mit einem oder zwei Eiern und brüteten mit großer Ausdauer. Ihre Bemühungen waren bis jetzt noch nicht von Erfolg gekrönt; demungeachtet läßt sich hoffen, daß dies später der Fall sein wird.
Die Edelfalken unter den Geiern oder die edelsten Mitglieder der Familie sind die Bartgeier ( Gypaëtus). Sie zeichnen sich nicht bloß vor allen übrigen Arten ihrer Gruppe, sondern auch vor allen Raubvögeln überhaupt durch auffallend gestreckten Leibesbau so wesentlich aus, daß sie als Vertreter einer eigenen Familie ( Gypaëtidae), mindestens einer Unterfamilie ( Gypaëtinae), betrachtet werden. Ihr Leib ist kräftig, aber gestreckt, der Kopf groß, lang, vorn platt, hinten etwas gewölbt, der Hals kurz, der Flügel sehr lang und spitzig, die dritte Schwinge, welche wenig über die zweite und vierte, wohl aber weit über die erste vorsteht, in ihm die längste, der sehr lange, zwölffederige Schwanz stufig oder keilförmig, der Schnabel groß und lang, die Oberkinnlade an der Wurzel sattelförmig eingebuchtet, gegen die Spitze hin aufgeschwungen, scharfhakig herabgekrümmt, an der Schneide zahnlos; die untere Kinnlade gerade, der Fuß kurz und verhältnismäßig schwach, der Fang mittellang und sehr schwach, mit starken, aber wenig gekrümmten und ziemlich stumpfen Nägeln bewehrt, das Gefieder reich und großfederig. Die Schnabelwurzel umgeben nach vorn gerichtete Borstenbüschel, welche die Wachshaut bedecken und auch den Unterschnabel teilweise einhüllen; den Kopf bekleiden dunen- und borstenartige, kurze, den Hals dagegen große Federn; das übrige Gefieder liegt etwas knapper an, verlängert sich aber namentlich an den Hosen noch bedeutend und bedeckt die Fußwurzeln bis gegen die Zehen hinab.
Das Knochengerüst zeigt auffallende Eigentümlichkeiten. Die Wirbelsäule zählt dreizehn Hals-, acht Rücken- und sieben Schwanzwirbel; das Brustbein ist lang und breit, der Kamm auf ihm sehr hoch; die Armknochen sind ungewöhnlich, die Schulterknochen auffallend stark, die Schlüsselbeine kräftig, fest an dem Brustbeine anliegend, alle Beinknochen dagegen schwach. Der Schädel ist oben flach und schmal, unten hingegen so breit, daß die Gelenke der Unterkiefer weit von einander abstehen; die Schädelhöhle verhältnismäßig klein; die Kiefer selbst sind äußerst biegsam. Die Zunge ist kurz und ziemlich breit, der Gaumen mit vielen Hautzähnen besetzt, die Speiseröhre auffallend weit und so faltig, daß eine großartige Ausdehnung möglich wird. Schlund und Magen bilden einen einzigen Sack, obwohl man Speiseröhre, Kropf und den eigentlichen Magen unterscheiden kann, weil beide durch kleine Wülste geschieden werden. Der schlauchförmige Magen ist ebenfalls faltig und dehnbar, im Inneren mit einer großen Menge von Drüsen besetzt, welche einen scharfen, übelriechenden Magensaft absondern. Die Därme sind mittellang, die Bauchspeicheldrüsen sehr groß. Die Brustmuskeln sind selbst für Raubvögel ungewöhnlich entwickelt, die Kau- und Beinmuskeln hingegen ungemein schwach. Unter den Sinneswerkzeugen verdient vor allem das Auge Beachtung; es hat innerhalb der Klasse seinesgleichen nicht. Bei anderen Vögeln bleibt nur die Regenbogenhaut unbedeckt, bei dem Geieradler aber ist auch die Augenhaut ( Sclerotica) sichtbar und bildet einen breiten, wulstigen Ring, welcher sich rings über den Rand der Regenbogenhaut anlegt und prachtvoll gefärbt ist. Dieser Ring besteht, nach Schinz, aus dichtem festen Zellengewebe und dient anstatt der Verbindungshaut zur Befestigung des Auges. Die Nasenhöhle ist groß und weit; die Riechmuscheln sind sehr lang und zweimal ineinander gewunden. Das Gehirn ist verhältnismäßig klein und nur das kleine Gehirn tief gefaltet.
Zur Zeit hat man sich noch nicht darüber geeinigt, ob man alle Geieradler der Erde zu einer Art zu zählen oder als verschiedene Arten anzusehen hat; sicher aber ist, daß die in Afrika lebenden von dem auf unseren Alpen vorkommenden ständig sich unterscheiden. Hinsichtlich ihrer Lebensweise und ihres Betragens stimmen, wie die neueren Beobachtungen dargethan haben, alle Geieradler überein, und deshalb ist es vollkommen zulässig, wenn man aus den in Europa, Asien und Afrika gesammelten Beobachtungen ein Gesammtbild des Lebens und Treibens zusammenstellt.
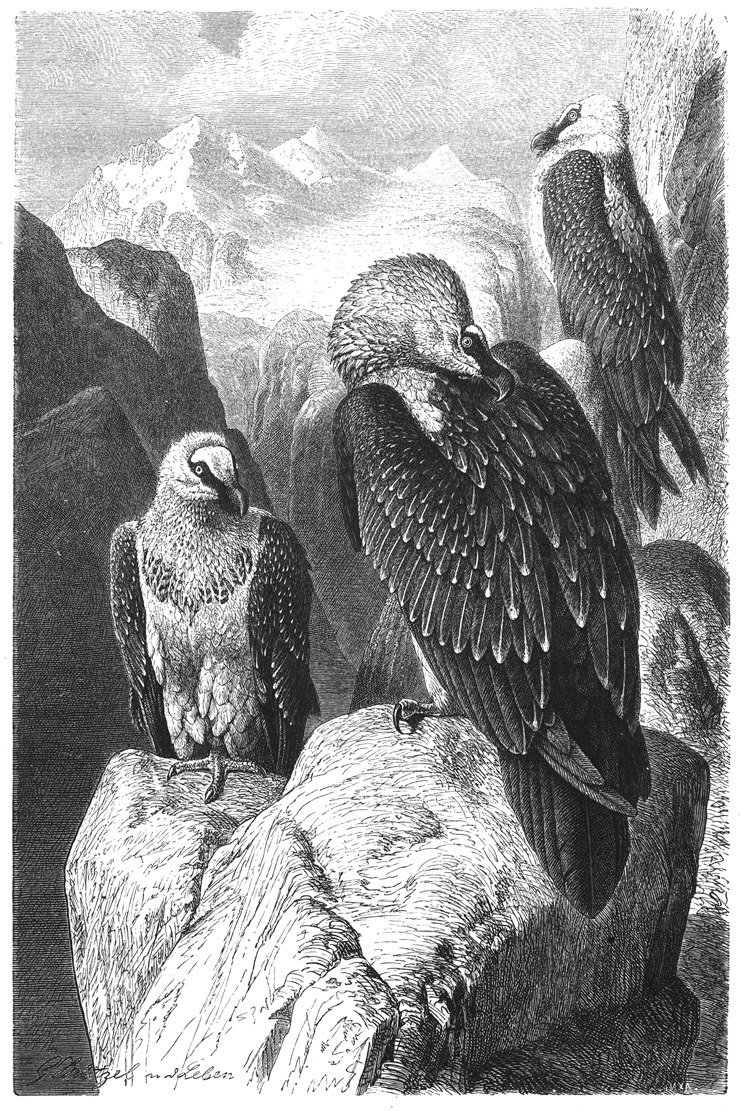
Bartgeier.
Der Bartgeier, Bartadler oder Bartfalk, Geieradler, Lämmer-, Gemsen-, Gold-, Greif- und Jochgeier, Weißkopf oder Grimmer ( Gypaëtus barbatus, grandis, alpinus, aureus, castaneus, melanocephalus, hemalachanus, occidentalis und orientalis, Falco barbatus, Vultur barbatus, alpinus, niger und leucocephalus, Phene ossifraga) ist, nach eigenen Messungen spanischer Stücke, 1 bis 1,15 Meter lang, 2,4 bis 2,67 Meter breit; die Fittiglänge beträgt 79 bis 82, die Schwanzlänge 48 bis 55 Centimeter. Erstere Maße gelten für das Männchen, letztere für das Weibchen; die einen wie die anderen aber dürften, wie bei allen großen Vögeln, nicht unerheblichen Schwankungen unterworfen sein. Das Gefieder des alten Vogels ist auf Stirn, Scheitel und an den Kopfseiten gelblichweiß, durch die borstenartigen Federn dunkler gezeichnet, auf Hinterkopf und Hinterhals schön rostgelb, auf dem Rücken, dem Bürzel, den Oberflügel- und Oberschwanzdeckfedern dunkelschwarz mit weißlichen Schäften und hellerer Schafteinfassung, vorn mit gelblichen Spitzenflecken. Die Schwingen und Steuerfedern sind schwarz, auf der Innenfahne aschgrau, die Schäfte weißlich. Der ganze Unterkörper ist hoch rostgelb, an den Vorderhalsfedern am dunkelsten, an den Seiten der Oberbrust und an den Hosen mit einzelnen braunen Seitenflecken gezeichnet. Ueber die Brust verläuft ein Kranz von weißgelben, schwarz gefleckten Federn. Von der Schnabelwurzel an durch das Auge zieht sich ein schwarzer Zügelstreifen, welcher am Hinterhaupte sich umbiegt, sich aber nicht ganz mit dem der anderen Seite vereinigt, also nur einen unvollständigen Kranz bildet. Das Auge ist silberweiß, die äußere Augenhaut mennigroth, die Wachshaut bläulichschwarz, der Schnabel horngrau, an der Spitze schwarz, der Fuß bleigrau. Beim jungen Vogel ist das Auge aschgrau, der Schnabel hornblau, auf der Firste und an der Spitze des Unterschnabels dunkler, der Fuß schmutzig hellgrün, bläulich schimmernd, die Wachshaut bläulichschwarz. Sehr junge Vögel sind oberseits, einige weiß gefleckte Federn an: Oberrücken ausgenommen, schwarzbraun, auf Hals und Kopf fast schwarz, unterseits hell rostbraun. Erst nach wiederholtem Federwechsel geht das Jugendkleid in das der alten Vögel über.
Nun will man gefunden haben, daß die sardinischen, spanischen und südafrikanischen Geieradler dunkler, die auf den Pyrenäen und dem Altai lebenden aber lichter gefärbt seien, als der, welcher die Schweizer Alpen bewohnt; Meves hat auch entdeckt, daß sich die Rostgoldfärbung des Gefieders durch Waschen ausreiben und durch chemische Mittel ausbleichen läßt. Einzelne Forscher sind deshalb geneigt, anzunehmen, daß die Färbung dem Vogel ursprünglich nicht eigen, sondern nur eine Folge sei von wiederholtem Baden in eisenhaltigen Gewässern; sie haben sogar versucht, darauf hin die Artverschiedenheit der Geieradler in Frage zu stellen oder geradezu zu leugnen, und kühn behauptet, daß das dunklere oder hellere Gefieder einfach darauf hin zurückzuführen sei, ob sich ein Geieradler bade oder nicht. Auf letztere Annahme ist jedoch schon aus dem Grunde kein Gewicht zu legen, weil bekanntermaßen auf allen Hochgebirgen eisenhaltiges Gewässer so häufig ist, daß es keinem Geieradler an der Gelegenheit mangeln dürfte, für sein reiches Gefieder die schöne Goldfarbe zu erwerben. Mit der Chemie kommen wir in diesem Falle nicht weiter, um so weniger, als die in Meves' Auftrage ausgeführten Untersuchungen noch viel zu mangelhaft sind, als daß sie zur Entscheidung der Hauptfrage etwas beitragen könnten. Es wird daher kein Fehler sein, wenn wir einstweilen noch mehrere, mindestens zwei Geieradlerarten annehmen, und festhalten, daß sich der Nacktfußbartgeier ( Gypaëtus nudipes oder meridionalis) ständig von dem der Alpen unterscheidet. Auf letzteren wird sich der größte Theil der nachfolgenden Mittheilungen beziehen.
Der Bartgeier ist weit verbreitet. In Europa bewohnt er die Schweizer Alpen und die Hochgebirge Siebenbürgens, einzeln auch den Balkan und die Pyrenäen sowie alle höheren Gebirge der drei südlichen Halbinseln und endlich den Kaukasus. In Asien verbreitet er sich über sämmtliche Hochgebirge vom Altai an bis zu den chinesischen Rand- und Mittelgebirgen und von hier wie dort bis zum Sinai, den Gebirgen Südarabiens und dem Himalaya. In der Schweiz, woselbst sein Bestand gegenwärtig ungemein zusammengeschmolzen ist, haust er, laut Girtanner, mehr oder minder regelmäßig nur noch auf den höchsten Gebirgen von Bern, Graubünden, Tessin und Wallis, in Graubünden erwiesenermaßen, in Bern und Tessin wahrscheinlich als Brut-, in Wallis vielleicht nur als Strichvogel. In den deutschen und österreichischen Alpen ist er gänzlich ausgerottet oder mindestens in einem Menschenalter erweislich nicht mehr vorgekommen; doch mag er einzelne Gebirgszüge Südtirols dann und wann vielleicht noch besuchen. Auf der Balkanhalbinsel fehlt er keinem höheren Gebirgszuge; in Italien findet er sich, obschon selten, noch in den Alpen, in Sardinien überall, wenn auch nicht gerade in bedeutender Anzahl; in Spanien, mit Ausnahme von Galicien und Leon, ist er eine so regelmäßige Erscheinung, daß dieses Land für Europa gegenwärtig als seine eigentliche Heimat bezeichnet werden darf. In Asien bevölkert er den Südwesten noch in Menge. Selten im Altai wie im Himmlischen Reiche, tritt er in Turkestan, Kleinasien, Palästina, Persien, Arabien und im Himalaya, von Nepal bis Kaschmir und von Salt bis Suliman, geeigneten Ortes noch überall ständig und so zahlreich auf, daß man ihn nirgends übersehen kann. In Afrika endlich beschränkt sich sein Wohngebiet auf den Nordrand des Erdtheiles, insbesondere den Atlas und den Djebel Ataka nebst Umgegend. Im Nilgebirge läßt er sich sehr selten, im Nilthale selbst nur ausnahmsweise einmal sehen. Adams, welcher ihn von seinen Jagden im Himalaya so gut kennt, daß er ihn gewiß nicht mit einem anderen Vogel verwechselt, hat ihn von der Spitze der Pyramiden aufgescheucht, Hartmann ihn unweit von den Stromschnellen von Wadi Halfa beobachtet. Ich meinestheils habe ihn weder in Egypten, noch in Nubien jemals gesehen, so häufig er auch in den Gebirgen zu beiden Seiten des Rothen Meeres zu sein scheint. Der im Osten und Süden Afrikas, namentlich in Habesch und im Kaplande vorkommende Lämmergeier ist nicht unser Geieradler, sondern der Nacktfußbartgeier.
Kein einziger deutscher Raubvogel, nicht einmal der Adler, ist so eingehend beschrieben worden als der Geieradler, und dennoch darf man behaupten, daß seine Naturgeschichte erst in den letzten Jahren geklärt worden ist. Ich selbst bin infolge meiner vielfachen Beobachtungen des stolzen Vogels im Steinigten Arabien wie in Spanien einer der ersten gewesen, welche sich bemüht haben, seine Lebensgeschichte wahrheitsgetreu zu schildern. Gegenwärtig liegen viele anderweitige Beobachtungen vor. Wir haben mehr oder minder ausführliche Berichte erhalten von Jerdon, Adams, Hodgson, Irby, Heuglin, Gurney, Krüper, Hudlestone, Hume, Salvin, meinem Bruder und anderen, welche sämmtlich unter sich übereinstimmen, jedoch im Widerspruche stehen mit dem, was von älteren und neueren Forschern, unter anderen auch dem trefflichen Girtanner, über den schweizerischen Bartgeier erzählt worden ist. Ich werde deshalb zunächst meine eigenen und die mit diesen im Einklange stehenden Mittheilungen der zuerst erwähnten Naturforscher zusammenstellen und auf diese, wenn auch nicht ohne Verwahrung, die mir wichtig erscheinenden Angaben der Schweizer Forscher folgen lassen.
Mehr als jedes andere Mitglied seiner Familie, vielleicht mit alleiniger Ausnahme der Kondore, darf der Geieradler als ein Bewohner der höchsten Gebirgsgürtel angesehen werden. Doch ist dieser Ausspruch nur so zu verstehen, daß er zwar die Höhe liebt, die Tiefe aber durchaus nicht meidet. Sturm und Wetter, Eis und Schnee lassen ihn gleichgültig; aber auch die in tieferen Lagen südlicher Gebirge regelmäßig herrschende Hitze ficht ihn nicht ersichtlich an, um so weniger, als ihm bei seinem Dahinstürmen selbst die heißen Lüfte Kühlung zufächeln müssen, und er im Stande ist, jederzeit belästigender Schwüle zu entgehen und seine Brust in dem reinen Aether der kalten Höhe zu baden. Da, wo er in der Tiefe, ungefährdet durch den Menschen und mühelos, Nahrung findet, siedelt er sich auch in niederen Lagen des Gebirges an, wogegen er in der Regel die höchsten übergletscherten oder schneeumlagerten Berggipfel nicht verläßt. In Spanien ist er in allen Hochgebirgen eine keineswegs ungewöhnliche Erscheinung, horstet aber auch auf Bergzügen von zwei- bis dreihundert Meter unbedingter Höhe. Dasselbe gilt für Persien. In der Schweiz dagegen treibt er so lange als möglich in den höchsten und unzugänglichsten Theilen des Hochgebirges, von wenigen gesehen, sein Wesen, und erst wenn, wie Girtanner sagt, »die wildesten Winterstürme, mit Schnee und Eis um sich werfend, dahinrasen, während unter polternden Föhnstößen tiefer in den Bergen die Hütten erbeben, der altehrwürdige Bannwald unter der Wucht solch mächtigen Andranges ächzt und seufzt und wankt und kracht und alles Leben in dem maßlosen Toben der ringenden Naturkräfte zu ersterben droht: erst dann schaut der kundige Bergjäger aus niedrigem Fenster nach den Höhen, ob er etwa den Bartgeier über ihnen oder dem Dorfe kreisen sehe, wohl wissend, daß auch ihn zuletzt jener Riesenkampf in der Natur und der nagende Hunger zwingen werden, von seinem hohen Wohnsitze herabzusteigen und den menschlichen Wohnungen sich zu nähern. Gelang es ihm, für seinen hungrigen Magen etwas zu erbeuten, so wiederholte er wohl bald den Besuch; war ihm das Glück nicht günstig, so verschwand er, um vielleicht nie wiederzukehren. Er kam und ging wie ein Fremdling aus fernem, unbekanntem Lande. So kam er früher von den Kurfirsten bis an die Ufer des Wallensees, bis Quinten und Bethlis herab, suchte sich ein Opfer und erhob sich nach gelungener Sättigung sofort wieder zu bedeutender Höhe; so schwebt er, nach Bericht des Regierungsrathes Brunner in Meiringen, noch jetzt zu den Bergdörfern des Oberhasli sowie nach Kandersteg, Lauterbrunn, Grindelwald herunter, in Graubünden nach Pontresina, wo er bis vor die Häuser kommt, nach Lawin, Süß herab; so wird er tief im Maggia- und Livinenthal während längerer Zeit gesehen.« Nach meinen Beobachtungen lebt er höchstens in kleinen Trupps; ich habe meist einzelne oder Paare und nie mehr als ihrer fünf zusammen gesehen. Jedes Paar bewohnt ein Gebiet von vielen Geviertkilometern Flächenausdehnung und durchstreift dieses tagtäglich, ja sogar mit einer gewissen Regelmäßigkeit. Deshalb wird man ihn da, wo er vorkommt, sicherlich beobachten.
In den Morgenstunden sieht man ihn, nach meinen Erfahrungen, selten oder nicht; erst anderthalb Stunden nach Sonnenaufgang etwa beginnt er sein Gebiet zu durchstreifen, und spätestens um fünf Uhr nachmittags zieht er seinem Schlafplatze wieder zu. Beide Gatten des Paares fliegen in nicht allzu großer Entfernung von einander längs hauptsächlichsten Zügen des Gebirges dahin, gewöhnlich in einer Höhe von nicht mehr als etwa fünfzig Meter über dem Boden. Sie folgen dem Gebirgszuge seiner ganzen Länge nach, kehren an der Spitze eines auslaufenden Berges auch wohl um und suchen, in gleicher Weise dahinstreichend, die andere Seite ab. Unterbrechen Querthäler den Hauptzug, so werden diese in derselben Höhe, welche der Vogel bisher innegehalten hatte, überflogen, selten aber sogleich mit durchsucht; über Thalkesseln dagegen kreist er meist längere Zeit. Findet sein scharfes Auge nichts genießbares auf, so steigt er empor und sucht, ganz in derselben Weise die Berggipfel und Hochebenen ab; erweist sich auch hier seine Umschau vergeblich, so streicht er in die Ebene hinaus. Ein gerade in seinem Zuge begriffener Bartgeier läßt sich nicht gern durch etwas aufhalten. Ich habe gesehen, daß einer so nahe an den bewohnten Gebäuden einer Einsiedelei vorüberflog, daß man ihn von dem Fenster aus hätte mit Schroten herabschießen können. Auch vor Menschen scheut er sich durchaus nicht, schwebt, wenn er Futter sucht, im Gegentheile oft auf wenige Meter vor einem vorüber. Auch streichend fliegt der Bartgeier äußerst schnell, unter laut hörbarem Rauschen seines Gefieders, dahin, ohne jeden Flügelschlag, und seine Gestalt erscheint dabei so zierlich, daß es ganz unmöglich ist, ihn mit irgend einem Geier oder Adler zu verwechseln. Nur Unkundige können ihn für einen Schmutzgeier ansehen. Ich bin oft versucht worden, den fernfliegenden Bartgeier für einen – Wanderfalken zu halten, wenn ich, von der Falkengestalt getäuscht, mich augenblicklich nicht an die schnellen Flügelschläge des Edelfalken erinnerte. Gurney sagt ungefähr dasselbe: »Der Flug ähnelt so sehr dem größerer Falken, daß ich überrascht und förmlich getäuscht war, als ich den ersten herabgeschossen und einen Geier in den Händen hatte.« Beim Fliegen läßt er seinen Blick nach allen Seiten schweifen, bis er etwas entdeckt hat; dann beginnt er sofort seine Schraubenlinien über dem Gegenstande zu drehen; sein Genosse vereinigt sich sogleich mit ihm, und beide verweilen nun, oft lange kreisend, über einer Stelle, bevor sie ihre Wanderung fortsetzen. Zeigt sich das gefundene der Mühe werth, so lassen sie sich allgemach tiefer hernieder, setzen sich endlich auf den Boden und laufen nun wie Raben auf das gesuchte zu. Beim Fußen wählt der Bartgeier stets erhabene Punkte, am liebsten vorstehende Felszacken oder wenigstens Felsplatten. Man erkennt, daß ihm das Auffliegen schwer wird und er deshalb vorzieht, beim Abstreichen gleich eine gewisse Höhe zu haben, um von hier aus ohne Flügelschlag sich weiter fördern zu können; denn wenn er einmal schwebt, ist der geringste Luftzug genügend, ihn in jede beliebige Höhe emporzuheben. Im Hochgebirge von Habesch steigt er, laut Heuglin, zuweilen so hoch in die Lüfte, daß er dem schärfsten Auge nur noch als kleiner Punkt im blauen Aether erscheint. Auf Felsen, welche dies gestatten, sitzt er ziemlich aufrecht, gewöhnlich aber wagerecht, wie der lange Schwanz es bedingt. Der Gang ist verhältnismäßig gut, schreitend, nicht hüpfend. So selten er die Gesellschaft seinesgleichen aufzusuchen scheint, so wenig meidet er die anderer größerer Raubvögel, ohne sich jedoch jemals näher mit ihnen zu befassen. Unbekümmert um sie, gleichsam als ob sie nicht vorhanden wären, zieht er seine Straße, und selbst wenn er unter ihnen horstet, tritt er niemals mit ihnen in irgend welche Verbindung. Selbst mit dem Steinadler verträgt er sich, aber er beachtet ihn ebenso wenig wie irgend ein anderes Mitglied seiner Zunft oder Ordnung, vorausgesetzt, daß er von übermüthigen Räubern angegriffen wird. Aber auch in diesem Falle fliegt er, ohne Abwehr zu versuchen oder Vergeltung zu üben, wie vorher seinen Weg weiter.
Mit vorstehenden Wahrnehmungen stehen die Beobachtungen, welche Girtanner über das Auftreten des Vogels in den Alpen gesammelt hat, im Einklange. Aus Bünden und Tessin wird übereinstimmend mitgetheilt, daß er seine Thätigkeit erst längere Zeit nach Sonnenaufgange, »wenn die Sonne an die Berge scheint«, beginne. »Im Sommer vom Horste oder von einer hohen, etwas geschützt und sicher gelegenen Felswarte aus, wo er die Nacht zubrachte, im Winter aus der wärmeren waldigen Schlucht aufsteigend, unternimmt er wieder, je nach der Jahreszeit, allein oder mit der Ehehälfte zuerst einen Jagdzug in die von Gemsen oder von Ziegen- und Schafherden besuchten Alpengegenden oder fliegt nach den Murmelthiersiedelungen, sucht den Alpenhasen aufzustöbern und sich auf irgend eine Weise zu sättigen. Ist ihm dies gelungen, so zieht er sich für einen Theil des Tages auf seinen Lieblingssitz, gewöhnlich eine alleinstehende Felsspitze, zurück, wo er der Verdauung obliegt und der Ruhe pflegt, um später noch einen Vergnügungsflug auszuführen oder nach den Resten einer Beute zurückzustreichen. Längere Zeit nach Sonnenuntergang erst sah ihn unser Tessiner Gewährsmann seinem Schlafplatze zusegeln.« Zuverlässige Augenzeugen berichten Girtanner, daß der Flug je nach seinem Zwecke sehr großer Verschiedenheit fähig ist. Einem bestimmten Ziele zuführend, ist er wahrhaft reißend, sausend, lange Zeit ohne Flügelschlag und ungemein fördernd; dabei zieht der Vogel in möglichst gerader Richtung und gleicher Höhe hoch über Thäler und dicht über Gebirgskämme oder in unabsehbarer Ferne längs der Bergrücken dahin. Hierbei läßt er sich nach allen Berichten nicht gern, selbst nicht durch menschliche Wohnungen und Menschen, aus der einmal eingeschlagenen Richtung und Höhe bringen. Ueber Menschen rauscht er oft so niedrig und dabei so langsam und sorglos dahin, daß man unter Umständen nicht wisse, ob man es dabei mit einem durch die Einsamkeit seines gewöhnlichen Aufenthaltsortes durchaus furchtlos gewordenen, das heißt die Gefahr nicht kennenden Vogel zu thun habe oder aber mit einem solchen, welcher sich an die Gefahr nicht kehre, falls nicht gar Angriffspläne im Kopfe habe. Der Vergnügungsflug wird von allen, welche denselben selbst zu beobachten Gelegenheit hatten, übereinstimmend als leicht, schwebend, schwimmend, in weiten Schneckenringen auf- und abwärts kreisend beschrieben. Ganz anders nimmt sich unser Vogel beim Absuchen eines Jagdgebietes aus. Dann sah ihn Hold scheinbar schwerfällig mit langsamen, weit ausholenden, rauschenden Flügelschlägen dicht über dem Boden daherfahrend und zu seinem Erstaunen gleich nachher in scharfen Schwenkungen aufs zierlichste um einzelne Felsblöcke fliegend und sich förmlich schlängelnd. So vollkommen er Meister seiner Bewegungen ist, sowie er erst Luft unter seine Fittige gefaßt hat, so mühsam erhebt er sich wegen der Länge der Flügel und Kürze der Beine vom Boden. Auf ebene Flächen setzt er sich ohne unbedingte Nothwendigkeit nicht, und in Tessin sah ihn ein Jäger, unter solchen unangenehmen Umständen überrascht, eiligst einer Erhöhung zulaufen und erst von dort aus zum Abfluge sich rüsten. Einer, welchen Salis plötzlich zu beiderseitigem Erstaunen etwa funfzehn Meter über sich am Abhange sitzen sah, schob sich mit einigen komischen Sprüngen förmlich in die Luft hinaus, um dann leicht und stolz über dem Kopfe des überraschten Beobachters abzuziehen. Kommt er aus der Luft herab, so läßt er schon hoch über dem Boden die Ständer herunterhängen, sucht den Fall durch Hochstellen der Flügel zu mäßigen und betritt nun die Erde, muß jedoch auf ebenem Boden, wo er nicht sofort fest einfassen kann, gewöhnlich noch einige rasche Schritte ausführen.
Wenn man, so habe ich mich im Jahre 1858 ausgesprochen, einen glaubwürdigen spanischen Jäger fragt, was der Bartgeier fresse, wird er sicherlich keine Jagd-, Spuk-, Raub- und Mordgeschichten wie der Schweizer von seinem Geieradler zum besten geben, sondern einfach sagen, der »Knochenzerbrecher« ( Quebranta-huesos) frißt Aas, Kaninchen, Hasen und noch andere kleine Säugethiere, hauptsächlich aber Knochen, welche er zerbricht, indem er sie aus bedeutender Höhe herab zur Tiefe fallen läßt. Kein einziger Spanier, mit welchem wir in jagdlicher oder wissenschaftlicher Hinsicht verkehrt haben, kannte den Bartgeier als berüchtigten Räuberhauptmann wie der Schweizer den seinigen. Man wußte mir, als ich nach dem Vogel fragte, welcher Ziegen und Schafe, Kinder und Hunde raube und fresse, niemals den Geieradler, sondern immer nur den Steinadler zu nennen. Von diesem, aber auch bloß von ihm, hatte man ebenso viele Geschichten zu erzählen wie unsere deutschen Naturforscher von dem Geieradler der Alpen. Im ganzen wird der Bartgeier als sehr unschuldiger Vogel betrachtet. Kein Hirt fürchtet ihn, kein Viehbesitzer weiß etwas von Räubereien, welche er ausgeführt haben soll, aber jedermann versichert, daß er regelmäßig mit den Geiern auf das Aas falle und, wie bemerkt, Knochen aus der Höhe herabwerfe, um sie zu zerbrechen. Ich selbst habe in der Sierra Nevada einen Lämmergeier lange Zeit hinter einander von einem Felsen aus hoch in die Luft steigen, niederschweben, etwas von diesem Felsen aufnehmen, wieder emporsteigen und von neuem nach dem Felsen herabschweben sehen und mir solches Beginnen nicht anders als der Aussage der Spanier entsprechend erklären können. In der That liegt kein Grund vor, zu zweifeln, daß der Vogel große Knochen in dieser Weise zertrümmere. Seeadler und andere Raubvögel, namentlich aber Raben und Möven, thun, nach den Versicherungen der gewissenhaftesten Beobachter, genau dasselbe. Der Bartgeier führt also seinen spanischen Namen mit Fug und Recht. Vom abessinischen Geieradler berichtet Heuglin (1869) wie folgt: »Unsere Stubengelehrten schildern den Bartgeier als stolzen Räuber, welcher muthig große Säugethiere, ja selbst den Menschen angreift und in den Abgrund zu stoßen sucht. Wir haben Gelegenheit gehabt, diesen Vogel durch längere Zeit alltäglich in nächster Nähe zu beobachten, haben viele Dutzende von ihnen erlegt und untersucht und zu unserem Erstaunen gefunden, daß seine Nahrung fast ausschließlich in Knochen und anderen Abfällen von Schlachtbänken besteht, daß er gefallene Thiere und menschliche Leichen angreift, daß er aber nur im Nothfalle selbst jagt; denn selten glückt es ihm, einen Hasen oder eine verirrte oder kranke Ziege wegzufangen. Rabenartig umherschreitend, auch seitwärts hüpfend, sieht man ihn zuweilen auf den grünen Matten des Hochlandes auf die dort überaus zahlreichen Ratten lauern. In der Haltung hat er nichts mit den eigentlichen Geiern gemein, eher noch manches mit dem Schmutzgeier, namentlich was seine Bewegungen auf der Erde anbelangt. Morgens mit Tagesgrauen verläßt er die Felsen, auf denen er ruht, schweift rasch und weit über Felder, Wiesen und Dörfer zu Thale, oft so blitzschnell, daß man deutlich das sturmartige, fast metallisch klingende Rauschen seines Gefieders vernimmt, kreist dann um Marktplätze, wo gewöhnlich geschlachtet wird, oder folgt mit vielen anderen Aasvögeln den Lagern und Heereszügen. So war er während der ersten Monate unseres Aufenthaltes in den Bogosländern nicht beobachtet worden bis zur Ankunft abessinischer Truppen, mit denen er auch wieder verschwand. Während der Feldzüge des Königs Theodor gegen die Gala fanden sich Dutzende dieser Vögel als stetige Begleiter des Heeres ein.«
Krüper gebraucht folgende Worte: »Hört man den Namen Lämmergeier aussprechen, so erinnert man sich unwillkürlich an den kühnsten Räuber in der Vogelwelt und schaudert zusammen, so gebrandmarkt stellt sich der Vogel vor das geistige Auge. Ist der Lämmergeier denn auch wirklich ein den Herden und Menschen Furcht und Schrecken einflößendes und so schädliches Thier, oder ist er ohne sein Zuthun in den Ruf gekommen, den er in wissenschaftlichen Schriften und Köpfen erhalten hat? In Arkadien, wo die Gebirge nicht sehr hoch sind, beginnt sein Gebiet unmittelbar am Meere. Was raubt denn dort in der Ebene dieser gefährliche Nachbar? Sucht er dort die Lämmer, Ziegen oder sogar die Rinder auf, um sie zu verspeisen? Man sieht ihn zuweilen in nicht großer Höhe am Fuße eines gebüschreichen Berges kreisen, den Kopf nach unten gerichtet, spähend, plötzlich herabfliegen und verschwinden. Sicherlich macht er in diesem Augenblick eine Beute, gewiß, er hat eine Ziege – nein, er hat nur eine Schildkröte gefunden, welche seinen Hunger stillen oder seinen Jungen wohlschmecken soll. Um zu dem Fleische der Schildkröte zu gelangen, wirft er dieselbe aus der Höhe auf einen Felsen, damit sie zerschellt. Der Engländer Simpson, welcher den Geieradler in Algerien beobachtete, bestätigt die Angabe und erzählte mir, daß jeder Vogel einen Felsen habe, auf dem er die Schildkröten zertrümmere. Am vierzehnten Mai 1861 besuchte ich den Horst eines Lämmergeiers. Unten an der Felsenwand lag eine große Menge von Schildkröten sowie verschiedene Knochen.«
»Markknochen«, gibt Simpson an, »sind die Leckerbissen, welche der Geieradler am meisten liebt, und wenn die übrigen Geier das Fleisch von dem Gerippe einer Thierleiche abgefressen haben, erscheint er zu Ende des Festes und verschlingt die Knochen oder zerbricht sie und verschlingt dann die Stücke, wenn er nicht im Stande ist, das Mark auf andere Weise zu gewinnen. Die Knochen zerbricht er, indem er sie in bedeutende Höhe hebt und von hier aus auf einen Stein fallen läßt. Weder er noch sein Junges sind genügsam. Man findet Knochen, Schildkröten und ähnliche Leckereien in Menge neben dem Horste. Damit soll jedoch keineswegs gesagt sein, daß er sich oder sein Junges auf Markknochen, Schildkröten und ähnliche Leckereien beschränke: im Gegentheile – auch ein Lamm, ein Hase oder ein Huhn kommt ihm gelegen, obgleich die Kraft seiner Klauen und seines Schnabels für einen so großen Vogel sehr schwach und er nicht fähig ist, in derselben Weise wie ein Geier oder Adler die Beute zu zerreißen. Dies gleicht sich aber aus durch sein außerordentliches Schlingvermögen. Die Griechen behaupten, daß er alles verschlinge und verdaue; aber die Geschichten, welche ich in dieser Hinsicht habe erzählen hören, sind zu wunderbar, als daß ich sie weiter verbreiten möchte. Ich selbst sah einmal einen Geieradler, welcher einen Knochen oder sonst einen ungewöhnlichen Gegenstand hinabgewürgt hatte. Er befand sich in einer höchst ungemüthlichen Lage und mußte sich, um zu seinem Zweck zu kommen, auf die langen Federn seines Schwanzes stemmen.«
»Aas«, sagt Irby, »scheint die fast ausschließliche Nahrung des Geieradlers zu sein.« »Dieser Vogel«, bestätigt Gurney, »verschlingt große Knochen. Der Magen von dem, welchen ich (an der Südostküste Afrikas) erlegte, war vollgestopft mit solchen. Die Knochen waren zweifellos ohne jegliches Fleischanhängsel verschluckt worden, und ich selbst sah, daß einer einen dürren Knochen nahm. Der größte von denen, welche ich fand, war ein Ochsenwirbel von zehn Centimeter Länge, sieben Centimeter Breite und fünf Centimeter Dicke. Eine Menge Haare vom Klippschliefer fand sich ebenfalls im Magen zwischen den Knochen vor und bewies also, daß der Geieradler auch derartige Thiere raubt, wahrscheinlich, wenn sie bei Tage außerhalb ihrer Höhle sich sonnen.« Er fängt, laut Adams, »Murmelthiere, hält sich aber nicht ausschließlich an lebende Beute; denn man sieht ihn auch längs der Bergseiten gemächlich dahinschweben und nach Aas und anderen Abfällen suchen. In dem Magen eines von mir in den Bergen von Kaschmir getödteten Vogels fand ich verschiedene lange Knochen und einen Huf von einem Steinbock.« Hutton versichert, daß er sich in Indien regelmäßig von Aas nähre und selten eine größere Beute erhebe als ein Huhn, welches er zerreiße, während er fliege. Hodgson bestätigt diese Angabe; Hume endlich gibt an, daß er unter Umständen sogar Menschenkoth fresse.
»Seine Nahrung«, schreibt mir mein in Spanien lebender Bruder Reinhold nach zwanzigjährigen Beobachtungen, »besteht in Knochen, Aas und lebenden Thieren. Auf frisches Luder sah ich ihn nie fallen, wohl aber, ohne es und die bereits schmausenden Raben, Milane und Geier zu beachten, niedrig darüber wegstreichen. Er zieht unter solchen Umständen vielleicht einige Kreise über dem Aase, nimmt am Schmause jedoch keinen Antheil. Auf meinen Geierjagden habe ich ihn täglich beobachten können. Oft zog er nur sechs oder acht Meter über dem Aase weg, umkreiste es vielleicht drei- oder viermal, ließ sich aber, mochte das Aas noch unangerührt liegen oder von schmausenden Geiern umringt sein, niemals weder auf ihm, noch auf einem in der Nähe befindlichen Felsen nieder. Vier und fünf Tage nach einander habe ich von früh bis nachmittags auf ihn angestanden, weder auf sich einfindende Geier noch Adler geschossen, um ihn nicht zu verscheuchen, stets aber vergeblich seiner geharrt. In den Gebirgen Mittelspaniens, Sierra de Guadarrama, de Avila, de Gredos z. B., hält man ihn allerdings für einen gewaltigen Räuber; ich selbst aber habe ihn nie ein lebendes Thier ergreifen, ja sogar über Ziegenherden hinwegstreichen sehen, ohne daß er die Absicht bekundet hätte, auch nur auf ein Zicklein zu stoßen. Ob etwas wahres an der Lilford gewordenen Mittheilung südspanischer Jäger ist, daß er Bergsteinböcke über die Felsen jage und sich, nachdem die Geier das Fleisch gefressen, mit deren Knochen nähre, lasse ich dahingestellt sein. In seinem Horste habe ich noch mit Wolle bekleidete Schafe und Lammsbeine gefunden, welche dafür sprechen, daß er diese Thiere lebend ergriffen hat, da der spanische Hirt so leicht kein Thier den Geiern überläßt, ohne ihm vorher das Fell abgezogen zu haben.«
Nach so vielen, fast in jeder Beziehung unter sich übereinstimmenden Berichten wird es schwer, die Erzählungen für wahr zu halten, welche über die Stärke, Kühnheit und Raubsucht desselben Vogels von den schweizerischen Forschern gegeben worden sind. Hierher gehören die Geschichten Steinmüllers, daß ein Bartgeier versuchte, einen Ochsen von einem Felsen herabzustürzen, daß ein anderer einen einjährigen Ziegenbock, ungeachtet der Gegenwehr seines Herrn, durch die Lüfte davontrug, nachdem er den Besitzer in die Flucht geschlagen hatte, daß ein dritter eine funfzehn Pfund schwere Ziege aus der Luft herabfallen ließ, ein vierter eine siebenundzwanzig Pfund schwere Eisenfalle auf ein gegenüberstehendes hohes Gebirge schleppte, ein fünfter von einem Fuchse, welchen er geschlagen hatte, in der Luft getödtet wurde, ein sechster ein Kind in Gegenwart seiner Eltern aufhob und entführte, ein siebenter sogar ein dreijähriges Mädchen, Anna Zurbuchen, vierzehnhundert Schritte weit geschleppt und nur durch die Ankunft eines dem schreienden Mädchen folgenden Mannes abgehalten wurde, es zu fressen, so daß sein wohl am linken Arme und an der Hand verwundetes Opfer gerettet wurde und später als » Geieranni« einen Schneider heirathen konnte, und anderes mehr. Berichtete nicht Girtanner über einen in der neuesten Zeit vorgekommenen Angriff des Geieradlers auf einen halberwachsenen Knaben, ich würde alle Geschichten solcher Art unbedenklich in die Rumpelkammer der Fabel geworfen haben und nach wie vor den Geieradler als einen Vogel bezeichnen, welcher im großen nicht mehr ist, als der ihm in vieler Hinsicht nahe verwandte Schmutzgeier im kleinen: ein kraftloser, feiger, leiblich wie geistig wenig begabter Raubvogel, welcher nur gelegentlich ein schwächeres, lebendes Wirbelthier wegnimmt, gewöhnlich aber in Knochen und anderen thierischen Abfällen seine Speise findet. Eingedenk aber der Gewissenhaftigkeit des eben genannten, von mir hochgeachteten Forschers, darf ich dessen Darlegung nicht verschweigen, so schwer mir auch wird, zu glauben.
»Mit der Frage nach der Ernährung des Alpenbartgeiers«, sagt Girtanner, dessen Mittheilungen ich übrigens nur im Auszuge wiedergebe, »sind wir sowohl in Bezug auf die Beschaffenheit des Nährstoffes als auf die Art und Weise, wie er sich desselben bemächtigt, bei dem streitigsten Kapitel in seiner Naturgeschichte angelangt. Daß er Aas frißt, steht fest: hierin stimmen alle Berichte überein. Am deutlichsten beweist dies, wenn wir noch vermeiden wollen, aus seinem bezüglichen Verhalten in Gefangenschaft auf sein Freileben zu schließen, der Umstand, daß die Falle stets mit solchem geködert wird, und daß er oft auf Aas angetroffen worden ist. Ein Bündner Jäger schoß ein altes Thier auf einem todten jungen Rinde, welches am Fuße eines steilen Felsens lag und welchem der Vogel bereits die Augen ausgefressen hatte. Er war im Begriffe, mit aller Kraft seines Reißhakens die Leibeshöhle des Rindes aufzubrechen, als ihn die Kugel todt über das todte Thier hinstreckte. Das Rind war kurze Zeit vorher auf der Fläche jenes Felsens weidend beobachtet worden. Auf todten Gemsen wurden schon mehrere erlegt und die frischtodte Gemse sammt dem darauf erlegten Bartgeier als gute Prise zur Hütte geschleppt. Beim Verzehren eines kleinen Säugethieres scheint er auch in der Freiheit im Genicke zu beginnen und mit dem Haken die Beute stückweise zu zerfleischen, indem er sie mit einem Fuße, wohl auch mit beiden festhält. Bei großen Thieren befolgt er immer die angedeutete Zerreißungsmethode. Auch sein oft angezweifeltes Auffliegen mit großen Knochen, um sie in der Höhe fallen und auf den Felsen zerschellen zu lassen und verschlingbar zu machen, wird mir von Graubünden her als vielfach und über alle Zweifel sicher festgestellt gemeldet. Zu von ihm getödteten oder schon todt gefundenen Thieren kehrt der Alpenbartgeier nur zurück, um sie vollends zu verschlingen, wenn es ihm bis zur Wiederkehr des Hungers nicht gelungen ist, lebende Beute zu machen.« Nach mehr als acht Tagen sah ihn unser Tessiner Jäger im Winter zu einem für ihn als Lockspeise hingelegten todten Thiere zurückkehren, in gerader Linie aus weiter Ferne daherschießend, sei es, daß ihn hierbei mehr der Geruchs- oder der Ortssinn geleitet. Auf dem Aase angelangt, dem er sich jedoch stets nur unter Beobachtung gewisser Vorsichtsmaßregeln nähert, frißt er sich, von seiner Sicherheit überzeugt, so voll, als er eben kann. So vorsichtig er sich im allgemeinen vor dem Aase benimmt, so dreist machte ihn Hunger und Noth angesichts eines Fraßes. »So erhob sich«, schreibt mir Manni, »einst bei heftigem Schneesturme ein alter Bartgeier von der Landstraße vor mir erst, als ich ihm etwa auf funfzehn Schritte nahe gerückt war. Derselbe befand sich zudem unmittelbar hinter einem Hause, in welchem nämlichen Tages geschlachtet worden war, und wo er wohl einen Knochen, Eingeweide oder sonst ein Ueberbleibsel eines Schlachtthieres gefunden haben mochte.« Von ihm selbst getödtete kleinere Vierfüßler: Berghasen, Murmelthiere, frischgesetzte, überhaupt junge Gemsen und Ziegen, Lämmer, Ferkel etc. zieht er bei uns jeder anderen Nahrung vor, die wildlebenden aber den Hausthieren. Findet er solche seinerseits ohne Anstrengung und Gefährdung zu erbeutende Säuger in genügender Anzahl, so ist er gewiß zufrieden, seinen Hunger auf die müheloseste Weise stillen zu können; gelingt ihm dies aber nicht, und ist auch kein Aas zu haben, dann zwingt ihn der Hunger, dann führt ihn der Selbsterhaltungstrieb dazu, größere lebende Thiere zu überfallen und zu bezwingen: Schafe, Ziegen, Gemsen, Füchse, Kälber etc. Hierüber sind alle Berichte, welche mir seitens gewissenhafter Beobachter eingegangen sind, zu sehr einig, als daß für mich die vollständige Sicherheit der Thatsache noch im geringsten fraglich sein könnte. Dieselben Berichterstatter sind auch darin einig, daß sich der Alpenbartgeier von Aas und kleinen Säugern allein gar nicht zu erhalten im Stande wäre. Berghasen sucht er aus dem Gestrüppe und Krummholze herauszujagen, um sie dann auf offenem Gelände entweder ohne weiteres zu fassen oder vorher durch einen Flügelhieb zu betäuben. Je nach der Sicherheit der Stelle frißt er die Beute sofort an oder trägt sie nach dem Horste oder seinem gewöhnlichen Standplatze. Bei der Jagd auf erwachsene Gemsen, Schafe etc. bedient er sich zu deren Bewältigung in erster Linie seiner Flügel, nicht der Fänge. Während der Adler mit angezogenen Flügeln wie eine Bombe aus der Luft auf die Beute herabfährt, ihr die Fänge einschlägt und sie durch Ersticken mordet, so geschieht der Angriff des Bartgeiers meist erst aus ziemlicher Nähe. Unser Tessiner Beobachter berichtet nach mehrfacher eigener Anschauung: »Wenn der Bartgeier mit seinen scharfen Augen auf dem Boden unter sich ein Thier sieht, welches er fressen will, so fällt er nicht wie ein Stein aus der Luft herab, gleich dem Steinadler, sondern er kommt in weiten Kreisen herabgeflogen. Oft setzt er sich zunächst auf einen Baum oder einen Felsen und beginnt den Angriff erst, nachdem er sich von hier nochmals, jedoch nicht hoch, erhoben hat. Sieht er Leute in der Nähe, so schreit er laut und fliegt fort. Nie greift er Thiere an, welche weit von Abhängen im flachen Thale weiden; bemerkt er aber eine Gemse zum Beispiel, welche nahe am Abgrunde graset, so beginnt er, von hinten heranschießend, mit wuchtigen Flügelschlägen das aufgeschreckte Thier hin und her zu jagen und zu schleppen, bis es völlig verwirrt und betäubt, nach dem Abhange hinflieht. Erst wenn er diesen seinen Zweck erreicht hat, legt er seine ganze Kraft in die starken Flügel. Von beiden Seiten fahren mit betäubendem Zischen und Brausen die harten Schwingen klatschend auf das tödtlich geängstigte, halb geblendete Opfer. Wohl sucht dieses, zeitweise noch sich zusammenraffend, mit den Hörnern den Mörder abzuwehren – vergebens. Zuletzt wagt es einen Sprung oder macht einen Fehltritt; es springt oder stürzt in die Tiefe, oder aber es bricht todesmatt zusammen und kollert sterbend über die Felsbänke. Langsam senkt sich der Bartgeier seinem Opfer nach, tödtet es nöthigenfalls noch vollständig mit Flügeln und Schnabel und beginnt ungesäumt, das warme Thier zu zerfleischen. Steht ein Schaf oder ein ähnliches Thier, ein Jagdhund, an sehr steiler Stelle am Abhange, und er wird nicht von ihm bemerkt, bis er, von hinten kommend, sich ihm genaht hat, so dauert der Kampf oft nur sehr kurze Zeit. Er fährt mit scharfem Flügelschlage geraden Weges an das überraschte Opfer an und wirft es durch den ersten Anprall glücklich hinunter, oder er reißt dasselbe fliegend mit Schnabel und Krallen über die Felskante hinaus und läßt es stürzen, im Abgrunde zerschellen.« Hiermit übereinstimmend schreibt mir Baldenstein: »Als ich einst auf einer meiner Gebirgsjagden gegen Abend in gemüthlichem Gespräche bei einem Hirten saß, schnobberte dessen Hund am nahen Abhange herum. Plötzlich erreichte ein Schrei des Hundes unser Ohr. Im selben Augenblicke sahen wir den treuen Herdenbewacher über dem Abgrunde in der Luft schweben, während sein Mörder, ein alter Bartgeier, triumphirend über ihm hinschwamm. Wir hatten unmittelbar vorher nicht auf den Hund geachtet und auch von dem Geier nichts bemerkt, bis uns der sonderbare Schrei des armen Thieres nach jener Stelle sehen ließ. Ohne jenen Schreckenslaut wäre der Hund auf räthselhafte Weise verschwunden, und wir hätten uns sein Verschwinden nie erklären können, wenn auch sicher der Verdacht auf diese Todesart in uns sofort aufgetaucht wäre. Schnell ließ sich auch der Geier auf seine Beute hinunter und verschwand wie diese vor unseren Augen. Es wickelte sich alles sehr rasch ab, rascher, als es erzählt werden kann. Ob der Vogel diese Beute mehr durch die Gewalt seines Flügelschlages oder durch einen Riß mit dem Schnabelhaken über den Felsen hinaus geworfen, bin ich deshalb zu entscheiden nicht im Stande, weil, wie gesagt, bei unserem Aufblicken der Hund schon frei in der Luft schwebte; sicher aber weiß ich, daß der Bartgeier nie auf einen meiner jagenden Hunde stieß, so lange sie, entfernt vom Abgrund, auf ebenem Boden suchten, so oft er auch allein oder zu zweien nahe über ihnen kreiste. Der Bartgeier ist nicht ein Stoßvogel im Sinne des Adlers.« Daß und in welcher Weise der Bartgeier auch erwachsene Gemsen angreift und bewältigt, hatte Saratz mit eigenen Augen anzusehen Gelegenheit: »Als ich einst«, schreibt er, »von meinem Hause aus Gemsen auf ihrem Marsche zuschaute, sah ich plötzlich, wie ein gewaltiger Bartgeier von hinten auf eine derselben niederstürzte, ihr einige rasche Flügelschläge versetzte, dann auf die am Boden liegende Beute sich warf und sie sofort mit dem Schnabel zu bearbeiten begann. Bei meinen Jagdstreifereien auf Gemsen, sah ich einmal ein kleines Rudel derselben an einem schmalen Gletscher dahinziehen und ruhig, die Geis voran, dem Berggrate sich zuwenden. Plötzlich stutzt die Geis, die anderen halten bestürzt an, und im Nu haben alle einen Kreis gebildet, die Köpfe sämmtlich nach innen zu gekehrt. Was mochte diese Unruhe, diesen plötzlichen Halt bewirkt haben? Hierüber gab mir ein der Höhe zugewandter Blick Aufschluß; denn ich wurde bald gewahr, daß sich über ihnen in der Luft etwas schaukelte, was mir mein Glas als Bartgeier zu erkennen gab. Plötzlich stürzte sich dieser in schräger Richtung von hinten den Gemsen nach, welche ihn jedoch mit thatkräftigem Emporwerfen der Hörner empfingen und zwangen, von ihnen abzulassen. Er erhob sich, um viermal denselben Angriff zu wiederholen. Nochmals stieg er empor, diesmal aber immer höher und höher, und als er nur noch als Punkt am Himmel sichtbar war, da plötzlich stiebten meine geängstigten Thiere auseinander, um sich im gestreckten Laufe einer überhängenden Felswand zu nähern, welcher sie sich anschmiegten und nun das Auge unverwandt der Höhe zurichteten. In dieser Stellung verblieben sie, bis ihnen die herandämmernde Nacht Beruhigung über ihre Sicherheit brachte.« Ein anderer bündnerischer Jäger erzählt, wie er einst einen Bartgeier, nicht weit von seinem Standpunkte entfernt, auf eine Gemse habe stürzen sehen, vergeblich sich bemühend, sie mit Flügelschlägen in den Abgrund zu werfen. Seine gewöhnliche Angriffsweise mißlang diesmal, da die gescheidte Gemse, anstatt nach dem Abgrunde hin zu fliehen, sich mit einigen kühnen Sätzen noch rechtzeitig in eine Felsennische gerettet hatte, dort mit den Hörnern muthig die Angriffe abwies und sich um keinen Preis aus ihrer gedeckten Stellung vertreiben ließ. Ein ganz ähnlicher Fall wird mir gleichzeitig aus dem Tessin gemeldet. Alle diese Berichte stammen aus dem Munde von Gebirgsbewohnern und alle aus Alpengebieten, wo der Bartgeier noch Standvogel ist; alle rühren von Männern her, welche ihn vollkommen sicher vom Steinadler zu unterscheiden wissen, welche die eine Räuberei mit Bestimmtheit dem einen, die andere dem anderen aufbürden, und mit vollkommenem Rechte sich nicht ausreden lassen wollen, was sie am hellen Tage mit den ihnen eigenthümlich zugehörenden, äußerst scharfen Augen gesehen haben. Daß der Bartgeier sich auch an Menschen wage mit der Absicht, sie zu tödten, ist seit langer Zeit geglaubt und als Märchen verlacht, dann wieder als Thatsache behauptet oder doch wenigstens als vielleicht möglich gehalten worden. Beispiele vom Raube kleiner Kinder durch große Raubvögel, bei denen es sich in unserer Alpenkette jedenfalls nur um den Steinadler und den Bartgeier handeln kann, sind zu sicher festgestellt, als daß hieran noch gezweifelt werden könnte. Warum nun der Verbrecher immer der Steinadler sein soll, ist nicht so ohne weiteres klar. Was den Bartgeier, welcher sich erwiesenermaßen an erwachsene Gemsen wagt, die doch im Verhältnisse mit einem kleinen Kinde jedenfalls wehrhaft sind und die dennoch meist besiegt werden, abhalten sollte, bei gebotener Gelegenheit ein solches hülfloses Wesen wegzuschleppen, über einen Felsen, an denen man sie in den Bergen oft genug in der Nähe der Hütten herumkrabbeln läßt, herunterzuwerfen, will mir nicht einleuchten. Man vertheile hier ruhig die Schuldenlast auf beide Räuber. Denn auch der Bartgeier versucht die Beute wegzutragen, wenn er sie aus irgend einem Grunde nicht an Ort und Stelle verzehren kann. Uebersteigt ihr Gewicht seine Kraft, welche man sich jedoch nur nicht zu gering vorstellen möge, so kann er sie immer noch fallen lassen, wie dies bei allen Arten von Dieben vielfach beobachtet worden ist. Begründeter und begreiflicher ist der Zweifel darüber, daß sich unser Bartgeier auch an halberwachsene Menschen wage, in der Absicht, sie auf irgend eine Weise zu vernichten. Beispiele von solchen Ueberfällen mit oder ohne Erfolg, an denen nicht die gerechtesten Zweifel haften, sind sehr wenige bekannt; doch gewinnt die Glaubwürdigkeit jenes Falles an der Silbernalp, wo ein Hirtenbube durch einen Bartgeier von einem Felskopfe in den Abgrund gestoßen und am Fuße der Felswand von ihm angefressen worden sein soll, durch die Feststellung der Wahrheit der neuesten ähnlichen Begebenheit im Berner Oberlande eine kräftige Stütze. Dieser jüngste Fall eines Angriffes seitens eines schweizerischen Bartgeiers auf einen halberwachsenen Menschen trug sich im laufenden Jahre zu, ist also keine veraltete Geschichte, und ich habe mich sehr bemüht, die Feststellung der Thatsache oder die Grundlosigkeit des Gerüchtes sicher zu stellen.
»Im Laufe des Juni 1870 war in mehreren schweizerischen Zeitungen zu lesen, daß bei Reichenbach, im Kanton Bern, ein Knabe von einem ›Lämmergeier‹ überfallen worden sei und dem Angriffe sicher erlegen wäre, wenn der Vogel nicht noch rechtzeitig hätte verscheucht werden können. Zuerst schenkte ich der Mittheilung wenig Aufmerksamkeit und erwartete, der Lämmergeier werde sich wohl baldigst in einen Adler, wo nicht gar in einen Habicht, und der überfallene Knabe in ein Hühnchen verwandeln; doch der Widerruf blieb diesmal aus, und da die Sache für mich Theilnahme genug darbot, um verfolgt zu werden, so wandte ich mich an Herrn Pfarrer Haller in Kandergrund, dessen Freundlichkeit mir von früher her schon bekannt war.«
Unser Forscher erzählt nun, wie er von dem genannten Pfarrherrn an einen zweiten, Herrn Blaser, verwiesen wurde und von letzterem nach verschiedenem Hin- und Herschreiben folgende Nachricht erhalten habe. »Es war am zweiten Juni 1870, nachmittags vier Uhr, da ging jener Knabe, Johann Betschen, ein munterer, aufgeweckter Bursche von vierzehn Jahren, noch klein, aber kräftig gebaut, von Kien hinauf nach Aris. Kien liegt im Thalgrunde bei Reichenbach, im Winkel, welchen der Zusammenfluß der Kander und der Kien aus dem Kienthale bildet, Aris ungefähr hundertundfunfzig Meter hoch auf einer Stufe des Bergabhanges. Der Weg führte den Knaben ziemlich steil über frischgemähte Wiesen hinauf, und wie er eben oben auf einer kleinen Bergweide noch ungefähr tausend Schritte von den Häusern entfernt, ganz nahe bei einem kleinen Heuschober, angelangt war, erfolgte der Angriff. Plötzlich und ganz unvermuthet stürzte der Vogel mit furchtbarer Gewalt von hinten auf den Knaben nieder, schlug ihm beide Flügel um den Kopf, so daß ihm, nach seiner Bezeichnung, gerade war, als ob man zwei Sensen zusammenschlüge, und warf ihn sogleich beim ersten Hiebe taumelnd über den Boden hin. Stürzend und sich drehend, um sehen zu können, wer ihm auf so unliebsame Weise einen Sack um den Kopf geschlagen, erfolgte auch schon der zweite Angriff und Schlag mit beiden Flügeln, welche fast mit einander links und rechts ihm um den Kopf sausten und ihm beinahe die Besinnung raubten, so ›sturm‹ sei er davon geworden. Jetzt erkannte der Knabe einen ungeheueren Vogel, welcher eben zum dritten Mal auf ihn herniederfuhr, ihn, der etwas seitwärts auf dem Rücken lag, mit den Krallen in der Seite und auf der Brust packte, nochmals mit den Flügeln auf ihn einhieb, ihn beinahe des Athems beraubte und sogleich mit dem Schnabel auf seinen Kopf einzuhauen begann. Trotz alles Strampelns mit den Beinen und Wenden des Körpers vermochte er nicht, den Vogel zu vertreiben. Um so kräftiger benutzte der Junge seine Fäuste, mit deren einer er die Hiebe abzuwehren suchte, während er mit der anderen auf den Feind losschlug. Dies muß gewirkt haben. Der Vogel erhob sich plötzlich etwas über den Knaben, vielleicht um den Angriff zu wiederholen. Da erst fing dieser mörderlich zu schreien an. Ob dies Geschrei das Thier abgehalten habe, den Angriff wirklich zu erneuern, oder ob er bei seinem Aufstiegen eine auf das Geschrei des Burschen herbeieilende Frau gesehen und er ihn deshalb unterließ, bleibt unausgemacht. Anstatt wieder sich niederzustürzen, verlor er sich rasch hinter dem Abhange. Der Knabe war jetzt so schwach, von Angst und Schreck gelähmt, daß er sich kaum vom Boden zu erheben vermochte. Die erwähnte Frau fand ihn, als er sich eben taumelnd und blutend vom Boden aufraffte. Gesehen hat die Frau den Vogel nicht mehr. Dieses kann nun trotz allem bezweifelt werden; ich selbst bezweifle es aber nicht im geringsten. Johann Betschen, welcher von solchen Vögeln vorher nie gehört hatte, konnte auch einen solchen Vogelkampf nicht sofort erfinden und eingehend beschreiben, während er doch seiner Retterin sofort den Hergang der Sache erzählte, sowie nachher anderen Leuten, als man ihn bei den Häusern wusch und verband. Ich kenne zudem ihn und seine Familie als wahrheitsliebend. Die Wunden, welche ich selbst bald nachher besichtigte, bestanden in drei bedeutenden, bis auf den Schädel gehenden Aufschürfungen am Hinterkopfe. Auf Brust und Seiten sah man deutlich die Krallengriffe als blaue Flecken, zum Theil blutig, und der Blutverlust war bedeutend. Der Knabe blieb acht Tage lang sehr schwach. An seinen Aussagen also und an der Wirklichkeit der Thatsache ist nach meiner Ansicht kein Zweifel zu hegen. Wie sollte ich nun aber von dem Jungen, welcher nie sonst solche Vögel gesehen, nach der Angst eines solchen Kampfes erfahren, ob er es mit einem Steinadler oder mit einem Bartgeier zu thun gehabt habe? Ich nahm ihn ins Verhör, und er berichtete mir, so gut er konnte. Namentlich war ihm der fürchterliche gekrümmte Schnabel, an welchem er beim Aufsteigen des Vogels noch seine Haare und Blut sah, im Gedächtnis geblieben, ferner ein Ring um den Hals und die ›weiß grieseten Flecken‹ (mit weißen Tupfen besprengte Fittige) und endlich, was mich am meisten stutzig machte, daß er unter dem Schnabel ›so 'was wüstes G'strüpp‹ gehabt habe.«
Der Pfarrer berichtet nun in ausführlicher, schon von Girtanner gekürzter Weise über die mit dem geschädigten Knaben, unter Vorlegung verschiedener Abbildungen vorgenommene, sehr geschickt und sorgfältig geleitete Prüfung, beschließt mit ihm nach Bern zu reisen und erzählt, daß der Bursche, im Museum zuerst zum Steinadler geführt, von diesem als von seinem Gegner durchaus nichts wissen wollte, daß er beim Anblicke eines Bartgeiers im dunklen Jugendkleide in die größte Verlegenheit gerieth, weil ihm der Vogel zwar in Bezug auf die Form und Größe des Schnabels und das Gestrüpp unter demselben seinem Feinde ähnlich, im Gefieder aber durchaus unähnlich vorkam, und daß, als er endlich vor einem alten, gelben Bartgeier stand und denselben kaum erblickt hatte, er plötzlich ausrief: »Der isch's jitzt, das isch jitzt dä Schnabel, grad däwäg sy d'Flecke grieset gsi und so dä Ring um e Hals, und das isch jitzt s'G'strüpp.« Immer wieder kehrte der Knabe zu diesem Bartgeier mit hellgelbem Halse, Brust und Bauch zurück und anerkannte ihn als seinen Gegner. Immer wieder trat er erregt vor denselben hin mit der Erklärung: »das isch e, grad so isch er gsi!«
»So vereinzelt glücklicherweise Angriffe des Bartgeiers auf Menschen überhaupt sind und zumal auf solche in der Größe des angeführten Knaben dastehen«, fährt Girtanner fort, »zweifle ich wenigstens jetzt nicht mehr daran, daß sie vorkommen, überlasse es jedoch natürlich jedem, selbst davon zu halten, was immer er möge. Daß unser Bartgeier auch erwachsene Menschen, in der Hoffnung sie zu bewältigen, mörderisch überfallen, vom Felsenrande gestürzt, oder auf eine andere Art umgebracht habe, ist nie festgestellt worden. Ebenso wenig aber wollen sich solche Jäger, Alpenwanderer, Hirten, welche an gefährlicher Stelle im Gebirge verweilend, plötzlich den knarrenden, sausenden Flügelschlag des unmittelbar über ihrem Körper pfeilschnell am Felskopfe hin und in den gähnenden Abgrund hinaus schießenden mächtigen Vogels in beängstigendster Weise selbst gespürt haben, einreden lassen, daß der reine Zufall den Weg desselben an jener Stelle durch und genau über die Länge ihres Leibes weggeführt habe. Ich könnte hierzu Belege geben, wie sie mir Männer wie Baldenstein, ein echter, ehemaliger rhätischer Bergjäger, aber auch ein gebildeter und zuverlässiger Beobachter und Berichterstatter, und auch andere nach ihren eigenen Erfahrungen mitgetheilt haben, und welche übereinstimmend das sehr unheimliche solcher Lagen in den einsamen Wildnissen beschreiben; indessen fehlen, wie bemerkt, sicher festgestellte Beispiele von hierdurch wirklich herbeigeführten Unglücksfällen. Nichtsdestoweniger möchte es in Wirklichkeit auch den größten Zweiflern gewagt erscheinen, das Nichtgelingen ernsthafter wiederholter Angriffe von seiner Dummheit und Schwäche zu erwarten.«
Unsere Kenntnis über die Fortpflanzung des Bartgeiers ist in den letzten Jahren durch verschiedene Beobachter wesentlich erweitert worden. Ziemlich übereinstimmend wird angegeben, daß auch dieser Vogel, wie so viele andere Mitglieder seiner Zunft, wiederholt in demselben Horste, im Süden auch ohne Bedenken unter anderen Geiern brütet. Ein Horst, welchen Lilford in Spanien besuchte, war, wie die Bewohner der nächsten Ortschaften versicherten, seit Menschengedenken benutzt worden. In der Regel wählt der Bartgeier, nach anderer Raubvögel Art, eine geräumige Felsenhöhle an einer in den meisten Fällen unzugänglichen Felswand zu seiner Brutstätte; nach Mittheilungen meines Bruders kann es aber auch geschehen, daß er kaum zehn Meter über zugänglichem Boden nistet. Ob er selbst den Horst erbaut oder den eines anderen Raubvogels einfach in Beschlag nimmt, ist bis jetzt noch nicht ausgemacht, ebensowenig, als festgestellt werden konnte, ob ein und dasselbe Paar in jedem Jahre in dem nämlichen Horste brütet oder zwischen mehreren Niststellen wechselt. In der Schweiz wählt er, nach Girtanners Erhebungen, zu seiner Brutstätte eine Stelle an einer möglichst kahlen, unnahbaren Felswand ziemlich hoch oben im Gebirge, immer da, wo überhängendes Gestein ein schützendes Dach über einer geräumigen Nische bildet. Ein Sarde, dessen Girtanner gedenkt, will einen Horst auch auf drei nahe bei einander stehenden verstümmelten Eichen zunächst einem großen Felsblocke gefunden haben. Seinen Horst besucht der Vogel bereits in den letzten Monaten des Jahres regelmäßig; denn schon im Januar, spätestens in den ersten Tagen des Februar, beginnt er sein Brutgeschäft. In weitaus den meisten sicher festgestellten Fällen legt das Weibchen nur ein einziges Ei; doch bemerkt Saratz, daß am Camogaskerhorste bald ein, bald zwei Junge von der gegenüber liegenden Felswand aus bemerkt wurden, und hiermit stimmt auch eine später mitzutheilende Beobachtung von Adams überein. Die Eier sind groß, rundlich und grobkörnig, auf trübweißlichem Grunde mit kleineren und größeren, zuweilen auch sehr großen, aschgrauen oder rothgrauen Schalenflecken und ockergelben, braunrothen oder rothbraunen Tupfen und Flecken gezeichnet, welche unten oder um die Mitte des Eies dichter zusammenstehen. Wie lange die Brutzeit währt, ist nicht bekannt; man weiß nur, daß zu Anfang des März, spätestens im April, in der Schweiz wie in Südspanien und Nordafrika ausgeschlüpfte Junge bemerkt werden.
Der erste Naturforscher, welcher einen Horst des Geieradlers erstieg, scheint mein Bruder gewesen zu sein. Der Horst stand auf einem Felsenvorsprunge, welcher durch das etwas überhängende Gestein einigermaßen vor den Sonnenstrahlen geschützt war, kaum mehr als fünfzehn Meter über dem Fuße des letzten Felsenkammes, war also verhältnismäßig leicht zu erreichen. Der Durchmesser des Unterbaues betrug ungefähr anderthalb Meter, der Durchmesser der etwa zwölf Centimeter tiefen Nestmulde sechzig Centimeter, die Höhe einen Meter. Dicke und lange Aeste, von der Stärke eines Kinderarmes bis zu der eines Daumens, bildeten den Unterbau; hierauf folgte eine dünne Schicht von Zweigen und Aestchen, zwischen denen die Nestmulde eingetieft war. Diese bestand aus denselben, aber etwas feineren Bestandtheilen und war innen mit Baststricken, Kuh- und Roßhaaren sorgfältig ausgekleidet. Um den Horst herum waren alle Felsplatten mit einer schneeweißen Kothkruste überzogen. Ein zweiter Horst in Griechenland wurde von Simpson bestiegen. Derselbe war, wie Krüper berichtet, aus starken Zweigen erbaut und mit verschiedenen Thierhaaren, besonders solchen von Ziegen, ganz durchwebt und innen flach ausgepolstert. Auf ihm saß ein drei Wochen altes Junges, dessen Tafel mit Knochen, einem ganzen Eselsfuße, Schildkröten und dergleichen reich bedeckt war. »Beide Eltern nahten und stießen zuweilen ein Pfeifen aus, welches dem eines Hirten nicht unähnlich klang.« Später zeigten sich die Alten noch ängstlicher: davon aber, daß sie einen Angriff versucht hätten, sagt Krüper kein Wort; die das Gegentheil berichtenden Erzählungen werden aber auch durch Salvin geradezu widerlegt. Alle Paare, welche der letztgenannte beim Horste beobachtete, während die Jungen ausgehoben wurden, hielten sich fern von den zu ihren Jungen aufkletternden Menschen und kein einziges versuchte jemals einen Angriff. »Der Horst«, sagt Adams, »wird im Himalaya immer auf Felsen und unnahbaren Plätzen angelegt. Die Brutzeit fällt in die Monate April und Mai. In der Nähe von Simla fand ich einen mit zwei Jungen in der Höhle einer überhängenden Klippe. Eine reiche Knochensammlung von Schafen und anderen Herdenthieren lag umher. Es waren die Abfälle einer europäischen Niederlassung, einige Meilen von hier gelegen.«
Das Gefangenleben der Lämmergeier ist vielfach beobachtet worden und entspricht vollständig dem Charakterbilde, welches man bei Erforschung des Freilebens unseres Vogels gewinnt. Mein Bruder erhielt einen jungen Bartgeier im Jugendkleide, welcher von zwei Hirten aus dem beschriebenen Horste genommen und zunächst einem Fleischer zum Auffüttern übergeben, von diesem aber seinem späteren Herrn abgetreten worden war. Die beiden alten Vögel hatten, als man ihnen ihr Junges rauben wollte, die Hirten nahe umkreist, ohne jedoch auf dieselben zu stoßen, sich auch nach einigen Steinwürfen entfernt und das Geschrei ihres Kindes nicht weiter beachtet.
»Als ich den jungen Geieradler zum ersten Male sah«, erzählt der genannte, »war er sehr unbeholfen und ungeschickt. Er trat noch nicht auf die Füße, sondern ließ sich, wenn er zum Auftreten gezwungen worden war, sofort wieder auf die Fußwurzeln nieder, legte sich auch wohl geradezu auf den Bauch. Die ihm vorgelegten Fleischstückchen ergriff er mit der Spitze des Schnabels, warf sie dann in die Höhe und fing sie geschickt wieder auf, worauf er sie begierig hinunterschlang. Knochen behagten ihm jetzt ebenso wenig als später; stopfte ich ihm solche, welche scharfe Ecken oder Kanten hatten, bis an den Kropf hinab, so würgte er so lange, bis er sie wieder ausspie.
»Ich ließ ihn noch längere Zeit bei seinem ersten Besitzer, und von diesem verpflegen, besuchte ihn aber, da mich mein Beruf als Arzt wöchentlich einmal nach dem Dorfe führte, jedesmal. Er wohnte in einem engen Hofe, freute sich aber immer sehr, und gab dies mit lebhaftem Geschrei zu erkennen, wenn sein Herr ihm nahte. Bei Tage wurde er in die Sonne gesetzt und breitete dann sogleich Flügel und Schwanz aus, legte sich wohl auch auf den Bauch und streckte die Beine weit von sich; in dieser Stellung blieb er mit allen Anzeichen der höchsten Behaglichkeit stundenlang liegen, ohne sich zu rühren. Nach ungefähr einem Monate konnte er aufrecht stehen und begann nun auch zu trinken. Dabei hielt er das ihm vorgesetzte Gefäß mit einem Fuße fest, tauchte den Unterschnäbel tief ein und warf mit rascher Kopfbewegung nach oben und hinten eine ziemliche Menge von Wasser in den weit geöffneten Rachen hinab, worauf er den Schnabel wieder schloß. Vier bis sechs Schlucke schienen zu seiner Sättigung ausreichend zu sein. Jetzt hackte er auch bereits nach den Händen und Füßen der Umstehenden, verschonte aber immer die seines Herrn. Ich ließ ihn noch einen Monat bei diesem, dann nahm ich ihn zu mir nach Murcia. Er war jetzt bis auf den Hals, dessen Krausenfedern oben hervorsproßten, vollkommen befiedert und sein Schwanz bedeutend, jedoch noch keineswegs zu voller Länge gewachsen. Er wurde in einen geräumigen Käfig gebracht und gewöhnte sich auch bald ein, nahm jedoch in den ersten beiden Tagen seines Aufenthaltes in dem neuen Raume keine Nahrung zu sich und trank nur Wasser. Nach Ablauf dieser Frist bekam er Hunger. Ich warf ihm Knochen vor: er rührte sie nicht an; sodann bekam er Köpfe, Eingeweide und Füße von welschen und anderen Hühnern: aber auch diese ließ er unberührt liegen. Als ich ihm Knochen einstopfte, brach er dieselben augenblicklich wieder aus, ebenso die Eingeweide der Hühner; erst viel später begann er Knochen zu fressen. Frisches Rind- und Schöpsenfleisch verschlang er stets mit Gier. Nachdem er das erste Mal in seinem Käfige gefressen hatte, legte er sich wieder platt auf den Sand, um auszuruhen und sich zu sonnen.
»Schon nach wenigen Tagen kannte er mich und achtete mich als seinen Herrn. Er antwortete mir und kam, sobald ich ihn rief, zu mir heran, ließ sich streicheln und ruhig wegnehmen, während er augenblicklich die Nackenfedern sträubte, wenn ein Fremder nahte. Auf Bauern in der Tracht der Vega schien er besondere Wuth zu haben. So stürzte er mit heftigem Geschrei auf einen Knaben los, welcher seinen Käfig reinigen sollte, und zwang ihn mit Schnabelhieben, denselben zu verlassen. Einem Bauer, welcher ebenfalls in den Käfig ging, zerriß er Weste und Beinkleider. Nahte sich ein Hund oder eine Katze seinem Käfige, so sträubte er die Federn und stieß ein kurzes, zorniges ›Grik, grik, grik‹ aus, dagegen kam er regelmäßig an sein Gitter, wenn er meine Stimme vernahm, ließ erfreut und leise seinen einzigen Laut hören und gab auf jede Weise sein Vergnügen zu erkennen. So steckte er den Schnabel durch das Gitter und spielte mit meinen Fingern, welche ich ihm dreist in den Schnabel stecken durfte, ohne befürchten zu müssen, daß er mich beißen werde. Wenn ich ihn aus seinem Käfige herausließ, war er sehr vergnügt, spazierte lange im Hofe herum, breitete die Schwingen, putzte seine Federn und machte Flugversuche.
»Ich wusch ihm von Zeit zu Zeit die Spitzen seiner Schwung- und Schwanzfedern rein, weil er dieselben stets beschmutzte. Dabei wurde er in einen Wassertrog gesetzt und tüchtig eingenäßt. Diese Wäsche schien ihm entschieden das unangenehmste zu sein, was ihm geschehen konnte; er geberdete sich jedes Mal, wenn er gewaschen wurde, geradezu unsinnig und lernte den Trog sehr bald fürchten. Wenn er dann aber wieder trocken war, schien er sich höchst behaglich zu fühlen und es sehr gern zu sehen, daß ich ihm seine Federn wieder mit ordnen half.
»In dieser Weise lebte er bis Ende Mai gleichmäßig fort. Er fraß allein, auch Knochen mit, niemals aber Geflügel. Ich versuchte es mit allerlei Vögeln: er erhielt Tauben, Haus- und Rothhühner, Enten, Blaudrosseln, Alpenkrähen, Blauröcke, gleichviel. Selbst wenn er sehr hungrig war, ließ er die Vögel liegen; stopfte ich ihm Vogelfleisch mit oder ohne Federn ein, so spie er es regelmäßig wieder aus. Dagegen verschlang er Säugethiere jeder Art ohne Widerstreben. Ich habe diesen Versuch unzählige Male wiederholt: das Ergebnis blieb immer dasselbe.
»Ende Mai erhielt mein Liebling – denn das war er geworden – seiner würdige Gesellschaft. Ein Bauer meldete mir, daß er eine ›Aguila real‹ flügellahm geschossen habe und sie verkaufen wollte. Ich wies ihn ab, weil ich an einem Fleischfresser genug hatte. Der Mann kam aber doch wieder und brachte – die Mutter des jungen Geieradlers. Der verwundete Vogel lag auf seiner gesunden Seite regungslos vor mir und gab sein Unbehagen nur durch Oeffnen des Schnabels und Sträuben der Nackenfedern zu erkennen. Wenn sich ihm jemand nahte, verfolgte er dessen Bewegungen mit seinen Blicken, hackte mit dem Schnabel nach ihm und hielt das, was er erfaßt hatte, mit demselben fest. Ich löste ihm zunächst den verwundeten Flügel ab. Der durch die Wundhülfe verursachte Schmerz machte ihn wüthend; er biß heftig um sich und gebrauchte auch seine Klauen mit Geschick und Nachdruck.
»Hierauf steckte ich ihn zu dem jungen Vogel. Er legte sich auch im Käfige sofort nieder und gab lautlos dieselben Zeichen seines Unwillens wie vorher. Der junge beschaute ihn neugierig von allen Seiten, und saß viertelstundenlang neben ihm, ohne seine Aufmerksamkeit zu erregen. Das ihm vorgeworfene Fleisch rührte er nicht an. Am anderen Tage saß er auf seinen Füßen; am dritten Tage ließ ich beide in den Hof heraus. Der alte ging mit gemessenen Schritten, mit lang herabhängenden Federhosen, erhobenem Schwanze und geöffnetem Schnabel auf und ab, scheinbar, ohne sich um seine Umgebung zu kümmern. Ich setzte ihnen Wasser vor; der junge lief eilig darauf los und begann zu trinken. Als dies der alte sah, ging er ebenfalls nach dem Gefäße hin und trank das langentbehrte Naß mit ersichtlichem Wohlbehagen. Gleich darauf wurde er munterer, und würgte zunächst das ihm eingestopfte Fleisch, das er bisher immer ausgespieen hatte, in den Kropf hinab. Das Fleisch von Geflügel verschmähte er ebenso, wie der junge es gethan hatte, und war niemals dazu zu bringen, auch das kleinste Stückchen davon zu verschlingen.
»In sehr kurzer Zeit verlor der alte allen im Anfange gezeigten Trotz. Er wählte sich im Käfige einen Mauervorsprung zu seinem Sitze, und ließ, dort fußend, alles erdenkliche um sich geschehen, ohne es zu beachten. Wenn er in den Hof gebracht wurde, lief er stets schleunigst wieder in seinen Käfig. Nach wenigen Tagen durfte ich ihn streicheln.
»Geraume Zeit später erhielten beide neue Gesellschaft, und zwar eine Dohle. Sie wurde nicht beachtet und bald so dreist, daß sie die durstigen Geieradler so lange von dem frischgefüllten Trinkgeschirre mit Schnabelhieben zurückscheuchte, als sie nicht selbst ihren Durst gestillt hatte, holte sich auch mit der größten Frechheit Brocken von dem Fleische, an welchem die Geieradler gerade fraßen. Beide ließen die kecke Genossin gewähren, warteten mit dumm erstaunten Blicken, bis sie getrunken hatte, und nahten sich dann schüchtern, um ebenfalls ihren Durst zu löschen. Ueberhaupt schien größte Gutmüthigkeit ein Hauptzug ihres Wesens zu sein. Wenn ich sie des Abends nebeneinander auf eine erhöhte Sitzstange setzte, konnte ich ruhig unter dieser weggehen, ohne daß einer von beiden jemals den Versuch gemacht hätte, mich zu beschädigen; vielmehr bog sich der junge zu mir herab, um sich streicheln zu lassen. Einen bereits flüggen Steinadler und zwei junge Schmutzgeier, welche ich wenige Tage später erhielt, schienen die Bartgeier erstaunt zu betrachten, thaten ihnen jedoch ebenfalls nichts zu Leide; ja, der junge gab sogar zu, daß einer der Schmutzgeier sich auf seinen Rücken setzte, wenn er sich im Sande ausstreckte. Als ich noch einen Habichtsadler zu dieser bunten Gesellschaft brachte, war die Ruhe für immer gestört. Aber auch dieser Vogel erhielt einen seiner würdigen Genossen. Man brachte mir einen dritten Aasgeier und einen Uhu. Der lichtscheue Finsterling suchte sich sofort einen stillen Winkel aus und schien sich katzenjämmerlich zu fühlen. Alle Insassen des Käfigs betrachteten den neuen Ankömmling mit deutlich ausgesprochener Neugier; sogar der junge Geieradler schien Theilnahme für ihn zu zeigen, ging zu ihm hin, besah ihn sorgfältig von allen Seiten, und begann schließlich das Gefieder des mürrischen Gastes mit dem Schnabel zu untersuchen. Augenblicklich fuhr der Nachtkönig auf und versetzte dem arglosen Bartgeier einige scharfe Klauenhiebe, fiel jedoch bald wieder grollend in seine Stellung zurück. Der Geieradler sah ihn nach diesem Wuthausbruche mit allen Zeichen des höchsten Erstaunens an und wandte ihm fernerhin den Rücken.
»Gegen Abend setzte ich den größten Theil der Gesellschaft in folgender Ordnung auf die Sitzstange: zuerst den Steinadler, sodann den Uhu, neben diesen den jungen Bartgeier, hierauf einen Aasgeier, und zuletzt den alten Bartgeier. Der Habichtsadler blieb niemals sitzen. So lange ich im Käfige war, blieben alle in ihrer Stellung; sobald ich aber heraustrat, begann der junge Bartgeier sich jedesmal mit dem Uhu zu beschäftigen, und erntete dann auch regelmäßig die Grobheiten desselben. Trotzdem ließ jener seine Neckereien nicht eher, als bis der Uhu von der Sitzstange herabflog, wobei er aber gewöhnlich dem immer zum Kampfe bereiten Habichtsadler in die Klauen fiel. Wenn beide Störenfriede sich in die Federn geriethen, herrschte die größte Ruhe und Stille unter den übrigen; sie gaben dann neugierige, theilnahmlose Zuschauer ab.
»Daß die rothe Farbe den Geieradlern gänzlich gleichgültig war, beweist der Umstand, daß mein rothgefütterter Schlafrock, dessen Inneres sie oft genug zu sehen bekamen, ihnen niemals ein Zeichen des Unwillens abzwingen konnte. Ebenso wenig zeigten sie gegen Kinder besondere Abneigung, wie dies Crespons vom sardinischen Geier beobachtet haben will. Wenn sie im Hofe herumliefen, gingen sie oft an einem spielenden Kinde vorüber, ohne es anzutasten oder auch nur eines Blickes zu würdigen. Nur wenn jemand sie in ihrem Käfige belästigte, wurde der junge ärgerlich, machte aber auch dann keinen Unterschied zwischen erwachsenen Personen oder Kindern.
»Leider war der Käfig den Strahlen der spanischen Mittagssonne ausgesetzt, woher es wohl auch kommen mochte, daß der alte Bartgeier nach und nach erkrankte und schließlich an einer Lungenentzündung sanft und ruhig verschied. Der junge Geieradler, die drei schmutzigen Aasgeier und der Habichtsadler blieben jedoch trotz der Hitze gesund und konnten nach Deutschland gesandt werden. Die Hitze, welche die Thiere unterweges auszustehen hatten, belästigte unseren Vogel sehr; er saß mit weit geöffnetem Schnabel und lechzte nach frischer Luft und nach Wasser. Nachdem wir ihn mehrere Male getränkt hatten, steckte er jedes Mal, wenn der Wagen hielt, seinen Kopf zwischen den Sprossen des Reisekäfigs durch, als wollte er wieder um Wasser bitten. Bei der Ueberfahrt nach Frankreich wußte er sich bald die Liebe aller Matrosen des Dampfschiffes zu erwerben, und wurde von ihnen reichlich mit Nahrung bedacht. Er saß oft ganz frei auf dem Decke, ohne den Versuch zu machen, seine gewaltigen Schwingen zu proben.«
Von anderweitigen Mittheilungen über das Gefangenleben des Bartgeiers will ich einzig und allein den Bericht Girtanners, welcher mir der belehrendste zu sein scheint, jedoch auch ihn nur im Auszuge wiedergeben. Zu Ende des Mai 1869 wurde der von meinem Freunde einige Monate gepflegte Vogel im Kanton Tessin vermittels des Fuchseisens gefangen. Die Falle hatte das eine Bein am Laufe erfaßt und die Strecksehne der Hinterzehe gänzlich durchgequetscht, und diese sich, da für sachgemäße Behandlung nichts geschehen war, nach vorn umgelegt, so daß der Fuß zum Theil lahm blieb. Der im übrigen gesunde Vogel gelangte nach zwei Monaten in Besitz Girtanners und in einer sehr reichhaltigen, geschickt angeordneten Ausstellung lebender Schweizer Vögel, welche ich besuchte, zu verdienter Anerkennung. Während der Dauer der Ausstellung frei auf einer gepolsterten Kiste stehend und täglich durch Hunderte von Besuchern beunruhigt, oft auch geneckt und erschreckt, blieb er in beständiger Aufregung, nahm in Anwesenheit von Fremden nie Speise zu sich, saß mit geöffnetem Schnabel hastig athmend da, ließ Flügel und Schwanz unschön hängen und machte den Eindruck eines kranken Vogels. Anfänglich erhob er sich bei dem Erscheinen seines Pflegers sofort, um für alle Fälle gerüstet zu sein; später ließ er sich durch diesen nicht mehr stören. »Während er«, sagt Girtanner wörtlich, »anfangs auch gegen mich die Nackenfedern sträubte und wie einen Strahlenkranz um den schmälen Kopf aufstellte, mich dabei grimmig anglotzte, theils ängstlich, theils zornig hin- und herlief, bei größerer Annäherung und jedem Versuche, ihn zu berühren sofort die Flügelbuge vorschob und mit dem Schnabel auszuhauen versuchte, in der irrigen Meinung, sich gegen mich vertheidigen zu müssen, mochte er wohl nicht denken, daß der Respekt ganz meinerseits war. Bald aber verlor sich durch ruhige Behandlung dieses Mißtrauen; er ließ in der Folge den Halskragen liegen und erkannte in mir bald seinen Pfleger. Die Halsfedern ganz besonders eng anziehend, so daß Hals und Kopf sehr klein erschienen, ließ er sich sogar berühren und im Gefieder an Hals und Brust krauen.« Das wunde Bein konnte nun untersucht werden, und der Vogel gestattete dies auch, obwohl er, wenn ihm die Streckung oder eine sonstige Berührung der Hinterzehe Schmerzen verursachte, mit dem Schnabel dann und wann immer wieder, aber ohne zu verletzen, nach der Hand fuhr. Solche Behandlung ließ er sich jedoch nur von Girtanner gefallen; Fremde wehrte er sofort ab, sobald er ihre Absicht, den Fuß zu berühren, merkte. Seinen früheren Besitzer erkannte er vierzehn Tage nach seinem Hiersein noch sehr wohl und ließ ihn alles mit sich vornehmen, was er auch Girtanner gestattete. Wollte er besonders gute Laune bezeigen, so hielt er, wenn seine Freunde ihm den Kopf krabbelten, den letzteren schief, schielte, in seinen Blick sichtbar eine gewisse Freundlichkeit legend, empor, schloß dabei die Augen und ließ einen seinen, piependen Pfiff hören.
Bald hatten Pfleger und Pflegling Zutrauen zu einander gewonnen und das unangenehme Verhältnis des »thust du mir nichts, so thu' ich dir auch nichts« war einem ganz gemüthlichen Verkehre gewichen. Nur wenn ihn sein Pfleger erschreckte, flammte sein Auge feurig auf, der Augenring erglänzte blutroth und erschien größer und dicker; er erhob dann auch wohl die Flügel drohend und setzte den Schnabel zu einem weitausholenden Hiebe in Bereitschaft, ließ sich aber durch freundliche Worte sofort beruhigen. Doch sollte auch Girtanner Gelegenheit haben, die gewaltige Kraft seiner verschiedenen Waffen kennen zu lernen. Die Untersuchung und Behandlung des verwundeten Fußes machte es nöthig, ihn von Zeit zu Zeit auf den Rücken zu legen. Dies war ihm jedoch entschieden das widerwärtigste, was ihm angethan werden konnte. Sobald er die hierzu nöthigen Vorkehrungen treffen sah, verwandelte sich seine Gemüthlichkeit in mit Wuth gepaarte Angst, und unser Forscher und sein Gehülfe mußten sich dann gegen seine Krallen und den schrecklichen Schnabel durch ein festes Tuch schützen. Wieder frei gelassen sprang er wüthend auf, breitete die Flügel weit aus, öffnete den Schnabel und hieb, sich um sich selbst drehend, blindlings um sich, beruhigte sich jedoch endlich wieder. Ein anderes Mal gab er einen Beweis seiner Kraft ohne schlimme Absichten dabei zu haben. Girtanner und sein Gehülfe waren damit beschäftigt, einen starken krummen Ast, bestimmt, zu einem zweiten Sitzplätze zu dienen, auf dem Boden zu befestigen, als plötzlich das Knarren seiner Schwingen hörbar wurde und in demselben Augenblicke jeder der beiden Herren einen Stoß von den Flügelbugen erhalten hatte, welcher sie zur Seite warf. Nachdem sich beide lachend vom Schrecke erholt hatten, sahen sie mit Erstaunen den Pflegling genau auf der Stelle jenes Astes sitzen, welche zwischen den Händen frei geblieben war. Nur einmal, und zwar aus Nothwehr, vergriff er sich an seinem Gebieter selbst, als dieser allein seine Wunde untersuchte und eine besonders empfindliche Stelle getroffen haben mochte. Blitzschnell machte er mit einem grellen Pfiffe einen Sprung in die Luft, entfaltete die Schwingen und hieb, sozusagen in der Luft stehend, mit seinen harten Schwungfedern kräftigst von unten ausholend nach dem Gesichte seines Pflegers. »Von Schnabel und Krallen«, sagt Girtanner, »machte er glücklicher Weise keinen Gebrauch und konnte es in seiner Stellung wohl auch nicht; hingegen war meine Persönlichkeit dermaßen in die brausenden Federn, welche mir dabei scharf zwickend um den Kopf sausten, eingehüllt und so verblüfft, daß ich mir wohl denken kann, wie es mir bei der nämlichen Behandlung zu Muthe gewesen wäre, wenn dieselbe anstatt auf ebenem Boden an einer gefährlichen Stelle im Gebirge hart am Abgrunde stattgefunden, wobei sich mein Widersacher bei voller Kraft und freier Bewegung befunden und ihn der Hunger stets zu wiederholten Angriffen vermocht hätte. In jenem Augenblicke sah und hörte ich nichts mehr: ich suchte nur beförderlichst aus dem Wirkungskreise des Wütherichs zu kommen. Von seiner Flügelkraft, dem betäubenden Brausen und blendenden Zwicken der Schwingen bin ich nun genügend überzeugt.«
Da er sich in seinem Gefängnisse einsam fühlen mochte, erfreute ihn das jeweilige Erscheinen seines Pflegers ersichtlich. Sein Gruß bestand regelmäßig in einem feinen Pfiffe. Stand er auf dem Boden, so flog er sofort auf seinen Sitz, um in gleicher Höhe mit seinem Herrn zu sein, spielte mit dem Schnabel an dessen Uhrkette, steckte denselben da und dort in die Kleider, nestelte an seinem Freunde herum und suchte auf alle Weise gute Laune zu bezeugen. In der Hand festgehaltenes Stroh zog er unter fröhlichem Kichern hervor; Strohschnüre zerriß oder zerbiß er vergnüglich, kam auch sofort herbei, sobald er Girtanner Vorkehrungen treffen sah, solche zwischen den Fingern auszuspanneu. Den scheinbar plumpen Schnabel wußte er aufs feinste zu benutzen, nahm beispielsweise erbsengroße Knochensplitterchen oder Markkörner mit Leichtigkeit auf, indem er den Schnabel flach hinlegte, sie zwischen den Spitzen des Ober- und Unterschnabels hielt und sie dann in den Schlund zurückwarf. Das starke Polster seiner Kiste riß er nach allen Richtungen hin auf, zog das Stroh heraus und spielte anhaltend damit.
Hunde fürchtete er ebensowenig als sie sich vor ihm; kamen sie ihm aber näher als er für nöthig hielt, so hieb er auch nach ihnen mit den Flügeln oder holte stehenbleibend mit dem Schnabel aus. Gegen Katzen hingegen benahm er sich ganz so, wie schon Scheitlin geschildert. Girtanner war begierig, dies selbst zu prüfen. »Endlich«, sagt er, »verlief sich ein solcher Mauser in sein Gemach. Rasch schloß ich ab ohne mich zu zeigen. Kaum hatte die Katze ihren Feind bemerkt, welcher übrigens durch das Gitter von ihr getrennt war, als sie laut heulend, wie ich es bei einer Katze in dieser Art und mit diesem Ausdrucke der größten Todesangst nie vernommen habe, halb gelähmt vor Schreck und Furcht im Zimmer umherzuschleichen beginnt. Plötzlich aber wagt sie einen gewaltigen Sprung nach einem in der Höhe angebrachten offenen Fenster und ist, ohne sich nochmals umgesehen zu haben, verschwunden.«
Als der Fuß unserem Bartgeier nicht mehr zu schmerzen schien, zog er Steine als Sitze dem Polster vor. Oft saß er lange Zeit unbeweglich da in halb oder ganz gesenkter, scheinbar sehr unbequemer Stellung mit eingezogenem, zurückgelegtem, aber meist vorgestrecktem Kopfe, welcher dann mit dem Körper und Schwanze eine gerade Linie bildete. Da Girtanner bemerkt hatte, daß er nachts gern im Strohe liege, brachte er ihm eine mit Stroh gefüllte Kiste. Kaum ließ er ihm Zeit, dieselbe niederzusetzen, als er auch schon hereinflog und es sich mit Wohlbehagen darin bequem machte. Fortan ruhte er jede Nacht in ihr, indem er sich ganz auf das Brustbein und die Fersen niedersenkte, den Kopf auf den Rand legte und ebenso den Schwanz frei über denselben hinausstehen ließ. Wollte ihn sein Pfleger in einen anderen Raum bringen, so lief er ihm auf einem Gange auf dem Fuße nach. Rief er ihn sodann wieder, so kam er sogleich eiligen Schrittes und fröhlich piepend daher gelaufen. So zutraulich verkehrte er aber nur, wenn außer seinem Freunde niemand zugegen war. Wasser trank er sehr viel, versuchte auch zu baden, verspritzte jedoch stets eine große Menge Wassers, ohne seinen Zweck zu erreichen, da er sich in dem zugespitzten Gefäße völlig niederlegen wollte. Girtanner übergoß ihn daher von Zeit zu Zeit mit einer Brause, was ihm wohl zu behagen schien; denn er streckte sodann die Flügel weit ausgespannt von sich, ließ sie an der Sonne trocknen, putzte und ordnete das Gefieder und fettete es zuletzt ein. Seine Nahrung bestand in der Hauptsache aus rohem Rindfleische. Ein halbes Pfund davon befriedigte ihn für den Tag. Außerdem erhielt er gelegentlich Kaninchen, Katzen, Meerschweinchen etc. Vögel ließ auch er beharrlich liegen. Lebenden Kaninchen setzte er, mit einem Fuße auf sie tretend, ganz bedächtig den Haken am Kopfe ein, kneipte seine Zange zu: ein Ruck und ein Druck, und das kleine Opfer war todt. Dies ging alles mit der größten Ruhe vor sich, ohne die geringste Gier oder Mordlust. Er begann immer hinter den Ohren zu fressen, schälte hierauf den Körper aus der Haut und verschluckte davon je nach Bedürfnis, ließ aber immer einen Theil übrig. An stark riechendes Fleisch ging er nicht. Knochen waren ihm ebensosehr Bedürfnis als Fleisch, allem aber zog er Knochenmark vor. Beinahe faustgroße Stücke von Röhrenknochen schlang er hinunter, ob er auch dabei zu ersticken drohte, wenn er gesehen hatte, daß die Markhöhlen noch gefüllt waren, wogegen er ebenso große Röhren liegen ließ. Im Hunger füllte er seinen Sack auch mit alten, längst ausgekochten, trockenen Knochen an. Messerscharfe Kanten an demselben, nadelfeine Spitzen und Ecken behelligten ihn nicht im mindesten; einer nach dem anderen wanderte in den Schlund. War der Kropf scheinbar voll, so führte er einige heftige Schlingbewegungen aus, bei denen er den Kopf fast völlig um seine Achse drehte, und man konnte dann deutlich das knarrende Reiben der spitzigen Knochen, welche sich im Vormagen über einander schoben, hören. Kaum aber begriff man, daß die dünnen Wandungen durch sie nicht durchbohrt wurden. Nach einer solchen Hauptmahlzeit saß er ruhig mit stark vorstehendem Vormagen da, Kropf und Hals dem Gewichte des vollen Magens folgen lassend, tief gesenkt, oft mit offenem Schnabel mühsam athmend und lag dem Verdauungsgeschäfte ob. Durch einzelne, von Zeit zu Zeit sich folgende Schlingbewegungen unterstützte er das Nachrücken der hinreichend zersetzten und erweichten Knochen aus dem Vormagen in den Magen. Hatte er des Abends eine Knochenfütterung vorgenommen, so schmeißte er am folgenden Morgen schon halbfeste, graugelbe, ziemlich große Kalkmassen, nach Fleischnahrung dagegen war der Koth flüssig, weiß, mit schwarzer und grüner Gallenbeimengung. Waren viele Haare verschlungen worden, so konnte man dieselben im Kothe der nächsten Knochenmahlzeit wieder vorfinden, nicht verdaut zwar, aber auch nicht zusammengeballt, sondern ringförmig in denselben eingelagert. Ein einziges Mal innerhalb eines halben Jahres und zwar nach einem besonders reichlichen Katzenfraße, warf er einen Gewöllballen aus. Sperrten sich bei hitzigem Fressen spitzige Knochen im Schlunde querüber, so würgte er sie oft unter großen Mühsalen und Schmerzenslauten wieder aus, wobei meist eine ziemliche Menge des ekelhaft riechenden, fast farblosen Magensaftes aus dem Schnabel rann. Geschickter warf er die Stücke sofort wieder herunter, und einige Stunden nachher fühlte sich der Kropf wieder weich und halb leer an. Letzterer wurde durch ein bis anderthalb Pfund Fleisch strotzend gefüllt.
Beinahe acht Monate nach seiner Gefangennahme erkrankte der Vogel, fraß nicht mehr, schmeißte in den nächsten Tagen rein dunkelgrüne Galle, wurde immer schlaffer, seine Laune stets schlechter, das Auge matter, der Augenring blasser, bis er zuletzt gelb- und röthlichgefleckt und gestreift erschien, und war am vierzehnten Tage nach Beginn seiner Krankheit eine Leiche. Die Untersuchung ergab allgemeine Fettsucht als Todesursache.
Eine von Girtanner vorgenommene Vergleichung der von ihm an seinem Pfleglinge und von früheren Beobachtern an anderen gefangenen schweizerischen Bartgeiern gesammelten Erfahrungen ergibt, daß sich junge, in die Gefangenschaft gerathene Geieradler sehr zu ihrem Vortheile von alten unterscheiden. Diese erweisen sich als träge, dumm und trotzig und wollen nie in ein trauliches Verhältnis zu Menschen treten, wogegen die jungen nicht nur viel beweglicher sind, sondern auch weit mehr Fassungsgabe bekunden, sich geistig und körperlich selbständiger zeigen, mit ihren Pflegern in vertraulicheren Verkehr treten und deshalb weit richtigere Einblicke in ihr Betragen in der Freiheit erlauben als die alten. Einer, welchen Baldenstein sieben Monate lang pflegte, benahm sich im wesentlichen ebenso wie der vorhin geschilderte und faßte dieselbe Zuneigung zu seinem Gebieter wie der Girtanners zu diesem. So wußte er sein Bedürfnis nach Bädern aufs deutlichste dadurch anzuzeigen, daß er sich mit den Flügeln schwimmend und mit dem Schwanze hin und herfegend auf dem Boden niederkauerte und alle Bewegungen eines badenden Vogels so deutlich darstellte, daß Baldenstein sofort eine gefüllte Wanne holte, in welche der Vogel ungesäumt sich stürzte und nun alle Bewegungen, welche er vorher im trockenen ausgeführt, jetzt mit dem größten Behagen im Wasser wiederholte, sich im Bade fast völlig untertauchend und gänzlich einnässend. Neckte Baldenstein seinen Vogel zu arg, so machte dieser unschädliche Scheinangriffe auf seinen Gebieter, so innig er diesem sich auch angeschlossen und so bestimmt er auch in ihm seinen Wohlthäter erkannt hatte. Wenn er auf dem Tische stand, war sein Kopf in gleicher Höhe mit dem seines Herrn, und beide hielten Unterredungen mit einander. Der Bartgeier krabbelte seinem Pfleger mit dem Schnabel im Backenbarte herum oder steckte ihn beim Handgelenke in die Aermel und ließ dabei sein gemüthliches »Gich« hören. Baldenstein dagegen konnte ihn streicheln wie er wollte, ohne daß er jemals Mißtrauen zeigte. Fremden gegenüber benahm er sich ganz anders. Ein ebenfalls junger Vogel, welchen Amstein pflegte, flog, als sein Gebieter sich anschickte, ihn abzumalen, und ihn deshalb vor sich hingesetzt hatte, von Zeit zu Zeit auf die Schulter seines Herrn und schmeichelte diesem mit dem Schnabel, da er wohl begriff, daß man etwas mit ihm vorhatte, über dessen Folgen aber nicht klar war. Daß aber auch anscheinend höchst gutmüthige Bartgeier zuweilen sich erzürnen, erfuhr Salis von einem, welcher ein Jahr lang gefangen gehalten und mit einem Taubenhabichte längere Zeit zusammengesperrt war. Als dieser ihm jedoch einst ein Stück Fleisch streitig machen wollte, erglühte sein Auge, die Halsfedern sträubten sich, ein Griff mit der Kralle nach der Brust des Habichts, und derselbe lag in den letzten Zuckungen neben ihm, während der Mörder, als wäre nichts von Bedeutung vorgefallen, weiter fraß.
Der Schaden, welchen der freilebende Bartgeier dem Menschen zufügt, ist gering, läßt sich mindestens mit dem vom Steinadler verursachten nicht vergleichen. Im Süden, wo Aas und Knochen, Schildkröten und andere kleinere Thiere ihn mühelos ernähren, erlaubt er sich nur ausnahmsweise Uebergriffe auf menschliches Besitzthum, und in der Schweiz ist er selbst so selten geworden, daß seine Räubereien hier auch nicht besonders ins Gewicht fallen. Von einem erheblichen Nutzen, welchen er stiften könnte, ist freilich ebensowenig zu reden, es sei denn, daß man der Tuaregs gedenken wollte, welche diesen, bei ihnen gemeinen Vogel seines Fleisches und Fettes wegen erlegen, um ersteres zu verspeisen und letzteres als Mittel gegen den Biß giftiger Schlangen zu verwenden. Da, wo der Bartgeier häufig auftritt, führt er ein ziemlich unbehelligtes Leben. Man verfolgt ihn nicht, wenigstens nur, um der Jagdlust Genüge zu thun, nicht aber aus Gründen der Nothwehr. Demungeachtet bleibt der Mensch der schlimmste Feind des Vogels; denn er schädigt ihn, wenn nicht unmittelbar, so doch mittelbar durch weiter und weiter umsichgreifende Besitznahme derjenigen Gebiete, in denen er vormals ungehindert herrschte oder noch heutigen Tages ein freies Leben führt. Zwar wird auch er von niederen Raubvögeln, namentlich Habichtsadlern, kleinen Falken, und ebenso von Krähen vielfach geneckt und geplagt, nicht minder von allerlei Schmarotzern gequält; alle diese Feinde zusammengenommen aber sind nicht im Stande, sein Leben zu verbittern. Der Herr der Erde allein ist es, welcher ihn weiter und weiter zurückdrängt und aus einzelnen Theilen seines Verbreitungsgebietes gänzlich vertreibt. Ueber die Jagd selbst wie den Fang ist wenig zu berichten. Wen der Zufall nicht begünstigt, wem nicht ein Horst die Jagd erleichtert, darf sich nicht verdrießen lassen, in der Nähe eines Aases tagelang zu lauern, wie wir es, jedoch vergeblich, in Spanien gethan haben, oder aber wochenlang nach einander an gewissen Gebirgszügen sich aufzustellen, in der Hoffnung, einen vorüberstreichenden Geieradler zu erlegen. Eher noch führt ein geschickt aufgestelltes Fuchseisen zum Ziele; doch muß dasselbe wohl befestigt werden, damit es der Vogel nicht losreißt und wegschleppt. Gefahr bringt die Jagd in keiner Weise. Auch verwundete Bartgeier denken nicht daran, sich dem Menschen gegenüber zur Wehre zu setzen, wie dies die Gänsegeier regelmäßig thun. Nach meinen eigenen Erfahrungen sträuben sie die Nackenfedern und sperren den Schnabel möglichst weit auf, versuchen mit diesem allerdings auch ihren Gegner zu packen, sind aber leicht gebändigt. Ihre Lebenszähigkeit ist sehr groß; nur ein gut angebrachter Schuß tödtet sie augenblicklich. Ich schoß einem fliegenden eine Kugel durch den Leib, welche das Zwerchfell und die ganze Leber zerrissen und neben den Lendenwirbeln ihren Ausgang gefunden hatte. Der Vogel stürzte zwar sofort zum Boden hernieder, lebte aber noch volle sechsunddreißig Stunden, bevor er an Eitervergiftung starb.
Die Altweltsgeier ( Vulturinae), welche eine zweite Unterfamilie, nach anderer Auffassung eine besondere Familie, bilden, sind plumper gebaut als die Geieradler und die plumpesten aller Raubvögel überhaupt. Ihr Leib ist kurz und kräftig, ungemein breit auf der Brust, der Flügel lang, breit und abgerundet, die vierte Schwinge in ihm die längste, der Schwanz mittellang und etwas abgerundet, die einzelne Feder steif, an der Spitze regelmäßig abgeschliffen, der Fuß mittelhoch und stark, von der Ferse ab unbefiedert, der Fang langzehig und kräftig, nicht aber greiffähig, mit flachgebogenen stumpfen Nägeln bewehrt, der Schnabel etwa von Kopfeslänge, stark, gerade, an der Spitze sehr gekrümmt, höher als breit, der Haken mittellang und ziemlich scharf, der Schneidenrand seicht ausgebuchtet. Das Gefieder besteht aus sehr großen, langen und breiten Federn. Ein Theil des Kopfes und Halses bleibt regelmäßig unbefiedert, ist dafür aber mit haarartigen Dunen mehr oder minder spärlich bedeckt oder auch vollständig nackt. Ausnahmsweise bekleiden dunige Federn, dann aber in dichter Fülle, auch die Schenkel, die Waden und den Unterleib; auf letzterem werden sie in solchem Falle durch lange und schmale Oberfedern spärlich überdeckt. Düstere und unbestimmte Farben sind vorherrschend, doch fehlt es auch nicht an lebhaften, und außerdem sind die dünn befiederten oder nackten Hautstellen oft sehr grell gefärbt. Die Augen sind groß und ausdrucksvoll, die Nasenlöcher verschieden gestaltet. Unter den Sinnen steht das Gesicht ausnahmslos obenan; nächstdem sind Gehör und Geruch besonders entwickelt.
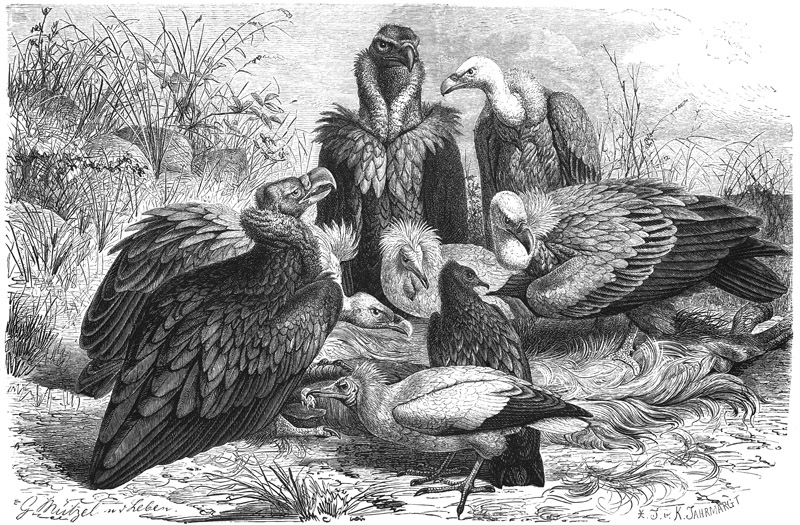
Kuttengeier. Schmutzgeier. Gänsegeier.
Südeuropäische Geier.
Unter allen Mitgliedern der Gruppe hat kein einziger eine so große Berühmtheit erlangt wie der Schmutzgeier, der seit uralter Zeit bekannte und beschriebene Koth- oder Maltesergeier, der Racham, Alimosch, die »Henne der Pharaonen«, und wie er sonst noch benamset worden sein mag ( Neophron percnopterus und ginginianus, Vultur percnopterus, albus, meleagris, ginginianus und stercorarius, Percnopterus aegyptiacus). Er ist es, dessen Bildnis die altegyptischen Bauwerke zeigen, welcher von den alten Egyptern und den Hebräern als Sinnbild der Elternliebe gefeiert wurde und heutigen Tages noch wenigstens keine Mißachtung auf sich gezogen hat. Er unterscheidet sich von allen bekannten Arten seiner Familie durch seine rabenähnliche Gestalt, die langen, ziemlich spitzen Schwingen, den langen, abgestuften Schwanz und die Art und Weise der Befiederung. Der Schnabel ist sehr in die Länge gestreckt, die Wachshaut über mehr als die Hälfte desselben ausgedehnt, der Haken des Oberschnabels lang herabgekrümmt, aber zart und unkräftig, der Fuß schwach, die Mittelzehe fast ebenso lang als der Lauf, der Fang mit mittellangen, schwach gebogenen Nägeln bewehrt. Im Fittige überragt die dritte Schwinge alle übrigen; die zweite ist länger als die vierte, die sechste länger als die erste. Im Schwanze sind die seitlichen Federn nur zwei Drittel so lang als die äußeren. Das reiche Gefieder besteht aus großen und langen Federn, welche sich im Nacken und am Hinterhalse noch mehr verlängern, zugleich auch verschmälern und zuspitzen. Gesicht und Kopf bleiben unbefiedert. Ein schmutziges Weiß, welches in der Hals- und Oberbrustgegend mehr oder weniger in das Dunkelgelbe spielt, auf Rücken und Bauch aber reiner wird, herrscht vor; die Handschwingen sind schwarz, die Schulterfedern graulich. Der Augenstern ist rothbraun oder licht erzgelb, der Schnabel an der Spitze hornblau, im übrigen wie die nackten Kopftheile und der Kropfflecken lebhaft orangegelb, die Kehlhaut etwas lichter als der Unterschnabelrand. Bei jungen Vögeln sind Schultern und Oberflügeldeckfedern, ein Streifen über die Mitte der Unterbrust und des Bauches, Krause, Bürzel, Steiß und Steuerfederenden stahlgrau, Hinter- und Vorderhals, Brust, Bauchseiten und Schwingen aber schwarzbraun, die Federn der Schenkel grau und schwarz gescheckt, die wolligen der Krause grau, die des Seitenhalses braun geschäftet und gespitzt, die Steuerfedern gänsegrau, Gesicht, Wachshaut und Kopf aschgrau. Das Auge ist dunkelbraun, der Schnabel schwarz, der Fuß lichtgrau wie bei den Alten. Die Länge des Weibchens beträgt siebzig, die Breite einhundertundsechzig, die Fittiglänge funfzig, die Schwanzlänge sechsundzwanzig Centimeter. Männchen habe ich zufällig nicht gemessen.
Der Schmutzgeier wird unter den deutschen Vögeln mit aufgezählt, weil er einige Male in unserem Vaterlande erlegt worden ist. Häufiger kommt er in der Schweiz vor, wie schon der alte Geßner angibt; in der Nähe von Genf hat sogar ein Paar gehorstet. Weiter nach Süden hin tritt er in namhafterer Menge auf. Im Süden von Frankreich ist er zwar noch nicht ansässig, als Besuchsvogel aber doch nicht allzu selten, in Italien auf das Vorgebirge Argentaro und die Nähe von Nizza beschränkt, auffallenderweise aber in Sardinien, dem bevorzugten Wohngebiete anderer Geier, nicht seßhaft, in Spanien ein überall vorkommender, wenn auch nicht gerade häufiger Vogel, in Griechenland und auf der Balkanhalbinsel überhaupt allgemein verbreitet. Hier erscheint er, laut Krüper, mehr oder weniger regelmäßig an den ersten Frühlingstagen, weshalb die Hirten den Beginn des Frühlings von seiner Ankunft an zu berechnen pflegen, ebenso wie sie ihn das »Pferd des Kukuks« nennen, weil sie glauben, daß der letztere auf seinem Rücken die Winterreise zurücklegen soll. Ausnahmsweise läßt sich einer bereits am zwölften März im Lande sehen, und ebenso kann es vorkommen, daß man sie erst zu Ende des Monats oder selbst im Anfange des April bemerkt. Von dieser Zeit an verweilt er im Lande bis zum September oder Oktober, um seine Winterreise anzutreten. Auf den Kykladen bleibt der eine oder andere während des Winters wohnen, und ebenso ist es in Spanien, woselbst wir unseren Geier noch im November und December in Andalusien und im Januar in der Umgegend von Toledo beobachteten. Die Krim und Südrußland, woselbst er ebenfalls horstet, pflegt er im Winter zu verlassen; in Afrika, vielleicht mit alleiniger Ausnahme der westlichen Küstenländer, und einem großen Theile West- und Südasiens dagegen ist er entschiedener Standvogel. Von Mittelegypten an südlich wird er häufig, in Nubien ist er einer der gemeinsten Raubvögel. Dasselbe gilt für Mittel- und Südafrika, jedoch unter Maßgabe, daß der Schmutzgeier als entschiedener Freund morgenländischen Getriebes betrachtet werden muß. So häufig er sich allerorten findet, wo der Morgenländer im weitesten Sinne des Wortes sich angesiedelt hat, so einzeln tritt er in anderen Gegenden auf. Er bewohnt in der That ganz Afrika, von der Nordgrenze an bis zum äußersten Süden, vielleicht mit alleiniger Ausnahme der Küstengebiete des Westens, woselbst er bisher nur auf den Inseln des Grünen Vorgebirges beobachtet wurde, ist jedoch nicht allein in den Küstenländern des Rothen Meeres, sondern auch im tieferen Inneren oder überall da, wo der Neger lebt, eine seltene Erscheinung und meidet größere Waldungen, welche sein Vetter, der Kappengeier, besucht, fast gänzlich. In West- und Südasien haust er in Kleinasien, Syrien, Palästina, Arabien, Persien, Nepal, Afghanistan, den Himalayaländern, in Nord- und Mittelindien, fehlt dagegen im Süden des Landes und ebenso weiter nach Osten hin, insbesondere in China, durchaus.
Das schmutzige Handwerk, welches dieser Geier betreibt, hat Vorurtheile erzeugt, welche selbst von unseren tüchtigsten Naturforschern getheilt werden. »Es möchte schwerlich einen Vogel geben«, sagt Naumann, »dessen widerliches Aeußere seinen Sitten und seiner Lebensweise so vollkommen entspräche als diesen. Das kahle Gesicht des kleinen Kopfes, der vorstehende nackte Kropf, die lockere Halsbefiederung, das stets beschmutzte und abgeriebene Gewand nebst den groben Füßen sind nicht geeignet, einen vortheilhaften Eindruck auf den Beschauer zu machen. Dazu kommt noch, daß dem lebenden Vogel häufig eine häßliche Feuchtigkeit aus der Nase trieft, der Geier überhaupt einen Geruch, ähnlich dem unserer Raben ausdünstet, welcher so stark ist, daß ihn selbst der todte Balg nach Jahren und in einem fast zerstörten Zustande nicht verliert. Er ist ein trauriger und träger Vogel.« Ich bin fest überzeugt, daß Naumann anders geurtheilt haben würde, hätte er den Schmutzgeier so oft wie ich lebend gesehen. Das Handwerk, welches der Vogel betreibt, ist widerlich, nicht er selbst. Es ist durchaus nicht meine Absicht, ihn zu einem schönen und anmuthigen oder liebenswürdigen Vogel stempeln zu wollen: eine angenehme Erscheinung aber ist er gewiß. Mir wenigstens hat er immer weit besser gefallen als die großen Arten seiner Zunft.
Der Schmutzgeier ist nur in Südeuropa scheu und vorsichtig. In ganz Afrika vertraut er dem Menschen, vorausgesetzt, daß er von der Mordsucht des Europäers noch nicht zu leiden gehabt hat. Er ist nichts weniger als ein dummer Vogel; denn er unterscheidet sehr genau zwischen dem, was ihm frommt, und dem, was ihm schadet, weiß sich auch, oft unter recht schwierigen Umständen, mit einer gewissen List sein tägliches Brod zu erwerben. Träge kann man ihn ebenfalls nicht nennen; er ist im Gegentheile sehr viel in Bewegung und gebraucht seine Schwingen oft stundenlang nur des Spieles halber. Hat er sich freilich satt gefressen, so sitzt auch er lange Zeit auf einer und derselben Stelle. Im Gehen ähnelt er unserem Kolkraben; im Fliegen erinnert er einigermaßen an unseren Storch, aber auch wieder an den Geieradler, nur daß er weit langsamer und minder zierlich fliegt als dieser. Er verläßt mit einem Sprunge den Boden, fördert sich durch einige langsame Flügelschläge und streicht dann rasch ohne Flügelbewegung dahin. Ist das Wetter schön, so erhebt er sich mehr und mehr, zuweilen, der Schätzung nach, bis in Luftschichten von tausend bis zwölfhundert Meter Höhe über dem Boden. Zu seinen Ruhesitzen wählt er sich, wenn er es haben kann, Felsen; die Bäume meidet er so lange als möglich, und in großen Waldungen fehlt er gänzlich. Ebenso häufig als auf Felsen, sieht man ihn auf alten Gebäuden fußen, in Nordafrika, Indien und Arabien auf Tempeln, Moscheen, Grabmälern und Häusern. Mit seinen Familienverwandten theilt er Geselligkeit. Einzeln sieht man ihn höchst selten, paarweise schon öfter, am häufigsten aber in größeren oder kleineren Gesellschaften. Er vereinigt sich, weil sein Handwerk es mit sich bringt, mit anderen Geiern, aber doch immer nur auf kurze Zeit; sobald die gemeinsame Tafel aufgehoben ist, bekümmert er sich um seine Verwandten nicht mehr. Im Bewußtsein seiner Schwäche ist er friedlich und verträglich, wenn auch nicht ganz so, wie der alte Geßner sagt, welcher behauptet, daß er »gantz forchtsam und verzagt« sei, also »daß er von den Rappen vnd anderen dergleichen Vögeln geschlagen, gejagt vnd gefangen wirt, dieweil er schwer vnd faul zu der Arbeit ist«. In Südegypten und Südnubien bemerkt man zahlreiche Flüge von ihm, welche sich stundenlang durch prächtige Flugübungen Vergnügen, gemeinschaftlich ihre Schlafplätze aussuchen und auf Nahrung ausgehen, ohne daß man jemals Zank und Streit unter ihnen wahrnimmt. In Gesellschaft der großen Geier sitzt er entsagend zur Seite und schaut anscheinend ängstlich deren wüstem Treiben zu.
Der Schmutzgeier ist kein Kostverächter. Er verzehrt alles, was genießbar ist. Man nimmt gewöhnlich, aber mit Unrecht, an, daß Aas auch für ihn die Hauptspeise sei: der Schmutzgeier ist weit genügsamer. Allerdings erscheint er auf jedem Aase und versucht, soweit seine schwachen Kräfte erlauben, sich zu nähren, pickt die Augen heraus, öffnet am After eine Höhle und bemüht sich, die Eingeweide herauszuzerren, oder wartet, bis die großen Geier sich gesättigt haben, und nagt dann die Knochen ab, welche sie übrig ließen: aber ein derartiger Schmaus gehört doch zu seinen Festgerichten. Größere Ströme oder die Küste des Meeres bieten ihm schon mehr, sei es, daß sie ein Aas oder wenigstens todte Fische an den Strand schwemmen, ihn mindestens zu allerlei niederem Seegethier verhelfen. Endlich liefert ihm auch allerlei Kleingethier dann und wann eine Mahlzeit. Räuberisch überfällt er Ratten, Mäuse, kleine Vögel, Eidechsen und andere Kriechthiere; diebisch plündert er Nester mit Eiern, und geschickt fängt auch er Heuschrecken auf Wiesen und Triften. Mein Bruder beobachtete von einem gefangenen Schmutzgeier, daß er augenblicklich auf seine gezähmten Vögel losging und sie eifrigst verfolgte. Einen Fettammer, welchen er glücklich erlangte, tödtete er mit einem einzigen Schnabelhiebe, hielt ihn fest und verzehrte ihn auf der Stelle. Don Lorenzo Maurel erzählte Bolle, er könne nur mit Schwierigkeit Pfauen erziehen, weil die Schmutzgeier deren frisch gelegte Eier auf das schamloseste wegholten, ja den Hennen zu diesem Behufe auf Tritt und Schritt nachschlichen. Allein weder seine Räubereien noch seine Diebereien können für seine Ernährung besonders ins Gewicht fallen. Zum Glück für ihn weiß er sich anders zu behelfen. In ganz Afrika, ja in Südspanien schon bildet Menschenkoth seine hauptsächlichste Nahrung. Fast die ganze Bevölkerung ist gezwungen, zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse gewisse Plätze aufzusuchen, welche für Wiedehopf und Schmutzgeier gleich ergiebig werden. Hier nun findet sich der letztere ein, unbekümmert um das Treiben der Menschen, welche in seiner baldmöglichst beginnenden Thätigkeit zwar etwas überaus verächtliches, in dem Vogel selbst aber doch einen Wohlthäter sehen. Daß es in Indien nicht anders ist, haben wir durch Jerdon erfahren. In der Nähe größerer Ortschaften Afrikas ist er ein regelmäßiger Gast bei den Schlachtplätzen, welche außerhalb der Städte zu liegen pflegen. Hier sitzt er dicht neben dem Schlachter und lauert auf Fleisch und Hautfetzen oder auf die Eingeweide mitsammt deren Inhalt, welche sein Brodgeber ihm zuwirft. Im Nothfalle klaubt er blutgetränkte Erde auf. Daß dabei zuweilen auch ein Gegenstand mit unterläuft, welcher eigentlich nicht genießbar ist, ein alter, mit Blut besudelter Lappen zum Beispiel, oder etwas ähnliches, ist gewiß begründet. Den europäischen Beobachter fesselt besonders, wahrzunehmen, wie richtig er den Menschen beurtheilt, wie genau er ihn kennt. Eines gewissen Schutzes oder, richtiger gesagt, gleichgültiger Duldung gewiß, treibt er sich unmittelbar vor den Hausthüren herum und geht seiner Nahrung mit derselben Ruhe nach wie Hausgeflügel oder mindestens wie eine unserer Krähenarten. Ich habe beobachtet, daß er, wenn wir im Zelte Vögel abbalgten, bis zu den Zeltpflöcken sich heranschlich, uns aufmerksam zusah und unter unseren Augen die Fleischstücke auffraß oder die Knochen benagte, welche wir ihm zuwarfen. Bei meinen Wüstenreisen habe ich ihn wirklich lieb gewonnen. Er ist es, welcher der Karavane tagelang das Geleite gibt; er ist nebst den Wüstenraben der erste Vogel, welcher sich am Lagerplatze einfindet und der letzte des Reisezuges, welcher ihn verläßt.
Ueber das Brutgeschäft sind erst in der Neuzeit sichere Beobachtungen angestellt worden. Krüper hat in Griechenland mehrere Horste bestiegen und gibt an, daß mehrere Paare selten in großer Nähe neben einander, wohl aber zuweilen in einer und derselben Gebirgswand brüten; Bolle hingegen beobachtete, daß fünf bis sechs Horste dicht neben einander in den zerklüfteten Wänden eines tiefen Thales standen. »Sie lieben es«, sagt er, »nachbarlich neben einander zu horsten. Wo eine steile Felswand ihnen bequeme Nistplätze darbietet, da siedeln sie sich an, ohne auf die größere oder geringere Wärme der Oertlichkeit besonders Rücksicht zu nehmen. Die Masse des neben und unter den Nestern sich anhäufenden Kothes macht, daß dieselben weithin sichtbar werden und dem Beobachter mit Leichtigkeit ins Auge fallen. Die Geier scheinen ihre Sicherheit durchaus nicht durch eine versteckte Lage begünstigen zu wollen, sondern sich einzig und allein auf die Unzugänglichkeit der Orte, welche sie wählen, zu verlassen.« In Spanien tritt der Vogel so einzeln auf, daß ein gesellschaftliches Brüten kaum möglich ist; in Egypten sieht man die Horste an den steilen Wänden der Kalkfelsen zu beiden Seiten des Niles, und zwar, wenn die Oertlichkeit es erlaubt, oft mehrere neben einander, regelmäßig aber an Stellen, zu denen man nur dann gelangen kann, wenn man sich an einem Seile von oben herabläßt. Das habe ich nicht gethan. Heuglin, welcher auch die Pyramiden als Standort der Nester angibt und letztere untersucht zu haben scheint, bemerkt, daß sie von dem Vogel selbst gebaut werden, ziemlich groß und dicht sind und aus dürren Reisern und Durahstengeln bestehen, wogegen Hartmann sagt, daß der große Horst aus Gras und Lumpen erbaut werde. Auch in Indien brütet der Schmutzgeier auf Felsen und Klippen, ebenso aber in großen Gebäuden, Pagoden, Moscheen, Gräbern, gelegentlich sogar auf Bäumen, baut hier wie da den Horst aus Zweigen und mancherlei Abfällen und kleidet die Mulde oft mit alten Lumpen aus. Ein besonders beliebter Brutplatz scheint, laut Alléon, die Stadt Konstantinopel zu sein, jedoch nur der von den Türken bewohnte Theil Stambuls und nicht das Fremdenviertel Pera. Dort nistet der Vogel ebenso auf den Cypressen wie auf den Moscheen, und zwar in so bedeutender Menge, daß der genannte die Anzahl der alljährlich ausfliegenden Jungen auf tausend Stück anschlägt. In Egypten fällt die Brutzeit in die Monate Februar bis April, in Griechenland, nach Krüper, etwa in die Mitte des letztgenannten Monates. Doch erhielt Krüper auch zu Ende April und im Anfänge des Mai noch frische Eier. Das Gelege enthält gewöhnlich zwei Eier; dreimal fand jedoch Krüper nur ein einziges. Die Eier sind länglich, hinsichtlich des Korns und der Färbung sehr verschieden, gewöhnlich auf gilblichweißem Grunde entweder lehmfarben oder rostbraun gefleckt und gemarmelt, einzelne auch wie mit blutschwarzen größeren Flecken und Streifen überschmiert. Diese Flecke stehen zuweilen am dickeren, zuweilen am spitzeren Ende dichter zusammen. Wie lange die Brutzeit währt, ist noch nicht ermittelt; auch weiß man nicht, ob beide Geschlechter an der Bebrütung theilnehmen, obwohl sich dies erwarten läßt. Das Weibchen sitzt sehr fest auf den Eiern und verläßt sie erst, wenn der störende Mensch unmittelbar vor dem Horste angelangt ist. Die Jungen, welche anfänglich mit grauweißlichem Flaume bekleidet sind, werden aus dem Kropfe geatzt, sitzen lange Zeit am Horste und verweilen auch dann noch Monate in Gesellschaft ihrer Alten.
Jung eingefangene Schmutzgeier werden sehr zahm, folgen zuletzt ihrem Pfleger wie ein Hund auf dem Fuße nach und begrüßen ihn mit Freudengeschrei, sobald er sich zeigt. Auch alt gefangene gewöhnen sich bald ein und ertragen den Verlust ihrer Freiheit viele Jahre.
In Mittel- und Westafrika gesellt sich dem Schmutzgeier ein naher Verwandter ( Neophron pileatus, monachus und carunculatus, Vultur pileatus, Cathartes monachus, Percnopterus niger), welchen wir Kappengeier nennen wollen. Er unterscheidet sich von jenem durch etwas kürzeren Schnabel, breitere Flügel, kürzeren, gerade abgestutzten Schwanz, wollige Befiederung der Hinterhals- und Nackentheile und geringere Ausdehnung der unbefiederten Stellen, da nur der Scheitel, die Wangen und der Vorderhals nackt sind. Ein sehr gleichmäßiges Dunkelerdbraun ist die vorherrschende Färbung des Gefieders; die weichen, sammetigen Federn des Hinterkopfes und Halses sind graulichbraun, die kurzen, welche den Kropf bekleiden, schmutzig weiß, die der Innenschenkel reiner weiß, die Handschwingen braunschwarz, die Steuerfedern schwarzbraun. Die Iris ist braun, der Schnabel hornblau, an der Spitze dunkler, die Wachshaut lebhaft violett, der nackte Kopf bläulichroth, an der Kehle etwas lichter, der Fuß licht bleigrau. Den jungen Vogel unterscheiden der dunkelbraune Hinterhals, die minder deutlichen Ohröffnungen, die glatte, nicht warzige und weniger lebhaft gefärbte Halshaut. Die Länge beträgt dreiundsechzig bis achtundsechzig, die Breite einhundertsiebenundfunfzig bis einhundertneunundsechzig, die Fittiglänge fünfundvierzig bis funfzig, die Schwanzlänge dreiundzwanzig bis fünfundzwanzig Centimeter; erstere Maße gelten für das Männchen, letztere für das Weibchen.

Kappengeier (Neophron pilcatus). ¼ natürl. Größe.
In Mittel- und Südafrika hat man den Kappengeier ziemlich allerorten, in Nordafrika dagegen ebensowenig wie in Asien und Europa gefunden. In Westafrika ist er, soviel bis jetzt bekannt, der einzige Geier, welcher das Küstengebiet belebt, in Habesch häufiger als alle dort lebenden Verwandten, wenigstens viel häufiger als der Schmutzgeier. In Massaua sitzt er auf den Dächern der Häuser; in den abessinischen Küstendörfern erscheint er morgens in der Nähe der Wohnungen, verweilt hier den ganzen Tag und fliegt erst mit Sonnenuntergang seinem Schlafplatze zu. Tiefer im Inneren ersetzt er den Schmutzgeier, welcher die Wildnis flieht und sich am behaglichsten in unmittelbarer Nähe des Morgenländers zu fühlen scheint, wogegen jener auch fern von dem Menschen den Kampf um das Dasein besteht. Man kann ihn ein halbes Hausthier nennen. Er ist mindestens ebenso dreist wie unsere Nebelkrähe, ja beinahe so wie unser Sperling. Ungescheut läuft er vor der Hansthüre auf und nieder, macht sich in unmittelbarer Nähe der Küche zu schaffen und fliegt, wenn er ausruhen will, höchstens auf die Spitze eines der nächsten Bäume. Am Morgen harrt auch er vor den Hütten der sich entleerenden Menschen, schaut sachkundigen Auges der hierbei zu entfaltenden, für beide Theile ersprießlichen Thätigkeit zu und ist sofort bei der Hand, um die verunreinigte Stelle wieder zu säubern. Auf jedem Schlachtplatze ist er ein ständiger Gast; niemals aber nimmt er etwas weg, was ihm nicht zukommt, niemals erhebt er ein Küchlein oder ein anderes lebendes, kleines Hausthier: seine Hauptnahrung besteht in den Abfällen der Küche und des menschlichen Leibes. Manchmal frißt er wochenlang nur Menschenkoth, füttert damit auch seine Jungen auf. Beim Aase erscheint er ebenfalls und benimmt sich hier genau ebenso wie fein Gesippe. Abweichend von seinen großen Verwandten verläßt er seinen Schlafplatz mit der Sonne und fliegt ihm erst mit einbrechender Nacht wieder zu. Für die Nachtruhe wählt er sich immer solche Bäume, welche möglichst weit von allem menschlichen Treiben entfernt stehen. Bei Massaua schläft er entweder auf einzelstehenden Mimosen in einsamen Thälern der Samchara oder auf dem dichten Schoragebüsche der Inseln. Ueber solchen Schlafplätzen führt er erst einen kurzen Flugreigen aus, fällt sodann mit zusammengelegten Flügeln nach unten und setzt sich in Gesellschaft von anderen auf den gewohnten Baum.
In seiner Haltung ist der Kappengeier ein sehr schmucker Vogel und ein echter Geier. Selbst wenn er fliegt, hält es manchmal schwer, ihn von den übrigen großen Verwandten zu unterscheiden, wogegen sein Vetter, der Schmutzgeier, sich schon von weitem durch seine spitzigen Flügel und den keilförmigen Schwanz auszeichnet. Die lebhaft gefärbte Kopf- und Kehlhaut verleiht jenem noch einen besonderen Schmuck; denn während des Lebens zeigen die nackten Theile alle die Farbenschattirungen, welche wir an der Kollerhaut des Truthahnes beobachten können.
Auch er liebt die Gesellschaft von seinesgleichen mehr, als die anderer Geier; so streng aber, wie Heuglin angibt, meidet er die Genossenschaft mit dem ihm in vieler Hinsicht verwandten Schmutzgeier doch nicht; man sieht ihn vielmehr auch nach der Mahlzeit oft mit diesem verkehren.
In den ersten Monaten unseres Jahres verläßt er die Ortschaften und wendet sich geeigneten Wäldern zu, um hier zu horsten. In einem hochstämmigen Mimosenwalde am Blauen Flusse fand ich im Januar eine förmliche Ansiedelung dieser Vögel. Die Horste standen hier auf hohen Mimosen, theils in Gabel-, theils auf stärkeren Aesten am Stamme. Eine weit zahlreichere Ansiedelung befindet sich in der Nähe von Massaua in der kleinen mit Schora- und Gondelbäumen, Avicennien und Rizophoren bestandenen Insel des Scheich Saïd. Hier sahen wir, und ebenso nach uns Heuglin und Antinori, weite Strecken des dichten Gebüsches förmlich bedeckt mit den Horsten, welche in einer Höhe von einem bis sechs Meter über der Flugmarke je nach der Oertlichkeit einzeln oder in größerer Anzahl neben einander stehen und zum Theil auch den Schmarotzermilanen und zwei verschiedenen Reiherarten zu ihrem Brutgeschäfte dienen. Alle von mir untersuchten Horste waren verhältnismäßig klein, kaum sechzig Centimeter im Durchmesser, flach, fest zusammengefügt und bestanden aus dickeren und dünneren, zur Auskleidung der Nestmulde sorgfältiger gewählten Reisern. Die Nestmulden waren so klein, daß höchstens ein Junges Platz hatte. Ich habe wohl zwanzig Horste erstiegen und ersteigen lassen und in allen nur ein einziges Ei gefunden. Dasselbe ist rundlich, grobkörnig und grauweiß von Farbe, am dicken Ende stark lehmroth besprengt; doch gibt es viele Abweichungen. Beide Geschlechter brüten, die Männchen, wie es scheint, in den Mittagstunden, zu welcher Zeit wir mehrere von ihnen beim Abstreichen vom Horste erlegten. Beim Zerstören des einen Horstes fand ich zwischen den unteren Reisern unzählbare Scharen von Schaben und Wanzen und ganz zu unterst, zwischen den stärkeren Reisern, eine Schlafmaus, welche hier Herberge genommen hatte. An der südlichen Küste des Rothen Meeres traf ich im April in jedem Horste einen halberwachsenen jungen Vogel an. Die Brutzeit scheint demnach lange zu währen; die Jungen können also nur langsam wachsen. Heuglin theilt mit, daß sie den Horst verlassen, ehe sie eigentlich fliegen können, und sich dann einige Zeit lang am Meeresstrande herumtreiben, von Ratten, ausgeworfenen Krabben, Fischen etc. sich nährend.
Der Kappengeier wird ebenso wenig verfolgt wie seine übrigen Verwandten. Seine Jagd verursacht keine Schwierigkeiten; denn da, wo er vorkommt, vertraut er dem Menschen. Auch der Fang ist einfach genug. Ich habe einen dieser Vögel längere Zeit lebend besessen und mich wirklich mit ihm befreundet. Abgesehen von seiner natürlichen Hinneigung zu unreinlichen Stoffen, war er ein schmucker und netter Gesell, welcher mich bald kennen lernte und bei meinem Erscheinen stets lebhafte Freude an den Tag legte. Er entflog mir zu meinem Leidwesen in Egypten. Neuerdings sieht man den Kappengeier auch in diesem oder jenem Thiergarten, immer aber selten und einzeln.
Die Gänsegeier (Gyps) kennzeichnen sich durch gestreckten, schlanken, verhältnismäßig schwachen Schnabel und niedrige Füße, vor allem aber durch ihren langen, gänseartigen Hals von gleichmäßiger Stärke, welcher ohne Absatz an den länglichen Kopf sich anschließt und spärlich mit weißlichen, flaumartigen Borsten bedeckt ist. Bei jungen Vögeln sind alle Federn, namentlich die der Halskrause, lang, junge Gänsegeier also an ihrer langen und flatternden, alte hingegen an ihrer kurzen, zerschlissenen und haarartigen Krause mit untrüglicher Sicherheit zu erkennen. Auch hinsichtlich der Färbung findet eine mehr oder minder erhebliche Umänderung des Gefieders statt, wiederum besonders an den Federn der Krause, welche bei jungen Vögeln regelmäßig dunkel fahlbraun, bei alten aber ebenso regelmäßig weiß oder gilblichweiß gefärbt sind.
Der Gänsegeier, Fahl-, Alpen-, Aas-, Erd- und Weißkopfgeier, Mönchsadler ( Gyps fulvus und vulgaris, Vultur fulvus, leucocephalus, albicollis, orientalis und occidentalis) erreicht eine Länge von 1,12, eine Breite von 2,56 Meter bei 68 Centimeter Fittig- und 30 Centimeter Schwanzlänge. Das Gefieder ist sehr gleichmäßig licht fahlbraun, auf der Unterseite dunkler als auf der Oberseite, jede einzelne Feder lichter geschäftet. Die breiten, weiß gesäumten großen Flügeldeckfedern bilden eine lichte Binde auf der Oberseite; die Schwingen erster Ordnung und die Steuerfedern sind schwarz, die Schwingen zweiter Ordnung graubraun, auf der Außenfahne breit fahl gerandet. Das Auge ist lichtbraun, die Wachshaut dunkel bleigrau, der Schnabel rostfarben, der Fuß licht bräunlichgrau. Bei jungen Vögeln treten die Schaftstriche mehr hervor, und das ganze Gefieder ist dunkler; die langen, schmalen Federn der Halskrause sind ebenfalls braun, nicht kurz, nicht zerschlissen, nicht weiß.
Der Gänsegeier ist häufig in Siebenbürgen, Südungarn und auf der ganzen Balkanhalbinsel, in Ost-, Süd- und Mittelspanien, auf Sardinien und Sicilien, kommt dagegen auf der Italienischen Halbinsel sehr selten und immer nur zufällig vor, verbreitet sich andererseits mehr und mehr in Krain, Kärnten und dem Salzkammergute, allmählich die Stelle des Geieradlers einnehmend, und verfliegt sich nicht allzuselten nach Deutschland. Als nördlichster Brutplatz dürften die Salzburger Alpen zu betrachten sein. Noch häufiger als in Siebenbürgen lebt er in ganz Egypten und Nordnubien, in Tunis, Algier und Marokko, und ebenso kommt er in Nordwestasien bis zum Himalaya vor.

Sperbergeier ( Gyps Rüppellii). 1/5 natürl. Größe.
In Mittelafrika ersetzt ihn der Sperbergeier ( Gyps Rüpellii, Kolbii und magnificus), wohl das schönste Mitglied der Sippe und deshalb einer kurzen Beschreibung werth. Nach eigenen Messungen beträgt die Länge 1, die Breite 2,25 Meter, die Fittiglänge 63, die Schwanzlänge 25 Centimeter. Beim alten Vogel sind mit Ausnahme der Schwingen und Schwanzfedern, alle Federn dunkel graubraun, geziert mit einem schmutzigweißen, halbmondförmigen, mehr oder minder breiten Saume am Ende, wodurch das Kleid buntscheckig wird. Die durchschimmernde nackte Haut des spärlich bekleideten Halses ist graublau, vorn und an den Seiten des Unterhalses ins Fleischrothe übergehend, die nackten Schulterflecken bläulich fleischroth gesäumt. Das Auge ist silbergrau, der Schnabel an der Wurzel gelb, an der Spitze bleifarben, die Wachshaut schwarz, der Fuß dunkel bleigrau. Beim jungen Vogel sind die kleinen Federn dunkel graubraun, bräunlichgelb geschäftet und ungesäumt, die der Halskrause dunkelbraun, gelbbraun geschäftet, die Schwingen und Schwanzfedern schwarzbraun. Das Auge ist licht röthlichbraun, der Schnabel bis auf die bläulichen Ränder schwarz wie die Wachshaut, der Fuß grünlichgrau.
Alle Gänsegeier scheinen vorzugsweise Felsenbewohner zu sein; deshalb trifft man sie am häufigsten in der Nähe von Gebirgen, welche geeignete steile Wände haben. Unseren europäischen Gänsegeier habe ich nur in der Fruschkagora auf Bäumen ruhen sehen; dagegen bäumen andere Arten, insbesondere der Sperbergeier, nicht selten und verbringen auf Bäumen auch die Nacht.
Die Lebensweise der Gänsegeier stimmt in vieler Hinsicht mit der anderer Arten der Familie überein; doch unterscheiden sie sich in anderen Stücken nicht unwesentlich von den noch zu erwähnenden altweltlichen Verwandten. Ihre Bewegungen sind leichter und zierlicher als bei diesen, und namentlich beim Herabsenken aus großer Höhe benehmen sie sich durchaus eigenthümlich, weil sie fast mit der Leichtigkeit eines Falken unter vielfachen Schwenkungen herabschweben, während sich die anderen Arten aus einer bedeutenden Höhe ohne Flügelbewegungen herabfallen lassen, bis sie fast den Boden berührt haben. Ihr Gang auf dem Boden ist so gut, daß sich ein Mensch sehr anstrengen muß, wenn er einen laufenden Geier einholen will. Noch mehr, wenngleich nicht in gutem Sinne, zeichnet die Gänsegeier ihr Wesen aus. Sie sind die heftigsten, jähzornigsten und tückischsten Arten der Familie. Ihr Verstand ist, auch im Vergleich zu den Geistesfähigkeiten anderer Geier, gering; nur die niederen Eigenschaften scheinen ausgebildet zu sein. Sie leben in großen Gesellschaften, gründen gemeinschaftlich Nistansiedelungen und vereinigen sich regelmäßig auch mit anderen Arten der Familie; aber sie sind und bleiben immer die Störenfriede, die, welche den meisten Streit erregen. Bei längerem Zusammensein mit anderen ihrer Familie wissen sie sich bald die Herrschaft zu erringen, und gegen den, welcher sie angreift, vertheidigen sie sich tolldreist. Angeschossen wehren sie sich mit Muth und Ingrimm, gehen wie bissige Hunde auf den Mann, springen über einen halben Meter hoch vom Boden auf und schnellen ihren langen Hals unter vernehmlichem Schnabelklappen stets nach dem Gesichte ihres Gegners. Anfänglich flüchten die, welche durch den Schuß flugunfähig wurden, im raschen Laufe, wobei sie sich mit den Flügeln nachhelfen, vor dem Menschen; ist dieser ihnen aber nahe gekommen, so drehen sie sich blitzschnell um, fauchen wie eine Eule und rollen wüthend die Augen. Hat man sie glücklich gepackt, so krallen sie sich noch mit den Klauen fest und wissen diese, trotz ihrer Stumpfheit, nachdrücklich zu gebrauchen. »Auf einer meiner Jagden in der Sierra de Guadarrama«, schreibt mein Bruder, »beobachtete ich, daß zwei Gänsegeier, plötzlich in hoher Luft über einander herfielen, sich in einander verkrallten und nunmehr, einen Klumpen bildend, zum Fliegen selbstverständlich unfähig, wirbelnd zur Erde herabsausten. Nicht einmal der Sturz auf den Boden änderte ihre Wuth; sie setzten auch hier den Kampf fort und schienen die Außenwelt so vollständig vergessen zu haben, daß sich ein in ihrer Nähe befindlicher Schäfer verleiten ließ, sie fangen zu wollen. Wirklich brachten sie erst mehrere wohlgezielte Hiebe mittels eines langen Stockes zur Besinnung und zur Ueberzeugung, daß es doch wohl besser sei, für jetzt den Zweikampf aufzuschieben. Dieses thaten sie denn endlich auch und eilten nach verschiedenen Richtungen hin auseinander.«
Beim Wegräumen eines Aases fressen sie vorzugsweise die Leibeshöhlen der todten Thiere aus. Einige Bisse schneiden ein rundes Loch in die Bauchwand, und in dieses nun stecken sie den langen Hals so tief hinein, als sie können. Die edleren Eingeweide werden hinabgewürgt, ohne daß sie den Kopf aus der Höhle hervorziehen, die Gedärme aber erst an das Tageslicht gefördert, durch heftige Bewegungen nach rückwärts herausgezerrt, dann mit einem Bisse durchschnitten und nun stückweise hinabgeschlungen. Es versteht sich ganz von selbst, daß bei derartiger Arbeit Kopf und Hals mit Blut und Schleim überkleistert werden und die Gänsegeier nach dem Schmause ein wahrhaft abschreckendes Bild gewähren. Ob auch sie über kranke und bezüglich verendende Thiere herfallen, lasse ich dahingestellt; die Araber klagen sie derartiger Uebelthaten an, und auch die Hirten der südungarischen Gebirge erzählen dasselbe.
Nach meinen Beobachtungen erscheinen sie erst in den Vormittagsstunden in ihrem Jagdgebiete und fallen vorzugsweise um die Mittagszeit auf das Aas. Während ihrer Brutzeit scheinen sie sich mehr anstrengen zu müssen; wenigstens schreibt mir Lázár, welcher sie zur Zeit beobachtete, daß sie sich, einer nach dem anderen, bald nach Sonnenuntergang erheben und zunächst ihren Felsenvorsprung wohl eine Stunde lang umkreisen. »Sie steigen nun immer höher und ziehen stets sich erweiternde Kreise, bis sie sich einzeln in der Ferne verlieren. Gegen Mittag kommen sie wieder zurück, ebenfalls einzeln, sammeln sich bald in der Nähe ihrer Ansiedelung und umfliegen nun wieder eine Zeitlang die Felsenwand. Dann läßt sich einer nach dem anderen auf die Felsenkanten und Vorsprünge nieder und verträumt ein paar Stunden in träger Ruhe. Nachmittags, zwischen zwei und drei Uhr, fliegen sie unter lautem Geräusche nochmals empor, umschweben einige Male ihre Wohnung und ziehen dann zum zweiten Male auf Aas aus, niemals jedoch auf längere Zeit. Schon mehrere Stunden vor Sonnenuntergang sind sie wieder an ihren Wohnsitzen angelangt.«
Ueber das Brutgeschäft des fahlen Gänsegeiers haben neuerdings Baldamus, Krüper, Simpson, Heuglin und mein Bruder berichtet. Die Beobachtungen des letzteren enthalten im wesentlichen alles, was bisher festgestellt wurde. »Die Brutzeit des Gänsegeiers fällt in Spanien in die letzte Hälfte des Februar oder in den Anfang des März. Der Horst wird gewöhnlich in einer Felsenhöhle oder wenigstens unter einem überhängenden Felsen errichtet und besteht aus einer niedrigen Schicht nicht sehr starker Reiser. In diesen Horst legt das Weibchen ein weißes Ei von der Größe eines Gänseeies, mit dicker Schale, welches es mit dem Männchen gemeinschaftlich bebrütet und zwar so, daß das Männchen in der Regel während der Vormittags- und ersten Nachmittagsstunden dem Brntgeschäfte obliegt, das Weibchen dagegen den übrigen Theil des Tages im Neste verweilt. Auf Bäumen horstet der Gänsegeier nie. An einem günstigen Brutplatze findet man immer mehrere Horste in einer Entfernung von etwa hundert bis zweihundert Schritt von einander. Zu bemerken ist, daß die Nistgesellschaften an solchen Felswänden keineswegs ausschließlich aus Geiern bestehen, sondern daß die Geier ruhig neben und unter sich auch den Geieradler und Habichtsadler dulden, ja selbst dem Schwarzstorch gestatten, unmittelbar neben ihrem Horste sich anzusiedeln und zu nisten. Auf den Eiern sitzen sie ziemlich fest, kommen erst auf lautes Anrufen aus der Höhle hervor, stellen sich auf den Rand derselben und sehen sich neugierig nach dem Störer um, trippeln auch wohl, wenn dieser sich gut verborgen hatte, nach dem Neste zurück und verlassen letzteres überhaupt nur, wenn sie sich wirklich von der ihnen drohenden Gefahr überzeugt haben. Bei meinen Jagden in der Nähe des Escorial machte ich mir oft das Vergnügen, die brütenden Geier vom Neste aufzurufen. Sie erschienen auf jedesmaligen Anruf, schauten sich sorgfältig nach allen Seiten um und zogen sich dann, wenn sie mich nicht gewahren konnten, wieder in das Nest zurück. Ein nach ihnen abgefeuerter Schuß scheucht freilich die ganze brütende Gesellschaft auf, und jeder einzelne sucht mit raschen Flügelschlägen das weite. Dann währt es lange Zeit, ehe sie sich wieder sehen lassen; man späht vergeblich nach allen Seiten hin, die Gegend erscheint mit einem Male wie ausgestorben, und von den gewaltigen Vögeln ist auch nicht das geringste mehr zu entdecken. Erst nach ungefähr einer halben Stunde erscheint einer nach dem anderen. Jeder streicht mehrere Male am Nistplatze vorbei, hält sorgfältig Umschau und schießt dann plötzlich, aber mit einer gewissen Heimlichkeit, nach dem Horste hernieder, verweilt noch eine Zeitlang vorn auf dem Felsenrande, späht nochmals vorsichtig und mißtrauisch in die Runde und schleicht sich nun erst wieder in das Innere seiner Felsenburg zurück. Man hat vielfach behauptet, daß diese Geier den das Nest bedrohenden Jäger muthig angreifen; diese Angabe entbehrt jedoch nach meinen Beobachtungen jeder Begründung. Noch ist es mir unbekannt, wie viele Tage der Bebrütung erforderlich sind, um das große Ei zu zeitigen; ich weiß nur, daß gegen Ende des März bereits einzelne der Jungen ausgeschlüpft sind. Bezeichnend für diese Vögel, welche niemals Wohlgerüche verbreiten, ist, daß nicht blos das ausgeschlüpfte Junge, sondern schon das sich im Ei entwickelnde, ja selbst Dotter und Eiweiß heftig nach Moschus stinken. Das Ausblasen eines solchen Eies erfordert in der That die ganze Gleichmüthigkeit eines begeisterten Naturforschers, und selbst dieser muß gewaltsam ankämpfen, um des aufsteigenden Ekels sich zu erwehren. Das Junge, welches einem kleinen Wollklumpen gleicht, wird von beiden Alten mit vieler Liebe behandelt und sorgfältig geatzt, zuerst mit den durch die Verwesung bereits gänzlich zersetzten Fleischtheilen eines Aases, später mit kräftigerer Nahrung, freilich immer mit solcher, welche derselben Quelle entstammt. Dank der reichlichen Fütterung wächst das Junge rasch heran, braucht aber immerhin drei Monate, bevor es flugfähig wird.«
Zu unserer nicht geringen Ueberraschung bemerkten wir, Eugen von Homeyer und ich, während der Jagdreise des Kronprinzen Rudolf von Oesterreich in der Fruschkagora, unter den in den herrlichen Waldungen häufig brütenden Kuttengeiern auch Gänsegeier und erfuhren durch Erlegung eines Weibchens am Horste, daß da, wo Felsenwände gänzlich fehlen, auch dieser Geier sich entschließt, seinen großen Horst auf Bäumen zu errichten, mindestens den eines Kuttengeiers zu beziehen. Erwähnenswerth scheint mir die Thatsache, daß das Weibchen in noch nicht ausgefärbtem Kleide horstet. Graf Chotek, Grundherr der Fruschkagora, ein erfahrener Vogelkenner, hatte den Gänsegeier bisher noch niemals auf dem ihm wohlbekannten Horstplatze des Kuttengeiers bemerkt und war geneigt, anzunehmen, daß die kurz vorher gekämpften Schlachten in Serbien und Bulgarien wohl Veranlassung zu dem Vorrücken des Gänsegeiers gegeben haben dürften.
Baldamus nahm an der unteren Donau einen jungen Gänsegeier aus dem Horste. Der Vogel hatte die Größe eines starken Hahns und war überall mit dichtem, schmutzigweißem, wolligem Flaume bedeckt, verbreitete schon einen höchst empfindlichen Geruch und bekundete unstillbaren Hunger. Er fraß sofort nach seiner Gefangennahme zwei Steindrosseln, einen Kukuk, am anderen Morgen einen Milan, einen halbgroßen Karpfen und die Eingeweide verschiedener Vögel. Drei Wochen später verzehrte er binnen vierundzwanzig Stunden zwei Kalbseingeweide, Gekröse, Herz, Lunge, Leber etc., verschlang daneben noch alles, was in seinen Bereich kam, auch Holz und Erdstückchen, und erhielt außerdem noch manchen Bissen von den Reisenden des Dampfschiffes. Wenn man ihm ein ganzes Thier vorlegte, so suchte er schon jetzt die Bauchhöhle zu öffnen und verfuhr, wenn man ihm dabei geholfen hatte, ganz nach Art seiner Väter. Später ließ er den übrigen Körper der Vögel stets so lange unberührt, bis er die Bauchhöhle geleert hatte. »In seinem Heißhunger war er stets so ungestüm, daß er, sobald er mich ohne Futter in den großen Hühnerstall kommen sah, wüthend auf mich losstürzte, ein ununterbrochenes Geschrei hören ließ, den Kopf heftig schüttelte und sobald er mich erreichen konnte, in die Füße und Kleider kniff. Bald wußte er mich sehr wohl von anderen zu unterscheiden und wendete sich auch, wenn ich mit mehreren Leuten eintrat, stets an mich.«

Afrikanische Geier.
Es ist eine Ausnahme, wenn ein Gänsegeier zahm wird. »Man sagt nicht zu viel«, meint mein Bruder, »wenn man behauptet, daß er immer in gewissem Grade gefährlich bleibe. Nur ein einziges Mal habe ich in dem Hofe eines Wirtshauses zu Bayonne einen wirklich gezähmten Gänsegeier gesehen. Er hing freilich an einer langen, dünnen Kette und war in seinen Bewegungen hierdurch wesentlich gehindert. Dieser Vogel kam auf den Ruf seines Pflegers von der Stange herab geflogen, näherte sich vertraulich dem Manne und duldete sogar, daß dieser ihn zwischen die Beine nahm und ihm Kopf und Hals und Rücken streichelte. Mit den im Wirtshause befindlichen Hunden lebte er ebenfalls in größter Einigkeit.« Auch Lázár, welcher den Gänsegeier einen tückischen, traurigen Gesellen nennt, der mit heimtückischen Blödsinnigen eine gewisse Aehnlichkeit habe, kannte zwei ausnahmsweise zahme Vögel dieser Art. Der eine, welcher verwundet worden war, folgte seinem Herrn fliegend bis auf das Feld hinaus, unternahm selbständig kleine Ausflüge und blieb zuweilen einen oder zwei Tage aus, kam aber immer wieder zu seinem Pfleger zurück. Ein Fleischer hielt einen anderen Gänsegeier mehrere Jahre lang lebend auf seinem Hofe. Dieser Geier lebte in größter Freundschaft mit einem alten Fleischerhunde. Als letzterer starb, wurde der Leichnam dem Geier vorgeworfen; dieser aber rührte seinen alten Freund, obgleich er hungrig war, nicht an, wurde traurig, verschmähte fortan alle Nahrung und lag am achten Tag verendet neben dem todten Hunde.
In Egypten wird der Gänsegeier nicht selten gefangen, weil man die Federn in vielfacher Weise benutzt. Namentlich die Schwung- und Steuerfedern finden mancherlei Verwendung zu Schmuck- und Wirtschaftsgegenständen. Auf Kreta und Arabien soll der Balg an Kürschner verkauft, von diesen gegerbt und zu einem geschätzten Pelzwerke zubereitet werden.
Die Schopfgeier ( Vultur) unterscheiden sich von den Gänsegeiern durch kräftigeren Leib, kürzeren, stärkeren Hals, größeren Kopf mit kräftigerem Schnabel und breitere Flügel. Der Kopf ist mit kurzem, krausem und wolligem Flaume bekleidet, welcher am Hinterkopfe einen wenig hervortretenden Schopf bildet. Der Hinterhals und einige Stellen des Vorderhalses sind nackt. Die Krause besteht aus kurzen, breiten, kaum zerschlissenen Federn.
Europa beherbergt einen Vertreter dieser Sippe, den Kutten- oder Mönchsgeier ( Vultur monachus, cinereus, vulgaris, arrianus und niger, Aegyptius cinereus und niger, Gyps cinereus und Polypteryx cinereus), welcher sonst auch grauer, gemeiner, großer und brauner Geier genannt wird. Er ist der größte Vogel unseres Erdtheils. Die Länge des Männchens beträgt nach eigenen Messungen 1,1, die Breite 2,22 Meter, die Fittiglänge 76, die Schwanzlänge 40 Centimeter. Das Weibchen ist noch um 4 bis 6 Centimeter länger und um 6 bis 9 Centimeter breiter. Das Gefieder ist gleichmäßig dunkel braungrau, das Auge braun, der Schnabel an der Wachshaut blau, stellenweise röthlich, sodann lebhaft violett, an der Spitze aber blau, der Fuß fleischfarben, ins Violette spielend, der Hals, soweit er nackt, licht bleigrau, ein unbefiederter Ring ums Auge violett. Der junge Vogel ist dunkler; sein Gefieder hat mehr Glanz, und die Flaumfedern am Scheitel sind schmutzig weißlichbraun.
Der Kuttengeier kommt in Spanien, auf Sardinien und allen Gebirgen der Balkanhalbinsel sowie in Slavonien, Kroatien und den Donautiefländern, nach Norden hin bis zur Fruschkagora, Wodzicki's Angabe zufolge sogar bis zu den Karpathen, als Brutvogel vor. Von hier aus verbreitet er sich über einen großen Theil Asiens bis China und Indien. Noch vor fünfundzwanzig Jahren war er im südlichen Ural eine Seltenheit; gegenwärtig ist er häufig. Die beständige Viehseuche, welche seit Jahren in jenen Gegenden herrscht, gibt ihm hinreichende Nahrung. In den Donautiefländern, auf Sardinien, in Armenien, Syrien und Palästina ist er häufig, in Persien selten. Afrika, die Atlasländer und einen Theil der Westküste ausgenommen, bewohnt er nicht; im nördlichen Theile des Nilthales zeigt er sich jedoch dann und wann einmal. Nach Norden hin hat er sich bis Dänemark verflogen. In Deutschland ist er wiederholt erlegt worden: seiner Flugkraft verursacht eine Reise aus Ungarn bis in unser Vaterland keine Schwierigkeiten.
Nach meinen Beobachtungen, welche mit denen anderer Forscher übereinstimmen, tritt der Kuttengeier regelmäßig seltener als der Gänsegeier auf; nur für Ungarn scheint das Gegentheil zu gelten. In Südspanien sieht man ihn einzeln oder in kleinen Flügen von drei bis fünf. Diese fallen mit den Gänsegeiern auf das Aas, geberden sich hier aber viel ruhiger und anständiger als letztere. Ihr Benehmen steht im vollsten Einklange zu dem großen, wohlgebildeten Kopfe. Die Bewegungen sind gemessener als bei den Gänsegeiern, aber, falls dies möglich, ausdauernder und gleichmäßiger. Selbst das Flugbild unterscheidet sich von dem des Gänsegeiers, einerseits weil es durch die verhältnismäßig breiteren und etwas mehr zugespitzten Flügel und den längeren Schwanz dem eines großen Edeladlers ähnelt, anderseits aber dadurch auffällt, daß die Spitzen der Fittige ein wenig nach oben gebogen, vom Gänsegeier dagegen gerade getragen werden. Die Haltung ist edler, mehr adlerartig, und der Blick des Auges hat durchaus nichts tückisches, sondern höchstens etwas feuriges und kluges. Bei dem Schmause verzehren die Kuttengeier zunächst die Muskeltheile, eines Thieres Eingeweide dagegen nur dann, wenn sie kein besseres Fleisch haben. Auch Knochen werden von ihnen verschlungen. Nach einer brieflichen Mittheilung Lázárs stimmen alle Gebirgsjäger Siebenbürgens darin überein, daß der Kuttengeier auch lebende Thiere ergreife und tödte. Ich kann eine Reihe von Belegen erbringen, welche diese Angabe bewahrheiten. Einer der fünf Kuttengeier, welche vom Erzherzog Rudolf von Oesterreich, Prinz Leopold von Bayern, Graf Bombelles und mir in der Fruschkagora erlegt wurden, hatte ein Zisel, ein anderer eine Eidechse im Kropfe, beides Thiere, welche die Geier kaum nach ihrem Tode aufgenommen haben dürften. Heuglin sah in Griechenland sechs bis acht Kuttengeier beim Mahle, schlich sich bis auf dreißig Schritte an sie heran und erfuhr zu nicht geringem Erstaunen, daß sie sich um den Besitz mehrerer ziemlich großer Landschildkröten stritten. Der eine hielt eines der Kriechthiere zwischen den Fängen und arbeitete gewaltig mit dem mächtigen Schnabel am Rückenschilde; die übrigen hatten eine Schildkröte bereits geöffnet und ihren Leib aus dem Panzer geschält, eine andere zwischen den Nähten der Schildtafeln angebohrt und schwer verwundet, so daß sie stark blutete, eine vierte auf den Rücken gewälzt und ebenfalls verletzt. Von Meyerinck berichtet, daß im Jahre 1867, in welchem unser Vogel Deutschland mehrfach besucht zu haben scheint, auf dem Rittergute Helmsdorf ein Kuttengeier einen Hasen geschlagen habe und beim Kröpfen desselben erlegt worden sei. Beweisender als alles dies ist eine Beobachtung meines Bruders. »Ich hatte«, schreibt er mir, »eine junge Ziege angebunden, um Geieradler anzulocken. Plötzlich beginnt dieselbe wie toll hin und her zu springen, soweit der Strick ihr erlaubt. Ich höre ein starkes Brausen in der Luft und hoffe schon, einen Bartgeier vor mir zu haben, erstaune aber nicht wenig, als ich einen Kuttengeier erblicke, welcher mit ausgestreckten Fängen dicht über dem Boden dahinsaust und auf die Ziege stößt. Rasch trete ich aus meinem Verstecke hervor und kann eben noch verhindern, daß der Geier das geängstigte Thier ergreift.«
»Der Kuttengeier«, berichtet mein Bruder ferner, »nistet nicht wie der fahle oder Gänsegeier in Gesellschaften, sondern einzeln und, in Spanien wenigstens, nur auf Bäumen. Sein umfangreicher Horst steht entweder auf dem starken Aste einer Kiefer oder auf dem breiten, buschigen Wipfel einer immergrünen Eiche, oft nicht höher, als drei bis vier Meter über dem Boden. Er besteht aus einer Unterlage von armstarken Knüppeln, auf welche eine zweite Schicht dünnerer Stöcke folgt; erst auf dieser ruht die flache Nestmulde aus dünnen, dürren Reisern. In dieser findet man Ende Februar ein weißes, dickschaliges Ei, welches an Größe das der Gänsegeier nicht übertrifft, demselben im Gegentheile häufig nachsteht: sein Längsdurchmesser beträgt etwa fünfundachtzig, sein Querdurchmesser achtundsechzig Millimeter. Ich habe stets nur ein Ei gefunden, und die Erfahrungen aller spanischen Jäger, welche ich befragte, stimmen mit meiner Beobachtung überein. Das aus dem Ei geschlüpfte Junge ist mit dichtem, weißem, wolligem Flaume bekleidet und bedarf mindestens vier Monate bis zum Ausfliegen. Es wird von den Eltern sorgfältig mit Aas gekröpft, keineswegs aber so heldenmüthig vertheidigt, wie man gewöhnlich annimmt. Nähert man sich dem Horste, in welchem sich ein Junges befindet, so umkreisen wohl die Geier den Platz, jedoch in bedeutender Entfernung, und kommen nie dem Jäger auf Schußweite heran. Bei La Granja, wo die Geier in dem das Dorf umschließenden, ausgedehnten Kieferwalde die herrlichsten Nistplätze finden, horsten sie häufig und ungefähr in der Entfernung einer Viertelstunde von einander. Ich habe den Horst auch in der Nähe des Nistplatzes einer Gesellschaft der Gänsegeier und zwar unmittelbar neben einem Neste dieses letzteren bemerkt; allein der Baum, auf welchem der Horst stand, war der einzige in der ganzen Gegend, und dies jedenfalls der Grund, warum der Mönchsgeier sich in Gesellschaft der vorher genannten Art ansiedelte.« Gelegentlich der Jagdreise des Kronprinzen Rudolf von Oesterreich in Südungarn wurden von uns in der Fruschkagora sechs bis acht Horste des Kuttengeiers besucht und während des Anstandes auf die Horstvögel erwähnenswerthe Beobachtungen gewonnen. Die Horste standen nur auf Bäumen, meist auf alten Eichen, Buchen und Linden der dichtesten Bestände, stets aber so, daß der Brutvogel freien Abflug hatte, daher fast ausnahmslos im oberen Theile der Bergabhänge. In der Regel hatte der Geier die stärkeren, oberen Wipfel-, selten die nahe stehenden Kronenzweige solcher Bäume gewählt, welche einen oder mehrere dürre Zacken in die Luft streckten; letztere dienten in den meisten Fällen dem Männchen zum Ruhesitze. Der Horst, welcher manchmal zwischen verdeckendem Gezweige angelegt worden war, ist so groß, daß man den in ihm brütenden Vogel nicht sehen kann, besteht aus verschiedenen starken, jedoch nicht allzudicken Prügeln, Aesten, Stöcken und Zweigen und soll, nach Angabe der Steiger, eine besondere Auskleidung nicht enthalten. Das Weibchen sitzt fest auf dem Neste, läßt sich jedoch regelmäßig durch Anklopfen vertreiben. Dann und wann pflegt es sich vor dem Wegfliegen aufzurichten, als ob es sich über die Störung vergewissern wolle; hierauf entfaltet es die Schwingen sofort zu voller Weite und streicht schwebend ohne Flügelschlag ab. Wird es nicht wiederholt gestört, so kehrt es bald wieder zurück, bäumt auf einem dem Horste benachbarten dürren Aste und springt von diesem aus in den Horst. Hat es längere Zeit gekreist, so kehrt es stets in Gemeinschaft seines Männchens zurück, und beide erscheinen dann gleichzeitig über dem Horste, fallen auch wohl, wie ich es einmal beobachtet habe, in demselben Augenblicke aus hoher Luft rauschend herab und bäumen dicht nebeneinander auf dem Horstbaume. Beide scheinen Antheil am Brüten zu nehmen. Von der innigen Zuneigung der Männchen zu ihren Weibchen lieferte mir eines der ersteren einen rührenden Beweis. Ich hatte lange Zeit lauernd unter dem einen Horste gesessen und bereits mit der Büchse einen Schuß abgegeben, welcher aus dem Grunde nicht traf, weil ich das durch Aeste verdeckte Weibchen nicht deutlich sehen konnte. Beide Gatten des Paares waren durch meinen tückischen Angriff selbstverständlich sehr erschreckt und vorsichtig geworden; der herannahende Abend trieb jedoch das Weibchen endlich auf den Horst zurück, und als es diesmal, gleichzeitig mit dem Männchen, erschien, empfing es die tödtliche Kugel, so daß es, ohne sich weiter zu regen, in den Horst fiel und dort liegen blieb. Erschreckt hob sich das Männchen zum zweiten Male, beschrieb einige Kreise, kehrte aber, wohl weil es das Weibchen liegen sah, schon nach wenigen Minuten zurück und bäumte abermals. Mein auf den Schuß herbeigekommener Führer verscheuchte es, und wiederum begann es zu kreisen. Jetzt ließ ich den Horst erklettern; bevor jedoch der Steiger die Höhe erreicht hatte, war das Männchen, welches den kletternden Mann und uns offenbar sehen mußte, wiederum erschienen, bäumte nochmals und bezahlte nunmehr seine Anhänglichkeit an die Gattin mit dem Leben. Während unserer Jagd in der Fruschkagora, in den ersten Tagen des Mai, saßen alle Weibchen noch brütend auf den Eiern. In Siebenbürgen will man, wie zum Schluße noch erwähnt sein mag, beobachtet haben, daß einer der Alten das Junge bei großer Gefahr mit den Klauen packt und davon trägt.
Daß der Kuttengeier, welchem man im allgemeinen wohl friedliche Gesinnungen zutrauen darf, ebenfalls Widersacher hat, welche ihm sein Leben verbittern, erfuhren wir bei folgender Gelegenheit. Erzherzog Rudolf sah, unter dem Horste eines Geierpaares lauernd, zwei große Raubvögel in hoher Luft sich bewegen, endlich in einander sich verkrallen und wirbelnd zum Horste herunterstürzen. Hier trennten sie sich, und der Kronprinz erkannte jetzt mit Erstaunen, daß die zwei Kämpfer nicht eines Geschlechtes, sondern ein Kuttengeier und ein Steinadler gewesen waren. Was den letzteren bewegt haben konnte, den friedlichen Kuttengeier anzugreifen, bleibt ein Räthsel. Von dem Menschen hat letzterer wenig zu leiden, wird wenigstens nicht regelrecht verfolgt. Graf Chotek, welcher ihn schützt, beklagt, daß er viele verliert, weil sie im Winter das für Wölfe bestimmte vergiftete Fleisch fressen, trotzdem dasselbe, ihnen zu Liebe, unter einem niedrigen Breterdache ausgelegt wird.
Ein Kuttengeier, welchen Leisler pflegte, war anfänglich sanft und gutmüthig, wurde aber später boshaft und hieb, nur seinen Wärter verschonend, mit Schnabel und Fang nach jedem, welcher ihm nahte. Er verzehrte verwesende Thiere ebenso gern wie frische, fraß sie mit Haut und Haaren, selbst den Schwanz von jungen Füchsen, und spie sodann Gewölle aus. Zwölf bis fünfzehn Centimeter lange Knochen verdaute er ganz. Fische rührte er nie, lebende Thiere griff er nicht an: ein Kolkrabe und eine Rabenkrähe lebten monatelang friedlich mit ihm, und obschon man ihn Hunger leiden ließ, that er doch einem Hasen, mit welchem er sich zusammen befand, nichts zu Leide. Todte Katzen fraß er sehr gern; befestigte man aber einen Bindfaden an eine derselben und zog sie hin und her, so sprang er furchtsam davon, kam nach einiger Zeit wieder, gab ihr einen Hieb mit dem Fuß, sprang schnell wieder zurück und that dies so oft, bis er von ihrem Tode überzeugt war. Um den Geier zu tödten, gab man ihm zwölf Gran Arsenik. Nach einer Stunde bekam er Zittern, würgte das vergiftete Fleisch heraus, fraß es wieder und befand sich abermals eine Stunde später wiederum ganz wohl. Am selben Nachmittage gab man ihm noch zwei Quentchen Arsenik; wiederum aber erfolgte wohl Zittern und Erbrechen, jedoch nicht der Tod. Ein anderer zeigte sich trotzig, so lange er eingesperrt war, heiter und neckisch, nachdem man ihm gestattet hatte, frei im Hofe umherzulaufen. »Er erschreckt«, so schreibt mir Lázár, sein Pfleger, »die Hähne, ohne sie jedoch zu gefährden, zerrt die Schweine am Schwanze, läuft den Hunden nach und treibt sie wohl auch in die Flucht. Selbst mein Diener muß sich in Acht nehmen, daß ihm Pandur nicht das zur Fütterung bestimmte Fleisch mit Gewalt wegnimmt. So lange er nicht gereizt wird, lebt er mit allen Leuten im besten Einverständnisse: selbst Kinder können ohne Furcht in seine Nähe kommen; angegriffen aber vertheidigt er sich tapfer und theilt kräftige Schnabelhiebe aus. Im Zorne schleift er die halbgeöffneten Flügel, sträubt seine langen Rückendeckfedern, nimmt eine wagerechte Stellung an, streckt den Hals weit vor und trippelt und hüpft so sonderbar umher, daß man sich des Lachens kaum erwehren kann. Er ist ebenso gefräßig, kann aber nicht auch so lange hungern, wie der Gänsegeier. Wasser ist ihm Bedürfnis; denn er trinkt oft und badet ungemein gern. Das Fleisch von Säugethieren zieht er allem anderen vor; doch frißt er auch Vögel. Fische verzehrt er selbst beim größten Hunger nicht.« »Als Knabe«, erzählt mir Graf Rudolf Chotek, »erhielt ich einen Kuttengeier, welcher mit durchnäßtem Gefieder aus den Fluten der Donau gezogen und durch zwölf Jahre im Pfarrhause gepflegt worden war. Diesen Geier nahm ich mit nach Korompa, woselbst er weitere dreißig Jahre lebte. Dann erhielt ihn Fürst Lamberg, brachte ihn nach Steyer und wies ihm im dortigen Schloßgraben seinen Aufenthalt an. Hier würde er wahrscheinlich noch leben, wäre er nicht von einem, denselben Aufenthalt mit ihm theilenden Hirsch todtgeforkelt worden. Dieser Geier, ein Weibchen, welches wiederholt Eier legte, hatte absonderliche Freundschaft mit einem jungen, mutterlosen Haushuhne geschlossen, welches zwischen den Latten seines großen Käfigs durchgeschlüpft war und sich ihm gesellt hatte. Des Abends oder bei Regen sah man es stets bei seiner großen Freundin, welche es zärtlich bewachte und huderte. Was aus dem Huhne später geworden, ist mir nicht mehr erinnerlich; wohl aber weiß ich, daß der Geier es nicht getödtet hat.«
Als die Riesen der Familie dürfen die Ohrengeier, Vertreter einer besonderen Untersippe ( Otogyps) angesehen werden. Sie kennzeichnen sich durch sehr großen, kräftigen Schnabel, hohe Beine, große, breite, aber etwas abgerundete Flügel, verhältnismäßig kurzen Schwanz und eigenthümliche Befiederung. Nur die Federn der Oberseite sind gestaltet wie bei anderen großen Geiern, die Unterseite deckt dichtstehender, ziemlich langer Flaum von grauweißlicher Färbung, aus welchem einzeln stehende lange und schmale säbelförmige Federn hervorragen. Auch an Schenkel und Wade finden sich sehr spärlich kleine Federchen von gewöhnlicher Beschaffenheit; diese Theile sind vielmehr ebenfalls mit Flaum bekleidet, welcher nur durch seine größere Länge und durch fahlgraue Färbung von dem der Brust sich unterscheidet. Der Kopf, der halbe Hinterhals und der ganze Vorderhals sind nackt. Das Kinn ist mit haarartigen Federn bekleidet.
Die bekannteste Art der Sippe ist der Ohrengeier ( Vultur auricularis, nubicus, aegyptius und imperialis, Otogyps auricularis, nubicus und tracheliotus). Die Länge des Männchens beträgt 1 bis 1,05, die Breite 2,7 bis 2,8 Meter, die Fittiglänge 69 bis 72, die Schwanzlänge 34 bis 36 Centimeter; das Weibchen, dessen Maße ich nicht verzeichnet habe, ist noch erheblich größer. Fahlgraubraun ist die vorherrschende Färbung des Gefieders; die Schwingen und die Steuerfedern sind dunkler, die großen Flügeldeckfedern lichter gerandet. Sehr häufig stehen blaßfahle und gelbweiße Federn im Nacken und am Oberrücken. Junge Vögel unterscheiden sich durch dunkleres Gefieder und breitere Bauchfedern von den alten. Das Auge ist dunkelbraun, der Schnabel seitlich hornfarben, auf der Firste und am Unterschnabel dunkel, der Fuß licht bleigrau, der nackte Halstheil grau, die ebenfalls nackte Wange violett. Bei größerer Aufregung des Vogels röthen sich alle nackten Stellen des Kopfes und Halses mit Ausnahme des Scheitels.
Der Ohrengeier, welcher sich wiederholt nach Europa verflogen haben soll, ist von Oberegypten an über ganz Afrika verbreitet und steigt im Hochgebirge bis zu viertausend Meter unbedingter Höhe empor. Er tritt seltener auf als seine Verwandten, kommt jedoch überall vor.
Der indische Vertreter des gewaltigen Vogels ist der Kahlkopfgeier, »Sukuni« der Hindu ( Vultur calvus und pondicerianus, Otogyps calvus, Hemigyps pondicerianus). Seine Länge beträgt, laut Jerdon, einundneunzig, die Fittiglänge sechzig, die Schwanzlänge fünfundzwanzig Centimeter; der Vogel ist also erheblich kleiner als der Ohrengeier. Der Kopf, mit alleiniger Ausnahme der mit haarartigen Federn gebildeten, spärlich bekleideten Ohrgegend, Kinn, Kehle, Gurgel, Vorderhalsseiten und eine Stelle am inneren Theile des Unterschenkels über dem Knie sind nackt, Vorderhalsmitte und obere Kropfgegend mit haarigen, untere Kropfgegend, einen in die Breite gezogenen, bis zu den Achseln reichenden Fleck bildend, Oberschenkel, Hüft- und Kreuzbeingegend mit wolligen Dunen bekleidet, die Krausenfedern nur im Genick haarig, die Ohrlappen und die Falten an Kehle und Gurgel sehr entwickelt, Mantel, mittlere Flügeldecken und alle Untertheile bräunlichschwarz, die Schulterfedern fahlbraun, mit mehreren, weit von einander stehenden feinen, dunklen Querlinien und dunkleren Spitzen geziert, die kleinen Flügeldeckfedern ebenso, die Armschwingen ober- und unterseits graulich lichtbraun, an der Spitze schwarzbraun, so daß eine breite Flügelbinde entsteht, die Handschwingen und Steuerfedern bräunlichschwarz gefärbt. Alle nackten Theile sehen karminroth, bei Erregung blutroth aus. Die Iris ist dunkelbraun, der Schnabel hornschwarz, die Wachshaut dunkel, der Fuß hell karminroth.
Das Verbreitungsgebiet des Vogels erstreckt sich über ganz Indien bis Burma.
Von Mittelnubien an südwärts vermißt man den Ohrengeier selten bei einem größeren Aase. Er scheut sich nicht vor dem Menschen und kommt, obgleich er sich nicht so zutraulich zeigt wie die kleineren Rabengeier, dreist bis in die Dörfer oder auf die Schlachtplätze der Städte. Auf dem Aase spielt er den Alleinherrscher und vertreibt alle übrigen Geier, vielleicht mit Ausnahme der bissigen Gänsegeier. Die Hunde, welche in ganz Nordostafrika das Gewerbe der Geier beeinträchtigen, weiß er stets in Achtung zu erhalten. Ganz dasselbe wird von seinem indischen Vertreter gesagt. »Die Indier«, bemerkt Jerdon, »nennen den Sukuni ›Königsgeier‹, weil ihn alle übrigen fürchten und ihm stets das Feld räumen, wenn er sich zeigt.« An Gefräßigkeit steht jener unter allen seinen Verwandten obenan, demungeachtet geberdet er sich nicht so gierig wie seine langhälsigen Verwandten. Aber seine Mahlzeit geht regelmäßig überaus rasch von statten. Vier Ohrengeier fressen binnen fünf Minuten den größten Hund bis auf den Schädel und die Fußknochen rein auf. Von der Stärke eines Ohrengeiers habe ich mich oft überzeugt. Ein einziger Biß von ihm zerschneidet die dickste Lederhaut eines großen Thieres, und wenige Bisse genügen, um auf eine bedeutende Strecke die Muskeln bloszulegen. Ich sah einen dieser Vögel eine ausgewachsene Ziege mit dem Schnabel packen und mit größter Leichtigkeit fortziehen.

Kahlkopfgeier (Vultur calvus). 1/6 natürl. Größe.
Nach jeder Mahlzeit fliegt der Ohrengeier dem nächsten Wasser zu, trinkt und putzt sich dort, ruht aus, indem er sich wie ein Huhn in den Sand legt und behaglich sonnt, und fliegt dann kreisend, oft auf Strecken hin ohne Flügelschlag schwebend, seinem Schlafplatze zu. Zur Nachtruhe wählt er sich nicht immer die größten Bäume aus, sondern begnügt sich mit jedem, welcher ihm passend erscheint, oft mit einem kaum drei Meter hohen Mimosenstrauche. Hier sitzt er in sehr aufrechter Haltung, wie ein Mann, den Kopf dicht eingezogen, den Schwanz schlaff herabhängend. Am Morgen verweilt er wenigstens zwei Stunden nach Sonnenaufgang auf seinem Schlafplatze, und bis zum Auffliegen ist er so wenig scheu, daß man ihn unterlaufen und selbst mit Schrot herabschießen kann. Als ich das erstemal von Mensa zurückkehrte, traf ich in einem wegen des durchführenden Weges wenigstens einigermaßen belebten Thale eine Gesellschaft von etwa acht schlafenden Ohrengeiern an. Die Vögel saßen so fest, daß ich um ihren Schlafbaum herum reiten konnte, ohne sie aufzuscheuchen. Erst nachdem ich einen von ihnen niedergeschossen hatte, flogen sie auf, waren aber noch so schlaftrunken, daß sie schon nach einer Entfernung von ungefähr fünfhundert Schritten wieder aufbäumten. Auf dem Aase erscheinen sie nie vor zehn Uhr Morgens und verweilen daselbst spätestens bis vier oder fünf Uhr nachmittags. Man erkennt sie an ihrem ruhigen, schönen Fluge, namentlich aber daran, daß sie, wenn sie ein Aas aufgefunden haben, weit über hundert Meter senkrecht herabfallen, hierauf die Schwingen wieder breiten, die Ständer weit von sich strecken und sich dann vollends schief auf das Aas herabsenken. Hier halten sie sich, wie die Kuttengeier, vorzugsweise an die Muskeln; Eingeweide scheinen sie zu verschmähen.
Ueber die Fortpflanzung des Ohrengeiers weiß ich aus eigener Erfahrung nichts mitzutheilen und muß deshalb Levaillant anführen. »Der Ohrengeier nistet in Felshöhlen. Das Weibchen legt zwei, höchst selten drei weiße Eier und zwar im Oktober. Im Januar schlüpfen die Jungen aus. Da die Vögel in zahlreichen Gesellschaften leben, enthält oft eine Felsenwand so viel Horste, als sie bergen kann. Wie es scheint, leben die Mitglieder einer Ansiedelung im besten Einvernehmen unter einander. Ich habe in einer und derselben Höhle bisweilen zwei bis drei Horste gesehen, einen dicht an dem anderen. Mit Hülfe meiner Hottentotten habe ich mein Leben auf das Spiel gesetzt, um die Horste zu untersuchen. Ihre Umgebung ist wirklich ekelhaft und der Gestank daselbst fast unerträglich. Dazu kommt, daß die Felsen von der herbeigeschleppten Fleischmenge glatt und schlüpfrig geworden sind, so daß man in Gefahr kommt, auszugleiten und in die Tiefe zu stürzen. Ich kostete Eier des Ohrengeiers und fand sie ebenso wie die des Gänsegeiers gut genug, um sie zu gebrauchen. Die jungen Geier entschlüpften dem Ei in einem weißen Dunenkleide.«
Ich glaube, daß vorstehende Beschreibung der Berichtigung bedarf. Höchst wahrscheinlich legt der Ohrengeier nicht zwei oder drei Eier, sondern bloß ein einziges, und sicherlich sind diese für Menschen europäischer Abkunft gänzlich ungenießbar. Für das erstere spricht eine Mittheilung Gourney's, dessen gefangenes Weibchen vier Jahre nach einander und zwar stets im Februar je ein einziges, auf weißem Grunde mit röthlichen, am stumpfen Ende sich häufenden Flecken gezeichnetes Ei legte; das letztere bedarf für den, welcher einmal ein frisches Geierei berochen hat, weiterer Worte nicht. In allem übrigen mag Levaillant Recht behalten.
Während meines längeren Aufenthaltes in Chartum jagte ich einen Monat lang tagtäglich auf Geier, welche ich durch ausgelegtes Aas herbeilockte. Letzteres wurde auf einer weiten Ebene hinter einem dort stehenden Erdwalle ausgeworfen und uns dadurch die Möglichkeit geboten, an die schmausende Gesellschaft bis auf zwanzig Schritte heranzuschleichen. Bei diesen Jagden sammelte ich die Beobachtungen, welche ich weiter oben mitgetheilt habe. Es ist mir wiederholt gelungen, mit Hülfe eines rasch gewechselten Gewehres mehrere Ohrengeier zu erlegen; ich habe einmal sogar vier von ihnen mit einem Schusse niedergestreckt. Nebenbei wurden auch Fallen gestellt und zwar solche der allereinfachsten Art; sie bewiesen sich aber als wirksam. Ich hatte nach kurzer Zeit eine ziemliche Anzahl von Geiern beisammen. Unter diesen nun waren stets mehrere Ohrengeier, und sie wurden bald meine Lieblinge. Sie betrugen sich in der Gefangenschaft von allem Anfange an ruhig und verständig, mir gegenüber furchtlos und in gewissem Sinne vertraulich, ganz im Gegensatze zu den Gänsegeiern. Alle waren an Stricke gefesselt; es fiel aber keinem von ihnen ein, die Kraft ihres gewaltigen Schnabels an ihren Fesseln zu erproben. Schon am dritten Tage der Gefangenschaft nahm der erste Ohrengeier, welchen ich erlangt hatte, Wasser zu sich; am vierten Tage begann er eine vor ihm liegende Katze, welche er drei Tage verschmäht hatte, zu bearbeiten; am fünften Tage fraß er bereits vor meinen Augen, und fortan achtete er nicht mehr auf mich, auch wenn ich dicht neben ihm stand. Später nahm er mir die Nahrung aus der Hand.
Beim Fressen stellt sich der Ohrengeier auf seine gerade ausgestreckten Füße, legt alle Federn glatt und nimmt eine vollkommen wagerechte Stellung an. Das vor ihm liegende Fleischstück wird mit den Klauen festgehalten und dann mittels des Schnabels mit einer Kraft bearbeitet, welche mit dem Riesenkopfe durchaus im Einklange steht. Er verschlingt übrigens nur kleine Stückchen und nagt die Knochen sorgfältig ab. Wasser ist auch ihm Bedürfnis: er trinkt viel und badet sich, wenn er dies haben kann, sehr regelmäßig. Im Zorne sträubt er alle Federn und faucht wie eine Eule; dabei röthet sich der nackte Fleck am Hinterkopfe in auffallender Weise. Aergert er sich mehr als gewöhnlich, so pflegt er das im Kropfe aufbewahrte Fleisch auszubrechen; er frißt es aber auch, wenn die Ruhe eintritt, nach Art der Hunde, wieder auf. In einem größeren Gesellschaftsbauer benimmt er sich ebenso ruhig wie in der Freiheit. Er ist sich seiner Stärke bewußt und läßt sich nichts gefallen, wird aber niemals zum angreifenden Theile. Unser Klima scheint leicht von ihm ertragen zu werden, obgleich er Wärme in hohem Grade liebt. In unseren Thiergärten hält man die Ohrengeier Sommer und Winter im Freien. Sie frieren bei strenger Kälte allerdings und geben dies durch heftiges Zittern kund, erhalten dafür aber etwas mehr zu fressen als im Sommer und trotzen dann dem Winter.
Mehr als jeder andere Geier steht der Ohrengeier bei den Eingeborenen in schlechtem Rufe. Man hält ihn nicht nur für unrein in Glaubenssachen, wie die übrigen, sondern auch für Menschen gefährlich. Gerade von ihm will man beobachtet haben, daß er schlafende Leute angehe und tödte.
Das auffälligste Kennzeichen der neuweltlichen Geier besteht in den durchgehenden, großen, eiförmigen Nasenlöchern. Man erachtet dies Merkmal für wichtig genug, um darauf eine besondere Familie zu begründen, und wir wollen dieser Auffassung insofern Rechnung tragen, als wir die Neuweltsgeier in einer Unterfamilie ( Catharinae) vereinigen. Abgesehen von dem gesagten, kennzeichnen sich die betreffenden Vögel durch ihren mehr oder weniger verlängerten, an der Wurzel des Oberschnabels mit weicher Wachshaut bedeckten, vor der Wachshaut eingeschnürten, im Spitzentheile stark gekrümmten und hakigen Schnabel, die kräftigen, dickläufigen Füße und langen, zugespitzten Flügel, den ziemlich langen Schwanz, und nackten Kopf und Oberhals, welche Theile meist noch mit kammartigen Hautgebilden auf der Schnabelwurzel und Stirne sowie mit grell gefärbten Wülsten und Falten verziert zu sein pflegen. Auch der innere Bau läßt bemerkenswerte Unterschiede mit dem der altweltlichen Geier und insbesondere des Geieradlers erkennen.
Als die edelsten Glieder der Unterfamilie sehen wir die Kammgeier ( Sarcorhamphus) an. Die Merkmale liegen in dem verhältnismäßig gestreckten Leibe und langen, rundlichen, seitlich zusammengedrückten, stark hakigen Schnabel, welcher beim Männchen an der Wurzel mit hohem Kamme, in der Kinngegend mit Hautlappen verziert ist, dem mittellangen Halse, den hohen und langzehigen Füßen, den langen, aber ziemlich schmalen Flügeln, dem langen Schwanze und dem verhältnismäßig kleinfederigen, lebhaft bunten Gefieder, welches jedoch den Kopf und den Unterteil des Halses nicht bekleidet. Das Männchen übertrifft sein Weibchen an Größe.
Das Schicksal des Geieradlers ist auch dem Kondor ( Sarcorhamphus gryphus, magellanicus, Cuntur und Condor, Vultur gryphus, Cathartes gryphus) geworden. Ebenso wie jenen hat man ihn verkannt und verschrieen, über ihn die wunderbarsten Sagen erzählt und geglaubt. Erst den Forschern unseres Jahrhunderts blieb es vorbehalten, seine Naturgeschichte von Fabeln zu reinigen. Humboldt, Darwin, d' Orbigny und J. J. von Tschudi verdanken wir so genaue Nachrichten über den bis zur Veröffentlichung ihrer Forschungen fabelhaften Vogel, daß wir uns gegenwärtig eines vollkommen klaren Bildes seiner Lebensweise versichert halten dürfen.

Kondor ( Sarcorhamphus gryphus). ⅙ natürl. Größe.
Das Gefieder des ausgefärbten Kondors ist schwarz, schwach dunkelstahlblau glänzend; die Fittigfedern sind mattschwarz, die äußersten Deckfedern aller drei Ordnungen sowie die aus weichen, haarig wolligen aber ziemlich langen Federn bestehende Krause weiß, die Armschwingen an der äußeren Fahne weiß gesäumt. Dieser Saum wird bei den Arm- und Schulterfedern immer breiter und erstreckt sich zuletzt auch auf den inneren Fahnentheil, so daß die eigentlichen Schulterfedern ganz weiß und nur an der Wurzel schwarz sind. Hinterkopf, Gesicht und Kehle haben schwärzlichgraue, ein schmaler Hautlappen an der Kehle wie die beiden warzigen Hautfalten zu beiden Halsseiten des Männchens lebhafter rothe, der Hals fleischrothe, die Kropfgegend blaßrothe Färbung. Das Auge ist feurig karminroth, bei zwei mir bekannten Männchen aber lichtgrünlich erzfarben, der Schnabel am Grunde und auf der Firste hornschwarz, an den Seiten und an der Spitze horngelb, der Fuß dunkelbraun. Nach Humboldts Messungen beträgt die Länge des Männchens 1,02, die Breite 2,75, die Fittiglänge 1,15 Meter, die Schwanzlänge 37 Centimeter, die Länge des Weibchens 2,5, die Breite 24 Centimeter weniger.
Das Hochgebirge Südamerikas ist die Heimat des Kondors. Er verbreitet sich von Quito an bis zum fünfundvierzigsten Grade südlicher Breite. In den Andes bevorzugt er einen Höhengürtel zwischen drei- bis fünftausend Meter über dem Meere; an der Magelhaensstraße und in Patagonien horstet er in steilen Klippen unmittelbar an der Küste. Auch in Peru und Bolivia senkt er sich oft bis zu dieser Küste hernieder, ist aber, laut Tschudi, in der Höhe mindestens zehnmal so häufig als in der Tiefe. Nach Humboldt sieht man ihn oft über dem Chimborazo schweben, sechsmal höher als die Wolkenschicht, welche über der Ebene liegt, siebentausend Meter über dem Meere.
Lebensweise und Betragen des Kondor sind im wesentlichen die anderer Geier. Er lebt während der Brutzeit paarweise, sonst in Gesellschaften, wählt sich steile Felszacken zu Ruhesitzen und kehrt, wie die Menge des abgelagerten Mistes beweist, regelmäßig zu ihnen zurück. Beim Wegfliegen erheben sich die Kondore durch langsame Flügelschläge; dann schweben sie gleichmäßig dahin, ohne einen Flügel zu rühren. Erspäht einer von ihnen etwas genießbares, so läßt er sich hernieder, und alle übrigen, welche dies sehen, folgen ihm rasch nach. »Es ist«, sagt Tschudi, »oft unbegreiflich, wie in Zeit von weniger als einer Viertelstunde auf einem hingelegten Köder sich Scharen von Kondoren versammeln, während auch das schärfste Auge keinen einzigen von ihnen entdecken konnte.« Waren sie im Fange glücklich, so kehren sie gegen Mittag zu ihren Felsen zurück und verträumen hier einige Stunden.
Der Kondor ist, ebenso wie andere Geiervögel, vorzugsweise Aasfresser. Humboldt berichtet, daß ihrer zwei nicht bloß den Hirsch der Andes und die Vicuña, sondern selbst das Guanaco und sogar Kälber angreifen, diese Thiere auch umbringen, verfolgen und so lange verwunden, bis sie athemlos hinstürzen, und Tschudi bestätigt, daß die Kondore den wilden und zahmen Herden folgen und augenblicklich über ein verendetes Thier herfallen. Unter Umständen stürzen sie sich auf junge Lämmer, Kälber, selbst auf gedrückte Pferde, welche sich ihrer nicht erwehren können und es geschehen lassen müssen, daß sie das Fleisch rings um die Wunde wegfressen, bis sie in die Brusthöhle gelangen und jene endlich umbringen. Beim Ausweiden erlegter Vicuñas oder Andeshirsche sieht sich der Jäger regelmäßig von Scharen von Kondoren umkreist, welche mit gieriger Hast auf die weggeworfenen Eingeweide stürzen und dabei nicht die geringste Scheu vor dem Menschen an den Tag legen. Ebenso sollen sie den jagenden Puma beobachten und die Ueberreste seiner Tafel abräumen. »Wenn die Kondore«, sagt Darwin, »sich niederlassen und dann alle plötzlich sich zusammen erheben, so weiß der Chilese, daß es der Puma war, welcher, ein von ihm erbeutetes und getödtetes Thier bewachend, die Räuber hinwegtreibt.« In der Lammzeit der Schafe beobachtet der Kondor auch die Herden sehr genau und nimmt die Gelegenheit wahr, junge Ziegen oder Lämmer zu rauben. Hochträchtige Kühe müssen, laut Tschudi, immer in einem in der Nähe der Wohnungen errichteten, mit einer Mauer eingefaßten Corral oder Hag getrieben und dort sorgfältig überwacht werden; denn sobald eine Kuh gekalbt hat, erscheinen unverzüglich die Riesenvögel, um sich des Kalbes zu bemächtigen. Wird es nicht kräftig durch Menschen vertheidigt, so ist es verloren. Schäfer- und Hirtenhunde der von Kondoren heimgesuchten Gegenden sind abgerichtet, herauszulaufen, so lange der Feind in den Lüften ist, nach oben zu sehen und heftig zu bellen. Am Meeresstrande nähren sich die Vögel von den durch die Flut ausgeworfenen großen Seesäugethieren, welche Südamerika in großer Menge umschwärmen. Menschliche Wohnungen meiden sie, greifen auch nicht Kinder an. Oft schlafen solche in der freien Höhe, während ihre Väter Schnee sammeln, ohne daß diese irgend welche Sorge bezüglich der Raublust des Kondors haben müßten. Indianer versichern einstimmig, daß letzterer dem Menschen nicht gefährlich wird.
Bei der Mahlzeit verfahren die Kondore genau wie andere Geier. »Zuerst«, sagt Tschudi, »werden diejenigen Theile, welche am wenigsten Widerstand bieten, weggerissen, besonders die Augen, die Ohren, die Zunge und die weichhäutigen Theile um den After. Hier öffnen sie gewöhnlich ein großes Loch, um in die Bauchhöhle zu gelangen. Wenn sich eine größere Anzahl dieser Vögel auf einem Thiere versammelt, so reichen die natürlichen Oeffnungen nicht hin, um ihrem Heißhunger rasche Befriedigung zu gewähren. Sie reißen sich also einen künstlichen Weg auf, gewöhnlich an der Brust oder am Bauche. Die Indianer behaupten, der Kondor wisse ganz genau, wo das Herz der Thiere liege, und suche dies immer zuerst auf.« Vollgefressen wird der Kondor träge und schwerfällig, und auch er würgt, wenn er gezwungen auffliegen muß, die im Kropfe aufgespeicherte Nahrung heraus. »Der Kondor ist ein stolzer, majestätischer Vogel, wenn er mit ausgebreiteten, fast bewegungslosen Schwingen sich in den Lüften wiegt oder, auf einer hervorragenden Felsenspitze sich reckend, scharf das Land hinein nach Beute späht:
»Er packt den Fels mit krall'ger Hand,
Der Sonne nah' im öden Land,
Im blauen Luftmeer ist sein Stand.«
»Wenn er aber mit unsäglicher Gier seine Beute kröpft, große Fetzen von Aas hinunterwürgt und dann, vollgefressen, kaum noch einer Bewegung fähig, neben den Resten seines die Umgebung verpestenden Mahles zusammengekauert dasitzt, ist er doch nur ein ekelhafter Aasgeier.«
Die Brutzeit des Kondors fällt in unsere Winter- oder Frühlingsmonate. Absonderliche Liebeserklärungen seitens des Männchens gehen der Paarung voraus. Wie ich an gefangenen Kondoren beobachtete, balzen beide Geschlechter förmlich, um ihre Gefühle auszudrücken. In Zeitabständen, welche je nach der Höhe ihrer Erregung länger oder kürzer sein können, breiten sie die Flügel, biegen den vorher gestreckten und etwas aufgeblähten Hals nach unten, so daß die Schnabelspitze fast den Kropf berührt, lassen unter ersichtlichem Zittern der Zunge eigenartige, trommelnd murmelnde oder polternde Laute vernehmen, welche mit so großer Anstrengung hervorgestoßen werden, daß Gurgel und Bauch in zitternde Bewegungen gerathen, und drehen sich, langsam, mit kleinen Schritten trippelnd und mit den Flügeln zitternd, um sich selbst. Nach Verlauf einer, zwei oder drei Minuten stoßen sie den scheinbar eingepreßten Athem fauchend aus, ziehen den Hals zurück und die Flügel ein, schütteln ihr Gefieder, schmeißen wohl auch und nehmen ihre frühere Stellung wieder ein. Der andere Gatte des Paares nähert sich mitunter dem balzenden, streichelt ihn zärtlich mit Schnabel und Kopf, umhalst ihn förmlich und empfängt von ihm ähnliche Liebkosungen. Das ganze Liebesspiel währt ungefähr eine Minute, wird aber im Laufe einer Vormittagsstunde zehn- bis zwanzigmal wiederholt. Der Horst steht auf unzugänglichen Felsen, ist aber kaum Nest zu nennen; denn oft legt das Weibchen seine zwei Eier auf den nackten Boden. Die Eier, deren Längsdurchmesser hundertundacht, und deren Querdurchmesser zweiundsiebzig Millimeter beträgt, sind einfarbig und glänzend weiß. Häufiger als beim Bartgeier entschlüpfen zwei Junge. Sie kommen in graulichem Dunenkleide zur Welt, wachsen langsam, bleiben lange im Horste und werden auch nach dem Ausfliegen noch von ihren Eltern ernährt. Bei Gefahr vertheidigen sie letztere mit großem Muthe. »Im Mai 1841«, sagt Tschudi, »verirrten wir uns bei Verfolgung eines angeschossenen Hirsches in die steilen Kämme des Hochgebirges und trafen kaum anderthalb Meter über uns auf drei brütende Weibchen, welche uns mit grausenerregendem Gekrächze und mit den drohendsten Geberden empfingen, so daß wir fürchten mußten, durch dieselben von dem kaum sechzig Centimeter breiten Felsenkamme, auf dem wir uns befanden, in den Abgrund gestoßen zu werden. Nur der schleunigste Rückzug auf einen breiteren Platz konnte uns retten.«
Die Indianer fangen viele Kondore, weil es ihnen Vergnügen gewährt, sie zu peinigen. Man füllt den Leib eines Aases mit betäubenden Kräutern an, welche den Kondor nach dem Genusse des Fleisches wie betrunken umhertaumeln machen, legt in den Ebenen Fleisch inmitten eines Geheges nieder, wartet, bis er sich vollgefressen hat, sprengt, so schnell die Pferde laufen wollen, herbei und schleudert die Wurfkugeln unter die schmausende Gesellschaft, wendet endlich auch eine absonderliche Fangweise an, welche schon von Molina geschildert und von Tschudi und anderen bestätigt wird. Ein frisches Kuhfell, an welchem noch Fleischstücke hängen, wird auf den Boden gebreitet, so daß es einen unter ihm liegenden, hinlänglich mit Schnüren versehenen Indianer verdeckt. »Dieser schiebt, nachdem die Aasvögel herbeigekommen sind, das Stück des Felles, auf welchem ein Kondor sitzt, an dessen Füßen wie einen Beutel in die Höhe und legt um letztere eine Schnur. Sind einige so gefesselt, so kriecht er hervor, andere Indianer springen herbei, werfen Mäntel über die Vögel und tragen sie ins Dorf, woselbst sie für Stierhetzen aufgespart werden. Eine Woche vor Beginn dieses grausamen Vergnügens erhalten die Kondoren nichts zu fressen. Am bestimmten Tage wird je ein Kondor einem Stier auf den Rücken gebunden, nachdem dieser mit Lanzen blutig gestochen worden. Der hungrige Vogel zerfleischt nun mit seinem Schnabel das gequälte Thier, welches zur großen Freude der Indianer wüthend auf dem Kampfplatze herumtobt. In der Provinz Huarochirin befindet sich auf der Hochebene eine Stelle, wo diese Vögel mit Leichtigkeit in Menge erlegt werden. Dort ist ein großer, natürlicher, ungefähr zwanzig Meter tiefer Trichter, welcher an seiner oberen Mündung ebenso viel Durchmesser hat. An seinem äußersten Rande wird ein todtes Maulthier oder Lama hingelegt. Bald versammeln sich die Kondoren, stoßen beim Herumzerren das Thier in die Tiefe, und folgen ihm, um es dort zu verzehren. Sobald sie vollgefressen sind, können sie sich nicht mehr aus dem kaum fünf Meter weiten Boden des Trichters erheben. Dann steigen die Indianer, mit langen Stöcken bewaffnet, hinunter, und schlagen die ängstlich kreischenden Vögel todt.« Tschudi, welcher vorstehendes erzählt, fügt hinzu, daß er selbst an einem solchen Fange theilgenommen habe, bei dem achtundzwanzig Stück erlegt wurden. An gefangenen Kondoren sind sehr verschiedene Wahrnehmungen gemacht worden. Einzelne werden überaus zahm, andere bleiben wild und bissig. Häckel pflegte längere Zeit ihrer zwei, welche höchstliebenswürdig waren. »Ihren Besitzer«, schreibt Gourcy, »haben sie bald sehr lieb gewonnen. Das Männchen schwingt sich auf seinen Befehl von der Erde auf die Sitzstange, von dieser auf seinen Arm, läßt sich von ihm herumtragen und liebkost sein Gesicht mit dem Schnabel aufs zärtlichste. Dieser steckt ihm den Finger in den Schnabel, setzt sich ihm fast frei auf den Rücken, zieht ihm die Halskrause über den Kopf und treibt mit ihm allerlei Spielereien, wie mit einem Hunde. Dabei wird das Weibchen über das verlängerte Fasten ungeduldig und zieht ihn am Rocke, bis es Futter bekommt. Ueberhaupt sind sie auf die Liebkosungen ihres Herrn so eifersüchtig, daß ihm oft einer die Kleider zerreißt, um ihn von dem anderen, mit dem er spielt, wegzubringen.« Unter mitgefangenen Familienverwandten wissen sie sich Achtung zu verschaffen und diese zu behaupten. Wenn es zum Beißen kommt, gebrauchen sie ihren Schnabel mit Geschicklichkeit, Gewandtheit und Kraft, so daß selbst die bissigen Gänsegeier ihnen ehrfurchtsvoll Platz machen.
»Wie der Kondor die Aufmerksamkeit der ersten Reisenden in Peru auf sich zog«, sagt Tschudi, »so that es in Mejiko und Südamerika der Königsgeier. Er wird schon von Hernandez angeführt. Sein lebhaftes, zierliches Gefieder, wie es bei keinem anderen Raubvogel vorkommt, verdient ihm den Namen Rex vulturum, König der Geier.« Zudem ist er, wie alle großen Arten seiner Familie, welche mit kleineren verkehren, der Fürst und Beherrscher dieser letzteren, welche er durch Stärke und Eigenwillen in höchster Achtung hält.
Der Königsgeier ( Sarcorhamphus Papa, Vultur, Cathartes und Gyparchus Papa), nach Auffassung einiger Forscher Vertreter einer besonderen, gleichnamigen Untersippe ( Gyparchus), ist 84 bis 89 Centimeter lang, 1,8 Meter breit, der Fittig 52, der Schwanz 23 Centimeter lang. Alte, ausgefärbte Vögel tragen ein wirklich prachtvolles Kleid. Die Halskrause ist grau, der Vorderrücken und die oberen Flügeldeckfedern sind lebhaft röthlichweiß, der Bauch und die Unterflügeldeckfedern reinweiß, die Fittig- und Schwanzfedern tiefschwarz, die Schwingen außen grau gesäumt, Scheitel und Gesicht, welche kurze, steife, borstenähnliche Federn bekleiden, fleischroth, rundliche Warzen, welche das Gesicht hinter und unter dem Auge zieren, und eine wulstige Falte, welche nach dem Hinterhaupte verläuft, dunkelroth, Hals und Kopf hellgelb. Das Auge ist silberweiß, der hohe, lappig getheilte Kamm, welchen auch das größere Weibchen trägt, schwärzlich, der Schnabel am Grunde schwarz, in der Mitte lebhaft roth, an der Spitze gilblichweiß, die Wachshaut gelb, der Fuß schwarzgrau. Junge Vögel sind einfarbig nußbraun, auf dem Rücken dunkler, am Steiße und an den Unterschenkeln weiß.

Königsgeier ( Sarcorhamphus Papa). 1/5 natürl. Größe.
Durch Azara, Humboldt, Prinz von Wied, d' Orbigny, Schomburgk, Bonyan, Tschudi und andere sind wir über Aufenthalt und Lebensweise des Geierkönigs unterrichtet worden. Er verbreitet sich vom zweiunddreißigsten Grade südlicher Breite an über alle Tiefländer Südamerikas bis Mejiko und Texas und soll selbst in Florida vorgekommen sein. Im Gebirge findet er sich nur bis zu anderthalbtausend Meter über dem Meere. Sein eigentliches Wohngebiet sind die Urwaldungen oder die mit Bäumen bestandenen Ebenen. Auf den baumlosen Steppen und auf waldlosen Gebirgen fehlt er gänzlich. Er ist nach d'O rbigny höchstens halb so häufig als der Kondor, zehnmal seltener als der Urubu und funfzehnmal seltener als der Gallinazo. Die Nacht verbringt er, auf niederen Baumzweigen sitzend, meist in Gesellschaft, scheint auch zu gewissen Schlafplätzen allabendlich zurückzukehren; mit Anbruch des Morgens erhebt er sich und schwebt längs des Waldes und in dessen Umgebung dahin, um sich zu überzeugen, ob etwa ein Jaguar ihm die Tafel gedeckt habe. Hat er glücklich ein Aas erspäht, so stürzt er sich, sausenden Fluges aus bedeutender Höhe herab, setzt sich aber erst in geringer Entfernung nieder und wirft nur dann und wann einen Blick auf das leckere Mahl. Oft gewährt er seiner Gier erst nach einer viertel oder halben Stunde freien Lauf; denn er ist immer vorsichtig und überzeugt sich vorher auf das sorgfältigste von seiner Sicherheit. Auch er überfrißt sich manchmal so, daß er sich kaum mehr bewegen kann. Ist sein Kropf mit Speise gefüllt, so verbreitet er einen unerträglichen Aasgeruch; ist jener leer, so duftet er wenigstens sehr stark nach Moschus. Nach beendigter Mahlzeit fliegt er einem hochstehenden, am liebsten einem abgestorbenen Baume zu und hält hier Mittagsruhe.
Gewöhnlich sind es die überall häufigen Truthahngeier, welche noch früher als der Geierkönig ein Aas erspäht haben und ihm dasselbe durch ihr Gewimmel anzeigen. »Mögen auch«, sagt Schomburgk, »hunderte von Aasgeiern in voller Arbeit um ein Aas versammelt sein: sie werden sich augenblicklich zurückziehen, wenn sich der Königsgeier nähert. Auf den nächsten Bäumen oder, wenn diese fehlen, auf der Erde sitzend, warten sie dann mit gierigen und neidischen Blicken, bis ihr Zwingherr seinen Hunger an der Beute gestillt und sich zurückgezogen hat. Kaum ist dies geschehen, so stürzen sie wieder mit wilder und gesteigerter Gier auf ihr verlassenes Mahl, um die von jenem verschmähten Ueberbleibsel zu verschlingen. Da ich sehr oft Zeuge dieses Herganges gewesen bin, kann ich versichern, daß sich kein anderer Vogel einer gleichen Achtung und Aufopferung von seiten der kleinen Aasgeier rühmen kann. Wenn diese einen Königsgeier in der Ferne zu dem Mahle, bei welchem sie schon thätig beschäftigt sind, nahen sehen, ziehen sie sich augenblicklich zurück und machen, wenn der Königsgeier wirklich erscheint, ganz eigenthümliche Bewegungen mit den Köpfen gegen einander. Sie scheinen ihn förmlich zu begrüßen; so wenigstens deutete ich das Emporstrecken der Köpfe bei dem Auf- und Niederbewegen der Flügel. Hat der Geierkönig Platz genommen, so sitzen sie vollkommen still und sehen mit verlangendem Magen seiner Mahlzeit zu.« Tschudi bezweifelt vorstehendes, weil er das Herrscher- und Sklavenverhältnis nicht beobachtet hat, und bezeichnet Schomburgks Angaben als unrichtige; genau dasselbe Verhältnis findet aber, nach eigenen vielfachen Beobachtungen, zwischen den afrikanischen Ohren- und den Schmutzgeiern und, laut Jerdon, ebenso zwischen dem Kahlkopfgeier und letzteren statt.
Azara erfuhr von den Indianern, daß der Geierkönig in Baumhöhlen niste; der Prinz von Wied bezweifelt, Tschudi bestätigt diese Angabe; Schomburgk hat hierüber nichts erfahren können, d' Orbigny das Nest auch niemals gesehen, aber dasselbe gehört, was man Azara erzählte; Burmeister sagt, daß der Geier auf hohen Bäumen, selbst auf den Spitzen alter, abgestorbener, starker Stämme niste. Die zwei Eier, welche das Gelege bilden, sollen weiß sein. Ausgeflogene Junge sieht man noch monatelang in Gesellschaft ihrer Eltern.
Gefangene Geierkönige lassen sich leicht zähmen, bekunden jedoch nur ihrem Pfleger gegenüber Anhänglichkeit, wogegen sie gegen fremde Leute oft recht unfreundlich sein und eine Bissigkeit zeigen können, welche selbst dem Menschen Achtung vor ihren Waffen abringt.
Ganz Amerika wird bevölkert von den Rabengeiern ( Cathartes), welche neuerdings in zwei Sippen zerfällt worden sind, in Sein und Wesen aber wesentlich übereinstimmen, so daß ich dieser Zersplitterung nur Erwähnung thun, nicht aber weiter Rechnung tragen will.
Der Truthahngeier ( Cathartes aura und ruficollis, urbicola, septentrionalis und Ricordi, Catharista aura und burroviana, Vultur, Percnopterus, Oenops und Rhinogryphus aura) kennzeichnet sich durch verhältnismäßig kurzen, aber dicken Schnabel mit weit vorgezogener Wachshaut, welche die großen, länglichrunden, durchgehenden Nasenlöcher eben noch bedeckt, den in der oberen Hälfte nackten Hals, stufigen Schwanz und verhältnismäßig niedere Läufe. Der vorn nackte, hinten gewulstete Kopf, welcher außerdem noch eine vom Mundwinkel an über die Mitte des Scheitels verlaufende Wulst zeigt, ist vorn karmin-, hinten bläulich-, um die Augen blaß-, der nackte Hals fleischroth, der befiederte Theil des Halses wie der Oberrücken und die Unterseite schwarz, grünlich metallisch glänzend, jede Feder der Oberseite etwas lichter gerandet; die Schwingen sind schwarz, die Armschwingen mit breiten, verwaschenen fahlgrauen Rändern geziert, die Steuerfedern etwas dunkler als die Schwingen. Die Iris hat schwarzbraune, der Schnabel licht horngelbe, der Fuß weiße Färbung. Die Länge beträgt achtundsiebzig, die Breite einhundertvierundsechzig, die Fittiglänge neunundvierzig, die Schwanzlänge sechsundzwanzig Centimeter.
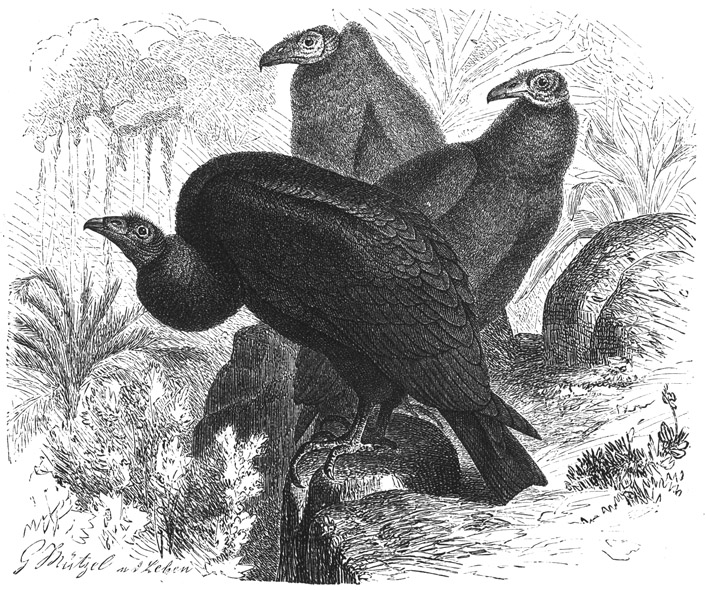
Truthahngeier ( Cathartes aura). 1/5 natürl. Größe.
Dem Truthahngeier gesellt sich im östlichen Südamerika der Urubu ( Cathartes Jota, Urubitinga, pernigra, ruficollis und falclandicus, Rhinogryphus burrovianus), ein jenem sehr ähnlicher Vogel, bei welchem jedoch nur Kopf und Gurgel nackt, Genick und Hinterhals aber befiedert sind.
Der Rabengeier oder »Gallinazo«, in Nordamerika »Schwarzgeier« oder »Aaskrähe« genannt ( Cathartes atratus und foetens, Vultur atratus und Urubu, Percnopterus Urubu, Catharista atrata, Coragyps atratus), kennzeichnet sich durch dünneren und längeren Schnabel, bei welchem die Wachshaut ebenfalls weit vorgezogen ist, während die kleineren, länglich runden und durchgehenden Nasenlöcher nahe der Wurzel liegen, durch kürzeren, gerade abgeschnittenen Schwanz und verhältnismäßig hohe Füße. Vom Schnabel über den Scheitel zum Nacken verlaufen schwache, ziemlich regelmäßig hinter einander stehende Querrunzeln, welche sich, mehr oder weniger unterbrochen, über Gesicht, Kehle und Vorderhals fortsetzen. Der nackte Kopf und der Vorderhals sind dunkel bleigrau, ins Mattschwarze übergehend. Das ganze Gefieder, Flügel und Schwanz inbegriffen ist mattschwarz, mit dunkel rostbraunem Widerscheine bei günstig auffallendem Lichte, die Wurzel der Schäfte der Fittigfedern weiß, das Auge dunkelbraun, der Schnabel schwarzbraun, an der Spitze horngrau. Die Länge beträgt sechzig, die Breite einhundertsechsunddreißig, die Fittiglänge neununddreißig, die Schwanzlänge achtzehn Centimeter.
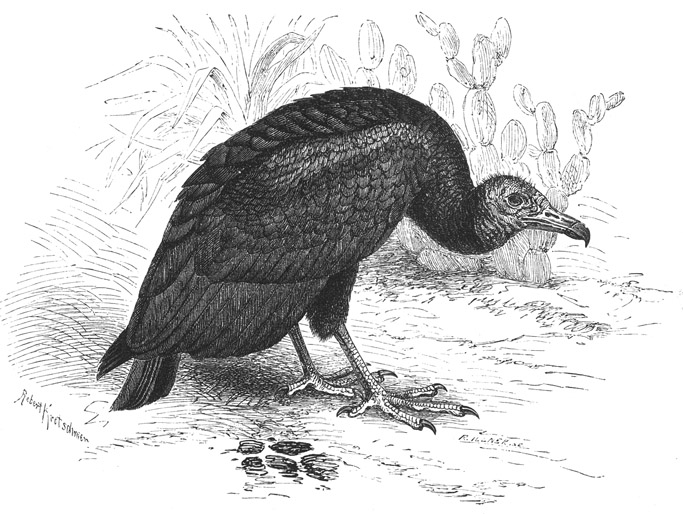
Rabengeier ( Cathartes atratus). ¼ natürl. Größe.
Die beiden beschriebenen Geierarten sind unter sich und mit dem noch erwähnten Urubu so vielfach verwechselt worden, daß es schwer hält, die bekannten Mittheilungen über ihr Leben immer richtig auf die eine oder andere Art zu beziehen; alle Rabengeier führen jedoch, soweit bis jetzt bekannt, eine so übereinstimmende Lebensweise, daß eine Zusammenstellung der wichtigsten Beobachtungen über dieselbe wohl ein ziemlich richtiges Bild von dem geben dürfte, was jeder einzelne thut und treibt. Ich werde daher wenigstens Truthahngeier und Urubu so behandeln, als ob sie gleichartig wären, bemerke auch, daß ich nicht immer Bürgschaft für richtige Anwendung der Namen übernehmen kann.
Der Truthahngeier verbreitet sich vom Saskatchewan an über ganz Nord-, Mittel- und Südamerika bis zur Magelhaensstraße und von der Küste des Atlantischen bis zu der des Stillen Meeres, tritt jedoch nicht überall in gleicher Häufigkeit auf; der Rabengeier dagegen gehört mehr dem Süden Amerikas an, findet sich in den Vereinigten Staaten nicht im Norden von Karolina, zählt aber in den an den Golf von Kalifornien angrenzenden Ländern, in Mittel- und Südamerika zu den gemeinsten Vögeln des Landes.
Ueber Lebensweise und Betragen der südamerikanischen Arten haben uns Uloa, Azara, Humboldt, der Prinz von Wied, d' Orbigny, Tschudi, Schomburgk, Darwin, Burmeister, Gosse, Taylor und Abott, über die nordamerikanischen Wilson, Audubon, Nutall, Gundlach, Ridgwah, Ord, Culloch, Coues und andere mehr oder minder ausführliche Berichte gegeben. Ihr Leben und Treiben ähnelt dem ihrer altweltlichen Verwandten; sie sind aber noch vertrauensseliger als letzterwähnte, weil in den meisten Ländern von Obrigkeitswegen eine hohe Strafe den bedroht, welcher einen dieser Straßenreiniger tödtet. Nicht überall kommen beide Arten zusammen vor; jede von ihnen bevorzugt vielmehr gewisse Oertlichkeiten. So lebt, nach Tschudi, der Truthahngeier mehr am Meeresufer und fast nie im Inneren des Landes, während der Gallinazo häufig in den Städten und einzeln auch wohl im Gebirge, aber nur selten am Strande gesehen wird. »Der Europäer, welcher zum ersten Male die Küste von Peru betritt, erstaunt über die unglaubliche Menge von Aasgeiern, welche er am Meeresstrande an allen Wegen und in den Städten und Dörfern trifft, und über die Dreistigkeit und Zuversicht, mit der sie sich dem Menschen nähern.« Sie scheinen zu wissen, daß sie, als höchst nothwendige Ersatzkräfte der mangelhaften Wohlfahrtsbehörde, geheiligt sind. In allen südamerikanischen Städten vertreten sie die Stelle unserer Straßenpolizei. »Ohne diese Vögel«, versichert Tschudi, »würde die Hauptstadt von Peru zu den ungesundesten des ganzen Landes gehören, indem von Seiten der Behörden durchaus nichts für das Wegschaffen des Unrathes gethan wird. Viele tausende von Gallinazos leben in und um Lima und sind so wenig scheu, daß sie auf dem Markte in dem dichtesten Menschengewühle herumhüpfen.« Im übrigen Süden, hier und da selbst im Norden Amerikas ist es nicht anders. Sie sind nicht bloß geduldete, sondern durch strenge Gesetze gesicherte Wohlfahrtswächter.
Ihre Bewegungen ähneln denen anderer Geier. »Sie gehen«, laut Prinz von Wied, »mit hoch aufgerichtetem Leibe umher und haben deshalb Aehnlichkeit mit einem Truthahne; daher wohl auch ihr Name. Sie fliegen leicht und viel schwebend, steigen auch oft in große Höhen empor, brauchen sich aber gewöhnlich wenig anzustrengen, weil es ihnen selten an Fraße fehlt. In der Ruhe sitzen sie mit eingezogenem Halse und gesträubtem Gefieder da und machen dann keinen angenehmen Eindruck.« Ihre Sinne sind scharf; doch ist es auch bei ihnen das Auge, welches sie beim Aufsuchen der Beute leitet. Audubon hat vielfache Versuche angestellt und gefunden, daß die Geier ohne ihr Auge verhungern müßten.
Eine ihrer Mahlzeiten schildert Burmeister in sehr lebendiger Weise. »Die großen schwarzen Vögel, welche auch in Brasilien das Aas aus dem Wege räumen müssen, finden sich überall ein. Wo ein Thier gefallen ist, lassen sie sich zu zwanzig, dreißig, vierzig und mehr auf das todte Geschöpf nieder, hacken ihm die Augen aus und warten mit einer Sehnsucht, welche unverkennbar in allen ihren Mienen sich ausdrückt, auf den köstlichen Augenblick, wo die unter den Einwirkungen der Sonne schnell im Körper gebildeten pestartigen Gase die faulige Bauchdecke sprengen und den duftigen Inhalt ihrem leckeren Gaumen darbieten werden. Ein furchtbares Gedränge entsteht, wenn endlich der langersehnte Augenblick eingetreten ist. Jeder packt ein Stück der hervorquellenden Eingeweide; im Nu ist das weiche, halb verfaulte Gedärme zerrissen und hinunter geschluckt. Dann sitzen die Geier vollgefressen und dicht an einander gedrängt auf dem nächsten hohen Baume, unverwandt nach dem Aase spähend, bis es soweit faul und erweicht worden ist, um weiter verzehrt werden zu können. Von Zeit zu Zeit läßt sich ein gieriger, welcher beim ersten Imbiß nicht genug bekommen hat, auf den ausgeweideten Körper herab, versucht hier und da einzuhauen, zaust an den Wundrändern und bahnt der um sich greifenden Verwesung einen Weg. Sehen die anderen, daß sein Unternehmen Erfolg hat, so fliegen sie bald nach, hacken und zerren auf dem Körper herum und verzehren einen Theil nach dem anderen, bis die Knochen vollständig rein und zernagt sind. In zwei Tagen sind sie fertig mit dem Geschäft, und wenn sie nichts mehr zu finden wissen, so betheiligen sich die Fliegen an der Ausführung der Arbeit.« Uebrigens gehen sie auch frisches Fleisch an, falls sie dasselbe zu zerstückeln vermögen, und ebenso ergreifen und erwürgen sie, trotz aller Behauptungen des Gegentheils, lebende Thiere. »Bei Tage«, sagt Humboldt, »streifen die Rabengeier an den Ufern umher und kommen mitten in das Lager der Indianer herein, um eßbares zu entwenden. Meist aber bleibt ihnen, um ihren Hunger zu stillen, nichts übrig, als auf dem Lande oder im seichten Wasser junge, achtzehn bis zwanzig Centimeter lange Krokodile anzugreifen. Es ist merkwürdig anzusehen, wie schlau sich die kleinen Thiere eine Zeitlang gegen die Geier wehren. Sobald sie eines ansichtig werden, richten sie sich auf den Vorderfüßen auf, strecken den Kopf aufwärts und reißen den Rachen weit auf. Fortwährend, wenn auch langsam, kehren sie sich dem Feinde zu und weisen ihm die Zähne, welche bei den eben ausgeschlüpften Thieren sehr lang und spitzig sind. Oft während so ein Geier die Aufmerksamkeit des jungen Krokodils ganz in Anspruch nimmt, benutzt ein anderer die gute Gelegenheit zu einem unerwarteten Angriffe. Er stößt auf das Thier nieder, packt es am Halse und fliegt damit hoch in die Luft. Wir konnten diesem Kampfspiele viele Vormittage lang zusehen.« Ihre Dreistigkeit und Unverschämtheit wird Menschen und Thieren lästig. So bemerkt der Prinz, daß sie aus allen Himmelsgegenden herbeistürzen, sobald ein Schuß im Walde gefallen ist. »Erlegten wir auf einem dicht beschatteten Waldbache eine Ente oder auch nur einen kleinen Vogel, so waren sie sogleich da und besetzten zu acht, zehn und mehreren die benachbarten Waldbäume und Aeste. Entfernte man sich nur einen Augenblick, so lag schon der geschossene Vogel auf dem Trockenen, um von ihnen verzehrt zu werden.« Dem Jaguar ergeht es nicht anders als dem menschlichen Jäger.« »Bei Joval«, erzählt Humboldt, »sahen wir den größten ›Tiger‹, welcher uns je vorgekommen. Er lag im Schatten einer großen Mimose und hatte eben ein Wasserschwein erlegt; aber seine Beute noch nicht aufgebrochen, nur eine seiner Tatzen lag darauf. Die Geier hatten sich in Scharen versammelt, die Reste vom Mahle des Jaguars zu verzehren. Sie ergötzten uns nicht wenig durch den seltsamen Verein von Frechheit und Scheu. So wagten sie sich bis auf einen halben Meter vor dem Jaguar vor, aber bei den leisesten Bewegungen desselben wichen sie zurück. Um die Sitten dieser Thiere mehr in der Nähe zu beobachten, bestiegen wir unser kleines Fahrzeug. Beim Geräusche der Ruder erhob sich der Jaguar langsam, um sich hinter den Büschen des Ufers zu verbergen. Den Augenblick, als er abzog, wollten sich die Geier zu Nutze machen, um das Wasserschwein zu verzehren; aber der Tiger machte trotz der Nähe unseres Fahrzeuges einen Satz unter sie und schleppte zornerfüllt, wie man an seinem Gange und dem Schlagen seines Schwanzes sah, die Beute in den Wald.« Als Eierdiebe sind auch die Rabengeier arg verschrieen: es wird ihnen nachgesagt, daß sie ihren Horst nur deshalb in der Nähe der Nester gewisser Sumpf- und Schwimmvögel anlegen, um deren Eier gleich bei der Hand zu haben. Nicht minder dreist, als angesichts fester Nahrung, benehmen sich sie an allen Trinkplätzen in solchen Gegenden, wo auf weithin Wasser spärlich ist. »Mein Hauswirt«, berichtet Tschudi, »klagte mir, daß die Rabengeier seinen Esel sehr häufig dursten ließen, und ich überzeugte mich am Morgen von der Richtigkeit dieser Angabe. Als nämlich dem Esel, welcher zum Herbeischleppen des für den Hausbedarf bestimmten Wassers benutzt wurde, ein im Hofe auf der Erde stehender Trog mit dem für ihn bestimmten Wasser angefüllt wurde, ließen sich unverzüglich gegen zwanzig Rabengeier auf dem Troge nieder, um ihren Durst zu löschen, und kaum entfernte sich einer, so nahm ein anderer dessen Stelle ein. Der arme Esel sah anfangs mit stummem Entsetzen diesem kecken Raube zu, ermannte sich sodann, drängte sich zum Troge und stieß einige der ungeladenen Gäste mit dem Kopfe weg. Diese aber hackten mit ihren scharfen Schnäbeln gegen das graue Haupt ihres Gegners und zwangen ihn zum Rückzuge. Nach kurzem, erbittertem Nachdenken drehte er sich plötzlich um und schlug mit seinen Hinterbeinen gegen die gierigen Vögel aus. Das wirkte für einen Augenblick. Einige hüpften vom Troge weg, und der Esel rannte wuthentbrannt und racheschnaubend hinter ihnen drein, bis er sie zum Wegfliegen nöthigte. Triumphirend und mit stolzem Selbstgefühle eilte er nun an den Trog zurück, fand ihn aber wieder dicht besetzt. Nun begann das nämliche Spiel und dauerte so lange, als die Rabengeier noch dursteten oder bis der Trog leer war. Der arme Teufel mußte nun wieder bis zum folgenden Tage warten, ehe er wenigstens den Anblick des Wassers genießen konnte. Nur wenn der Knecht mit einer Stange neben dem Troge stand und die Geier abwehrte, war es dem Esel möglich, ungestört seinen Durst zu stillen. Da die einzelnen Süßwasserquellen der Gegend fast Tag und Nacht von wasserschöpfenden Leuten besetzt sind, so müssen die Geier oft Durst leiden und suchen denselben durch List oder Gewalt zu löschen, wo sie eben können.«
Dem Menschen muß es absonderliches Vergnügen gewähren, die Geier bei ihrem Fressen zu stören. Schomburgk erzählt, daß die Officiere der Feste Joachim sich damit vergnügten, die Rabengeier, welche sich zu Scharen von drei- bis vierhundert über dem Schlachtplatze der Festung versammelten, mit Kanonen zu beschießen, welche mit kleinen Flintenkugeln geladen wurden. Bei solchen Gelegenheiten blieben oft ihrer vierzig bis fünfzig todt auf der Walstatt. »Unsere Indianer«, berichtet der ebengenannte weiter, »vergnügten sich an den Rastorten oft genug damit, daß sie ein Stück Fleisch an einen Angelhaken befestigten und diesen dann hinwarfen. Sowie dies geschehen, zappelte auch bereits der gierigste und schnellste an der Schnur. Dann wurde er auf die auffallendste Weise in ein wahres Scheusal verwandelt. Die übermüthigen Angler schmückten ihn mit fremden Federn, welche sie mit weichem Wachs befestigten, schnitten ihm Halskrause und dergleichen aus, setzten ihm eine Krone auf und schickten ihn dann wieder unter die Schar seiner Brüder zurück, wo der gespenstige Genosse das höchste Entsetzen erregte und nur zu bald verlassen und vereinsamt blieb, bis er seine falsche Kleidung wieder abgelegt hatte.« Taylor theilt uns mit, daß er ihnen oft ausgestopfte Thierbälge vorgeworfen und an ihrer vergeblichen Mühe, solche zu nutzen, sich ergötzt habe. »Besonderen Reiz«, sagt Burmeister, »gewährte es mir, die Geier bei ihrer Arbeit zu stören. Ich habe mir oft das Vergnügen gemacht, heranzuschleichen und einen Schuß unter sie zu thun. Nach allen Seiten stiebte der Schwarm wild aus einander und rauschte mit den großen Flügeln an mir vorüber, bis alle soweit sich erhoben hatten, daß sie außer dem Bereich der Gefahr zu sein glaubten. Dann kreisten sie wieder in ihren gewohnten Bogen langsam, ohne Flügelschlag hin und her durch die Luft, den Gegner beobachtend, so lange ihr scharfes Auge noch die Entfernung des Feindes erkennen konnte. Hernach sammelte sich die gefräßige Schar von neuem über dem Aase und ließ sich langsam auf die werthvolle Beute herab, hier einer den anderen von der Stelle drängend oder mit Schnabel und Flügel die Lieblingsstätte vertheidigend. Einen Ton hört man dabei nicht, sie sind bei allen ihren Bewegungen stumm.« Auch Raubvögel belästigen beide Geierarten. Caracara und Chimango fallen, wenn die Geier ihren Kropf gut gefüllt haben, über sie her und quälen sie so lange, bis sie die bereits geborgene Nahrung wieder ausbrechen.
Nach Tschudi horstet der Gallinazo auf Hausdächern, Kirchen, Ruinen und abgelegenen hohen Mauern, und zwar im Februar und März. Das Gelege soll aus drei weißlichbraunen Eiern bestehen. Der Urubu soll nach demselben Berichterstatter sandige Felsenrücken der Seeküste oder kleine Inseln in deren Nähe zur Anlage des Horstes wählen und hier zu derselben Zeit drei bis vier Eier legen, welche rundlicher und heller sind als die des Gallinazos. Alle übrigen Berichterstatter, mit Ausnahme Abotts, geben übereinstimmend an, daß beide Vögel nur zwei Eier legen, und zwar auf die bloße Erde, entweder in Felsenspalten oder unter einen halb umgefallenen Baumstamm, welcher der Brut etwas Schutz gegen die Witterung gewährt, auch wohl in eine Baumhöhle selbst und bezüglich unter Höhlungen im Gewurzel. In den südlichen Staaten Nordamerikas, in Texas und Mejiko, wählen die Geier am liebsten innerhalb sumpfiger Strecken einen Hügel, welcher bei Hochwasser nicht überschwemmt wird, zur Niststätte oder scharren unter einem Gebüsche eine seichte Höhlung aus, welche dann als Horst dient. Sehr häufig nisten sie mitten unter Reihern und anderen Sumpfvögeln. Beide Eltern brüten, nach Audubon, abwechselnd zweiunddreißig Tage lang, und einer der Gatten füttert dabei den anderen, indem er ihm das im Kropfe aufgespeicherte Aas vorwürgt. Die Jungen werden genau in derselben Weise geatzt, zuerst jedoch mit halb verdautem, fein zerstückeltem Aase, später mit größeren Bissen.
Gegenwärtig sieht man gefangene Rabengeier in allen größeren Thiergärten. Durch Azara erfahren wir, daß sie außerordentlich zahm, ja zu wirklichen Hausthieren werden können. Ein Freund dieses Forschers besaß einen, welcher aus- und einflog und seinen Herrn bei Spaziergängen oder Jagden im Felde, ja sogar bei größeren Reisen begleitete, wie ein folgsamer Hund auf den Ruf folgte und sich aus der Hand füttern ließ. Ein anderer begleitete seinen Pfleger auf Reisen über fünfzig englische Meilen weit, hielt sich stets zu dem Wagen und ruhte, wenn er müde war, auf dem Dache desselben aus, flog aber, wenn es heimwärts ging, voraus und kündigte hier die Rückkunft des Hausherrn an.