
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Winter 1914/15
Das Januarheft 1915 des Reichsarbeitsblattes veröffentlicht die folgende Übersicht über den Arbeitsmarkt auf Grund der Statistik der deutschen Arbeitsnachweise.
Auf je 100 offene Stellen kamen
Arbeitsgesuche
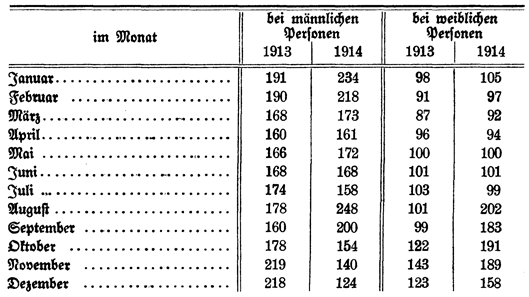
Diese kleine Tafel mit Zahlen ist ein ungemein lehrreiches und ergiebiges volkswirtschaftliches Dokument. Man kann aus ihr eine ganze Fülle von allgemeinen Tatsachen zu dem Thema »Der Krieg als Arbeitgeber« entnehmen. Und man kann von diesen Tatsachen die aufschlußreichsten Rückschlüsse machen auf die wirtschaftliche Widerstandskraft der Arbeiterscharen, die der Krieg in dieser Weise in ihren Aussichten und ihrer Verwendung beeinflußt hat.
Betrachten wir zuerst die Säule der männlichen Personen. Das Jahr 1913 war ein Jahr sehr ungünstiger Arbeitsgelegenheiten, ein Jahr gesteigerter Arbeitslosigkeit. Im Jahr vorher hatte sich die Ziffer der Stellensucher auf 100 angebotene Stellen von 192 im Januar abwärts bis 140 im Juli und wieder hinauf bis 175 im Dezember bewegt. Im Jahr 1913 geht die Zahl der Gesuche auf je 100 Stellen von dem gleichen Hochstande im Januar nur auf einen tiefsten Stand von 160 im September herunter, um dann rasch auf 218 im Dezember zu steigen. Die Arbeitslosigkeit war am Ende des Jahres 1913 so groß, daß auf 100 angebotene Stellen 218 Bewerber kamen. Im Anfang des Jahres 1914 ist diese Zahl noch höher gewesen. Sie hat dann aber schnell nachgelassen, und im Juli ihren tiefsten Stand von 158 erreicht.
Nun begann der Krieg. Seine Wirkung auf den Arbeitsmarkt zeigt sich sofort in dem Emporschnellen der Arbeitsuchenden auf 248 auf 100 angebotene Stellen. Das war die Zeit der raschen Lähmung der gesamten Industrie durch die Unsicherheit aller Verhältnisse, jene Zeit, als alle öffentlichen Körperschaften, erschreckt durch die Menschenansammlung an den Arbeitsnachweisen, in größter Schnelligkeit Notstandsarbeiten einrichteten, um einer in diesem Umfang nicht vorgesehenen Kriegsfolge durch besondere Veranstaltungen abzuhelfen.
Teils infolge dieser großartigen Notstandsarbeiten, viel mehr aber noch durch die selbständige Wiederbelebung von Gewerbe und Handel sinken die Arbeitslosenziffern ganz über Erwarten rasch. Man kann fast sagen: sie stürzen geradezu. Stürzen bis auf 124 Arbeitsuchende auf 100 angebotene Stellen, ein Verhältnis, das in Wirklichkeit kaum noch einen Überschuß von Arbeitsuchenden über angebotene Stellen bedeutet. (Man muß nämlich mit gewissen Doppelzählungen bei den Arbeitsuchenden rechnen, die sich bei verschiedenen Arbeitsnachweisen gleichzeitig zu melden pflegen.)
Die Industrie hat ihre Riesenglieder nach der ersten Lähmung wieder gereckt, und ihre Arbeitssäle und Werkstätten haben die ungeheuer gestiegene Reservearmee der Arbeitskräfte in raschem Tempo wieder aufgesogen.
Der weibliche Arbeitsmarkt bietet nun ein vollständig anderes Bild. So überraschend anders in allen Einzelheiten, daß sich daraus die charakteristischen Eigentümlichkeiten der Frauenarbeit mit einer Deutlichkeit ablesen lassen wie vielleicht noch niemals in normalen Zeiten.
Die Arbeitslosigkeit unter den Frauen ist normalerweise niemals so hoch wie unter den Männern. Auch die kritische Zeit für den Arbeitsmarkt am Ende des Jahres 1913 und in den ersten Monaten von 1914 äußert sich bei der Frauenarbeit in ganz anderer Form. Daß die Zahl der Arbeitsuchenden bei den Frauen immer in der Mitte des Quartals besonders hoch ist und am Anfang des Quartals stark herabsinkt, liegt vielleicht an dem Überwiegen von Dienstmädchen und Handelsangestellten, die am häufigsten zum Quartalswechsel neue Stellungen aufsuchen, sich daher in der Mitte des Quartals bei den Arbeitsnachweisen einstellen und im ersten Monat versorgt sind. Natürlich haben auch die Saisonindustrien mit ihrer weiblichen Arbeiterschaft auf diese besonderen Bewegungen von Angebot und Nachfrage auf dem weiblichen Arbeitsmarkt Einfluß. Jedenfalls ist es interessant, daß in der schlimmsten Zeit des Jahres 1913 die Zahl der Arbeitsuchenden auf 100 Stellen nicht höher als 143 ging, und schon im Januar 1914, während sie bei den Männern noch erheblich steigt, beinahe auf pari zurückgeht. In den ersten Monaten ist ein dauernder Mangel an weiblichen Arbeitskräften zu bemerken, während bei den Männern immer noch die Zahl der Arbeitsuchenden um 50 bis 75% die der angebotenen Stellen übertrifft.
Mit dem Kriegsausbruch nun verändert sich dieses Verhältnis der weiblichen Arbeitslosen zur ziffernmäßigen Bewegung der männlichen in ganz charakteristischer Weise. Daß die allgemeine industrielle Lähmung sich bei den Frauen in dem prozentual stärkeren Ansteigen der Arbeitsuchenden äußert, erklärt sich zum Teil aus der Verminderung der männlichen Arbeitskräfte durch die Truppeneinziehungen. Nicht aus denselben Ursachen aber kann man das sehr langsame Sinken der weiblichen Arbeitslosenziffern von da ab erklären. Während die Zahl der stellensuchenden Männer, die auf 100 offene Stellen entfällt, vom August bis zum Dezember genau um die Hälfte sinkt, bleibt diese Zahl bei den Frauen bis zum November doch ziemlich auf gleicher Höhe, um erst im Dezember – wesentlich mit durch die stärkere Einstellung kaufmännischer Angestellter in das Weihnachtsgeschäft – auf 158 herabzusinken.
Woraus erklärt sich die Tatsache, daß der soviel günstigere Stand des weiblichen Arbeitsmarktes in Friedenszeiten sich im Krieg genau in sein Gegenteil verkehrt hat?
Die Verminderung des Arbeitsangebotes der Männer durch die Truppeneinziehungen spielt selbstverständlich eine Rolle dabei. Es wäre ja aber an sich nicht ausgeschlossen, daß die freiwerdenden Plätze der Reserven, der Landwehr und des Landsturms auch auf die Gestaltung des weiblichen Arbeitsmarktes günstig hätten wirken können. Das ist nun tatsächlich in nur ganz geringem Umfang der Fall gewesen. Es hat nicht sehr viele Männerplätze gegeben, die durch Frauen ausgefüllt wurden oder ausgefüllt werden konnten. Auch wo es sich nicht um körperlich ungeeignete Arbeiten handelte, haben die Frauen nur in ganz kleinem Umfang männliche Posten einnehmen können. Ihre Hemmung war ihre mangelnde Ausbildung und Fähigkeit.
Diese Hemmung hat aber auch zum Teil die Ursache abgegeben dafür, daß überhaupt prozentual so viel mehr Frauen durch die Kriegsereignisse aus ihrer Arbeit herausgeworfen wurden als Männer. Besonders im Handelsgewerbe hat sich das gezeigt. Man hat bei der Verminderung des Personals die leicht ersetzbaren Kräfte, die Verkäuferinnen, die mit minder verantwortlichen Aufgaben betrauten Buchhalterinnen zuerst abgeschoben. Man hat sich selbstverständlich, soweit es irgend ging, wenn auch mit Opfern, die qualifizierteren Kräfte, die für das Geschäft einen rein individuellen Vorteil bedeuteten, zu erhalten gesucht. Und unter diesen Kräften waren eben doch Frauen nicht in nennenswertem Umfang. Ähnliches vollzog sich in der Konfektion. Die fähigeren Kräfte waren imstande, für die gewaltigen Qualitätslieferungen an das Heer sich einstellen zu lassen. Die halb geschulte Arbeiterin, die irgendeine Teilarbeit in der Damenkonfektion verstand, besaß diese Fähigkeit der Umschaltung nicht in wünschenswertem Maße. Es ist immer schon von Unternehmern beobachtet worden, und es hat sich jetzt auch in den Arbeitsstuben gezeigt, die von Wohlfahrtsorganisationen geschaffen sind, daß die Frauen schwerfälliger sind in der Übernahme irgendwelcher ungewohnten neuen Arbeit. Sie sind so befangen in der Einstellung auf das, was sie immer gemacht haben, daß sie die Gelegenheit eines Arbeitswechsels eher vermeiden und scheuen als begrüßen und aufsuchen.
Selbstverständlich ist aber auch an der ungünstigen Gestaltung des weiblichen Arbeitsmarktes die Tatsache schuld, daß die durch den Krieg gehemmten Industrien gerade die Industrien mit der starken Frauenarbeit sind. Unsere ziffernmäßig stärksten Frauenindustrien sind das Bekleidungsgewerbe, die Textilindustrie, die Industrie der Nahrungs- und Genußmittel. Relativ hohe Frauenziffern finden sich auch in der chemischen Industrie. Und neuerdings stark gestiegen ist der Anteil der Frauen an der Metallindustrie. Wie ist es nun diesen Industrien im Kriege gegangen?
Im Bekleidungsgewerbe trat zunächst der vollständige Stillstand ein. Am 15. August schon veranstaltete das Reichsamt des Innern eine Konferenz, die sich speziell mit dem Problem der weiblichen Arbeitslosigkeit in der Konfektion zu beschäftigen hatte. Ihr Ergebnis war letztlich die Gründung des Ausschusses für Konfektionsnotarbeit, der nach seinem damaligen Aufruf den arbeitslosen Berufsarbeiterinnen, die schon bisher im Konfektionsgewerbe tätig gewesen waren, Notstandsarbeiten verschaffen wollte. Solche Notstandsarbeiten sind in der Gestalt von Nähstuben und Strickstuben allenthalben schnell entstanden. Sie hatten aber im Grunde schon von Anfang an kaum den Charakter einer wirklichen Notstandsarbeit, sofern man unter einer solchen eine Arbeit versteht, für die ein wirtschaftliches Bedürfnis nicht vorliegt. Vielmehr haben die allermeisten dieser Arbeitsstuben für Heereslieferungen gearbeitet, sind also lediglich Vermittlungsstellen gewesen für eine Arbeit, die andernfalls durch die gewöhnlichen Wege geschäftlicher Verteilung auch an ihre Arbeitskräfte gekommen wäre. Allerdings hat die Heeresverwaltung sich durch Gesichtspunkte der sozialen Fürsorge insofern bestimmen lassen, als sie Aufträge schneller ausgegeben hat, als es unbedingt notwendig war, und insbesondere dafür gesorgt hat, daß die sozialen Vereine dabei berücksichtigt wurden.
Notstandsarbeiten im eigentlichen Sinne leisteten dagegen die Strick- oder Nähstuben, die grundsätzlich keine gelernten Konfektionsarbeiterinnen einstellten, sondern den Arbeiterinnen anderer Industrien Strick- und Näharbeit vermittelten, indem sie ihnen zugleich die notwendige fachmäßige Anleitung gaben und aus Wohlfahrtsmitteln höhere Löhne verschafften, als die sie mit ihrer eigenen geringen Fertigkeit hätten verdienen können.
Mit Hilfe dieser Wohlfahrtsorganisationen, aber auch und in höherem Maße durch den steigenden Bedarf der Industrie selbst, ist im Bekleidungsgewerbe der Beschäftigungsgrad der Arbeiterinnen von Monat zu Monat besser geworden. Bestimmte Zweige dieses Gewerbes haben begreiflicherweise niemals einen wirklich guten Beschäftigungsgrad erreichen können, z. B. ist die Damenkonfektion im ganzen trotz einer leichten Steigerung ihres Bedarfs nicht in eine eigentlich günstige Lage hineingekommen. Die Hutmacherei, die Industrie der Schürzen und Unterröcke, die Korsettindustrie, auch die Schirmindustrie sind bei niedrigem Beschäftigungsgrad stehengeblieben, selbst wo sie sich auf Heeresbedarf umgeschaltet haben – so hat z. B. die Schirmindustrie durch Herstellung von Militärwesten ihre Lücke auszufüllen gesucht. Auch die Korsettindustrie hat bestimmte Militärartikel herzustellen begonnen. Im allgemeinen zeigt sich aber die Steigerung des Bedarfs an Arbeitskräften durch die wachsende Zahl von Vermittlungen, die die Arbeitsnachweise in der Rubrik »Schneiderinnen« aufweisen. Die Ziffern sind für
| August | 4700 |
| September | 13 800 |
| Oktober | 16 700 |
| November | 15 500 |
| Dezember | 8200. |
Die Bewegung dieser Ziffern zeigt, wie sehr steigender Bedarf die verfügbare Armee der arbeitslosen Schneiderinnen allmählich aufgesogen hat. Wenn die Zahl der Vermittlungen im Dezember wieder sinkt, so bedeutet das keine Vermehrung der Arbeitslosigkeit. Es zeigt vielmehr an, daß die Beschäftigungen dauernd gewesen, neue Vermittlungen aus Befriedigung des Bedarfs und Rückgang der arbeitsuchenden Kräfte nicht mehr notwendig gewesen sind. Es ist nicht feststellbar, wie weit nun dieser steigende Beschäftigungsgrad der Schneiderinnen darauf zurückzuführen ist, daß die Frauen bei Militärbekleidungsstücken, Mänteln, Uniformen usw. eingestellt wurden. Wir haben darüber nur Einzelangaben, die von einer starken Inanspruchnahme weiblicher Kräfte bei der Herstellung von Militärmänteln berichten. Daß bei besserer Ausbildung der Beschäftigungsgrad der Frauen ein noch sehr viel höherer und insbesondere ihre Fähigkeit, die ausgeschaltete Männerarbeit zu ersetzen, eine sehr viel größere hätte sein können, liegt auf der Hand.
In der Textilindustrie hat der schlechte Geschäftsgang länger angehalten. In manchen Zweigen, z. B. der Samt- und Seidenwarenindustrie, mußte er dauernd bleiben, während andere: Leinen, Tuche, Garn usw. teils von Anfang an, teils schon gleich in den ersten Wochen nach der Mobilmachung in großem Umfang für den Heeresbedarf arbeiten mußten. Die feste Stelle, die in diesem Industriezweig die Frauenarbeit seit lange einnimmt, zeigt sich in charakteristischer Weise darin, daß hier die Frauen nicht etwa in stärkerem Maße als die Arbeiter abgestoßen und entbehrlich werden. Die Ziffern des Ortsverbandes Berlin des Textilarbeiterverbandes über seine arbeitslosen Mitglieder sind dafür charakteristisch. Die männlichen Arbeitslosen dieses Verbandes sanken vom 7. September bis zum 2. November von 561 auf 193, die weiblichen in etwa der gleichen Progression von 249 auf 84. In den Ziffern der Vermittlungen zeigt sich gleichfalls die rasche Wiederbelebung der Textilindustrie. Durch die Arbeitsnachweise wurden Textilarbeiterinnen eingestellt im
| August | 520 | gegen | 469 Männer |
| September | 1156 | " | 790 Männer |
| Oktober | 1353 | " | 1234 Männer |
| November | 2052 | " | 1431 Männer |
| Dezember | 1396 | " | 1107 Männer |
Hier geht also die Zunahme der Beschäftigung der Frauen ziemlich der der Männer parallel, ja übersteigt sie noch.
In der Metall- und Maschinenindustrie hat sich in den letzten Jahren der Anteil der weiblichen Arbeiterschaft ganz außerordentlich gehoben. Es sind im wesentlichen ungelernte oder halbgelernte Kräfte, die von den Frauen gestellt wurden. Die Folge dieser Tatsache war auch hier wieder ein Abschieben der weiblichen Kräfte angesichts der großen Lähmung in dem ersten Kriegsmonat. Aus der Kleineisenindustrie wird vom August gemeldet, daß ein Überschuß an weiblichen Hilfskräften vorhanden sei, und ebenso berichtet die Maschinenindustrie von einem starken Mangel an gelernten und einem unverwendbaren Überfluß an ungelernten Arbeitskräften. Der Beschäftigungsgrad all dieser Industrien ist nun bis zu einer nie dagewesenen Hochkonjunktur gestiegen durch die Munitionsherstellung, auf die sich alle allmählich eingerichtet haben. Hier hat man auch die Frau zum Teil zu solchen Arbeiten herangezogen, die sonst von Männern verrichtet worden sind. Die wachsende Einstellung weiblicher Kräfte zeigen die Ziffern der Arbeitsnachweise deutlich genug. Es wurden Metallarbeiterinnen eingestellt im
| August | 150 |
| September | 397 |
| Oktober | 664 |
| November | 619 |
| Dezember | 1341 |
Vermutlich wird man aber auch die allgemein unter dem Namen »Fabrikarbeiterinnen« in der Statistik erwähnte Gruppe zum Teil auf die Munitionsherstellung anrechnen müssen. Die Vermittlung von Fabrikarbeiterinnen zeigt uns folgende Bewegung:
| August | 1820 |
| September | 1246 |
| Oktober | 2175 |
| November | 2697 |
| Dezember | 2567 |
Im ganzen genommen zeigt die Bewegung auf dem weiblichen Arbeitsmarkt in den Kriegsmonaten eine Steigerung des ganzen industriellen und gewerblichen Gebietes und einen relativen Rückgang der Vermittlungen von Dienstboten, Aufwartefrauen, Kochpersonal, Gastwirtschaftspersonal. Daß selbstverständlich die Vermittlung von landwirtschaftlichem Personal ihren Höhepunkt im August hatte und dann allmählich ganz zurückgeht, liegt in der Natur der Sache. Im August sind zahllose Arbeiterinnen aus den Städten in die landwirtschaftliche Arbeit eingetreten. Der Berliner Zentralverein für Arbeitsnachweis in Berlin nennt z. B. am 2. September 2700 Arbeiterinnen, die aufs Land vermittelt wurden. In München sind während des August zirka 2200 städtische Arbeiterinnen für Landarbeit vermittelt.
Fast am deutlichsten tritt die besondere Lage der Frauenarbeit hervor im Handelsgewerbe. Die Arbeitslosigkeit der Frauen ist im Handelsgewerbe durchgehend erheblich größer geblieben als bei den männlichen Angestellten. Am Schluß des Jahres 1914 befanden sich von den männlichen Stellenbewerbern in ungekündigter Stellung 12%, in gekündigter Stellung 25%, stellenlos waren 63%. Bei den weiblichen Angestellten waren die entsprechenden Ziffern 4, 9 und 87%. Der kaufmännische Verband für weibliche Angestellte und ein Kontoristinnenverein aus Hamburg haben noch im vierten Vierteljahr 1914, also trotz des stärkeren Bedarfs beim Weihnachtsgeschäft, den höchsten Prozentsatz stellenloser Mitglieder (4,1; 7,6), während der Verein der deutschen Kaufleute auf 100 männliche Mitglieder 3,4 und auf 100 weibliche Mitglieder 5,1 Stellenlose zählte. Ohne Zweifel sind nun im gesamten Handelsgewerbe doch zahlreich und soweit es irgend möglich war männliche freiwerdende Stellen auch durch Frauen besetzt worden. Aus dem Bankgewerbe wird berichtet, daß, um die Einstellung weiblicher Kräfte in die Posten der eingezogenen Kollegen zu verhüten, die zurückgebliebenen Beamten lieber eine große Last von Überstunden auf sich nehmen. Ziffernmäßige Belege für den Ersatz männlicher Kräfte durch weibliche gibt es selbstverständlich, zurzeit wenigstens, nicht.
Im ganzen lehrt aber doch ein Überblick über den Arbeitsmarkt im Kriege sehr deutlich, daß die Möglichkeit für die Frauen, leer gewordene männliche Posten zu besetzen, verhältnismäßig gering war. Sonst wäre undenkbar, daß die Arbeitslosigkeit der Frauen dauernd größer bleibt als die der Männer, ja, während die der Männer allmählich fast verschwindet und in ungezählten Berufen ein ganz starker Mangel an Arbeitskräften eingetreten ist, doch immer noch große Scharen von Frauen in dieser von Arbeit ganz und gar erfüllten und gestrafften Zeit sich vergebens anbieten. Die einzige Stelle, wo sich das Eintreten der Frau für den Mann ohne weiteres vollzieht, ist die Landwirtschaft. In welchem Umfang die Frau hier auch tatsächlich den Mann ersetzt, darüber kann man jetzt noch kein Urteil fällen. Eins aber ist sicher hier wie überall sonst: die Heranziehung der Frau zur wirtschaftlichen Kriegsleistung der Heimat hat ihre Grenzen genau an der Stelle, wo ihr durch unzulängliche Ausbildung die Elastizität fehlt, die heute zahllose Kräfte fähig macht, auch außerhalb des gewohnten Gleises verwandt zu werden.
Das ist die große Kriegslehre auf dem weiblichen Arbeitsmarkt.