
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
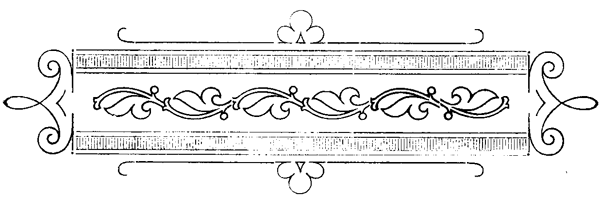
Seit halb zehn Uhr Morgens läuteten alle Glocken zum Pfingstfest, und Diana, welche vergessen hatte, den Glöckner verständigen zu lassen, erwachte zum zweiten Male.
Hatte sie wirklich geträumt? Anfänglich zweifelte sie nicht daran. In den Träumen Diana's waltete eine sehr lebhafte und wollüstige Einbildungskraft. Sie hatten ihr viele Phantasien eingegeben, welche sie manchmal einen ganzen Tag nachdenklich machten und welche sie nicht ohne einen gewissen Respekt überlegte, weil sie in wachem Zustande unfähig gewesen wäre, solche Phantasien auszuhecken. Die Erinnerungen an diese Träume waren wie Meilenzeiger in ihrem eintönigen Leben. Sie hörte sich ganz deutlich, wenn sie sich sagte, daß dieses und jenes kleine Ereigniß vor dem Traume mit dem Tambourmajor, oder nach dem Traume mit dem kleinen Neger zwischen den zwei Lehrerinnen geschehen sei. Sie wollte sich denn schon entschließen, den Traum mit dem Pagen den vielen anderen anzureihen, als sie, Gründe der Ungewißheit entdeckend, welche ihr nicht blos von der Überlegung kamen, und anderseits ein so phantastisches Vorkommniß nicht als wahrscheinlich ansehen könnend, in die tiefste Verwirrung gerieth.
König Pausol, welchen das helle Geläute schließlich aus seinem tiefen und süßen Schlafe geweckt hatte, setzte sich auf und sprang sogleich vom Bette.
Es war seine Geschäftsstunde.
Er mußte einen seiner Räthe sehen.
Er ließ Giglio kommen.
Der Page ließ auf sich warten, denn er hatte nach einem harten Tage nur wenig geschlafen. Zuerst Rosine, dann Thierrette, dann Philis, dann Emmanuela und endlich Diana mit der Puderquaste hatten nach einander erprobt, was er an Energie, an Ausdauer und an Geschicklichkeit ihnen zu bieten hatte, aber man begreift, daß solche Leistungen bei ihm ein wenig Schwindel und sogar Niedergeschlagenheit zur Folge hatten. So dauerte es denn zwanzig Minuten, bis er dem Rufe des Königs Folge leisten konnte, nachdem er kaum zweiundeinhalb Stunden geruht hatte. Pausol hatte schon sein Zimmer verlassen, um sich in sein Toilette-Kabinet zu begeben.
Gilles trat ein und da er sehr schlecht erzogen war, sah Diana sofort an seinem Lächeln, daß er offenbar ihren Traum wenigstens getheilt hatte.
Nach einem Augenblick der Verwirrung fand sie sich mit diesem Abenteuer ab, für welches sie so wenig verantwortlich war. Von ihrem Bette aus winkte sie dem Pagen, näher zu treten, umfing sein rechtes Bein mit einem schmachtenden, nackten Arme und sagte ihm langsam und ganz leise:
– Räuber! Bösewicht! Hundsfott! Schandkerl! Galgenvogel!
Er antwortete mit der Artigkeit eines fünfjährigen Kindes:
– Verzeihung, Madame!
– Ich verabscheue Dich.
– Ja, Madame.
– Wer hat Dich das gelehrt?
– Meine kleine Schwester.
– Noch einmal und …
– Ich werde es nicht wieder thun.
– Wenigstens so unvorsichtig.
– Ach, ja!
– Und mit Niemandem.
– Mit Niemandem, Niemandem, Niemandem. Und niemals, niemals, niemals!
Diana versetzte ihm lachend einen Schlag und fuhr in ernsterem Tone fort:
– Ich hoffe, daß wir heute Abend die weiße Aline nicht wiederfinden werden.
– Ach, Sie wollen nicht?
– Nein, nicht sogleich!
– Sehr gut.
Dann, um der jungen Frau durch eine Vertraulichkeit zu schmeicheln, die ihm übrigens nicht die geringste Schwierigkeit bereitete, fügte er hinzu:
– Es ist noch eine Zweite entflohen.
– Wer?
– Fräulein Lebirbe, die Ältere.
– Seit wann?
– Diese Nacht. Sie hat mir, auseinandergesetzt, daß der Hang zu einer regellosen Lebensweise, den sie in sich fühlt, im Familienleben sich nur schwer befriedigen lasse. Da schickte ich sie denn …
– Oh, das ist schlecht!
– Da schickte ich sie denn zu einer respektablen Dame, die in Tryphema ein eigenartiges Hotel hält, wo zahlreiche verheirathete Frauen mit Herren zusammenkommen, die – ebenfalls verheirathet sind, aber nicht mit ihnen …
– Sie kleiner Bandit! Das ist abscheulich!
– Keineswegs. Herr Lebirbe ist Präsident des Vereins zur Bekämpfung der Unzucht in den Familien, einer wunderbaren Gesellschaft, deren Thätigkeit ein wenig nachläßt, wie mir scheint. Wenn er erfahren wird, daß seine ältere Tochter in einem berühmten Hause alle Unzucht gestattet, wird dies seinen Eifer für die gute Sache anspornen.
Diana's lautes Lachen wurde vom König Pausol gehört, der nach seinem Bade sich in einem Morgenanzuge zeigte.
– Ach, Du bist's, Kleiner? rief er. Ich habe Dir nur zwei Worte zu sagen: Du hast gestern eine Untersuchung geführt, die eine hellsichtige gewesen sein muß, und deren Erzählung ich von Dir nicht verlange. Ich habe soeben das Briefchen gelesen, das Du gefunden hast. Dasselbe ist sehr warm, gibt aber keinen Aufschluß. Weißt Du, was aus meiner Tochter geworden ist? Wo mag sie heute sein? Das ist Alles, was ich wissen will.
Giguelillot war herzlich gern bereit, die weiße Aline zu retten, aber aus verschiedenen Gründen wollte er zugleich sich ihr nähern. Er gab Diana ein kaum merkliches Zeichen und antwortete dem König:
– Sie ist in Tryphema.
– Das genügt mir. Bist Du der Ansicht, daß wir heute noch nach einer neuen Station aufbrechen? Ich werde Nixis der Form halber um Rath fragen, da er des Morgens mein Rathgeber ist, aber ich habe mehr Vertrauen zu Dir.
– Es wird in der That besser sein, daß wir aufbrechen.
– Du hast Recht. Welche Stunde scheint Dir geeignet?
– Um die Mitte des Nachmittags.
– Welche Entfernung haben wir zurückzulegen?
– Tryphema ist vier Kilometer von hier entfernt, man erreicht die Stadt in drei Viertelstunden.
– Das ist viel, aber wir werden es leisten. Ich fühle mich heute Morgens in sehr guter Verfassung. Geh' und schicke mir Nixis.
Alsbald erschien der Palastmarschall.
– Sire, sagte er, heute Morgens ist ein neues Verbrechen begangen worden. Eine Jungfrau ist ihren zärtlich liebenden Eltern entführt worden.
– Was?
– Ja, durch einen unbekannten Verführer. Die ältere Tochter unseres Hauswirthes ist nicht mehr in ihren Gemächern.
– Hahaha! lachte der König. Der arme Lebirbe! Das mußte ihm widerfahren.
– Ich kann nicht umhin, einen gewissen Zusammenhang zwischen den ungewöhnlichen Ereignissen festzustellen, welche seit einigen Tagen geschehen sind und welche sich sämmtlich als Raub oder geheime Verführung darstellen.
– Diese Behauptung ist unhaltbar, sagte der König in mürrischem Tone. Abgesehen davon, daß ich meine Gründe habe, sie unrichtig zu finden, sagt uns schon die gesunde Vernunft, daß das nämliche Individuum nicht mehr als ein Mädchen auf einmal verführen und entführen kann. Mein Herr Groß-Eunuch, Sie sind in galanten Dingen fürwahr zu unwissend. Haben Sie mir nichts Anderes zu berichten?
– Der Unbekannte, welchen ich noch immer für den alleinigen Urheber aller der Anschläge halte, welche, in den letzten Tagen begangen worden, ist verhaftet oder doch nahe daran, verhaftet zu werden. Ich harre nur eines Winkes Eurer Majestät.
– Ach, wenn dem so ist, so gebe ich meine Zustimmung. Ich beglückwünsche Sie, mein Freund. Sie ersparen mir damit eine Reise, deren Beschwerlichkeit ich allmälig unliebsam zu empfinden beginne. Man mache ein Ende! Wo ist der Beschuldigte?
– Auf dem Wege nach Tryphema.
– Und wer begleitet ihn?
– Die Prinzessin Mine.
– Woher wissen Sie es?
– Indem ich in den Gemächern des Fräuleins Lebirbe meine Nachforschungen hielt, fand ich daselbst ein mächtiges Fernrohr, dessen das keusche Kind sich ohne Zweifel zu einem astronomischen Zwecke bediente, um allnächtlich das unergründliche Werk des Schöpfers zu betrachten, welches das Firmament …
– Kürzer, kürzer, Nixis. – Sie sind zu weitschweifig.
– Ich ergriff das Fernrohr und bediente mich desselben, um die Umgegend zu betrachten. Die Vorsehung wollte, daß dieser Gegenstand in meinen Händen zum Instrument einer Entdeckung werde. In einer Entfernung von etwa 200 Metern, auf der Straße nach Tryphema, bemerkte ich einen jungen Mann, dessen Kleidung genau derjenigen glich, welche mir als die des gesuchten Verbrechers geschildert wurde. Neben ihm schritt die Prinzessin Aline, mit dem grünen Kleide angethan, welches seit zwei Wochen Jedermann im Palaste kennt. Das ist das Ergebniß meiner Bemühungen. Ich glaube Ew. Majestät bemerken zu sollen, daß ein rascher Entschluß und rasches Handeln nothwendig sind, wenn Ihre Pläne, welcher Art immer sie seien, Erfolg haben sollen.
– Über einen ersten Punkt ist meine Meinung eine formelle, sprach der König; kein Anderer als ich selbst wird die Mission haben, meine Tochter festzunehmen. Von diesem Entschlusse werde ich nicht abgehen, ich hatte zuviel Mühe, ihn zu fassen.
– In diesem Falle müssen wir sofort aufbrechen.
– So gehen wir denn. Sind die Koffer bereit?
– Die meisten ja, die übrigen werden nachfolgen.
– Walten Sie Ihres Amtes, Nixis, und empfehlen Sie sich.
Man versammelte sich im Hofe, wo die Garde von der Treppe bis zum Gitterthor Spalier bildete.
Giglio saß schon im Sattel und zeigte sich dem neugierigen Volke, als aus einer Gruppe von Bauern die schöne Thierrette hervortrat. Lächelnd, mit matten Augen kam sie etwas mühsam, aber doch aufrecht herbei.
– Ich danke Ihnen, mein Herr, sprach sie erröthend zu Giglio. Sie waren gütig zu mir. Dank auch den anderen Herren für ihre Großmuth. Allen Dank … Dank … Dank!
Mit einem Seufzer und kopfschüttelnd schloß sie:
– Niemals werde ich es vergessen.
Doch Giglio neigte sich von seinem Zebra herab und fragte:
– Was hast Du da in der Hand?
– Es ist die vierzigste Tulpe, mein Herr. Ich habe sie für Sie aufbewahrt, auf daß sie Ihnen Glück bringe.
– Das ist eine zarte Aufmerksamkeit. Ich werde Deine vierzigste Tulpe als Andenken behalten. Was kann ich Dir dafür zum Tausche geben? Sprich!
– Mein Herr, man hat mich auf dem Meierhofe sehr schlecht behandelt … Der Patron sagte, daß ich mich verwürfe … daß ich Besuche empfange … daß ich die Abendmelke nicht gemacht hätte … und daß ihm zwei Milchzuber fehlten … Was weiß ich! … Ich bin nun an die Luft gesetzt, mit sechs Franken im Zipfel meines Kopftuches, und habe für den Augenblick keinen Dienstplatz …
– Aber, arme Thierrette, ich kann Dir keinen Dienstplatz bieten.
– Oh, doch! Ich sehe, daß ein Platz zu besetzen ist … Die Herren haben keine Kantinehälterin … Der Dienst ist ein schwerer, aber ich werde ergeben und dienstfertig sein. Ich werde thun, was ich kann … Sie wissen ja …
– Wie? Du wolltest? …
– Ja, aber in den ersten Tagen werde ich der königlichen Garde im Troß folgen … erst später werde ich zu Pferde steigen, wenn Sie nichts dawider einzuwenden haben.
– Angenommen. Geh' zum Troß; das ist eine sehr kluge Vorsicht. Und verbirg Dich gut bis Mittag. Zeige Dich nicht früher, verstehst Du?
– Oh, gewiß nicht. In diesem Augenblicke habe ich mehr Verlangen zu schlafen, als mich zu zeigen. Und nochmals Dank, mein Herr! Sie haben ein gütiges Herz für die Frauen.
