
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Peter Kranz, der Maler, war an einem dunstigen Julimorgen nach Kopenhagen gekommen. Zum ersten Male natürlich, denn es gab nur wenige Dinge, die Peter Kranz nicht zum ersten Male erblickte. Peter, der Entdecker, hatte ihn Onkel Bischoffs scharfer Apothekerwitz getauft. Er war zwanzig Jahre alt. Nein, zwanzig Jahre, drei Monate, acht Tage. Tante Linda wußte es genau. Er stammte aus Schnattersheim, einem badischen Marktflecken, Schnattersheim mit seinen alten Apfelbäumen an den Ufern der Schnatter, Schnattersheim mit seinen Hühnern und Gänsen und Meister Ortwins Sonnenuhr, die jeder Fremde mindestens dreimal ansehen mußte. Peter war noch nie aus seiner Heimat herausgekommen, bis zu der großen Reise, auf der er sich eben befand. Sie bildete ein wichtiges Gesprächsthema der Schnattersheimer. Er hatte zum Studium der Malerei zwei Jahre in Karlsruhe verbracht – nun, das war schon vorgekommen. Aber dann war er nach Berlin gereist – nach Berlin, klang es dumpf – und von dort aus zog er, so meldete ein Hörensagen aus Tante Lindas geheimnisvoller Korrespondenz, nach Dänemark. Das begriff man nicht mehr. Herr Scheible, der Schulrektor, war der einzige, der dafür Verständnis zeigte. Er war ein Shakespearekenner und ließ Peter Kranz mit pathetischer Rührung seinen Hamlet grüßen. Die anderen aber, am meisten die, welche es nichts anging, waren gegen Peters Wanderfahrt und machten Tante Lindas alten Kopf mürbe, indem sie behaupteten, ein junger Künstler ginge nach Karlsruhe, nach Stuttgart oder nach München, vielleicht auch nach Italien, wo Goethe gewesen sei, aber nach Dänemark, nein, das gäbe es nicht, das sei natürlich wieder ein Hirngespinst von Onkel Bischoff, aus dem gelben Apothekerschrank entsprungen. In Wahrheit verhielt es sich so, aber es verhielt sich auch anders, und die Schnattersheimer wußten mal wieder nicht das Richtige.
Peter war ein Waisenkind mit leichter Seele. Der große, unverschuldete Verlust, der andere Gemüter früh beschatten kann, hatte ihn zu seinem Glücke losgelöst wie ein Fähnchen im Winde. Er hielt sich treu an seiner Fahnenstange, an Heimat und entschwundener Elternliebe, aber ein langes Abschiednehmen gab es für ihn nicht, als er hinausging, und er fühlte sich mit dem ersten Schritt schon als Abenteurer auf buntem Märchenboden. Freilich dauerte es ziemlich lange, bis er zum Entschluß kam, Schnattersheim zu verlassen. Bei Peter mußte alles seine Weile haben. Er hing an Tante Lindas altem Efeuhäuschen und mehr noch an ihr selbst, der mütterlichen Freundin – freilich in einer eigentümlichen, echt Peterschen Weise. Er sah sie nämlich nur als wunderbares Modell an. Sie war nun freilich ein ganz kleines, vertrocknetes, siebzigjähriges Fräulein und ähnelte mehr einem alten Gerät in ihrem Giebelhause, als der Herrin selbst. Peter aber konnte sich nicht an ihr satt sehen. Er hatte sie schon an zwanzigmal gemalt, und Tante Linda ließ die Folter über sich ergehen, da sie so Gelegenheit hatte, ihn wiederum, aber nicht mit Maleraugen, anzuschwärmen. Peter hatte seine Vorliebe für alles, was schief gerückt und seltsam war, für jede geheime Winkelwelt vom Vater geerbt. Kranz senior war ein Holzschneider vom alten Schlage gewesen, ein Rethelschüler, der in Schnattersheims gotischen Gäßchen hundertfach Motive fand. Peters blaue Augen waren nun freilich von vornherein von staubigen Winkeln fort in die weiten Obstgärten vor der Stadt gerichtet gewesen, er liebte die Sonne jugendheiß und hatte einen Wandertrieb, der ihn stundenlang den Fluß hinauf bis zur letzten Mühle führen konnte. Er ehrte das freie, holde Leben. Aber es darzustellen verbot ihm eine eigentümliche, tiefe Scheu. Auf Altersgenossen, die anders als er empfanden und jedes hübsche Mädel, das des Weges kam, jeden blühenden Baum als rechtmäßiges Modell betrachteten, wurde er ganz böse und schalt ihre flüchtigen Skizzen »Kitsch«. Aber um einen uralten, verwitterten Armenhäusler konnte er immer wieder mit prüfenden Augen herumgehen, und die abnormste Häßlichkeit ward seinem Stift willkommene Beute. Besonders liebte er einen erblindeten Stadtschreiber und eine gelähmte Botenfrau. Die setzte er wohl auch einmal unter einen Frühlingsbaum auf seinen Bildern, aber die Bäume waren Nebensache. Man wunderte sich allenthalben über den Gegensatz von Peters Persönlichkeit und Peters Kunst. Dieser blondbärtige Germanenjüngling, der aus dem Vorstellungskreise eines Heldenbuches für die reifere Jugend zu stammen schien und so grämlich ernste, unscheinbare Probleme wählte. Liebte er denn das »Schöne« nicht? Die Schnattersheimer hörten nicht auf, sich darüber zu wundern. Sie fingen schon an, Peter Kranz zu bedauern. Nur eine traurige Seele konnte so traurige Werke schaffen. Aber fehlgeschossen – sie irrten sich wieder einmal gründlich. Diese Kunstkenner waren für Peters Überzeugung dürftige Banausen, die keine Ahnung hatten, worauf es ankam. Sie redeten wie der Esel vom Gesangunterricht. Heiter schimpfte Peter sich die Seele frei, wenn Tante Linda ihm schüchtern, um seine Zukunft besorgt, hinterbrachte, wie dieser und jener beim Nachmittagskaffee geurteilt habe. »O, diese Kamele!« rief er dann lachend und stampfte so grimmig im Stübchen umher, daß die weißen Blumentöpfe aneinanderklirrten. »So was erlaubt sich zu urteilen! Solche Schnattersheimer Gackelhühner und Gänse!«
»Peter, der Bürgermeister war dabei!«
»Dieses Nilpferd!«
»Peter, der Amtsrichter!«
»Dieser Pavian!«
»Ja, nun kommst du wieder mit deinem ganzen zoologischen Garten!«
»Tantchen, sie verstehen das nicht! Glaubst du denn, daß ein Künstler die Welt mit Bäckers- und Schneidersaugen ansehen muß?«
»Gewiß nicht! Aber er schafft nicht für sich, sondern für das Publikum!«
»Tantchen!«
»Peter, ich bitte dich dringend, laß meine Stühle in Ruhe! Die vertragen es nicht mehr, daß du mit ihnen herumturnst!«
»Tantchen, die Hand soll mir verdorren, wenn ich einen Strich mache, der diesen Banausen entgegenkommt! Ich weiß so gut, wie jeder andere, wie schön ein Sommerabend draußen ist! Ich gehe auch gern spazieren, wenn's nicht regnet, und gucke mir die Mädels an! Aber darum male ich das noch nicht, es interessiert mich nicht, es ist mir künstlerisch Wurst, zu glatt, zu klar, zu seicht, es interessiert mich nicht, Kreuzmillionendonnerwetter!«
»Gott verzeih' dir die Sünde! Man flucht nicht, Peter. Ich weiß auch nicht, warum das Schöne immer gleich glatt und klar und seicht sein soll.«
»Das Schöne, Tante! Was ist denn das Schöne!? Ich mal so – ein anderer sieht es so! Ich seh' es jedenfalls künstlerisch!«
»Nun gut, ich mag das nicht verstehen, aber ist es denn eines Künstlers nicht würdiger, etwa das stattliche Fräulein Brigitte zu malen, die Tochter unseres Bürgermeisters, als immer und ewig mich, eine arme Siebzigjährige?!«
»Weil sie dreißig ist? Weil sie blaue Augen hat und einen Madonnenscheitel? Nein, Tante, du bist schön, das wag' ich zu behaupten, und Bürgermeisters Brigitte ist häßlich!«
»Peter, um Gottes willen!«
»Brigitte ist 'ne Nachteule!«
»Ich bin 'ne Nachteule, wenn es schon bei dem Vergleich bleiben soll!«
»Nein, Tante!«
»Ich zweifle manchmal wirklich an deinem Verstande, Peter!«
»Immer noch besser, als wenn ein Künstler an meiner Ehrlichkeit zweifelt!«
So endeten die Debatten zwischen Peter Kranz und Tante Linda – eine wie die andere. Aber sie kamen nicht häufig vor. Denn im Grunde vergötterte das alte Fräulein ihren großen, blonden Jungen und gab ihm schließlich immer recht – selbst vor dem Bürgermeister. Sie sah es ja auch ein, seine traurige Kunst bedrückte Peters Gemüt keineswegs. Er war so lebensfroh, wie irgend einer am Ort, bei jedem tollen Streich war er dabei, und die Mädchen, die er nicht malen mochte, die küßte er oft genug, wenn sie ihm abends am Flußufer in den Weg kamen. Er küßte, liebte, lebte überhaupt in einer eigentümlichen Unschuld. Ganz siegfriedhaft, heiter und stark – ohne Leidenschaft. Er kannte noch kein Erlebnis. Er spielte einfach weiter, wie er als Knabe gespielt hatte. Er merkte kaum, wie groß die Mädchen um ihn herum geworden waren. Und von den Gespielinnen fort trachtete sein wunderlicher Einsamkeitstrieb mit gutmütiger Verachtung ins stille Atelier zurück, zu jener ernsten Göttin, die mehr war als alle irdischen Götter.
Onkel Bischoff beobachtete seinen Neffen. Peter nahm sich vor ihm in acht, wie dieser vor jenem – es war ein lustiges Versteckspiel, das die beiden miteinander trieben. Peter traute dem kleinen Apotheker, der immer so schleichend daher kam und plötzlich neben einem stand, in keinem Augenblick. Doch hatte Onkel Bischoff gerade deswegen eine besondere Anziehungskraft für ihn. Kein Tag verging, ohne daß Peter dem Alten in seinem scharf duftenden Laboratorium gegenüber gesessen und ihm lächelnd in die gelben Gnomenzüge geblickt hätte. Er studierte ihn, das wußte der Onkel. Dieser Künstler belauschte ihn in seiner Winkelwelt, die einem mittelalterlichen Alchimisten zu gehören schien, ergründete das wechselvolle Spiel seines Wesens, das von beißendem Witz zu trüber Schweigsamkeit schwankte und immer wieder den reinen Hintergrund hilfreicher Güte hervorleuchten ließ. Ein Spötter und ein Menschenverächter war Onkel Bischoff, aber im Innersten war er gut – Peter, der Elternlose, hatte Beweis dafür. Onkel Bischoff spielte nur den garstig galligen Kinderschrecken. Die Schnattersheimer waren zu dumm, um einen solchen Menschen zu durchschauen – sie fürchteten ihn. Man ging nicht gern in die Apotheke zum goldenen Hasen, aber entbehren konnte man sie nicht. Krank sein, sich kurieren lassen war fast ein Vergnügen in dem ereignisarmen Nest, und Konstantin Bischoff blieb ein notwendiges Übel. Er wurde reich dabei – im übrigen brauchte er seine Mitbürger nicht. Er hockte immer einsam bei allerlei chemischen Grübeleien und Erfindungen, ein Sonderling, ein eingefleischter Junggeselle. Nur Doktor Vogel, der Kreisarzt, kam zu ihm und Peter Kranz, der Neffe. Dieser breite, hochgewachsene Kindskopf mit den blauen Träumeraugen saß dann dem zwerghaften Griesgram gegenüber und lächelte ihn an. Je freundlicher Peter wurde, desto giftiger blickte der Apotheker. Und doch – er tat ihm nichts, im Gegenteil, er meinte es ernsthaft gut. Es war nur äußerliche Abwehr, die ihm nottat vor den Kindern der Sonne. Was aber Onkel Bischoff ängstlich überwachte, war die Gefahr, daß er dem Maler zu interessant werden könnte. Er wollte um keinen Preis sein Modell werden, wie Tante Linda, er empfand solchen Dienst als Eingriff in seine Junggesellenfreiheit. Peters Bitten, ihm zu sitzen, hatte er mit schneidender Schärfe immer wieder abgeschlagen. Kunst war eine geheimnisvolle, unangenehme Macht für Onkel Bischoffs klare Wirklichkeitsaugen. Macht aber sollte kein Mensch über ihn gewinnen, am wenigsten Peter, der Kiekindiewelt, der »Maler« ...
So saßen sie einander gegenüber und ergründeten sich. Wie Faust und Mephistopheles, doch in einem Stadium gegenseitiger Überwindung. Sie machten sich übereinander lustig und hatten sich doch sehr lieb. »Jetzt, in diesem Augenblick führt mich der Halunke hinters Licht,« fühlte Peter mit objektivem Behagen. »Er verehrt mich, der Schafskopf, und denkt sich altes Scheusal,« monologte der Onkel. Auf einem Gebiete fanden sie sich ernst zusammen – wenn nämlich die Rede auf Peters Reisepläne kam. Überhaupt in der Überwindung von Schnattersheims Philistertum, im Erkenntnis- und Freiheitsdrange verstanden sie sich am besten. Onkel Bischoff schimpfte mit Peter um die Wette aus die bürgerliche Tugendtyrannei ringsum. Wenn Peter dann losfuhr: »Ich muß fort, ich muß fort!«, dann zuckte der Onkel mit ironischem Mitleid die schiefen Achseln, als ob das etwas Selbstverständliches wäre.
Er selbst war viel herumgekommen. Er erzählte zwar nichts davon, aber Zeugen seiner Weltfahrten befanden sich auf allen Schränken, sogar an der Decke baumelnd. Hier stand ein ausgestopfter Pelikan mit unwahrscheinlichem Schnabel und rosenrotem Gefieder, der aus Afrika stammte. Dort hing ein gedörrter Haifisch, der sicher nicht in der Schnatter geangelt worden war. Ein Bündel orientalischer Geräte und Waffen schmückte die Wand über dem Perserdiwan, und im Eckschrank war eine Reihe griechischer Ausgrabungen, Vasen und staubige Trümmerchen, zu bewundern. Reizvoller aber für Peters Maleraugen war eine alte Mahagoniservante im Wohnzimmer des Onkels. Sie enthielt die dänische Porzellansammlung. Moderne Dinge, aber höchst erlesene. Hier duckte sich der zierliche Blaufuchs vor dem grotesken Nilpferd, hier funkelte der Fischzug in der Meerestiefe, die ein nachtblauer Teller war. Der Riesenkrebs, der Eisbär und der sandfarbene Dackel waren vorhanden. Kurz, die feinen Phantasiegeschöpfe alle aus Kopenhagens Porzellanwelt.
Immer wieder stand Peter Kranz davor und dachte mit stillem Gram: Er schenkt mir nichts davon, der Geizkragen. Eines Tages aber schlich sich Onkel Bischoff heran, öffnete den Schrank mit einem winzigen Schlüssel und überreichte ihm satanisch grinsend den Dachshund.
»Aber Onkel – –!«
»Darf ich mir erlauben?«
»Das schönste Stück?!«
»Ich habe dich beobachtet. Bei dem ästhetischen Geographieunterricht, den ich dir seit einigen Jahren erteile. Griechenland interessiert dich nicht, Italien und der Orient sind dir Wurst – du bleibst immer wieder vor Dänemark stehen.«
»Aber Onkel – das schönste Stück –!?«
»Du wirst dich bald entscheiden müssen, wohin du dich wendest, Peter. Reisen mußt du, du verschimmelst in Schnattersheim.«
»Nein, herrlich! Diese Farben!« Er hielt das Kleinod ins Licht.
»Also Dänemark ...«
»Ich möcht' schon – ein Land, wo's solch ein Kunstgewerbe gibt!«
»Warum kannst du denn nicht?«
»Tante Linda ist dagegen. Überhaupt – daß ich fort will.«
»Sie war mit Karlsruhe einverstanden – wie Karlsruhe ist die ganze Welt. Du erlebst es, Peter – für uns andere bist du fort. Ob du in Karlsruhe oder in Yokohama bist.«
»Ich muß es mir noch überlegen, Onkel.«
Er ging mit seinem Dackel heim und war für einige Tage glücklich. Dann aber überfiel ihn in verstärktem Maße die alte Unruhe, er suchte Onkel Bischoff auf und fand ihn nicht zu Hause. Witzel, der Provisor, berichtete mit spitzem Munde, daß sein Herr in wenigen Minuten zurückkehren müsse. Peter stand im Wohnzimmer allein. Eine Photographie, die auf dem sonst spartanisch leeren Tische lag, fesselte seine Aufmerksamkeit. Er besah sie. Wo hatte denn der Onkel so etwas her? Einen lieblichen, blonden Mädchenkopf mit klugen, großen Kinderaugen?! Dieser Onkel! Ertappte er ihn also doch bei einer anderen Schwärmerei noch, als Retorten, ausgestopften Haifischen und Kopenhagener Porzellan. (Zum letzteren hatte die unbekannte Dame allerdings eine seltsame Beziehung, die Peter sofort herausfühlte.) Aber das war ja ganz unmöglich! Onkel Bischoff und solch ein Wesen! »Sigrid« stand auf dem Bilde in großer, freier Schrift. Natürlich eine Dänin. Er hatte es sich gleich gedacht. Sigrid! ... Schön war sie. Peter hatte noch nie einen Kopf gesehen, der so ganz dem Ideal weiblicher Reize entsprach, wie er es in sich trug ... Sigrid! ... Dann wurde er plötzlich wütend, warf das stumme, dumme Bild auf den Tisch zurück und ging, die Hände in den Taschen, im Zimmer umher. Aber der Orient mit seinen interessanten Dolchen und Pfeifen über dem Perserdiwan kam ihm heute etwas muffig vor. Die griechischen Vasentrümmer im Eckschrank achtete er nicht höher als einen Kehrichthaufen. Er blieb wieder leise pfeifend vor dem Kopenhagener Porzellan stehen. Eigentlich war es ja wahr – man konnte die schiefen, alten Weiber, die krummen Gäßchen und schmutzigen Gänseherden satt bekommen – junges Blut, das man war – was hatte man schließlich von Schnattersheim, wenn Kopenhagen winkte? Vollendeter Geschmack, graziöse Schönheit! Nordische Herbheit und Größe! Er sehnte sich danach, weit mehr als nach der weichen Schläfrigkeit des Südens. Der funkelnde Fischzug auf tiefblauem Grunde lockte sein träumendes Auge an. Er sah ein blondes Weib am Meere stehen, das solches Kunstgerät mit schmalen Händen zur Sonne hob.
»Also Dänemark,« kicherte es plötzlich hinter ihm. Onkel Bischoff war wieder einmal auf Katzenpfoten herangeschlichen.
Peter bezwang seinen Zorn, machte Kehrt, trat an den Tisch heran und hielt dem Onkel triumphierend die Photographie vor die Augen.
»Also Dänemark,« wiederholte er. Dieser Sarkasmus erschien ihm außerordentlich.
Der Onkel schob seine spitze Zunge im Munde herum, so daß sie erst die eine, dann die andere Wange blähte. Dann fragte er unschuldig: »Habe ich dir das Bild noch nie gezeigt?«
»Noch nie!« rief Peter mit komischem Pathos.
»Das wundert mich. Das Bild ist fünfzehn Jahre alt. Es stellt eine berühmte Kopenhagener Schauspielerin dar, Fräulein Sigrid Pummernickel, nicht Pumpernickel, von der du jedenfalls gehört Hast.«
»Nicht das mindeste! Pummernickel? Ist das wirklich ein dänischer Name?«
»Sigrid Pummernickel! Das weiß doch jedes Kind!«
»Ich nicht!«
»Was kann ich dafür? Deine Bildung hat Lücken, Peter. Jedenfalls – das Bild ist hübsch.«
»Sehr hübsch! ...«
»Aber die Dame wird jetzt leider nicht mehr so aussehen. Fünfzehn Jahre sind ins Land gegangen ...«
»Schade! ... Die Photographie kam mir ganz neu vor?«
»Nein, Peter. Sie ist alt. Es ist eine alte Schwärmerei von mir.«
»Onkel! Ich berst' ja vor Vergnügen!«
»Birst, mein Junge. Du siehst hier jedenfalls einen nordischen Frauentyp. Einen der schönsten. Die Kopenhagenerin.«
»Mein Dackel ist mir lieber.«
»Der gehört dir ja auch. Hast du dich inzwischen entschlossen, wohin die Reise geht?«
»Die Reise! ... Noch immer nicht, Onkel!«
»Tante Linda ist einverstanden. Ich habe eben alles mit ihr besprochen.«
Peter wurde feuerrot und wandte sich wie von einem höllischen Versucher ab. Er lief mit kurzem Gruß davon. Nun kam er mehrere Tage nicht zu Onkel Bischoff. Stundenlang verbrachte er die grauen Nachmittage am Ufer der Schnatter, weit draußen, wo der Weg zur letzten Mühle ging. Er angelte dort, er angelte mit Leidenschaft, als wollte er aus kalter Tiefe die Lösung seines Rätsels fischen. Wozu sollte er sich entschließen! ... Die Welt war ihm eigentlich Wurst, und doch – er mußte fort. Schnattersheim war ihm gräßlich – aber er hatte es doch lieber als Berlin und Kopenhagen und Peking ... Eines Abends jedoch, als ihn plötzlicher Ingrimm packte, weil er schon den Pfundhecht an der Angel gehabt und in seiner Verträumtheit losgelassen hatte – an diesem Abend war sein Entschluß gefaßt. Er lief mit großen Schritten auf den Markt zurück, wo schwarze Giebel in den Mondschein ragten, und läutete an der Apotheke zum goldenen Hasen. Witzels Stimme, die immer ganz erschöpft klang, wenn sie auf die Nachtglocke reagierte, rief ihm durch den Türspalt zu: »Einen Moment, Frau Krause! Sie wollen gewiß das Abführmittel holen? Es ist in zwei Minuten fertig!«
Peter stampfte mit dem Fuße auf. »Sind Sie blödsinnig, Witzel?! Ich bin doch nicht Frau Krause! Machen Sie auf! Ich möchte meinen Onkel sprechen!«
»So spät noch?«
Da kam der Onkel schon selbst, nahm Peters Arm, als ob er sich über den ungewöhnlichen Besuch gar nicht wunderte, und führte ihn gemächlich in sein Wohnzimmer hinauf.
»Hör' mich ernsthaft an, Onkel!«
»Wie immer, mein Junge.«
»Na! – Also ich will jetzt reisen – so schnell als möglich –!«
»Bravo! Wohin denn?«
»Du kennst meine Vorliebe für Dänemark –«
»Ja, die kenn' ich. Was blickst du denn so unruhig umher? Das Bild von Sigrid Pummernickel ist wieder eingeschlossen. Soll ich's holen?«
»Onkel, was kümmert mich das Bild! Fräulein Pummernickel ist mir vollständig gleichgültig! Ich will Kopenhagen sehen! Ich habe das Buch von Jacobsen gelesen, das Tante Linda im Schrank hat! Das trifft mich! Das bin ich!«
»Niels Lyhne? Hoffentlich nicht.«
»Nein, untergehen werde ich nicht. Im Gegenteil. Ich will da oben erst sehen lernen.«
»Auf dem Wege kommst du über Berlin. Da kannst du auch schon sehen lernen.«
»Ich glaube nicht, Onkel. Für meine Kunst wird Berlin nichts sein. Aber nun bitte ich dich – gib mir jetzt ernsthaft, so gut du es mit mir meinst, Ratschläge für Kopenhagen.«
Das tat der Onkel. Er schenkte Peter einen alten Kognak ein, er holte eine Landkarte herbei und demonstrierte Station für Station die ganze Reise. Peter tat mit stiller Bewunderung einen Einblick in die Welterfahrung dieses Kleinstädters. Ihm schwirrte der Kopf, er nickte immer zustimmend, aber es prägte sich ihm nichts ein. Bei Kopenhagen verweilten sie am längsten. Hier bestand Onkel Bischoff darauf, daß Peter sich einige Adressen notierte.
»Muß ich die Leute besuchen, Onkel?«
»Du mußt nicht, obwohl man dich überall gut aufnehmen würde. Es sind lauter gute Bekannte von mir. Aber ich kenne ja deine Zurückhaltung, und es wird auch manchmal gar zu sehr mit der Sprache hapern. Nur meinen alten Freund Söderberg – den mußt du besuchen. Der kann auch am besten deutsch.«
Peter traute sich nicht zu widersprechen. Der Onkel wünschte diesen Besuch mit solchem Nachdruck – es wäre kränkend gewesen, sich zu weigern. Also gut. Er konnte ihm den Gefallen ja tun. Eine Höflichkeitsvisite. Willig ließ er sich erzählen, wer Herr Söderberg war. Er erfuhr, zerstreut und immer wieder den Blick auf das Kopenhagener Porzellan gerichtet, daß Jakob Söderberg einer der reichsten Brauereibesitzer Dänemarks sei, der mit seiner Familie eine prachtvolle Besitzung in Marienlyst bei Kopenhagen bewohnte.
»Ein Bierbrauer also,« sagte Peter mit leichter Ironie, doch ohne Überhebung.
»Ja – aber er braut sehr gut, Peter. Das ist die Hauptsache, nicht wahr. Und nebenbei ist er noch einer der bedeutendsten Kunstsammler Skandinaviens. Auf diesem Gebiet bin ich ihm näher getreten. Daß ich so besonders gutes Porzellan habe, verdanke ich ihm.«
Peter machte große Augen. »Ein prachtvolles Volk! Wenn sogar die Bierbrauer solche Eigenschaften haben!«
»Du gehst also hin?«
»Ja, ich gehe hin. Ich möchte mir ja sowieso die Nester am Sund ansehen. Marienlyst und Helsingör und Klampenborg und wie sie alle heißen.«
»Du wirst eine sehr liebenswürdige, echt dänische Familie kennen lernen. Das wird doch gewiß dein Wunsch sein.«
»O ja, aber ob der Wunsch gegenseitig sein wird, das ist der Haken, Onkel. Na, ich gehe jedenfalls hin. Haben die Leute Kinder?«
»Herr Söderberg ist Witwer und hat zwei erwachsene Töchter.«
»Schade. Richtige Kinder wären mir lieber.«
»Es sind ja seine richtigen Kinder.«
»Onkel, du fängst schon wieder an zu ulken! Es ist Zeit, daß ich gehe! Aber ich freu' mich, daß ich wegkomme! Herrgott im Himmel, ich freu' mich! Das wird ein Leben! Hoch, Tante Linda! Hoch, Onkel Bischoff!«
»Hoch Peter!«
»Entweder komme ich als anerkannter Künstler zurück oder gar nicht.«
»Dann bitte lieber als anerkannter Künstler.«
Schon am nächsten Morgen war Peter reisefertig, und der Abschiedsschmerz gestaltete sich kurz. Tante Linda tat das kleine Herz zum Zerspringen weh, doch Onkel Bischoff wußte die ganze Situation so unsentimental zu gestalten, daß sie zu guter Letzt in Peters und der Übrigen Heiterkeit einstimmte. Sie winkte mit ihrem geblümten Taschentuch, bis der Zug im Tunnelloch verschwunden war. Peter aber reiste durch Deutschland wie ein Eroberer. Das Gefühl, bei jeder Telegraphenstange in ein neues, unbekanntes Gebiet zu kommen, bewältigte ihn fast. Es tobte in ihm. Er sang seine pfälzischen Lieder mit einer Tenorstimme, die er sehr schön fand, durchs offene Fenster in den Sommer hinaus. Er konnte sich das leisten, denn er blieb bis Thüringen allein im Coupé. Hier erst gesellte sich ein gesprächiger Sachse zu ihm, ein Chemnitzer Fabrikant von Hundekuchen, der ihm zwischen Weimar und Leipzig seine ganze Lebensgeschichte erzählte.
Peter, der alles noch aus erster Hand empfing, nahm diese Mitteilungen, die ihm eigentlich gleichgültig sein konnten, mit unmittelbarem Interesse auf. Der Sachse, der erst dankbar überrascht war, einen solchen Zuhörer zu finden, geriet allmählich in gelinde Verzweiflung, da Peter keinen Einspruch für sich behielt, sondern alles, was ihm nicht sofort klar wurde, bestritt, sowie er es den Schnattersheimer Kameraden gegenüber getan hatte. Er blieb etwas verblüfft sitzen, als Herr Kuhnow (man hatte sich vorgestellt) ihn in Leipzig sichtlich verstimmt verließ. Außerdem wurde ihm jetzt bewußt, daß er durch das unnütze Geschwätz die ganze Strecke zwischen Weimar und Leipzig außer acht gelassen hatte. Er war wütend, aß drei Paar Würstchen hintereinander und lehnte sich, als der Zug den Leipziger Bahnhof verließ, in die Ecke zurück, indem er, die Arme verschränkend, den menschenfeindlichen Entschluß faßte, kein Wort mehr mit einem Reisebegleiter zu wechseln.
In Berlin, das er zwischen zwei Bahnhöfen kennen lernte, verbrachte er nur einen qualvollen Tag. Hier mißfiel ihm zunächst alles. Er lief in den lärmenden Straßen umher und wurde ganz kraftlos, weil ihn jedes Haus, jeder Mensch eine neue Erregung kostete. Peter war noch fähig, jede Einzelheit nach ihrer ästhetischen Bedeutung zu empfinden. Der Fund einer edlen Stileinheit, und wenn sie auch nur ein Gebäude umfaßte, beglückte und besänftigte sein Gemüt vollständig – rohe Wirrnis aber und Geschmacklosigkeit konnten ihn in Wut versetzen. In den Berliner Straßen irrte sein Auge ratlos umher. Sein Gesicht bezog sich mit Zornesröte, als ob an jedem Fenster ein ungezogener Junge stände, der ihm eine lange Nase machte. Die Menschen, die Häuser, der Lärm, der Verkehr! Alles erschien ihm so unsagbar gewöhnlich. Was war doch Onkel Bischoff für ein Mephisto! Hier sollte er sehen lernen? Im negativen, ablehnenden Sinne vielleicht – da hatte der Apotheker recht. Aber um sich durch diesen Jahrmarkt nicht verwirren zu lassen, dazu bedurfte es keines großen »Sehenlernens«. Immerfort stolperte er, immerfort befand er sich in Lebensgefahr. Hier ein tutendes Automobil – dort ein elektrischer Wagen! Jene Greisin am Krückstock war sicherer als er – mit abgestumpften Nerven humpelte sie an den Benzinfauchern vorbei, als ob es bellende Hündchen wären. Großstadtgeschöpfe! Er, der Kleinstädter, blieb ratlos mitten auf dem Damm stehen und mußte zum Gaudium einiger Schuljungen schließlich von einem Schutzmann über den Potsdamer Platz geführt werden. Wie unfein und ironisch die Menschen ihn anstarrten. Hätte er Zeit gehabt, und wäre er nicht froh gewesen, mit heilen Knochen auf den Bürgersteig zu kommen, so hätte er sich wohl manchen Frechling in der Nähe besehen. Kümmerte es jemand, daß er seinen grünen Strohhut trug und seinen schokoladefarbenen Überzieher, den Tante Linda ihm vom ersten Schneider in Schnattersheim hatte anfertigen lassen? Gewiß nicht. Er fand übrigens die Kleidung der Berliner durchaus nicht schöner. Die Farben, die er trug, waren etwas ungewöhnlich, aber sie ließen sich doch malerisch vertreten, namentlich in der Schnattersheimer Landschaft. Hier natürlich wirkte alles kalt und roh. Das heißt – kalt! Er wünschte sich etwas Kälte. Die Julisonne tat das ihrige, er war in Schweiß gebadet und zog den Überrock aus, wodurch sich zum Grün und Schokoladebraun noch das Silbergrau seines Anzuges gesellte. »Der is in 'n Farbentopp jefallen! Det is der fremde Herr aus Kottbus!« hörte er zwei Bierkutscher einander zurufen. Er wollte keine Beleidigung darin sehen und schritt, sich aufrichtend, durch das Brandenburger Tor. Hier wurde ihm etwas wohler zumute. »Das ist fein, das ist fein«, murmelte er erfreut, indem er das anmutige Palais der französischen Botschaft betrachtete. Dann zog er sein Skizzenbuch aus der Tasche und zeichnete die Front. Die lächelnden Blicke vorübergehender Neugieriger beachtete er nicht. Ihn entzückte das friderizianische Preußentum ringsum. Aber der Umschwung seiner Stimmung hielt nicht lange vor. Mechanisch ließ er sich, während es dunkel wurde, unter den Linden weiterschieben, interesselos und müde. Schließlich gelangte er in die Friedrichstraße und in einen Bierpalast, wo er sich bei einem Maßkrug, der ihn wieder mit manchem versöhnte, seinen traurigen Betrachtungen hingab. Heimweh überfiel ihn. Und er fand doch Heimweh so lächerlich! Nun, Dänemark! Wenn er erst nach Dänemark kam! Ans blaue Meer, zu Sigrid! ... Halt! Der Name sollte ihm ja nicht einfallen! Diesen Schabernack sollte ihm Onkel Bischoff nicht gespielt haben, daß er ihn mit einer Photographie verrückt machte. Noch dazu von einer Dame, die inzwischen 15 Jahre älter geworden war! Aber es leuchtete doch sanft in den rauchigen Dämmer der Berliner Kneipe hinein: Sigrid ... Ein kleiner Hoffnungsstern im grauen Irgendwo des Daseins. Und wohlig erwärmt von seiner gestaltlosen Sehnsucht hockte Peter Kranz vier Stunden lang im Tucherbräu. In diesen vier Stunden trank er sechs Maß Bier aus. Der Kellner machte immer größere, besorgtere Augen. Aber der Pfälzer Jüngling wankte nicht auf seinem Stuhl. So zart besaitet er im übrigen war, sein Magen war aus Eisen. Als es 8 Uhr geworden, ergriff ihn eine sentimentale Unruhe. Er gedachte Tante Lindas und Onkel Bischoffs, er wollte den beiden einzigen Menschen, die es gut mit ihm meinten, etwas Liebes erweisen. Etwas kaufen mußte er ihnen in Berlin und nach Schnattersheim als Zeichen seiner Treue schicken. Armer Kerl, der er eigentlich war – ließ sich schieben und betreuen von so alten Leuten. Lebte von Versprechungen, hatte noch nichts geleistet – mit 20 Jahren! Beinahe ein Schuft! – – Doch nein! Der Ausdruck war zu stark! Ein Künstler war doch was – er wollte ja ein Künstler werden. Vergrößerung des väterlichen Namens – Fortdauer! ... Doch lieber die Zeche bezahlen als große Worte verschwenden. Er erhob sich und ging etwas unsicher auf die regennasse Straße hinaus. Mitleidig sah er einer geputzten Dirne nach, die einen ganz anderen Blick von dem hübschen, jungen Herrn erwartet hatte. Dann fiel ihm ein, daß in einer Stunde sein Zug abging. Nun rasch noch, rasch den Einkauf machen! ... Aber wo? Und was? Es mußte etwas Exquisites sein, etwas, was bleibenden Wert hatte. Ob seine Reisekasse ihm gestattete, »bleibenden Wert« zu kaufen, daran dachte er nicht.
Er bummelte die Linden entlang und bemerkte erst allmählich, daß die meisten Läden schon geschlossen waren. Halb ärgerte, halb erleichterte ihn das, denn er ging sehr ungern in Geschäfte, und zu Hause hatte er es sich so eingerichtet, nur bei August Schölermann am Markt zu kaufen, der einfach alles hatte. Aber es mußte sein, er durfte sich seine Pietät nicht zu bequem machen. Schließlich blieb er vor einem großen Schaufenster stehen, das japanische Kunstgegenstände enthielt. Er dankte Gott für diese Eingebung – hier mußte er kaufen oder nirgend. Eine unsichtbare Gewalt schob ihn in den Laden hinein, wo die Verkäuferinnen schon damit beschäftigt waren, alles wegzuräumen und Schluß zu machen. Der späte Besuch in Gestalt eines hübschen Jünglings hielt aber ihren Eifer auf. Sie sahen Peter Kranz mit schläfrigem Lächeln in die Augen. Der ergrimmte sicherlich ob solcher Unsachlichkeit und fragte ziemlich barsch, was ein Leuchter, der einen hochaufgerichteten, phantastischen Drachen darstellte, koste. »Hundert Mark, mein Herr,« war die zierliche Antwort. Mein Gott – das war teuer. Aber schön war das Ding, und wie würde es in Onkel Bischoffs wunderlichen Kram passen! »Wir haben auch kleinere, mein Herr – zu siebzig Mark,« sagte das Fräulein, da es sein ängstliches Zögern bemerkte. Siebzig Mark. Er hatte noch nie etwas für siebzig Mark gekauft. Der kleine Leuchter aber war fast ebenso schön, wie der große. »Ich nehme ihn,« sagte Peter mit trotziger Stimme. »Den großen oder den kleinen?« »Den kleinen,« klang es gleichsam um Entschuldigung bittend. »Schön, mein Herr,« flötete die Verkäuferin. Wieder sah sie Peter zärtlich an und wickelte ihm den Drachen ein. Nun noch etwas für Tante Linda – etwas Kleineres, Apartes! Die Schlange? Nein, das war nichts, davor fürchtete sie sich. Aber halt – da lag eine höchst interessante Kleiderbürste. Mit einer außerordentlich feinen Schnitzerei im Rücken. Tante Linda bürstete viel und gern. Das war etwas. »Dreißig Mark, mein Herr. Ja, diese feinen Schnitzereien ... wir können sie beim besten Willen nicht billiger geben. Der Zoll, mein Herr, der Zoll!« Peter nickte zustimmend, mit dunkelrotem Gesicht – er wollte nur hinauskommen. Als er nach heftigem Stolpern glücklich an der Tür stand, fiel ihm die Hauptsache ein, und er stotterte, indem er die Pakete dem erstaunten Fräulein wieder zurückgab: »Würden Sie wohl die Güte haben – wäre es wohl möglich, daß Sie die Sachen mit der Post schicken?« »Aber gewiß, mein Herr!« »Besten Dank!« Im Hintergrunde kicherte ein Hilfsmädchen und verließ das Lokal. Peter diktierte die Schnattersheimer Adressen und hatte endlich alles glänzend erledigt. Er lief auf die Straße hinaus. Er warf sich, da es gewiß schon höllisch spät war, in eine Droschke. Nun ging es zum Stettiner Bahnhof. Himmeldonnerwetter! Er mußte ja noch seinen Koffer von der Aufbewahrung holen! ... Das Bier wirkte nach. Das Bier. Er fühlte sich sehr glücklich. Was würden die daheim für Augen machen! An die nicht vorgesehene Mehrausgabe von hundert Mark dachte er nicht. »Ich möchte in die Wählt hinaus!« sang er, daß die Fensterscheiben der Droschke klirrten. Als er endlich am Schalter stand, um das Billett nach Kopenhagen zu lösen, verflüchtigte sich seine Aufmerksamkeit sofort wieder und wurde, von den nächsten, dringendsten Entschlüssen fort, durch eine Beobachtung absorbiert. Er sah einen alten Herrn im Winkel der Vorhalle stehen, den seine Angehörigen dort sicher gestellt hatten, bis die Gepäckaufgabe besorgt war. Der alte Herr war blind. Er starrte teilnahmlos in das bunte Getriebe des Reiseverkehrs. Ein seltsames Symbol. Die Seinen mit ihren hellen Augen mühten sich eben, ihm die Fahrt in die Ferne, zum weiten Meer vielleicht, zu ermöglichen – und er? ... Was er für wunderbare Augen hatte. Und die ganze, vorgeneigte Gestalt. Und diese Stimmung überhaupt im stillen Winkel der lärmenden Bahnhofshalle. Es zuckte Peter in den Händen, sein Skizzenbuch aus der Tasche zu ziehen und den Eindruck festzuhalten. »Aber, mein Herr, nehmen Sie doch Ihr Billett und halten Sie den Verkehr nicht auf!« mahnte der Kassierer. »Inzwischen geht der Zug ab!« zischte eine dicke Dame als Wortführerin einer entrüsteten, langen Menschenreihe. Peter bezahlte und riß sich los. Nach der Uhr sah er nicht. Er näherte sich vielmehr diskret, als ob es sich um einen Hellsichtigen handelte, dem Blinden. Eine Weile stand er neben ihm und zeichnete ihn im Geist. Welch ein melancholisches Symbol ... Plötzlich nieste der Blinde, und Peter war aus der Stimmung gerissen. Auch näherte sich ihm in diesem Augenblick ein Mann, der neben ihm an der Kasse gestanden. »Se wolle doch nach Kopehage, nit wahr, Herr Landsmann? In zwei Minute fährt der Zug!«
Wie von einem Skorpion gestochen, fuhr Peter auf. Erst wollte er noch widersprechen, daß drei Minuten Zeit wären. Dann aber ließ er es, dankte dem Landsmann, auf dessen Namen er sich vergebens besann, und stürzte zum Bahnsteig. Er konnte eben noch hineingeschoben werden. Dann pfiff es schon und dampfte los.
Peter war im Coupé allein. Er besann sich, pustete, lachte und stöhnte vor sich hin. Er war ganz erschöpft. Als der Schaffner kam und sein Billett prüfte, fiel ihm erst ein, daß er vergessen hatte, seinen Koffer abzuholen. Er dachte zunächst daran, wie an das Versehen eines unpraktischen Bekannten. Erst allmählich wurde ihm klar, wie nahe ihn selbst die Sache anging. Nun, er konnte ja den Koffer nach Kopenhagen kommen lassen. Das wäre was für Tante Linda, die Ängstliche. Und Onkel Bischoff – der würde sich scheckig lachen! Von der Erkenntnis seiner horrenden Unachtsamkeit aber doch beunruhigt, tastete Peter plötzlich an den Taschen seines Anzuges entlang. Eine feurige Tafel »Vor Taschendieben wird gewarnt!« schwebte seinen Provinzleraugen entgegen. Doch nein! ... Das Portemonnaie war noch da, Gott sei Dank, und das Skizzenbuch, das Peter als seinen höchsten Wertgegenstand ansah. Erst wollte er das Buch herausziehen, entschloß sich dann aber doch lieber, den Inhalt des Portemonnaies zu prüfen. Er kam sich jetzt zum ersten Male so kindisch verlassen vor. Teufel, Teufel – nur noch 30 Mark ... Ja, ja, die Geschenke! Die waren ein Strich durch die Rechnung. Hm ... Er hatte Tante Linda versprochen, frühestens in 14 Tagen um Geld zu schreiben. Was er jetzt noch hatte, reichte kaum für acht. Tante Linda hatte sogar etwas von einem Monat gemurmelt, und in diesen Sachen verstand sie nicht den mindesten Spaß. Das Geschenk konnte, da es von ihrem Gelde gekauft war, ihre Entrüstung auch nicht beschwichtigen. Onkel Bischoff anzupumpen, war eine heikle Sache. Der gab nur von selber was. Nun, die Sache würde schon »wie« werden. Die schöne Hoffnung seiner ersten Wanderzeit ließ Peter sich durch den Mammon jedenfalls nicht verekeln. Er streckte sich auf der Bank aus, er lächelte und schlief bald ein. Aber sein Schlaf war unruhig. Er schnarchte schmerzlich, er glaubte Onkel Bischoffs Porzellanschrank durch eine ungeschickte Bewegung zertrümmert zu haben, er war von tödlicher Angst erfüllt, daß der Apotheker nach Hause kommen und die Bescherung sehen könnte. Stöhnend und gleichsam Schutz suchend, hielt er Sigrids Bild in beiden Händen, er preßte es fiebernd an sein Herz. Dann stieß der Wagen heftig, und Peter erwachte. Man war in Warnemünde. Er steckte den glühenden Kopf zum Fenster hinaus und empfand zum ersten Male den frischen Salzhauch der Seeluft. Während der Zug auf der Fähre stand und nach Gedser, an Dänemarks Küste, geschleppt wurde, wollte er keinesfalls in dem dumpfigen Kasten bleiben. Das hatte er sich schon in Schnattersheim vorgenommen. Er kletterte, völlig ermuntert, aus dem Coupé heraus und stand nun im Märchenschimmer der Mondnacht. Glitzernde Wasserweite lag ringsum und über ihm wölbte sich des ausgestirnten Himmels dunkler Frieden.
Leben! Leben! Nicht malen. Das war die eine jubelnde Empfindung, die jetzt sein einsames Gemüt beherrschte. Was galt es denn eigentlich, etwas werden? Sein, da sein auf dieser Gotteswelt, das war die Hauptsache. Den Becher des Lebens in die Silberflut solcher Nacht zu tauchen und ihn auszutrinken unter dem freien Firmament! Er schritt an schlafenden Schiffsleuten vorüber zum Bug der Fähre. Leise lachend bemerkte er, daß die Männer über einer kreisenden Schnapsflasche eingenickt waren. Diese Realisten berauschten sich nicht am salzigen Meerwasser, wie er es wollte. An das Tucherbräu dachte er jetzt nicht mehr. Er stand in dem scharfen Vorsprung, der die Flut zerteilte, allein. Seine träumenden Augen suchten die dänische Küste. Aber in der Dunkelheit vermochte er nur weit drüben eine schattenhafte, schwankende Linie zu erkennen, die auch die fernste Front der rollenden Wogen sein konnte. In seiner Unerfahrenheit beugte Peter sich über Bord und starrte lange in das schaukelnde Spiel des Wassers. Plötzlich gesellte sich zu seiner schweren Träumerei ein eigentümliches Unbehagen. Die See ging hoch, der schwere Bahnzug auf der Fähre schwankte wie eine dicke Dame im Ruderboot. Peter aber, der noch dazu am exponiertesten Punkt stand, merkte es zu spät und fühlte sich recht krank. Angstschweiß bedeckte seinen Körper, und ehe er protestieren konnte, hatte sein schwächeres Ich die Silberflut der See ganz anders berührt, als er geträumt hatte. Beschämt und das Tucherbräu mit seinem wohligen Gift verwünschend, schlich Peter in das Coupé zurück und schnarchte dort bis zum hellen Morgen. Der Schaffner rüttelte ihn auf. Er befand sich – wo? ... In Kopenhagen! Ja, im Bahnhof von Kopenhagen! Er war der letzte, der sich durch das fremdartige Gewühl, einem höflichen, aber unverständlichen Hotelportier nach, hinausdrängen mußte.
»Wo ist das Gepäck des Herrn?«
»Mein Koffer kommt nach,« stotterte Peter verlegen.
Er sah zerstreut zur Seite, da eben eine Dame vorüberschritt, die ihn lebhaft an Sigrids Bild erinnerte. Dann bekam er einen heftigen Stoß von einem vorüberlaufenden Gepäckträger und wandte sich mit einem sinnlosen »Verzeihung!« wieder dem Portier zu. Der aber war nicht mehr zu sehen. Hatte er sich davongemacht? Peter schwoll die Zornader auf der Stirn. Mißtraute man ihm, weil er kein Gepäck hatte? Das schien so ein schönes Hotel zu sein, das Onkel Bischoff ihm empfohlen! Nun, eigentlich war er ganz froh. Bei der Ankunft in einer fremden, großen Stadt, von tausend Eindrücken bestürmt, war es ihm ein Greuel, die Hotelformalitäten zu erledigen, sich von trinkgeldsüchtigen Frackträgern bekomplimentieren und schließlich in ein Zimmer sperren zu lassen, das er nie gewählt hätte. So aber war er ein freier Mann, konnte »singen« und tun, was er wollte. Ganz so, wie er es sich immer gewünscht hatte. Unbekannt – losgelöst von jeder Rücksicht. Er summte vergnügt vor sich hin. Es dämmerte ihm wohl, daß es jetzt richtiger wäre, zunächst den Koffer nachkommen zu lassen, denn sein Besitz in Dänemarks Hauptstadt bestand aus dem, was er am Körper trug, aber er verschob es, er lachte über die philiströse Pedanterie – es hatte bis zum Abend Zeit, wo er ja doch ein Gasthaus aufsuchen mußte. Mit Ingrimm nahm er sich schon vor, in ein recht obskures zu gehen, in eine Art Asyl für Obdachlose, wo man mehr auf sein ehrliches Gesicht, als auf elegante Koffer sah. Er hatte ja Geld bei sich – 30 Mark – geschehen konnte ihm nichts. Er wollte den Plunder übrigens sofort einwechseln. In dänischer Währung nahm sich sein Kapital nun freilich weniger majestätisch aus. Aber dafür gefiel ihm die Zeichnung der Kassenscheine – das versöhnte ihn wieder.
Seinen Vorsatz, an jedem Straßenschilde Dänisch zu lernen, blieb er nur im ersten Anfang treu. Er las Banegaard. Nun ja – Banegaard! Bahnhofstraße! Das war doch einfach! Vesterbros-Passage. Passage – hm. Aber Vesterbros – das war nicht ganz deutlich. Von seinem Sprachstudium wurde er bald durch das schöne, fremdartige Bild des Verkehrs abgelenkt. Da stand er nun inmitten der erträumten, skandinavischen Menschen. Er fand sie eigentlich robuster und heiterer, als er erwartet hatte. Es waren nicht alles Gestalten aus »Niels Lyhne«, die ihm da entgegenkamen. Fennimore wohl und Erik – aber die dicken und vergnügten Bürger des Allerwelts-Materialismus auch. Sie zerrissen den Schleier entrückter Beseeltheit, den Peter den Dänen aus ihrer Kunst beigelegt hatte. Das enttäuschte ihn weniger, als es ihn heiter stimmte. Er hatte genug geträumt, er fühlte wieder festen Boden unter sich. Forschend sah er den Menschen des Tages in ihre fremdartigen, aber gewinnenden Augen. Ihr Wesen und ihre Stadt, das empfand er jetzt schon deutlich, bestätigten ihm die schöne Hoffnung: Sie ruhten in einem angeborenen Geschmack. Ein künstlerischer Mensch war hier sofort kein Fremdling mehr. Die Linie dieses breiten Boulevard, den er entlangschritt, die Häuser, die Gefährte, die Kleider der Damen – alles stammte aus einer alten, vornehmen Kultur, kein Parvenütum drängte sich dazwischen. Langsam schlendernd, eingelullt von seinem etwas selbstgefälligen Kritikerbewußtsein, befand Peter sich plötzlich einem breiten Portal gegenüber, das in ein ausgedehntes Vergnügungsetablissement zu führen schien. Das tat es auch wirklich. »Tivoli« stand über dem Portal, und Peter reagierte ganz anders auf diese Entdeckung, als die Mehrzahl der deutschen Fremden. Er mißbilligte die Popularität dieses weltberühmten Lokals. Er nahm sich sofort vor, überhaupt nicht hineinzugehen. Da gab es in Kopenhagen wohl doch noch andere Sehenswürdigkeiten, als Tingeltangel mit Illumination. Der Durchschnittsreisende natürlich, der sich »amüsieren« wollte, der wurde sofort magnetisch davon angezogen. Ein lächerlicher Kitsch wahrscheinlich, das Ganze. Peter schimpfte. Er kam allmählich in das innerliche, wortlose Räsonieren hinein, das ihm immer wohltat, wenn er durch große Eindrücke erregt wurde. Er ging entrüstet weiter und würdigte Tivoli keines Blickes mehr. Vor dem Rathause aber blieb er stehen. Er nickte. Er nickte wie Gottvater und fand, daß es gut war.
Nie hatte er in seinem Leben ein so edles Gebäude gesehen. Er betrachtete es auf den Spitzen gehend von allen Seiten. Als er, die entzückten Augen zum Turm hinaufgerichtet, wieder zur Hauptfront kam, prallte er mit einem Herrn zusammen, der ihm schon von Tivoli aus gefolgt war. Selbst eine sonderbare Erscheinung, schien er an Peters Fremdartigkeit großes Interesse zu nehmen und benutzte jetzt die Gelegenheit des Zusammenstoßes, um ihn anzusprechen.
»Das ist herrlich – nicht wahr, mein Herr? Das Rathaus! Ja! Das Rathaus!«
Er sprach ein seltsam singendes Deutsch – ganz geläufig, aber viel weicher, viel mehr Klang darin, als Peter je gehört hatte. Auch begleiteten seine außerordentlich feinen Hände jedes Wort mit einer malenden, nervösen, leise zitternden Bewegung. Es war ein kleiner Mann von unbestimmtem Alter. Sein bronzefarbenes Antlitz hatte so schöne, schwarze Augen und so tief gegrabene Züge, daß man durch die plötzliche Gelenkigkeit des gebückten Körpers und den breiten, fast tierischen Mund ganz irritiert wurde. Ein Edelmann und ein tragikomischer Affe – diesen Eindruck hatte Peter. Zugleich fiel ihm die beispiellose Eleganz seiner ersten, dänischen Bekanntschaft auf. Dieser Mann konnte ein Fürst, ein Hochstapler oder ein großer Künstler sein. Peter wurde rot, indem er erwiderte: »Ich bin ganz außer mir über die Schönheit des Rathauses.«
»O, ich liebe jeden, der wegen ßolcher Szache außer ßich ßein kann,« sang der Fremde und malte mit den Händen dazu. Dann nahm er den Zylinder ab und senkte den angegrauten Kopf. »Szie ßind Fremder ... Darf ich Szie begleiten? Ein wenig Cicerone spielen?«
Peter nahm auch den Hut ab und senkte aus Verlegenheit ebenfalls den Kopf. »Mein Name ist Kranz,« sagte er förmlich.
»Szie ßind Deutscher?« war die Antwort, während Peter jetzt eigentlich den Namen des Fremden erwartet hatte und sofort verschnupft war. »Ich liebe die Deutschen. Szie ßehen die fremden Dinge oft wie ein Kind an! ... Wollen Szie in das Rathaus hineingehen?«
»Lieber nicht,« antwortete Peter kühl. »Sie sind sehr liebenswürdig, aber ich möchte vorläufig im Freien bleiben.«
»O,« klagte der dänische Sänger und grüßte zwei junge Damen, die ihm halb belustigt, halb bewundernd (so kam es Peter vor) dankten. »Aber Szie versprechen mir, daß Szie Kopenhagen nicht verlassen werden, ohne im Rathause gewesen zu ßein? Gut, gut! Szie ßind heute erst angekommen? Szo, ßo! Nun, dann werden wir die Östergade entlang gehen, und später werden wir frühstücken«
Peter wußte nicht, ob er lachen oder sich ärgern sollte. Er war doch noch zu sehr Peter Kranz aus Schnattersheim, um sich durch die mangelnde oder jedenfalls fremdartige Form nicht stören zu lassen. Schließlich aber freute er sich doch, einen Begleiter gefunden zu haben und diesen, der außerordentlich bewandert war, ihn immerfort auf etwas aufmerksam machte, was er sonst wohl nie gesehen hätte. Während sie die bunt belebte, lustige und doch ehrwürdige Östergade hinunterschritten, deutete der schnelle Affenarm des Dänen bald auf dieses, bald auf jenes Schaufenster. Plötzlich stand Peter zu seinem Entzücken auch vor der Auslage der königlichen Porzellanmanufaktur.
»Szind Szie auch außer Ihnen vor dem?« fragte der Cicerone mit gutmütiger Ironie.
»Na selbstverständlich!« polterte Peter gereizt. »Sie etwa nicht?! Na, ihr natürlich, ihr Kopenhagener, ihr habt das täglich! Für euch sind das einfach Suppenteller!«
Der Däne lachte herzlich. »Ausgezeichnet!«
»Ich besitze übrigens den Dackel! Den großen da! Dasselbe Exemplar!« »Szo, ßo, den Dackel!« Der andere sagte es mit spöttischer Güte, wie man zu einem Kinde spricht. Sie gingen langsam weiter. Peter betrachtete verblüfft die auffallendste Erscheinung des Kopenhagener Straßenlebens – die Unzahl junger, oft sehr hübscher, künstlerisch eigenartig oder eigensinnig gekleideter Mädchen. Sie beherrschten das Bild. Sie gingen allein oder zu zweien oder zu dreien – die Mehrheit aber radelte und wand sich mit kecker Sicherheit, klingelnd und die zierlichen Füße an das blanke Rad gepreßt, durch das Gewühl. Wunderliche Hüte trugen diese Damen – jeder sah wie eine persönliche Erfindung aus. Diese vielen schlanken, frohen, etwas blassen, graziösen Kinder ... Blond die meisten. Mattblond, wie das sonnegedörrte Gras der Dünen. In den blauen Augen ernste Klarheit, Spiegel der See. Peter lächelte. Ihm wurde wohlig heiß ums Herz. Er sagte nichts, aber sein gelenkiger Begleiter, der fast jede der zahlreichen Damen grüßte, schien seine Gedanken zu erraten.
»Wie gefällt Ihnen unsere Jugend? Szagen Szie es! Wir haben ein ßo kleines Land! Unser Land ist eigentlich nur eine Stadt! Kopenhagen! Wir verlieren hier leicht den objektiven Blick!«
»Wissen Sie,« erwiderte Peter gedehnt und errötete mit etwas plumpem Lächeln. »Hübschen Frauenzimmern gegenüber ist es verdammt schwer, objektiv zu sein.«
Der Däne schwieg. Sein dunkler Blick wurde ernst und überrascht – Peters Antwort schien ihm nicht sehr zu gefallen. Er sah ihn von der Seite an, dann sagte er lebhaft: »O, glauben Szie nicht, daß es hier nur auf das Urteil des männlichen Blickes ankommt. Das wäre wohl ein großes Mißverständnis. Nein! Diese Damen sind ßehr zu respektieren, als Individuen, als Geister! Ja, mein Herr! Die Mehrheit studiert! Es sind auch vorzügliche Künstlerinnen darunter. Diese zum Beispiel, die Swarze, ist eine unserer ersten Porträtmalerinnen! Und jene Blonde auf dem Rade –«
»Die mit der langen roten Fahne am Panamahut? Du mein Gott, was kann denn die sein?«
»Szie steht an der Spitze der dänischen Frauenbewegung. Ich liebe ßie nicht, aber ßie ist nicht unbedeutend.«
»Warum pudern sich denn diese bedeutenden Damen alle?«
»Spricht ßo etwas in Deutschland gegen ihren Geist?«
Peter zuckte die Achseln und schwieg. Es wurde ihm schwer, der Art des Fremden, hinter der eine liebenswürdige, aber scharfe Ironie lauerte, zu dienen. Er ärgerte sich und blieb unschlüssig stehen.
»Szie haben jedenfalls Hunger,« rief sein Cicerone eifrig. »Wir wollen frühstücken! Szagen Szie mir, woran Szie gewöhnt sind!«
»Zu Hause trinke ich Milch,« erwiderte Peter knabenhaft mürrisch, als gälte es eine persönliche Überzeugung zu verteidigen.
»Milch? Wir stehen am rechten Ort! Kommen Szie!«
Der Liebenswürdige wandte sich zur Seite und kletterte zu Peters Überraschung plötzlich in ein Kellerlokal hinab, das an der Straße lag. Peter folgte ihm kopfschüttelnd. Er stand in einem höchst appetitlichen und reichhaltigen Obstgeschäft. Sein unbekannter Freund deutete auf zwei mächtige Körbe mit Himbeeren und Erdbeeren. Peter sah, daß es Früchte von märchenhafter Schönheit waren. Er bekam einen Riesenappetit darauf, wagte aber doch noch, mürrisch zu protestieren. »Ich wollte Milch ...«
Der Däne antwortete nicht, sondern sprach eifrig und unverständlich auf das Ladenfräulein ein. Dieses schien ihn gut zu kennen, und wieder sah Peter das halb ehrfürchtige, halb belustigte Lächeln, mit dem die Kopenhagenerinnen seinem Begleiter begegneten. Seine Neugier, sein Mißtrauen wuchs. Er beschloß, die Vorstellung zu erzwingen, aber willenlos mußte er dem Cicerone folgen, der ihn unter vielen Komplimenten, etwa wie ein Prinzenerzieher seinen Zögling, ins Nebenzimmer führte. Halb geschmeichelt, halb verletzt saß er ihm hier an einem breiten Eichentische gegenüber.
»Sie sind wohl Rentier?« fragte er plötzlich.
Der Däne lachte. »Weil ich nichts zu tun habe, als Fremde herumzuführen und gute Szachen zu essen, meinen Szie?« Dann brach er ab, denn Fräulein Signe kam mit dem Frühstück. Er bediente Peter, als ob es gälte, eine heilige Pflicht zu erfüllen. Peter hatte sich schon darauf gefreut, dem eleganten Bummler durch die Mitteilung zu imponieren, daß er ein deutscher Künstler sei, aber der Teller mit der prachtvollen, gelblichen Milch und der Berg erlesener Früchte, der in einer blaugrünen Schüssel gehäuft war, lenkten ihn ab. Er machte sich seufzend an die Arbeit und erlebte – anders ließ es sich nicht ausdrücken –, daß ihm noch nie in seinem ganzen, zwanzigjährigen Dasein etwas so geschmeckt hatte. Er pamfte selig in sich hinein. Mit dieser dänischen Sitte war er vollkommen einverstanden. Seine gute Laune wuchs, er ärgerte sich jetzt nur noch darüber, daß er seine Dankbarkeit so gar nicht dokumentieren konnte. Denn der freundliche Cicerone zahlte für sich selbst und ließ auch den Deutschen für sich zahlen. Er schien die Schranke der Fremdheit damit betonen zu wollen. Peter empfand das als sehr angenehm.
»Nun möcht' ich aber auch 'n gutes Glas Bier trinken und was Reelles in den Magen kriegen,« sagte er, als sie wieder auf der Straße standen. Er sagte es weicher, fast demütig.
»O ja! Gewiß! Szie scheinen Appetit zu haben! Das freut mich!«
Der Däne nahm seinen Arm (noch immer nicht vorgestellt! dachte Peter) und führte ihn durch das lustige Gewühl zum Rathausplatz zurück. Sie traten in das Restaurant Bristol ein. Am Büfett wählte Peter. Er wählte, wählte, verwirrt und entzückt. Sein erfahrener Begleiter stand ihm mit ernsthaftem Rat zur Seite. Ein halber Hummer und eine Wildente waren schließlich Peters Entschluß. Das gelbe Dänenbier schäumte dazu im Glase, sehr alkoholisch, sehr berauschend. Er stieß mit dem Cicerone an. »Wie heißen Sie eigentlich, Menschenkind?« fragte er jetzt in plötzlichem Überschwunge, bittend.
»Fragen Szie mich, bitte, nicht nach meinem Namen,« erwiderte der Fremde langsam und mit niedergeschlagenen Augen, indem er zierlich Krabben aus der dünnen rosa Beschalung löste. »Es ist noch nicht die Zeit. Ich werde bald einen Namen tragen dürfen, welcher mein wahrer ist. Wenn wir uns nicht mißfallen in dieser flüchtigen Stunde – das genügt doch. Wie?«
Peter stieg das Blut zu Kopf. Er hatte zu rasch getrunken. »Mir nicht,« flüsterte er, indem er sich den Schnurrbart wischte.
Der Fremde schien diese Antwort zu überhören. Er begrüßte wieder mehrere Damen, die sich am Nebentische niederließen, und übernahm es sofort, der »swarzen« Porträtmalerin, die dabei war, ein Frühstück zu holen. Peter verschluckte seinen Zorn und lachte den Dänen, als er eifrig wie ein Kellner zurückkehrte, lustig, aber herausfordernd an. »Sie können ja alles!« rief er.
»Verachten Szie mich deswegen?« fragte jener mit leichtem Lächeln und setzte sich wieder zu ihm. Die Damen, die Deutsch zu verstehen schienen, sahen sich nach Peter um, aber ohne Interesse für seine germanische Schönheit, nur mißbilligend und ein wenig erschreckt. Besonders in den Zügen der Porträtmalerin zeigte sich dieses Gefühl, denn sie war vor Stolz errötet, als Peters Begleiter sie so ausgezeichnet hatte.
»Von Verachten ist keine Rede,« erwiderte Peter gereizt. »Man ist hier eben sehr galant, nicht wahr? Aber ich verstehe diese ›Damen‹ nicht. Wer sich so kleidet, wer so in ein öffentliches Lokal kommt – ich kann mir nach deutschen Sitten nicht denken, daß das wirklich respektable, junge Mädchen sind.«
Er hatte es nicht laut gesagt, nur für seinen Tischgenossen verständlich. Der aber stand jetzt, wie einem Federdrucke folgend, auf und sagte nervös mit leichtem, gleichsam entschuldigendem Lächeln: »Ich bitte mir doch zu glauben ... Aber nun verlasse ich Szie ... Szie sind ein deutscher Künstler, nicht wahr? ... Ich denke es mir ... Beim Bier sind deutsche Künstler nicht ßo liebenswürdig, wie im Freien, wenn ßie bewundern können ... das weiß ich – ich war lange in Deutschland ... Ich hoffe, Ihnen draußen wieder zu begegnen ... Jedenfalls rate ich Ihnen, heute noch das Rathaus und die Glyptothek zu besuchen ... Das Bier ist übrigens ßehr schwer ... Ich bitte Szie um Verzeihung, daß ich Szie darauf nicht aufmerksam gemacht habe ... Leben Szie wohl.«
Er gab ihm die Hand, verneigte sich vor den Damen und ging.
Peter saß da und kannte sich in seinem eigenen Gemütszustande nicht aus. Eigentlich war er wütend, aber er war auch beschämt. Eigentlich haßte er den Fremden, aber es tat ihm auch brennend leid, ihn verscheucht zu haben. Unruhig, in verbissenem Trotz blieb der Krakeeler sitzen. Seinen Nachbarinnen, die dänisch schwatzten und leise kicherten, ohne daß man ihrer Diskretion anmerken konnte, ob der Deutsche der Gegenstand ihrer Heiterkeit war, wandte er ostentativ den Rücken. Echt pfälzisch saß Peter da, breit und rot, und knabberte am letzten Knochen seiner Wildente. Als er zahlte, eine ziemlich hohe Zeche zahlte, fragte er den Kellner halblaut, wer denn der Herr gewesen sei, mit dem er eben gegessen habe.
Der Kellner sah ihn erstaunt mit runden Augen an und schwieg.
»Ja, ja, ich kenne ihn nicht!« flüsterte Peter ungeduldig. »Wie heißt er denn?«
»Das ist doch Herr Waldgren, der berühmte Dichter.« Nach diesen Worten zog sich der Kellner mit einer gewissen Verachtung zurück.
Waldgren? ... Robert Waldgren? Peter hatte in Tante Lindas Bibliothek zwei Bücher von ihm gefunden. Sogar in Schnattersheim war dieser Mann bekannt. Der Titel des einen Buches war ihm erinnerlich: »Sigrid und Karin«. Er hatte ihn behalten, weil Sigrid darin vorkam. Zum Lesen war er nicht mehr gekommen. Und nun? Nun kannte er den Dichter. Kannte ihn? – Er trat ins Freie hinaus. Unwillkürlich fiel ihm ein, daß er Waldgren im Freien besser gefallen hatte, als beim Bier. Er lächelte und freute sich fast darüber. Dann ging er, wie einem Befehle folgend, in das Rathaus. Als er in dem prachtvollen Hofe stand, dankte er nochmals seinem Begleiter innerlichst und wünschte ihn herbei. Dann schritt er, dem Diener nach, durch viele Säle und Zimmer. Überall Eigenart und Schönheit. Und er war noch gar nicht müde. Trotz Berlin, trotz der anstrengenden Nachtfahrt, trotz der erregten, ersten Kopenhagener Stunden! Im Gegenteil – er fühlte sich frischer als je. Es war ihm, als ob er sich in der Heimat verborgene Kräfte reserviert hätte, die hier erst, im gesteigerten Leben, zur Entfaltung kamen. Er dachte nicht an Ruhe, nicht an Hab und Gut – ja, es gab für ihn kaum ein Morgen. Er lebte und schwebte im Augenblick. Und als er wieder mit übernächtiger Blässe, aber heiter und aufrecht auf dem Rathausplatze stand, war es sein erster Gedanke, Waldgrens anderem Rat zu folgen und in die Glyptothek zu gehen.
Vor diesem Griechentraum nun, den dänische Sehnsucht mit kühl sicherem Geschmack in den harten Alltag hineingezaubert, gingen Peter Kranz, wie Onkel Bischoff zu sagen pflegte, mehrere Köpfe zugleich auf. Sein pfälzisches Selbstbewußtsein hatte heute schon so manchen Stoß bekommen – hier aber knickte ihn der Sturm vollständig. Er ging mit kurzen, schüchternen Schritten aus einem Saal in den anderen und in den ersten wieder zurück – er staunte und fühlte sich elendglücklich. Als er aber einen Aufseher gefragt, wer denn die wunderbare Sammlung gestiftet habe, ob etwa der Name Jacobsen, der golden in den Hauptsaal hinunterleuchtete, dem großen Dichter Jacobsen gehöre – in diesem idealen Reich schien ihm alles möglich, und er wußte nicht, wie arm der Dichter des Niels Lyhne gestorben war – als ihm die lächelnde Antwort wurde: »O nein, mein Herr – Herr Jacobsen, der Stifter der neuen Glyptothek, ist kein Dichter, sondern der erste Brauereibesitzer Dänemarks« – in diesem Augenblick erschrak er vor sich selbst. Denn er mußte, mußte mit seiner pfälzischen Kehle donnernd in die stille Marmorschönheit hineinlachen. Sonderbarerweise blieb der Aufseher ganz ruhig. Er entrüstete sich gar nicht. Allmählich merkte Peter, daß er nicht laut gelacht, sondern daß ihm seine Aufregung diese Emotion nur vorgespiegelt hatte. Er senkte den Kopf und ging. Nachdenklich irrte er durch die Straßen. Am Rathause hoffte er Waldgren wieder zu treffen. Aber es war jetzt nichts von ihm zu sehen. Etwas ermattet, nicht müde, eher überwach, setzte Peter sich schließlich an einen Tisch, der vor dem Café Bristol stand. Er starrte in das Getriebe. Als er plötzlich auf die Uhr sah, erfuhr er das Unbegreifliche, daß es schon später Nachmittag war. Halb sechs vorüber. Wie lautlos, glücklich flog hier die Zeit. Er stützte den Kopf in beide Hände und betrachtete eine Dame, die am Nebentische saß und ihn ansah. Seltsam, es lag in der Stimmung dieser Stunde – er nahm das Mädchen ganz unbefangen, wie einen hübschen Gegenstand, in Augenschein. Sie aber, die Gepuderte, bunt und extravagant Gekleidete, ließ es sich lächelnd gefallen. Peter hielt sie für eine Kollegin der Damen, die Waldgren so ritterlich verteidigt hatte. Auch sie gehörte wahrscheinlich zu »unserer Jugend«, auch sie war vielleicht eine bedeutende Porträtmalerin. Unwillkürlich beschloß er mit kindlicher Neue, an ihr wieder gut zu machen, was er an Waldgrens Bekannten gesündigt hatte. Daß sie wirklich etwas ramponiert aussah und gar zu offenkundig gefärbtes, goldblondes Haar trug, irritierte ihn nicht. Sie gefiel ihm. Er freute sich an ihrer eleganten Gestalt, die nachlässig im Korbsessel ruhte, er lächelte über die halb naiv, halb spöttisch gespitzten Lippen, mit denen sie aus einem Strohhalm süßen Eispunsch sog. Die schwarzen Straußfedern an ihrem breiten Hute flatterten im lauen Winde, und der ausgestreckte, feine Fuß im Lackschuh erregte ihn mit seiner pochenden Unrast. Plötzlich stand die Dame auf, warf eine Krone auf den Tisch und ging. Sie würdigte Peter keines Blickes. Starr, verliebt und fast beleidigt, sah er ihrer königlichen Gestalt nach. Gleich darauf war sein Entschluß gefaßt. Er zahlte ebenfalls und eilte der Entschwundenen nach. Bald sah er die nickenden, schwarzen Federn. Wohin eilten sie? Sie eilten energisch, zielbewußt auf ein hohes Portal zu, das ins Abenddunkel mit farbigen Lampen strahlte. ›Tivoli‹ leuchtete es Peter entgegen. Er hatte den Namen heute schon einmal gelesen. Indigniert und wegwerfend damals. Jetzt aber folgte er eifrig den ›Durchschnittsfremden‹, die zahlreich hineinströmten. Er wußte kaum, daß er es tat. Er wollte nur die schwarzen Federn nicht aus den Augen verlieren.
Schwer aber war es, in diesem bunten, zerstreuenden Wirrwarr das Wild in Sicht zu behalten. Auf einem großen Platze geriet Peter vollends in einen förmlichen Strudel hinein. Farbige Lampen umblitzten ihn, ringsum schmetterte lustige Musik. Plötzlich aber fühlte er sich am Arm ergriffen. Er sah sich zornig um. Waldgren stand vor ihm. Nun war es aus mit den schwarzen Federn. Peter wußte wieder nicht, ob er sich ärgern oder freuen sollte. »Störe ich Szie?« fragte noch dazu der Däne. Wieder mit jenem liebenswürdigen Lächeln, hinter dem eine große Bosheit lauerte.
»Gar nicht!« rief Peter unverschämt und drückte ihm die Hand. »Im Gegenteil, ich freu' mich sehr! Waren Sie heute vormittag beleidigt, als Sie so plötzlich davonliefen, Herr Waldgren?«
Wie freute er sich, diese kleine Rache an ihm nehmen zu können. Der Demaskierte errötete leicht, dann sagte er vollständig gefaßt: »O nein, Herr Peter Kranz. Ich wünschte nur, daß Szie bald in das Rathaus und in die Glyptothek gingen – darum entfernte ich mich.«
»Sie sind doch der leibhaftige Satan! Woher wissen Sie meinen Vornamen?«
»Nicht vom Kellner im Hotel Bristol. Ich dachte ihn mir. Szie müssen Peter heißen.«
Er faßte ihn unter und führte den trotzig Lachenden durch das Gedränge.
»Heute vormittag wollten Szie nicht nach Tivoli – nicht wahr? Das gefiel mir. Aber abends ist es vollkommen zu entschuldigen, daß Szie hineingingen.«
Peter war auf seiner Hut. Er schwieg. Er wollte sich von diesem Allwissenden nicht ausholen lassen.
»Ich darf Ihnen wohl auch hier das Beste zeigen,« fuhr der Däne fort. »Sonst geraten Szie leicht an das Schlechteste. Wollen wir zuerst speisen?«
»Nein! Sie denken wohl, ich esse überall, wo ich hinkomme? Nein! Ich will jetzt dahin, wo's am lustigsten ist!«
»Wo es am lustigsten ist ...« Waldgren sagte es ernsthaft und dachte nach. »Kommen Szie.«
Er zog ihn in ein wunderliches Gewirr von künstlichen Felsblöcken, die sich schließlich zu einem niedrigen Gang verengten. Dieser schien in ein unterirdisches Gewölbe zu führen. Verschwunden waren Lärm, Lichter und Musik. Doch plötzlich traten die Männer in eine um so lautere, sonderbare Halle ein, die rot erleuchtet und von einer diabolischen Musik erfüllt war. Gar nicht diabolisch aber bewegten sich die guten Kopenhagener darin, tanzten, lachten und waren bester Dinge. Kreischend lief man beständig vor einem grotesken alten Weibe davon, das einen Besen schwang und des Teufels Großmutter vorstellte.
»Wir sind in der Hölle,« sagte Waldgren lächelnd, aber mit müden Augen. »Ist es hier nicht lustig?«
Peter sah eine Weile in das tolle Getriebe und ließ die tanzenden Mädchen vorbeipassieren. Den Hut mit den schwarzen Federn entdeckte er nirgend. »Ach, wissen Sie,« sagte er schließlich, »ich finde das höchst abgeschmackt.«
»Ich auch,« erwiderte Waldgren. »Kommen Szie – wir gehen in den Himmel.«
Bald darauf traten sie in ein gut irdisches Etablissement ein, das von außen wie ein Varietétheater aussah. Ein hoher, hell erleuchteter Saal aber begrüßte sie mit eigenartiger, wenn auch naiver Blechmusik. Alles war hier auf Licht und farbige Wolken gestimmt. Auf die Wände über den Balkons, die eine dicht gedrängte Menge besetzt hielt, waren Karikaturen berühmter Kopenhagener gemalt. Lachend erkannte Peter, daß die größte und frechste Karikatur seinem populären Begleiter galt. Mit Jubel wurde Robert Waldgren allerorts von den »Himmelsgestalten« empfangen. Am lustigsten und liebenswürdigsten von der Dame mit den schwarzen Federn. Sie konnte doch keine bedeutende Porträtmalerin sein. Ahnungslos (oder etwa nicht? dachte Peter) holte Waldgren den verblüfften Deutschen heran und machte ihn mit dem schönen Mädchen bekannt. »Rita, die Szängerin!« rief er, mit seinen etwas schief gestellten Augen himmelnd. Rita lachte. Sie hatte Peter sofort erkannt und schien zu wissen, daß sie ihn interessierte. Er ging mit ihr umher, und schließlich tanzten sie. Durch Peters Ungeschicklichkeit immer in der Mitte des Saales, immer unter dem lustigen Symbol, das an der Decke des ›Himmels‹ hing und ein niedlicher Luftballon war. In der Gondel saß ein hübscher Knabe, der beständig Konfetti auf die Menge schleuderte. Rita hielt inne, denn sie war schwindelig geworden. Er hielt sie mit seinen starken Armen. »Danke« sagte sie. Sie sagte es oft, denn es war eines der wenigen deutschen Worte, die sie kannte. »Wollen wir gehen?« fragte Peter. Er sah sich unwillkürlich nach dem Dolmetsch Waldgren um. Der Dichter war aber nirgend mehr zu sehen. Rita nickte. Sie traten Arm in Arm hinaus. Draußen äußerte sie ihm eifrig einen Wunsch, aber auf dänisch – Peter hatte keine Ahnung, was sie von ihm wollte. Er riet verzweifelt auf ein gutes Abendessen und wollte sie in das nächste Restaurant führen. Sie aber lachte hell auf und flüsterte, sich an ihn drängend: »Spät!« Spät? ... Was meinte sie damit? Wahrscheinlich später. Sie konnte keinen deutschen Komparativ bilden, aber sich zur Not doch verständlich machen. Wohin mochte sie nur jetzt wollen? Er zuckte lachend die Achseln und ließ sich von ihr ziehen. Emsig strebte sie mit ihm auf eine Varietébühne zu, die im Freien errichtet und strahlend mit ihrem hüpfenden Ballett von einer dunklen Menschenmenge umlagert war. Peter erschrak. Er dachte plötzlich daran, daß Waldgren Rita als Sängerin vorgestellt hatte. Sollte sie ihm jetzt wieder entschlüpfen wollen, weil ihr Beruf sie auf die Bühne zwang? Er mußte Klarheit haben. Naiv versuchte er es mit der Zeichensprache, deutete erst auf Rita, dann auf die Bühne und machte ein ängstlich fragendes Gesicht dazu. Sie verstand ihn sofort und rief lachend: »O nein! Heute frei!« Dann zog sie ihn in die vorderste Parkettreihe. Die bunten Darbietungen der Bühne, für die Rita, zum ›Bau‹ gehörig, das größte Interesse hatte, ließen Peter kalt. Er hatte nur Augen für seine Begleiterin. Endlich war die Vorstellung zu Ende, und Peter überließ dem schönen, heiter erregten Mädchen die Wahl des Restaurants. Sie starrte ihn an, dann schien ein kecker Einfall über sie zu kommen. Tänzelnd zog sie den verblüfften Deutschen mit, der von nun an einem gewissen, starken Haustier, das blind zu Markt getrieben wird, immer ähnlicher wurde. Das vornehmste Restaurant von Tivoli war Ritas Ziel. Hier war nicht ihr Platz, das wußte sie wohl, aber gerade deshalb wollte sie sich hier einmal ganz unbefangen niederlassen. Sie hatte ja einen so ahnungslosen Kavalier, der sie schützte. Lächelnd, selbstbewußt in ihrer Berühmtheit und reichen Toilette stieg sie in die hell erleuchtete, offene Veranda hinauf, und Peter folgte ihr errötend, nachdem er seine Haltung durch ein unzeitiges Stolpern verloren hatte. Das Paar erregte bei der Kopenhagener Hautevolee, die an kleinen Tischen delikate Dinge schmauste, Sensation. Man steckte die Kopfe zusammen, man lachte, tuschelte und war ebenso indigniert, wie interessiert. Besonders die Damen prüften eifrig Ritas Toilette. Sie machten der »Unfeinen« das Feinste immer nach. Hätte Onkel Bischoff jetzt sehen können, wie Peter Kranz seiner Angebeteten gegenübersaß! Er hätte am Ende die ganze Raritätensammlung dafür hergegeben. Peter bestellte. Sein Portemonnaie, ein immer dunklerer Begriff, war ihm Nebensache. Wenn er der Schönsten nur gefiel. Er stieß den Champagner mit ihr an, er war verliebt, ganz richtig verliebt in dieses höchste Kulturprodukt des Landes. An Beobachter dachte er im Schatten ihres großen Federhutes, der so reizend das unbeholfene Geplauder schützte, nicht. Plötzlich aber, als er aufsah, um noch eine Flasche zu bestellen, sah er statt des Kellners Herrn Robert Waldgren vor sich. Erst ärgerte er sich über die Störung, zumal Rita beim Anblick des Dichters ihre gute Laune verlor und befangen wurde. Dann aber wollte er ihn doch ansprechen. Doch Waldgren kam ihm zuvor, ließ seinen ernsten, etwas vorwurfsvollen Blick auf Rita ruhen, schien Peter irgendwie warnen zu wollen und entfernte sich dann, nachdem er mehrere Bekannte begrüßt hatte. Peter war sich von Champagners wegen über Waldgrens Verhalten nicht klar. Doch in seltsamer Zusammenhanglosigkeit fiel ihm jetzt plötzlich ein, daß er kaum so viel Geld hatte, um die Zeche zu bezahlen. Ich bin ein Ochse, dachte er niedergeschmettert. Warum habe ich daran nicht früher gedacht? Dann brachte die Not ihn auf die Idee, Waldgren anzupumpen. Doch der Dichter war schon fort. Ihm nachlaufen? Unmöglich! Es blieb nichts anderes übrig, als die Bestellung der zweiten Flasche zu umgehen, indem er zahlte. Rita erleichterte ihm diesen scheinbar harmlosen Entschluß, da sie müde und verärgert aussah. »Blut schwitzen« mußte Peter bei der Verrechnung mit dem Kellner. Schließlich aber stellte die Sache sich doch etwas billiger heraus, als er gefürchtet hatte – er behielt noch anderthalb Kronen übrig, Rita rauschte voraus – er trabte hinterdrein, etwas beschwipst und nur von dem dunklen Drange beseelt, nicht auf ihre Schleppe zu geraten. Das Mädchen war verstimmt. Sie ging schweigend neben ihm her, und er überlegte ratlos, wie er sie wieder aufheitern könnte. Doch eine schreckliche, zornig bittere Stimmung bemächtigte sich seiner selbst. Er hatte ja kein Geld mehr. Aber sie hergeben, Verzicht leisten – nein, das wollte er keinesfalls. Nur ihrer sicher sein – er war es ja nicht gewöhnt, sein Glück vom Mammon abhängig zu machen. Es sollte jetzt keine Zukunft für ihn geben. Er hielt sich an die Gegenwart, an den Augenblick. Mit Gewalt zwang er sich dazu, sich selbst für einen außerordentlich leichtsinnigen Lebemann zu halten, dem alles zur Verfügung stand. Ein armer Schlucker war er nicht! O, nein! Blindlings folgte er Rita in ein Café, das neben dem Portal von Tivoli lag. Eigentümlich hastig, mit forschenden Blicken kehrte sie dort ein. Sie setzten sich, doch Rita schwieg beharrlich, war zerstreut und schien sich für den Deutschen kaum noch zu interessieren. Plötzlich geschah etwas, das Peter, der zornig vor sich hinstarrte, entging. Ein bleicher, vornehm gekleideter, junger Däne war in das Café getreten, blieb an der Tür stehen und musterte Rita halb spöttisch, halb drohend. Rita erblickte ihn, erhob sich wie auf ein Signal und entschuldigte sich bei Peter, indem sie ihn in liebevoller Eingebung streichelte. Dann ging sie hinaus. Peter, der natürlich dachte, daß sie bald wiederkommen würde, blieb trübsinnig sitzen. Aber es dauerte lange – sehr lange und schließlich wußte er sich betrogen. Die Entdeckung schmerzte ihn mehr, als sie ihn aufbrachte. Aber sie befreite ihn auch. Indem er Ritas Bild verlor, stand ihm um so deutlicher als erste, schwere Lebenserfahrung vor Augen, wie arm jede Kraft auf der Welt ohne Besitz war. Viele hätten ihn jetzt ausgelacht, das wußte er – er aber verharrte nachdenklich und traurig.
Gegen Mitternacht trat er auf die Straße hinaus. Widerwärtig war ihm jetzt der Gedanke, eine armselige Spelunke aufsuchen zu müssen. Wie ein fechtender Handwerksbursche. Brrr! Er hatte heute in großem Stil gelebt – er mußte dabei bleiben. Nur in keine dumpfe Armeleuteatmosphäre geraten – jetzt, wo die Flügel seiner Phantasie sich regten, wie noch nie. Wer mochte auch in dieser wunderbaren Sommernacht, von Sternbildern überwölbt, die tröstend in die dunkle Seele leuchteten, an Schlaf denken? Es war warm, wie am Tage, und silbern feierlich still. Peter schritt langsam die menschenleeren Straßen entlang, immer tiefer ins Neuland hinein. Eine seltsame Wonne war das – als Fremder unter Fremden – für sich entdecken, was hundert Generationen eingewurzelte Gewohnheit war. Er kam durch die Oestergade auf den Kongens Nytorv, einen großen Platz, der von prächtigen Gebäuden umgeben war. Peter erkannte ihn, als er sich aus Onkel Bischoffs Schilderung erinnerte, daß das Königliche Theater am Kongens Nytorv lag. Das Theater war es, denn an seinen Stufen saßen ja die beiden Riesengestalten aus dunkler Bronze: Holberg und Oehlenschläger. Seltsam irritierend lächelten die gemächlichen Dichter in ihrer ungeschlachten Größe. Sie machten beide ein Gesicht, als wollten sie dem Betrachter sagen: so sahen wir nicht aus. Peter schritt weiter. Aufs Geratewohl durch die Bredgade, denn ein richtiger Instinkt sagte ihm, daß in dieser Richtung die »lange Linie« läge und der Hafen. Er sehnte sich nach der See. Die russische Kirche glitt wie ein Traumbild an ihm vorüber. Sie war eine Seltsamkeit mehr mit ihren goldenen Zwiebeltürmchen. Amalienborg aber, das königliche Schloß, mit seinen stolzen vier Fronten und dem uralten Reiterdenkmal, ließ ihn stehen bleiben. Er sah durch das Gittertor in den Hof hinein. Wundersam, wie grünliches Silber, leuchtete das über und über patinierte Standbild im Mondschein. Welchen König es darstellte, wußte Peter nicht. Das war ihm auch gleichgültig – er hatte nie viel historischen Sinn besessen. Dann kam er bald an das Ende der Straße und in hübsche Anlagen hinaus, wo er sich absolut nicht mehr auskannte. Der linke Weg lockte ebenso wie der rechte. Peter folgte einem kleinen See, der ihm unter hängenden Weiden still entgegenschimmerte. Als er am Ufer eine Bank entdeckte, freute er sich. Es war eine wunderliche selbstironische Freude. Er ertappte sich dabei, daß seine Müdigkeit, die bisher nur als kleine Wolke am Horizont gedroht hatte, sachte über ihn hergekommen war. Seine Augen schmerzten plötzlich vor Schläfrigkeit. Es war eine Wohltat, sich auf die harte Bank niederlassen zu können. Nur nicht gleich einnicken, wie in Mutters Schoß – erst nachdenken, männlich klar werden über alles. Er hatte genau gezählt: Eine Krone fünfundvierzig Oere – das war sein Vermögen. Und kein Gepäck. Er lachte etwas heiser in sich hinein und schlug sich auf den Schenkel. Stilvoll war es eigentlich, einen solchen Tag hinter sich zu haben, den ersten in Kopenhagen! Aber morgen? – Und weiter? – Ganz frech sein und mit Baronallüren in ein vornehmes Hotel gehen? Das ging wegen des verfluchten Koffers nicht. Die Haltung hätte er sich schon zugetraut! O, warum mußte ihm der blinde Herr auf dem Bahnhof in Berlin begegnen! Er hatte nicht einmal eine Skizze von ihm machen können. – Schicksal. »Am Ende hat alles doch sein Gutes,« pflegte Taute Linda zu sagen. Kein großes Hotel und keine deprimierende Spelunke – bei Mutter Grün übernachten, das war das Billigste, Reinlichste und Anständigste. Hier saß er nun mit seinen müden Knochen – hier blieb er. Aber er wollte nicht einschlafen. Nein, wirklich nicht. Ein bißchen Zukunftspläne mußte er noch machen. Das wäre ja der Tante gegenüber unverantwortlich gewesen – dieser treuen Seele. Wenn er nur nicht immer gähnen müßte. Überanstrengung. Der Kiefer brach ihm fast ab. Er riß den Hut vom Kopf, um sich ein wenig frisch umwehen zu lassen. Also morgen früh – zunächst nach dem Koffer telegraphieren. Nein ... Blödsinn! Was blieb ihm dann zum Leben übrig? Von anderthalb Kronen? Er mußte sich doch etwas zu essen kaufen. Nicht für einen Tag, für mehrere. Das war übrigens lustig und sozial gerecht – ein so dicker, wohlgenährter Kerl, wie er, sollte auch mal kennen lernen, wie's tut ... Ganz lustig war es. Und in der Glyptothek vergaß man dann die physischen Nöte alle vor psychischen ... Er wollte morgen den ganzen Tag in der Glyptothek bleiben ... An Tante Linda telegraphieren? Um Geld dazu? Unmöglich ... Jetzt durfte er es noch nicht, sie hätte etwas Scheußliches von ihm gedacht, und belügen konnte er sie nicht. Ganz abgesehen davon, daß ein Telegramm die Tante ohnmächtig machen konnte, bevor sie den Inhalt erfuhr. Er erinnerte sich, daß sie nur einmal ein Telegramm erhalten – als ihr Bruder gestorben war. Seitdem gab es kein größeres Schreckbild für sie, als einen Depeschenboten. An Onkel Bischoff telegraphieren? Den ließ er aus dem Spiel. Den Giftpilz! Jetzt war ihm doch zu ernsthaft, stolz und frei zumute für die Stichelreden des Herrn Apothekers. Nein, nein ... Das Beste war, sich durchzuschlagen – morgen an Tante Linda einen Brief zu schreiben und abzuwarten, bis die Antwort kam. Das konnte vier Tage dauern, sagte ihm eine düstere Ahnung ... Naja! ... Aber es gab ja Leute, denen es viel schlechter ging! Und Kopenhagen war schön! Kopenhagen ... Kopenhagen ...
Sein blonder Kopf fiel schwer auf die Brust herab. Erst wackelte er noch ein bißchen, in instinktivem Widerstand gegen Morpheus. Dann aber war alles vergebens. Die dänische Sommernacht hielt den Atem an – sie hörte kichernd ein überzeugtes, unbeirrbares, deutsches Schnarchen.
Traumlose Stunden zogen dahin. Und im Frühlicht, hell beschienen in seiner rührenden Versunkenheit, saß Peter Kranz noch auf derselben Stelle. »Mir ist alles Wurst,« das drückte sein leise atmender Körper aus, der blonde Kopf, in die Hände gestützt, die starken Beine, mit den Absätzen in den Boden gegraben. Lächelnd standen einige Frühaufsteher – Soldaten, Bäckerjungen und Dienstmädchen – um den fremdartigen Schläfer herum. Er war ja gut gekleidet – gewiß hatte ihn der Rausch übermannt und ihm den Heimweg unfreiwillig abgekürzt – ein gewöhnlicher Stromer, der kein anderes Bett als eine städtische Bank bei Mutter Grün hatte, war das nicht. Doch ernst und gestreng nahte schon der Herr Parkaufseher und scheuchte den schwatzenden Kreis, der sich um Peter gebildet hatte, auseinander. Man blieb nun in gemessener Entfernung stehen, denn den Schlußeffekt des Erwachens wollte man um keinen Preis versäumen. Peter, von dem Beamten mit weltmännischer Schonung aufgerüttelt, riß die Augen auf und stierte höchst verblüfft in das fremdartige Leben hinein. Die Beobachter lachten nicht laut – echt dänisch kicherten sie nur und wandten sich fast verschämt ab. Man genierte sich, weil es sich um keinen Strolch, sondern um einen Herrn handelte. Jetzt sprach der Beamte ernst und eifrig auf Peter ein. Der Fremde verstand kein Wort, das sah man – er hatte genug damit zu tun, sich die Ereignisse des vergangenen Tages, die diesem Erwachen vorausgegangen und seine Ursache gewesen, ins Gedächtnis zu rufen. Endlich hatte er den Faden in der Hand und klärte den Beamten in deutscher Sprache auf. Er wisse wohl, daß es verboten sei, auf einer Bank zu übernachten, doch es gebe im menschlichen Leben stärkere Mächte als das Pflichtbewußtsein, und wenn man umhergeworfen sei, wie er, zwischen Haben und Nichthaben, Sein und Nichtsein – – er faselte, sein Kopf tat ihm weh, er fühlte sich wie zerschlagen und wußte nicht mehr, was er redete. Immerhin hatte er die Genugtuung, daß der Aufseher jetzt ihn nicht verstand, aber, um den Zuhörern zu imponieren, so tat, als wäre er des Deutschen mächtig. Er nickte gnädig und erklärte Peter mit einer entlassenden Handbewegung deutlicher, als mit einem salomonischen Urteil frei. Der Deutsche erhob sich, gähnte und suchte seinen Hut. Zu seinem Entsetzen fand er ihn nicht mehr. Da streckte ihm der Beamte den bisher verborgen Gehaltenen lächelnd entgegen. Aber wie sah der schöne, grüne Deckel aus! Er war ganz eingebeult, und die Krempe war auf der einen Seite abgerissen. Offenbar hatte der Nachtwind ihn dem Schläfer entführt und heimtückisch unter einen vorüberrollenden Wagen geworfen. Jetzt erst, als Peter sich die Schnattersheimer Ruine besah, platzten die Beobachter los und zerstoben wie Schulkinder in alle Richtungen. Er aber riß wütend eine grüne Strähne von der Krempe ab und stülpte trotzig den übrig gebliebenen ›Hut‹ auf den Kopf. Dann dankte er dem Aufseher und ging seiner Wege. – Wohin? Die Sehnsucht nach dem Wasser hatte er verloren. Ihn fröstelte. Nachttau bedeckte seinen Anzug, dessen schönes Silbergrau bedenkliche dunkle Flecken zeigte und überdies von dem harten Bette böse zerknittert war. Nein, nein, die ›lange Linie‹ konnte ihm gewogen bleiben. Er mußte vor allen Dingen erst etwas Warmes in den Leib bekommen. So wandte er sich wieder der Stadt zu und suchte ein Kaffeehaus auf. Endlich geriet er in ein ziemlich schäbiges Parterrelokal, das in all der Unverständlichkeit ringsum wenigstens das Wort ›Kaffee‹ an der Tür zeigte. Peter hatte einen Bärenhunger und verschlang mehrere belegte Brötchen, die auf dem Büfett lagen. Von dem Getränk, das nach etlichem schmeckte, nur nicht nach Kaffee, brachte er nur wenige heiße Schlucke hinunter. Dann zahlte er – fast eine Krone! Doch das erschütterte ihn jetzt nicht. Er hatte etwas im Magen und war sich klar darüber, daß der Rest seines Vermögens, etwa 50 Öre, wenig Bedeutung hatte. Wer gestern abend noch mit der schönsten Frau im feinsten Restaurant von Tivoli soupiert, der konnte sich ohnehin nicht tagelang wie ein Bettler durchschlagen. Es mußte irgend etwas eintreten, heute schon oder morgen, irgendein märchenhafter Wechsel des Glücks, ein Aufschnellen seiner Lebensschaukel zur Sonne hin – er war Phantast genug, um an so etwas zu glauben.
Die Bredgade ging er entlang. Mit gewaltsamer Fröhlichkeit, denn er war noch immer sehr müde. Auch genierte den Sohn aus guter Familie die ironische Aufmerksamkeit, die das Kopenhagener Publikum ihm schenkte. Nichts konnte seine Willenskraft so hemmen, wie das Bewußtsein äußerer Schäbigkeit. Entweihtes Silbergrau, zerstörter grüner Hut! Und ungewaschen war er, gänzlich ungekämmt – o Gott, ihn ekelte. Sollte er sich von dergleichen abhängig machen? Nein! Er raffte sich zusammen. Jetzt mußte er die Augen offen behalten für alles, was ihm neu entgegentrat. Nicht an physische Kalamitäten denken. Der Fremde, der Wanderer, der freie Kerl sein, wie gestern! Und als Künstler vorwärts kommen, mit geschärftem Blick.
Der Kuppelbau der Hofkirche, die Amalienborg gegenüberlag, lockte ihn an. Doch als er sich dem Portal näherte, grinste ihm schon von weitem »Eintritt 25 Öre« entgegen, und wütend zog er sich zurück. Die Hälfte seines Vermögens für den Anblick einer Kirche hinzuwerfen, hätte er nicht gezögert – ihn erboste nur die staatliche Willkür mittellosen Kunstjüngern gegenüber. Jeder Zoll ein Protest, wandte Peter Kranz sich mit langen Schritten dem Kongens Nytorv zu. Da lag wieder das Königliche Theater mit seinen langweiligen Riesendichtern. Er wäre heute abend gern hineingegangen. Jeder Ladenschwengel konnte sich das leisten – ein deutscher Künstler nicht. Jetzt verwünschte er Rita. 25 Kronen hatte sie ihm gekostet. Fort war sie wie ein Spuk – er hatte nicht das mindeste von ihr. Ein Abenteuer – ja – darauf war er ein wenig stolz. Er vergaß sie mit zorniger Anstrengung und eilte zur Glyptothek.
Hier kostete es nichts – natürlich. In diesem edlen Tempel verlangte man keinen Obolus. O Wonne, hier zu bleiben, hier zu vergessen. Aber was war das? Hatte er denn heute keine Augen im Kopfe? War sein Herz erstarrt? So mußte es sein, denn sie waren ihm plötzlich nur Steine, leblose Steine, die Wunderwerke, die er sah. Er irrte aus einem Saal in den anderen, und gestern hatte ihn keiner losgelassen. Ihn fror. Er dachte an Essen und Trinken, an ein weiches, behagliches Bett. Fast wie als kleiner Junge fühlte er sich, als der Vater ihn zum ersten Male in das Karlsruher Museum mitgenommen, und seine noch ungeweckten Augen gelangweilt umhergeirrt waren, als einzige Freude die Bonbontüte vor sich gesehen hatten, zu Hause in Mutters Schrank. Was war doch das ganze, große Künstlertum für ein Wahn, wenn der Mensch, der darunter steckte, in Unordnung geriet? Pfui Teufel! Heute erlebte er hier gar nichts. Gestern hatte er noch stolzgeschwellt dagestanden und am liebsten mit Correggio ausgerufen: Anch' io sono pittore! (obwohl dieser Ruf in einer Glyptothek nicht am Platze gewesen wäre). Und heute? – Heute schlich er sich mißmutig wie ein Nörgler davon. Eine Depression befiel ihn, wie in seinem ganzen Leben nicht. Er dachte an nichts intensiver, als an die Flecke in seiner Hose, an die Beule seines Hutes, und wo er wohl heute abend sein müdes Haupt niederlegen könnte. Ein letzter Stolz aber warnte ihn davor, der Einsamkeit seiner Erniedrigung zu entraten. Es fiel ihm jetzt nicht ein, sich an Waldgren zu wenden, den Fremden, den er hätte besuchen müssen, um einen Pump zu riskieren. Er beschränkte sich darauf, vornehm in ein Café zu gehen, dort einen unfrankierten Brief an Tante Linda zu schreiben, worin er ihr alles beweglich, aber heiter und selbstbewußt auseinandersetzte, und im übrigen bei einer Flasche Bier so lange hocken zu bleiben, wie man ihn dulden würde. Die dänische Geduld war groß, aber es war ein rettender Gedanke für Peter, daß er sein Skizzenbuch aus der Tasche zog und sich als Zeichner etablierte. Den neugierigen und mißtrauischen Kellner brachte er damit auf seine Seite. Er porträtierte ihn in mehreren Stellungen, und die Erkenntnis seines Talents ließ den Kellner alle Bedenken gegen den sonderbaren Gast vergessen. Bei törichtem Geplauder und planlos träumerischer Arbeit verging der zweite Kopenhagener Tag. Als es dunkel war, zahlte Peter mit stolzer Nachlässigkeit – dann fand er sich wieder ausgestoßen auf der unwirtlichen Straße.
Jetzt galt es, ernsthaft Kriegsrat zu halten. Zu einem armseligen Obdach entschloß er sich, indem er sein Skizzenbuch, mit dem Gefühl eines reichen Mannes einsteckte, auch diesmal nicht. Aber wohin? Ihn interessierte jetzt nichts mehr, nur eine friedliche Nachtruhe. Er lechzte danach, sich durch andere Kleider und ein Bad zivilisieren zu können. Unwillkürlich schritt er dem Ausgangspunkte seiner Irrfahrt, dem Bahnhof, zu. Plötzlich blieb er stehen. Eine riesige Reklame, deren Lettern die Brandmauer eines ganzen Hauses bedeckten, fesselte ihn. Er las: I. B. Söderberg's Bryggerie – Aktieselskab. Söderberg! ... Jawohl. Das war der Freund seines Onkels. Das war der Mann, dem Schnattersheim eine wundervolle Porzellansammlung dankte, der ungeheure Mengen Bier braute, nicht nur, um sein Land mit Alkohol zu vergiften, sondern um es auch durch Kunstschätze zu bereichern. Ein echt dänischer Widerspruch, den Peter jetzt erst richtig verstand. Warum war er nicht schon früher auf I. B. Söderberg verfallen? Hier lag ja der einzige Hafen für sein leckes Fahrzeug. Hatte ihm nicht der Onkel bei der Abreise noch einmal das Versprechen abgenommen, daß er nach Marienlyst hinausführe und dem alten Freunde Grüße brächte? Jetzt galt es freilich, eine tüchtige Portion Scheu zu überwinden. Aber eine Blamage konnte es unmöglich werden – in solchen Dingen war Onkel Bischoff zuverlässig, wie kein anderer. Ihm war gewiß darum zu tun, dem Neffen in der Fremde für alle Fälle eine Zuflucht zu sichern. Außerdem konnte es sich bei dem ihm völlig Fernstehenden ja nur um eine Höflichkeitsvisite handeln. Selbstverständlich suchte er nur den Herrn des Hauses auf. Am liebsten in seinem Kontor. Die beiden Töchter (Peter erinnerte sich, daß J. B. Söderberg Töchter hatte) wollte er verschonen. Sein gepantertes Silbergrau und das Scheusal von Hut, das er trug, machten ihn für Damen nicht präsentabel. Aber den reichen Brauer pumpte er in Gottes Namen an. Dem ließ er Onkel Bischoffs Grüße als Bürgschaft und verschwand dann gerettet.
Als er sich aber dem Bahnhof näherte, hohnlächelte ein neues Hindernis seines männlichen Entschlusses. Er hatte ja kein Reisegeld mehr, um nach Marienlyst zu fahren! – Leer gebrannt war die Stätte ...
Wenn eins gekneipt hat
Eine Nacht oder zwei
Und hat dann kein Geld mehr,
Versetzt er was – ei!
Zum Glück fiel ihm das wenig poetische, aber praktische Burschenlied aus der Heimat ein. Aber das war leichter gesungen als getan. Erst etwas haben zum Versetzen – ei! Er tastete an dem ganzen, langen Peter Kranz herum, um einen Wertgegenstand zu entdecken. Der einzige, den er fand, war ein alter Siegelring seiner Mutter, dünnes Gold und ein wenig kostbarer Achat. Seine Uhr war aus Stahl und die Kette daran aus Horn. Er trug diese wertlosen Dinge lieber, als die goldenen Konfirmationsgeschenke, die zu Hause im Schranke lagen. Scheußlich ... Freilich, wenn er sich vergegenwärtigte, wie die Gute selbst geurteilt hätte! ... »Nimm's, mein Junge. Versilbere es schnell, wenn du in Not bist, mein Junge!« So hörte er sie sprechen. Aber wo fand er einen Pfandleiher? Ein Schutzmann gab ihm Auskunft – der prächtige Mann sprach deutsch. Bald stand Peter bei Abraham Levy in einem trüben Kellerloch und ließ den dürftigen Patriarchen, den er am liebsten porträtiert hätte, seinen Ring prüfen. »Zwa Kronen« war das Ergebnis. Peter bestand auf drei, um ein Abendessen herauszuschlagen, aber der Alte war unerbittlich. Er schrieb ihm einen Pfandschein aus, und Peter rannte zum Bahnhof. Hier erfuhr er, daß kein Zug mehr nach Helsingör ging. Der nächste fuhr erst um 7 Uhr in der Früh! Das hieß also, noch eine zweite Nacht kampieren. Am besten im Wartesaal des Bahnhofes. Da gab es wenigstens ledergepolsterte Bänke, auf denen auszuruhen staatlich konzessioniert war. Da konnte man ohne Nachttau und Hüte entführende Stürme sanft schlummern, in angenehmer Wärme, zuweilen auch umherwandern und an eine bessere Zukunft denken. Wie schön war doch ein Wartesaal! Das hatte Peter noch gar nicht gewußt! Er ließ sich neben einem alten Frauchen nieder, das aus einer großen Tüte Kirschen aß. Als sie ihn sehnsüchtig zuschauen sah, bot sie sie ihm lächelnd an. Er dankte errötend und beteiligte sich am Souper. Dann schlief er, fast an seine Gastgeberin gelehnt, ein. Die Nacht gestaltete sich weniger abwechselungsvoll, als Peter gedacht hatte. Sein Schlaf war bleiern, und um halb sieben erst rüttelte ihn der Bahnhofsportier, der sein Reiseziel kannte, von der Bank auf. Bald fuhr er neu gestärkt in den strahlenden Morgen.
Heute schien ihm alles Hoffnung zuzuwinken. Wie schön war Dänemark! Jetzt erlebte er es erst, der Maler, als er die große Stadt im Rücken hatte. Sie hatte ihn mehr verwirrt als bereichert. Als seine Augen auf der ganzen, wundervollen Farbenskala Grün ruhten, die dieses Land erfüllte, fand er sich zur alten Kraft des Künstlers zurück, die keine Sicherheit mehr brauchte, wenn Schönheit und Lebensfreude vorhanden waren. Tiefblau mit goldener Sonnenflamme wölbte sich der Himmel über der grünen Pracht. O, diese Wälder, diese Wälder! Hier wurde »Niels Lyhne« erst lebendig, hier waren die Menschen Jacobsens wahr. Überall sproß es von Erika. Violette Beete umleuchteten die uralten Buchenstämme, deren goldgrüne Kronen sich einige Fuß über dem Boden, ungestüm und jede eine krafterfüllte Welt für sich, ausbreiteten. Rehe weideten furchtlos am Bahndamm, und in der flimmernden Luft schossen Schwalben wie Lichtblitze, führten Schmetterlinge ihr holdes Sommerspiel auf. Klampenborg, Charlottenlund, Skodsborg. Bekannte Namen flogen an Peters Augen vorüber. Auf jeder Station herrschte das lustige Gedränge der Kopenhagener. Mindestens eine Sigrid, blond, schlank und mit ernsten Kinderaugen, sah Peter unter den sommerlich gekleideten Frauen. Ihm unbewußt hatte sich auf dieser frohen Fahrt durchs Dänenland wieder die Photographie von Onkel Bischoffs Tisch in seiner Erinnerung gemeldet. Peter lächelte aufgeregt. Er schob das Bild, sich selbst beschwichtigend, behutsam zur Seite.
Nun war er in Helsingör. Er lachte zum Erstaunen seiner Reisegefährten laut auf, während er ausstieg. Eben war ihm Herr Scheible, der Schulrektor in Schnattersheim, eingefallen, der ihm aufgetragen hatte, »seinen Hamlet zu grüßen«! Der gute Rektor! Was kümmerte Peter Kranz hier Hamlet, was sein Vater und des Vaters Geist! Zum Henker mit der Historie! Das hohe, altersgrüne Schloß, das er in der Ferne liegen sah, war freilich schön und zum zweiten Male schon erzählte ihm der Marienlyster Omnibuskutscher, daß dort zum Sund hinaus die Terrasse läge, auf der der alte Dänenkönig herumgespukt wäre. Schön! dachte Peter. Ich habe jetzt keinen Sinn für Gespenster. Ich will ans helle, salzfrische, brausende Meer. Baden will ich, baden, mich hineinstürzen und all den Schlamm und Spuk im Nu von der Seele haben.
Der Omnibus rumpelte durch die schmalen Gassen der alten Schifferstadt Helsingör. Dann meldete der gesprächige Kutscher plötzlich Marienlyst. »Wo denn?!« rief Peter protestierend. »Das ist Marienlyst? Das ist ja ein großes Hotel?!«
»Jawohl, mein Herr!« lachte der Däne und lenkte seine Rosse, mit der Peitsche knallend, elegant in den Hof ein. »Marienlyst ist ein Hotel!«
»Aber wo ist denn das Villenviertel? Wo wohnt denn z. B. J. B. Söderberg, Bryggeri-Aktieselskap?«
Jetzt lachten die Insassen des Omnibus hell auf. »Herr Söderberg,« sagte der Kutscher feierlich, als ob er vom König selber spräche, »der wohnt freilich nicht im Hotel. Der hat hier die schönste Besitzung, hinter dem Hotelpark, hoch über dem Strande. In 10 Minuten sind Sie dort. Aber will denn der Herr nicht im Hotel wohnen?«
»Nein!« rief Peter ängstlich, denn er ermaß sofort den Gegensatz seines Vermögens und des wahrhaft großartigen Gebäudes, vor dem er stand. Er dankte dem Kutscher und machte sich eilends davon. Im Bannkreise des Hotels wurde ihm nicht wohler. Auf den glatten, abgezirkelten Kieswegen, wo er überall Vertreter der »obersten Zehntausend« von Kopenhagen traf, war er ganz unsicher. Beim Anblick der kostbaren Panamahüte fiel ihm die Ruine ein, die er selbst auf dem Kopf trug. Die schneeweißen Kleider der schönen, jungen Tennisspielerinnen waren ein offenkundiger Vorwurf für sein eigenes weiland Silbergrau. Hier mußte er möglichst schnell heraus. Endlich kam er in die Villenstraße. Er suchte mit scheuen Blicken J. B. Söderberg. Er war nicht zu finden. Unter den hübschen, aber etwas nuttigen Landhäusern, Dependancen des Hotels, konnte die Villa nicht sein. Er stieg eine Anhöhe hinauf, die sich in den Wald zu verlieren schien. Aber es war nur ein schmales, abgrenzendes Hügelland. Und jenseits, wo zugleich ein überwältigendes Bild der offenen See sich auftat, lag sie, J. B. Söderbergs Besitzung. Das war sie, ja! Still, einsam, fürstlich groß. Aber für die Augen eines armen Schluckers stand ein Engel mit feurigem Schwert an der Pforte. Peter machte unwillkürlich kehrt. Der boshafte Onkel hatte sicher übertrieben – oder – renommiert. Mit einem solchen Nabob konnte der Apotheker von Schnattersheim unmöglich intim sein. Oder doch wenigstens nicht so, daß der Neffe einfach in das Schloß hineingehen und den Besitzer anpumpen durfte. Weiß ragte der Turm des Herrenhauses aus buschigem Parkgrün. Zu beiden Seiten weitläufige Wirtschaftsgebäude. Ein unabsehbarer Garten, der sich nach hinten in Buchenwald verlor, vorn aber terrassenförmig, breit zur Brandung hinunterführte. Peter machte jetzt entschieden kehrt. Auch bellte ihn schon eine mächtige Dogge an. Er mußte wenigstens gebadet haben, bevor er da hineinging. Dieser erste Entschluß stand fest. Er wollte den Rest seiner Barschaft für ein Seebad verwenden, wovon allein er die moralische Stärkung hoffte, J. B. Söderberg sein Anliegen vorbringen zu können. Lehnte der Däne ab – nun gut. Des Menschen Zukunft war dunkel.
Rasch war Peter zum Strande hinuntergesprungen. Sein Geld reichte eben noch für das Badebillett aus. Und nun – hinein! O Wonne! Wiedergeburt! Er balgte, herzte, er verschwisterte sich mit dem schönen Element. Weit drüben blaute Schwedens Küste. Peter fühlte die Kraft, hinüberzuschwimmen. Jung war er, jung! Und rein! Das war die Hauptsache! Nun konnte er wieder fragen, was die Welt kostete. Herr Söderberg mit seinen Biermillionen imponierte ihm gar nicht mehr. Er verließ erst nach einer vollen Stunde das Wasser und ließ sich von der lieben Sonne trocknen. Dann hüpfte er singend in seine Zelle zurück, um Toilette zu machen. Aber o weh – Toilette! Der gebadete Peter erkannte erst völlig, wie schlimm es um seine äußere Hülle stand. Die zweite Bummelnacht hatte das Silbergrau des Anzuges nicht eben silberner gemacht. Er sah jetzt in dem zerknitterten Ding wie ein entlassener Sträfling aus, und als er sich von allen Seiten prüfte, machte er gar die schaudervolle Entdeckung, daß das Beinkleid an der Rückseite geplatzt war. Was anfangen? Entdeckte J. B. Söderberg den Defekt, dann war er gesellschaftlich unmöglich. Bei solchen feinfühligen, hypereleganten Dänen! Er kam ja nicht als abgerissener Bittsteller zu ihm, sondern als Fremder, der die Grüße des Freundes brachte. Einigermaßen anständig mußte er aussehen. Den abscheulichen Bibi konnte er ja im Vorzimmer lassen – das Urteil eines Dieners kümmerte ihn nicht. Aber wie war es möglich, die verletzte Rückseite in jedem Augenblick zu decken, zu verhüten, daß das diabolisch hervorschimmernde Weiß sichbar wurde? Peter nahm in der engen Badezelle die unwahrscheinlichsten Stellungen ein, um alle Möglichkeiten zu erproben und sein Gemüt zu beruhigen. Als aber bei einer besonders kühnen Wendung der Riß sich mit leisem Krachen noch vergrößerte, wurde er bitterböse, stülpte trotzig den Hut auf und lief ins Freie. Er hatte nasses, ungekämmtes Haar. Ihm war jetzt alles egal. Er war wenigstens sauber. Herr Söderberg sollte ihm nur in sein ehrliches Gesicht sehen. Dann würde sich schon zeigen, ob der Mann ein fauler Protz oder ein künstlerisch empfindender Mensch war.
Wieder stand Peter am Gittertor der Besitzung, von der Dogge, die jetzt hoch emporsprang, angeschnauzt. Er läutete. Ein Livreediener näherte sich, indem er Peter forschend, aber nicht kränkend ansah. Der Mann schien gut geschult zu sein. Er beruhigte den Hund und nahm mit einer Verbeugung Peters Karte entgegen. Bald kam er zurück, und auf seinem unbeweglichen Gesicht glaubte Peter die ersten Schimmer des Wohlwollens, eine Botschaft des Herrn, zu sehen. Er folgte ihm vorsichtig, indem er an die Deckung seiner Rückseite dachte. Denn unter den Türen der Wirtschaftsgebäude standen mehrere recht anmutige Dienstmädchen, die dem Fremden gewiß mit kritischen Augen nachsahen. Verblüfft trat Peter in die Halle des Hauses ein. Wie wundervoll, edel, hoch und ernst. Mit erlesenen Teppichen und Jagdtrophäen behangen. In der Mitte der Halle stand eine Jünglingsgestalt aus dunkler Bronze. Peter sah mit einem Blick, daß es eine Antike von höchstem Wert war. Durch die Schönheit des Kunstwerkes konsterniert, blieb er unwillkürlich stehen. Der Diener wartete ein wenig, dann bat er mit einer höflichen Handbewegung, ihm weiterzufolgen. Sie stiegen die Freitreppe hinauf und traten durch ein hohes Portal in die Bibliothek ein. Hier empfing Herr Söderberg Besuche. Als Peter allein war, sah er sich um. Er konnte nur gaffen – nachdenken war ihm unmöglich. Das war ja die höhere Welt seiner Sehnsucht. Er stand ja mitten darin. Von den Riesenwänden, dunkel golden und mit ernster Freundlichkeit, grüßten ihn die Geister der Zeiten. Er wartete, schüchtern und ergeben, wie ein armes Kind am Tor.
Plötzlich stand ein rundlicher und kleiner, auf den ersten Blick unscheinbarer Herr vor dem Verträumten. Grau gelockt, mit freundlichen, blauen Augen. Er erinnerte Peter an ein Bild von Edvard Grieg. »Mein Name ist Söderberg,« sagte der Herr. »Szie sind Deutscher? Womit kann ich Ihnen dienen?«
Peter verbeugte sich tief. »Ich wollte Ihnen meine Aufwartung machen, Herr Söderberg. Ich habe Ihnen Grüße meines Onkels zu überbringen.«
»Wer ist Ihr Onkel?«
»Herr Konstantin Bischoff, Apotheker in Schnattersheim.«
Peter kam in diesem Augenblick, was er als Empfehlung vorbrachte, selbst so unwahrscheinlich vor, daß er kaum ernst bleiben konnte. Doch zu seiner größten Überraschung trat Herr Söderberg mit aufleuchtenden Augen an ihn heran, ergriff seine Hand und rief: »Wie heißen Szie? Peter Kranz? Mein Gott, wo habe ich nur meine Gedanken! Sind Szie Maler? Ja?! O, das ist schön! Das freut mich ßehr! Ich heiße Szie herzlich willkommen!«
Er drückte ihm von neuem beide Hände, und der verblüffte Peter wußte nicht, worüber er sich mehr freuen sollte – über solchen Empfang oder über das rührende Wesen des Nabob oder über das wundervoll fließende Deutsch, das er sprach. Statt jeder Antwort streckte er ihm Onkel Bischoffs geschlossenen Empfehlungsbrief hin. Herr Söderberg las ihn, lachte oft dabei in herzlicher Rührung und schüttelte sein feines, graulockiges Haupt. »Nein, ßo etwas! Das ist der alte Konstantin!« – Konstantin? Standen die beiden so miteinander? – »Ja, er ist ein großer Schelm! Ich ßehe, er ist sich gleich geblieben!« Hierbei blinzelte der alte Däne, aus dem Brief aufblickend, den errötenden Jüngling an. »Ein Schelm, aber ein goldenes, vorzügliches Herz! O, ich verdanke ihm viel! Kommen Szie, lieber Freund – ich freue mich herzlich, Szie bei mir zu ßehen! Ich kenne Ihre ganze Entwicklung! Ihr Onkel hat mir in seinen Briefen viel von Ihnen erzählt! Und nun sind Szie plötzlich bei mir! Das ist reizend! Kommen Szie! Kommen Szie! Setzen Szie sich! Wir trinken zu Ehren Ihrer Ankunft ein Glas Sherry!«
Peter folgte dem Entzückten dumm, gehorsam, in alles ergeben. Die Welt drehte sich – nun gut, er drehte sich mit. Er hätte jetzt blindlings getan, was J. B. Söderberg von ihm verlangte. Diesen wunderbaren Sherry zu trinken, das war freilich nicht das Schlimmste. Er vergaß sogar seine empfindliche Rückseite, ließ sich auf einen seidenen Sessel niederdrücken und starrte seinem liebenswürdigen Wirt in die Augen.
»Nein! Nein!« rief dieser selig. »Das muß ich doch ßogleich meinen Töchtern erzählen!«
Auch das noch! ... Ehe er ihn zurückhalten konnte, lief Herr Söderberg davon. O, Onkel Bischoff! Onkel Bischoff! Hatte er ihn also doch hineingelegt! Peter wäre jetzt am liebsten fortgelaufen. Sein Ärger, daß der listige Apotheker ihn mit der offenbar hochgradigen Freundschaft, die ihn mit dem Dänen verband, überrumpelt hatte, war vorläufig stärker als seine Freude. Er fühlte eine eigentümliche Angst und Beschämung. Es lag Schicksal über dieser Stunde. Irgend etwas noch Verborgenes mahnte ihn hier, beizeiten zu verschwinden, und es forderte zugleich von ihm, für lange da zu bleiben ... Jedenfalls hatte Onkel Bischoffs Witz den Fehlgriff getan, daß J. B. Söderberg in der Stunde der Not nicht der Anhalt für Peter sein konnte, den der Apotheker ihm gewünscht hatte. Sein Stolz regte sich mächtig. Er fühlte sich in der seltsamen Pracht so ganz nur als Gast, daß er den Vorsatz, einen Pump zu riskieren, trotzig von sich wies und zu verschweigen beschloß, welche Tragikomödie Peter Kranzens Reise nach Dänemark geworden war. Das hatte Herr Bischoff nun von seiner Schlauheit – der Neffe würde vornehm, aber bettelarm, wie er gekommen, das Schloß seines Freundes wieder verlassen.
»Karin schläft noch – ich darf ßie nicht stören.« Mit diesen Worten trippelte Herr Söderberg, ein Zwerg in der Berghalle seiner Bibliothek, wieder herein. »Sigrid ist im Bade – ich werde ßie nachher benachrichtigen.« – Sigrid? ... Sonderbarer Zufall! Peter begann an Teufelsspuk zu glauben. Warum begegnete ihm auch hier wieder der Name?
»Wir werden einstweilen frühstücken, lieber Freund«, fuhr Herr Söderberg fort, indem er sein Ärmchen um den großen Deutschen legte. »Szie haben gewiß Appetit?«
»O ja«, murmelte Peter. Überwältigend schwebte ihm ein Frühstück vor, das dem Stil dieses Hauses entsprach.
Herr Söderberg lächelte und drückte auf einen elektrischen Klingelknopf. Alsbald erschienen, wie auf göttliches Geheiß, zwei Diener und brachten etwas Wundervolles mit. Es war eine fürstlich gedeckte Tafel, auf der sich die erlesensten Dinge breiteten. Peter blickte nur auf einen kolossalen, leuchtend roten Hummer, der ihn ebenso freundlich anzublicken schien. Dann saß er dem eifrig servierenden Wirt gegenüber und ließ sich füttern. Das hatte er nun wenigstens von dem Besuch, das dankte er Onkel Bischoff – er wurde satt! Mindestens für zwei Tage! Und dann kam Tante Lindas Geld nach Kopenhagen, und alles wurde gut. Wenn der liebenswürdige Brauereibesitzer nur nicht so verfängliche Fragen gestellt hätte! Alles wollte er in seiner gutmütigen Neugier wissen. Was Peter in Kopenhagen schon gesehen hätte, in welchem Hotel er logierte. Peter mußte sich jetzt nolens-volens auf ein Gebiet begeben, das für ihn besonders schlüpfrig war – aufs Lügen. Als Konfusionarius pflegte er über der zweiten Lüge die erste zu vergessen und verwickelte sich bald in Widersprüche. So erklärte er mit Bestimmtheit, im »König von Dänemark« zu wohnen, und hatte später keine Ahnung, in welcher Gegend der Stadt sein Hotel sich befand. In »Tivoli« hatte er so gut wie nichts gesehen, da er Himmel und Hölle verschwieg, und die »lange Linie« hatte er nicht gefunden. Herr Söderberg aber war ein Mann von Welt. Er schien bald Lunte zu riechen, merkte, daß Peter in Notlügen hineintappte, aber er verurteilte das nicht, es gefiel ihm gerade. Leimsieder und Musterknaben mochte er nicht leiden. Ein Wanderer sollte nur ein rechter Wanderer sein. Ein Künstler dazu. Peter gefiel ihm außerordentlich. Er half dem Verlegenen und sprach nur noch über die Glyptothek mit ihm. Da konnte nun Peter, vom Champagner entflammt, sein Feuer loslassen. Es tue ihm nur leid, erklärte er begeistert, daß nicht Herr Söderberg der Stifter dieses Heiligtums sei, sondern Herr Jacobsen. Ob denn sein Wirt diesen prachtvollen Jacobsen persönlich kenne?
»O ja!« rief Herr Söderberg lachend. »Recht gut ßogar! Er ist geschäftlich mein größter Konkurrent, künstlerisch aber ßind wir intime Freunde. Das geht famosh zusammen. Übrigens hat sich Jacobsen mehr auf das helle Bier und die Sammlung von Antiken gelegt, während ich das dunkle Bier und moderne, besonders christliche Kunst bevorzuge.«
Sie lachten sich beide in einen lustigen Zynismus hinein und verließen, als das Frühstück beendet war, Arm in Arm die Bibliothek. Herr Söderberg wollte seinem Gast jetzt das Museum, das sein Haus barg, zeigen und ihn dann in dem Garten herumführen, der eine Sehenswürdigkeit des Landes war. Peter, der Glückliche, gesättigt und etwas angeheitert, ging mit. Leise mahnend nur noch, wie aus weiter Ferne, regte sich der Entschluß in ihm, nach diesem Rundgange Abschied zu nehmen. Er beschloß vorläufig, zu verschwinden, bevor er sich den Damen des Hauses in seiner Schäbigkeit präsentieren mußte.
Der Mensch denkt, und Onkel Bischoff lenkt. Peter vergaß alle Vorsätze, während er die zauberhaften Kunstschätze des Dänen betrachtete. Was barg dieses Haus für Reichtümer! Hier thronte der Gipfel des Geschmacks, und nirgend machte sich ein aufdringlicher Snobismus breit, alles war erlebt und empfunden. Am verwirrendsten aber war es für Peter, daß Herr Söderberg, den er doch für außerordentlich verwöhnt halten mußte, sich an seinen Lobes- und Freudenausbrüchen aufs höchste delektierte. Er ging mit einem so glücklichen Schmunzeln neben dem jungen Deutschen her, als erblickte er nach langer, staubiger Wanderung endlich eine Waldquelle. So kam es, daß Peter, als er das Museum verließ, mit erlesenen Geschenken beladen war, Dingen, die ihm nicht im Traume eingefallen wären. Herr Söderberg schlug seine Proteste mit der feierlichen Erklärung nieder, daß die Freude des Gastes ihm einzig und allein den Wert solcher Dinge bedeute.
Was sollte daraus werden? – Sie schritten durch einen endlosen, wundersamen Garten. Durch rot blühende Alleen. An Wasserspielen vorüber, die ihr silberblaues Naß in weiße Marmorbecken schäumen ließen. Ein Märchen. Noch schöner fast für Peters Gefühl war der landwirtschaftliche Teil, der an den Park grenzte. Die Treibhäuser, deren Glasdächer in der Sonne blitzten, und besonders der Obstgarten. Ungestüm, in froh gesunder Pracht brachen hier die edelsten Früchte aus allen Zweigen. Peter tat es seinem Wirte nach, indem er die lockendsten über seinem Haupte abbrach und verzehrte. Plötzlich begann Herr Söderberg, der träumerisch gestimmt war, wieder von Onkel Bischoff zu sprechen. »Schade, daß er keine Frau fand. Er hatte nie den nötigen Glauben an ßeine Person, er hielt sich immer für zu häßlich. Bei bedeutenden Männern existiert dieses Hindernis oft nur in ihrer eigenen Einbildung, nicht im Urteil der Frauen. Schade. Er wäre auch der beste Vater geworden. Nun hat er Szie wenigstens. Ich kann mir vorstellen, wie lieb er Szie hat. O, ßein Szie ßich immer darüber klar, lieber Freund! Ich weiß, mein Konstantin hat viele Stachel, die große Allgemeinheit versteht ihn nicht, kann ihn gar nicht verstehen – Szie aber werden ihn nicht verkennen!«
Peter nickte. Dann fragte er Herrn Söderberg in plötzlicher Eingebung, wie denn seine Freundschaft mit Onkel Bischoff entstanden sei. Der Verschlossene habe ihm nie davon erzählt. Sie schritten an einem schwarzen Weiher auf und ab, auf dem zwei Schwäne schwammen, und Herr Söderberg erzählte. Es sei in Ägypten gewesen, vor 15 Jahren, bei einem Ausfluge zu den Pyramiden. Da hätten sie sich zuerst getroffen. Ihr Sammeleifer habe sie zusammengeführt, doch hätten sie sich auch menschlich in der lauten Reisegesellschaft sofort verstanden. Vielleicht habe auch die gegenseitige Sympathie, daß beide so klein seien, mitgesprochen. Sie seien zusammen nach Kairo zurückgekehrt, in dasselbe Hotel, und dort habe Herr Söderberg ein Telegramm gefunden, das ihm den plötzlichen Tod seiner Frau mitteilte. Fern in der Heimat, jung und schön. Sein Liebstes und Bestes. In diesem Höllensturz seines Glückes habe er eine Hand gefunden, die ihn festhielt und nicht versinken ließ. Es war Konstantin Bischoffs Hand. Aus der lichten Heiterkeit der gemeinsamen Reise in dunkelstes Leid – so entstand ihre Freundschaft. Der Mann, den er erst wenige Tage gekannt, pflegte ihn Tag und Nacht, als Schmerz ihn fieberkrank gemacht hatte, er begleitete den Witwer nach Dänemark zurück. Dann hätten sie sich nicht mehr gesehen. Nur korrespondiert. Nun wisse Peter, daß Onkel Bischoff ihn nicht schlecht empfohlen habe ...
Peter ging mit gesenktem Kopfe neben Herrn Söderberg her. Sie näherten sich wieder dem Hause. Plötzlich rief der Däne mit leichterer Stimme: »O, da kommt ja Sigrid! Nun kann ich Szie wenigstens mit meiner ältesten Tochter bekannt machen!«
Als der junge Deutsche erschrocken aufblickte, schritt schon eine schlanke, hell gekleidete Mädchengestalt auf ihn zu. Sie hatte lockeres, vom Winde bewegtes Blondhaar und große, blaue Augen. Ihr Gang und ihr Wesen trugen die liebenswürdige, freie Selbstverständlichkeit der Dänin. Sie wußte schon, wer Peter war, und streckte ihm herzlich die Hand hin. Dieser aber, als er sie in der Nähe sah, stand wie vom Donner gerührt. War das Spuk oder Wahrheit?! – Sigrid war Sigrid von Onkel Bischoffs Bild! – Keine Rede von Pummernickel oder Pumpernickel – Söderberg war Sigrids Name! Keine Rede von berühmter Schauspielerin, die »vor fünfzehn Jahren 'mal so ausgesehen habe!« Das Bild war funkelnagelneu! Wie Peter sie seit Schnattersheimer Tagen im Herzen trug – so sah das Mädchen aus. O Fuchs, o unergründlicher Fuchs von Apotheker! – Das war sein letzter, größter Streich! – Darauf war Peter Kranz hineingesaust, wie noch nie auf etwas! – Er hörte förmlich den kleinen Bosnickel in seinem Laboratorium kichern, wenn er sich Peters Verblüffung vorstellte. O, dieser Apotheker! – –
Sigrid sah den Verwirrten etwas erstaunt an und schritt dann schweigend neben ihm her.
»Wie geht es Karin?« fragte der Vater.
»Ganz gut,« war die Antwort. »Sie kommt zu Tisch.«
Herr Söderberg wandte sich jetzt zu Peter. »Ist es Ihnen recht, daß wir im Hotel dinieren, lieber Freund? Wir pflegen es hier immer zu tun, und für Szie ist es doch auch interessant, die Badegesellschaft dort zu beobachten. Es ist die eleganteste, die wir haben. Wir gehen um Zwei hinüber und finden dort einen Freund aus Kopenhagen, den ich ebenfalls eingeladen habe.«
Peter nickte. Ihm war jetzt alles recht. Wogegen sollte er sich überhaupt noch wehren? Nur ein Entschluß stand in ihm fest, als er Sigrid, dieses Leben gewordene Bild, mit einem scheuen Blick streifte: Er mußte, bevor man in das Hotel ging, seinen äußeren Menschen rehabilitieren. Er durfte sich vor ihr nicht lächerlich machen. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als sich Herrn Söderberg anzuvertrauen, ihm seine Kopenhagener Irrfahrt zu schildern und Hilfe zu erbitten. Ängstlich blieb er immer einen Schritt hinter Vater und Tochter zurück, um die gefährliche Rückseite nicht in ihren Gesichtskreis zu bringen. Er machte aber dadurch allmählich den Eindruck, als ob er übertrieben devot oder am rechten Bein verletzt wäre. Sigrid blieb deshalb in feinem Mitleid gleichfalls zurück und steigerte Peters Verlegenheit ins Unermeßliche.
»Was ist Ihnen? Szind Szie nicht wohl?« fragte schließlich Herr Söderberg besorgt.
»Haben Sie sich den Fuß verletzt?« fragte das junge Mädchen.
Auf diese ungeheure Frage blieb Peter die Antwort schuldig. Instinktiv erklärte Sigrid plötzlich, daß sie noch Toilette machen müsse, und entschuldigte sich, indem sie dem Deutschen liebenswürdig, aber auch ein wenig schalkhaft zulächelte. Er sah ihr nach und konstatierte, daß sie wunderschön sei. Dann wandte er sich zu ihrem Vater und beichtete alles. Das Resultat war, daß Herr Söderberg sich den Bauch hielt und fast weinte. »Reizend! Reizend!« rief er immer in den höchsten Tönen. »Aber warum haben Szie mir das nicht längst gesagt! O, Szie müssen die Geschichte bei Tisch noch einmal erzählen! Das ist eine prächtige Unterhaltung für alle!«
»Aber Herr Söderberg – in Gegenwart der jungen Damen –«
»Nun, da können Szie ja von Tivoli einiges fortlassen! Obgleich da auch nichts genieren würde! Szie haben ßich übertriebene Szorgen gemacht! Ihr Anzug ist ja besser, als Szie meinen!«
»So? Und der Riß, Herr Söderberg, der Riß?«
Der Däne wischte sich die Augen. »Ja, der freilich! Aber den hätten Szie auch riskieren können! Im Hotel lebt jetzt eine ßo dekadente Gesellschaft von Modenarren, daß man das am Ende für das Allerneueste gehalten und Ihnen nachgemacht hätte! Aber nun kommen Szie, kommen Szie geschwind. Hier ßind vorläufig hundert Kronen, nicht wahr? Und nun kleiden Szie ßich um!«
Nach einer Stunde schon erschien ein völlig verwandelter Peter in der Bibliothek. Herr Söderberg klatschte in die Hände, als er ihn sah, und führte den stattlichen Gast triumphierend ins Freie hinaus. Man sah es dem kleinen Herrn an, wieviel Mühe es ihn kostete, den jungen Damen, die sich ebenfalls einfanden, nicht sofort Peters Geschichte zu erzählen. Karin, Sigrids Schwester, war noch etwas größer und schmaler als diese, eine dunkle, blasse Schönheit. Sie trug den Stempel des Leidens in ihrem stillen Gesicht. Peter empfand sofort, daß sie eine aus dem Leben Schwindende war. Doch da sie sich heiter und freundlich zeigte, verlor sich sein schmerzliches Gefühl bald wieder, und er folgte selbstsicher, als hätte er niemals anders ausgesehen, an Söderbergs Seite den jungen Mädchen, die untergefaßt vorausschritten.
Etwas zaghafter folgte er dann den Einheimischen in den Speisesaal des Hotels, der eine gewaltige Ausdehnung hatte und ein festliches Bild bot. Die Wohlgerüche der Toiletten und guten Speisen mischten sich. Es flimmerte ein feines, mattgoldenes Mittagslicht über dem Tellergeklapper und fröhlichen Geplauder. Zwischen den mittelsten der Säulen, die den Prunksaal stützten, fiedelte eine Zigeunerkapelle in schmucker Uniform. Die Herren Kellner aber flogen lautlos, mit vornehmer Gravität umher und machten Gesichter, als hätten sie die schönen Damen so schön gepflegt, die eleganten Herren so elegant gekleidet. Herr Söderberg ergriff mit seiner Gesellschaft von einem reservierten Tisch Besitz, der an einem der breiten Fenster stand und aus dem Menschenlärm fort einen Ausblick auf die still bewegte Meeresfläche erlaubte. Er sah sich prüfend um und erwiderte freundlich mehrere ehrerbietige Begrüßungen. »Er ist noch nicht da,« sagte er dann und zog seine grünseidenen Handschuhe aus.
»Er wird wieder den Morgenzug versäumt haben,« meinte Sigrid lächelnd.
Um wen es sich handelte, wußte Peter nicht und war auch gar nicht darauf neugierig. Er hatte genug damit zu tun, das letzte Unbehagen der fremden Kleider zu überwinden, die aus Gabriels, des Kammerdieners, bester Zivilgarnitur bestanden. Herrn Söderbergs Garderobe hätte nur für einen fünfzehnjährigen Peter gepaßt. Endlich hatte er sich zurechtgerückt und konnte sich nun der angenehmen Betrachtung der jungen Mädchen widmen. Sigrid gewann den Preis. Sie erfüllte und verstärkte im Leben, was sie im vagen Traum versprochen hatte. Geradezu beglückend aber war es für ihn, bei ihr dieselbe Beobachtung machen zu können, wie bei vielen Kopenhagerinnen. Auch sie war frischer und lebenskräftiger als die Gestalten aus »Niels Lyhne«. Alles leuchtete an ihr, das Haar, die Augen und der schöne Mund. Ein sanftes, stilles Leuchten war es, wie eine Sonne hinter Nebelschleiern, aber stark doch und siegreich, gewiß in entfesselter Leidenschaft. Karin aber, Karin war der Mond. Eine bleiche Leuchte der Nacht neben dieser Morgensonne. Schwermut der Vergänglichkeit, kindliches Wissen vom großen Auf und Nieder, Blühen und Welken. Wie rührend war es, unvergeßlich für Peter, die Sorge der Gesunden um die Kranke zu sehen. Sigrid saß neben der Schwester, bediente sie wie ein Kind und ließ ihr Wohlergehen keinen Augenblick außer acht. Sie zeigte auch eine wunderbar gütige Freude darüber, daß Karin sich, offenbar dem Gast zuliebe, aufgerafft hatte und mit in das Hotel gegangen war. Karin aber lehnte ihr zartes Köpfchen an die starke Gesundheit der Schwester – sie lächelte oft mit einer schweren, schmerzlichen Süße und wußte zu schweigen, ohne die Lebhaftigkeit der anderen herabzudämpfen.
»Es ist schade,« wandte sich jetzt Herr Söderberg kauend an den verträumten Gast, der das köstliche Essen kaum zu beachten schien, »daß Szie in Kopenhagen noch keinen Cicerone hatten. Hätten Szie uns nur geschrieben! Sigrid wäre ja sofort hineingefahren und hätte ßich Ihnen zur Verfügung gestellt!«
Peter durchfuhr es. Diese Möglichkeit, die der Vater mit graziösem Freimut anbot, beglückte ihn noch in der Vergangenheit. Er sah Tage hinter sich, Tage ...! Kopenhagen, das wahre Kopenhagen wäre erst gekommen. Dann aber fiel ihm ein, daß er seiner Begegnung mit Robert Waldgren noch gar nicht Erwähnung getan hatte. Der Verdacht, daß man Waldgren hier persönlich kannte und dem feinen Ironiker Peters Irrfahrt als willkommenes Sujet hinterbringen könnte, hatte es ihn verschweigen lassen. Jetzt aber war es ihm ganz gleich – er benutzte den Gesprächsstoff und schilderte bis ins kleinste, ein treues Porträt des Dichters liefernd, die wunderliche Bekanntschaft. Warum lachte man aber so stark dabei? Viel stärker, als der Humor der Geschichte eigentlich verdiente? Herr Söderberg wischte sich die Augen, Sigrid lehnte den weißen Hals weit über die Stuhllehne zurück und stieß die wohllautendsten Lachtöne hervor. Karin sogar lachte fast erschrocken und schien mit holder Gutmütigkeit zu konstatieren, daß man in diesem Leben auch so lustig sein könne. Auf das fragend bestürzte Gesicht des Gastes hin klärte Herr Söderberg ihn auf. Robert Waldgren war ein intimer Freund seines Hauses. Der Gast, den man hier noch am Tisch erwartete, war kein anderer, als er. Jetzt gab Peter es auf. Er wunderte sich von nun an über kein neues Abenteuer mehr. Er erwartete jeden Augenblick, daß auch die »bedeutende Porträtmalerin« und die »Führerin der Frauenbewegung« aus dem Café Bristol erscheinen würden. Auch hätte es ihn kaum gewundert, wenn Abraham Levy, der Pfandleiher aus der Bahnhofstraße, und Rita, die Sängerin von Tivoli, eingetreten wären und vor versammelter Menge ein Pas de deux getanzt hätten. Ein törichter, großer, märchenhafter Kreislauf wurde ihm das Ganze. Ein Zauberring, der sich immer sofort wieder schloß, wenn man ihn eben aufgesprengt hatte. Und als Herr Robert Waldgren sich jetzt wirklich näherte mit seinem leisen, entzückenden Satyrlächeln, da ging der Deutsche dem Überraschten entgegen und schüttelte ihm emphatisch die Hand. Waldgren, der von Söderberg aufgeklärt wurde, fragte Peter sofort in seiner raschen Weise aus, wie es ihm seit ihrer letzten Begegnung in Tivoli ergangen sei. Peter wurde rot, und Herr Söderberg, das alte Kind, machte bittende Augen, indem er den lachenden Mund spitzte. Da dachte Peter an den Weisheitsspruch von den »Besten, die sich selbst zum Besten haben können«. Er erzählte alles. Es war sonderbar. Er brauchte von Rita, Himmel und Hölle nichts zu verschweigen. Sigrid und Karin waren keine Schnattersheimer Mädchen, nicht einmal Karlsruher. Es hatte etwas eigentümlich Holdes, sie Dinge erfahren zu sehen, die der deutsche Moralbegriff aus ihrem Gesichtskreis gebannt hätte. Sie waren innerlich reif und hatten fast einen Altersschimmer im Herzen, diese blühenden Geschöpfe. Sie verstanden alles instinktiv, mit reinem, fernem Urteil. Sie konnten lächeln und lachen, Mensch sein, wenn Menschliches sich enthüllte. Peter aber wurde wie ihr Bruder. Konstantin Bischoffs Neffe gehörte zum Kreis. Der Dichter sah es, und ein lächelndes, freies Begreifen schützte ihn sofort vor Eifersucht. Größe war Robert Waldgren, dem gelenkigen Dandy, dem Modegötzen der Flachheit, inne, wenn es darauf ankam. Seine schwarzen, etwas schief gestellten Augen irrten in feiner Unrast von dem glücklichen Deutschen auf die lachende Sigrid hinüber, von Sigrid auf die bleiche Karin. Hier verweilten sie, und der Mund, der fast tierisch sein konnte, schloß sich jetzt zu zartester, gütigster Menschlichkeit.
Man hob die Tafel auf und ging aus der geräuschvollen Hitze in die frische Freiheit des Strandes hinaus. Weithin dehnte sich der blaue Sund. Silberne Wellenkämme spielten mit Sonnenblitzen. Karin ging an Waldgrens Arm. Peter sah es, aber er fühlte es ohne Zögern als gewiß, daß der Dichter dem kranken Mädchen nur ein milder Freund und Berater war. Als er in seiner keuschen Sprödigkeit, möglichst gleichgültig, Sigrid andeutete, wie hübsch er den Anblick der beiden fände, sagte sie mit dankbarem Aufleuchten: »Ja! Ohne Waldgren hätten wir Karin nicht mehr. Sie hat keine Hoffnung, aber sie freut sich an dem, was ist.«
»Ist sie so leidend? ... Weiß sie's?«
»Ja. Aber Robert Waldgren hat die Macht, ihr Wärme und Licht zu geben. Jeden Nachmittag kommt er aus Kopenhagen zu uns hinaus und beschäftigt sich stundenlang nur mit Karin. Er liest ihr vor. Er weiht sie in alles ein, was ihn beschäftigt. So täuscht er sie über das Schwerste hinweg, gibt ihr Wahn und schöne Träume. Er hat es mir selbst gesagt, daß der eigentliche Wert seiner Kunst für ihn darin bestände, der letzte Arzt für Karin zu sein.«
»Das ist wundervoll ... Das ist ja eigentlich mehr als alles, was wir anderen wollen können! ...«
»Es ist jedenfalls etwas Großes.«
»Nein, Fräulein Sigrid! Ein Leben erhalten, solch ein Leben, mit seiner Kunst! Das ist das eigentlich Wahre!«
Sigrid schwieg. Sie wußte, daß ein Deutscher den Überschwang brauchte, etwas Höchstes und positiv Letztes, das er anbeten konnte. Auch gab sie ihm in diesem Augenblick recht, als sie den dunklen Gestalten nachsah, die langsam in der Farbenfülle des Nachmittags weiterschritten. »Kennen Sie Bücher von ihm?« fragte sie leise.
»Kein einziges – ich schäme mich fast.«
»Lesen Sie ›Sigrid und Karin‹.«
»Richtig! ... Mein Gott, sind Sie das etwa!? ... Mein Gott, der Irrgarten hört nicht auf!«
»Wie meinen Sie das? – Er hat meine Schwester und mich darin geschildert. Zu sehr beinahe. Nur geschildert, wissen Sie, mit seinen Augen. Ich liebe das Buch als Kunstwerk und habe doch Angst davor. Ich werde mich an einen Dichter nie gewöhnen können.«
»Wie hängt das eigentlich zusammen?« fragte Peter nach einer Weile. »Er wollte mir in Kopenhagen seinen Namen nicht nennen, weil er bald einen anderen Namen tragen dürfe, der sein wahrer sei?«
Sigrid lächelte. »O, wissen Sie nichts von Robert Waldgrens Namenssuche?«
»Namenssuche?«
»Ja. Er hat in einer Chronik gefunden, daß er aus einer morganatischen Ehe des alten Herzogs Gyldenlöwe stammt, also von der vornehmsten Familie des Landes. Nun trachtet er seit Jahren danach, daß der König ihm das Recht, diesen Namen zu führen, verleiht. Waldgren von Gyldenlöwe. Viele lachen darüber. Ich aber verstehe es von ihm aus. Er ist ein großer Patriot und empfindet es leidenschaftlich ernst, nicht nur als Dichter ein Edler zu heißen. Es ist bei ihm keine Eitelkeit.«
»Also darum! ... Na, ich weiß nicht! Mir hätte er schon sagen können, daß er Waldgren heißt!«
Sie hatten wieder das Haus erreicht. Herr Söderberg begab sich hinauf, um der Ruhe zu pflegen, Waldgren folgte Karin in ihr Zimmer, wo er ihr vorlesen wollte. Ohne eigentliches Dazutun blieben Peter und Sigrid allein. Sie bezwangen eine leise Erregung, die sich unwillkürlich ihrer bemächtigte, durch den gemeinsamen Entschluß, eine Gartenpromenade zu machen. Der Tag war brütend heiß. »Der Wind hat sich gedreht,« meinte Sigrid. »Es kann noch ein Gewitter geben.«
»Bei diesem klaren Himmel?« fragte Peter.
»Ja ... Das kommt schnell ...«
Sie kamen durch eine schattige Kastanienallee in einen Teil des Gartens, den Peter noch nicht gesehen hatte.
»Wollen wir schaukeln?« fragte Sigrid jetzt plötzlich mit kindlichem Lächeln. »Hier in der Nähe habe ich zwischen zwei uralten Bäumen eine prachtvolle Schaukel angebracht. Ich setze mich oft hinauf, wenn es so heiß ist, und lasse mich treiben. Es ist ein so stilles, beschauliches Glück und macht einen rasch zum Kinde, wenn man sich einbildet, Gott weiß wie erwachsen zu sein.«
Peter nickte und folgte ihr. Ein von hohen Bäumen umstandener, beschatteter Rasen war Sigrids Spielplatz. Sie prüfte die Stricke der Schaukel und schwang sich graziös hinauf. Peter, in dem der Schnattersheimer Spielkamerad erwachte, war es das größte Vergnügen, der Schaukel sanfte und doch energische Stöße zu versetzen, so daß die schlanke Sigrid weit in die Höhe und tief in die Tiefe flog. Sie jauchzte – wie entzückte ihn das. Er versuchte es immer von neuem dazu zu bringen, daß ihre Stimme so hell und klar, so sehnsüchtig schönheitsbang, wie ein Vogel, tönte. Sie streckte sich in ihrer ganzen gertenhaften Schlankheit, und die feinen Füße hielt sie sorglos gespreizt. Immer weiter schaukelte der starke, deutsche Bär das feine Dänenkind. Bis sie atemlos um Anhalten bat, und ihr anmutiger Gerechtigkeitssinn forderte, daß nun auch er die Freuden des Schaukelns erführe. Er schwang sich hinauf, und sie tat ihm jetzt den Dienst, zu stoßen und aufzumuntern, mit nicht geringerem Eifer. Der stille Garten hallte von dem hellen Gelächter der jungen Menschen wider.
»Werden wir auch Ihren Herrn Vater nicht stören?« fragte Peter plötzlich besorgt.
Sigrid nickte. »Das könnte sein! Jawohl! Wir wollen lieber aufhören! Bleiben Sie ruhig oben sitzen! Hat es Ihnen gefallen?«
Peter saß nachdenklich auf dem Brett, mit den Händen die Stricke umspannend, und ließ die Beine baumeln. Lächelnd sah er auf die erhitzte Sigrid nieder. »Die Schaukel ist ein Symbol für mich,« sagte er dann langsam. »Für andere Leute wahrscheinlich auch. Aber für mich besonders. Wenn ich mir alles ins Gedächtnis zurückrufe, was ich auf meiner Reise bisher erlebt habe. Bald hoch oben, bald tief unten – bald: was kostet die Welt?, bald: wer leiht mir einen Groschen? Gott im Himmel! Es ist wunderbar! Aber wissen Sie, Fräulein Sigrid, was ich fürchte?«
»Nun, was denn?« fragte sie, die Hände im Rücken gefaltet, während sie ernst und klar zu ihm empor sah.
»Daß – daß der Ruhepunkt, die Mitte, mein' ich, die doch schließlich nötig ist, nicht in der Höhe, sondern unten liegt.«
»Der Ruhepunkt? ... Ja, ja ... Aber nicht das Glück und nicht das Schöne! ...«
Er schwieg, er sah sie bewundernd an. Er sah nur noch Sigrid. Sie fühlte, daß er ihr recht gab. Nach einer Weile schritten sie dann wie spielmüde Kinder dem Hause zu.
»Ich würde Ihnen gern meine Bilder zeigen,« sagte Sigrid. »Ich male nämlich auch. Haben Sie Lust dazu? Bitte, sagen Sie es ganz offen – ich bin nie gekränkt in solchen Dingen.«
Anfangs war Peter etwas besorgt. Er hatte nun einmal eine trotzige Voreingenommenheit gegen malende Damen. Dann aber war er doch zu neugierig und ging mit. Sigrid hatte in einem Wirtschaftsgebäude ein geräumiges Atelier. Er besah ihre Bilder und war verblüfft, so strenge und fast männliche Arbeiten zu finden. Nichts von der zarten, blonden Sigrid. Alles Wille, ohne Eitelkeit, ohne Traum. Fast auch ein wenig ohne Glanz. Diese Bilder erinnerten ihn lebhaft an die eigenen aus der Schnattersheimer Periode.
Sigrid sah ihn nachdenklich werden und sagte rasch: »Mir gefällt jetzt auch nichts mehr davon! Es ist nur Arbeit!«
»Das ist schon was ...«
»Etwas Unentbehrliches, ja. Aber ich möchte jetzt Weicheres, Freieres, Froheres malen! Farben will ich mir erobern!«
»Ich auch!«
»Sie auch? ...«
»Gewiß!, Mir ging es ganz ähnlich, wie Ihnen. Aber seitdem ich in Dänemark bin, fühle ich, daß ich ein anderer werden muß. Mein nächstes Bild wird, das schwör' ich hiermit feierlich, die Schaukel im Garten! Und Sie darauf, wenn Sie Lust haben!«
»Gern!« Sigrid trat zum Fenster. »Aber in dieser Stimmung lieber nicht. Es kommt ein Gewitter. Hören Sie? Es pfeift und singt schon! O, es wird wundervoll! Wollen wir rasch zum Strande hinunter?«
Peter war dabei. Sie warfen Ledermäntel um und trabten, von aufgewirbeltem Seesand umprickelt, in die tosende Freiheit. Kein Mensch war jetzt am Strande. Die Hoteleleganz verkroch sich in ihre Zimmer. Waldgren, der Dichter, saß immer noch bei Karin und las ihr aus seiner Tragödie vor. Maler und Malerin aber, lachend und beglückt, liefen an dem ungeheuren Rauschen entlang und fürchteten mit wilder Lust nicht den Regen, der niederprasselte, nicht die Blitze, die rötlich aus den Wolkenklüften fuhren, nicht den Donner, der unaufhörlich brüllte. Sie fürchteten sich nicht. Sie erlebten alles. Plötzlich aber blieb Sigrid stehen, stützte sich auf Peters Arm und deutete erbleichend auf die sturmgraue See hinaus. »Dort!« rief sie heiser. »Dort!«
»Was denn, Fräulein Sigrid?!«
»Die Buben vom Gärtner sind wieder draußen! Die Schlingel! Das Wetter hat sie überrascht! Sie können nicht zurück!«
Jetzt erkannte Peter, worauf ihr bebender Finger deutete. Sehr weit hinaus, zwischen schaukelnden Wasserbergen, kämpften zwei unvorsichtige Schwimmer. Sie kamen immer mehr vom Strande ab. Man sah es. Sie schrien wahrscheinlich jämmerlich – man konnte es nur im Tosen der Elemente nicht hören.
»Gott, lieber Gott!« flüsterte Sigrid. »Niemand weiß es! Der arme Vater! Bis wir Leute holen, sind sie fort!«
Peter antwortete nicht. Er warf den Mantel ab, hierauf noch Gabriels, des Kammerdieners Feiertagsrock, und im Nu hatte er auch die Stiefel von den Füßen. Jäh entschlossen stapfte er mit seinen starken Beinen in die Flut. Er kannte die Richtung. »Bad Nummer zwei! Ganz schön!« durchfuhr es den Erhitzten in diesem Moment, trotz aller Gefahren. Sigrid starrte ihm nach, bittend, segnend. Jetzt war er schon weit. Wie er kämpfte! O, ein Deutscher! Bald verschwand er zwischen Wasserbergen, bald ragte wieder sein blondes Haupt. Und endlich –! »Er hat sie!« schrie Sigrid und sank in die Knie.
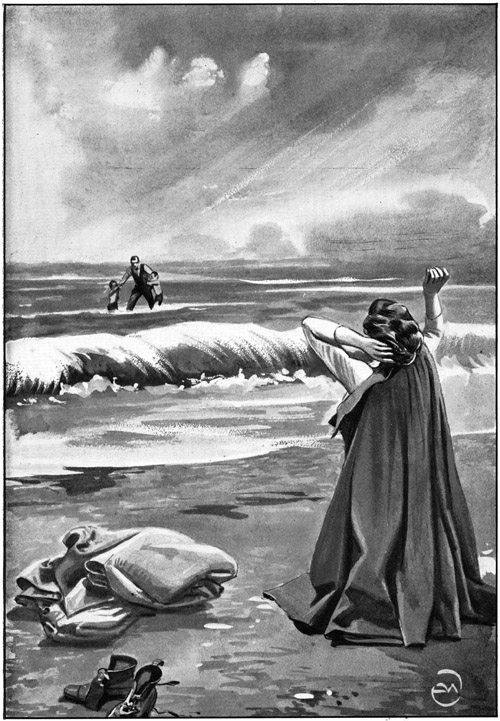
Da kam schon der Retter. Göttlich behütet kam er durch die Flut zurück. An jeder Hand führte er ein halb ohnmächtiges Kind. Er gab die Buben dem Vater, der mit Hunderten inzwischen herbeigeeilt war. Dann besah er sich selbst lachend.
»Wieder mal reparaturbedürftig!« Sigrid brachte ihn rasch ins Haus.
* * *
Eine Ohnmacht hatte den starken Peter doch gefällt. Von welcher Erregung sie stammte, wußte er später nicht. Erschöpfung, Sehnsucht, Liebe? – Kurz, sie war da. Doch als er jetzt nach mehreren Stunden erwachte, neigte Sigrid sich über ihn, war Sigrid in dem nachtdunklen Zimmer mit ihm allein und sprach die folgenden Zauberworte: »Was Sie getan haben, ist mehr, als durch Kunst ein Leben erhalten. Ja. Es ist mehr. Ich verehre Robert Waldgren, aber Sie habe ich lieb.«
Wie wunderlich! ... Das Schaukelspiel! ... Er träumte wohl wieder ...
»Staunen Sie, daß ich es sage?« fragte die Dänin und hatte Tränen in den ernsten Augen. »Man muß doch ehrlich sein. Oder bin ich Ihnen gleichgültig?«
»Ich staune,« flüsterte Peter. »Ich bin noch immer auf der Schaukel. Aber es ist Wahrheit – ja – hier im Norden ist die Schönheit immer Wahrheit. Laß mich bleiben.«
»Laß mich bleiben!«
»Sigrid!«
* * *
Der Zauberring hatte sich geschlossen. Jetzt offenbar für lange. Peter kam es sogar in diesen leuchtenden Tagen vor: für immer. Die großen Glücksfälle hatten noch kleine in der Gefolgschaft. Von Tante Linda kam ein Brief. Das Geld, das darin lag, machte Peter nicht den leisesten Eindruck – aber die freie, liebenswürdige Auffassung der alten Schnattersheimerin von seinen Abenteuern, die aus dem Begleitschreiben klang, entzückte seinen Familienstolz. Und dann – sein Koffer, sein einsamer Koffer vom Berliner Bahnhof war wieder da, und Mutters Siegelring natürlich auch, bei Abraham Levy pünktlich eingelöst. Kopenhagen aber wurde jetzt erst wirklich Kopenhagen. Mit seiner holden Braut am Arm, selbstsicher, ein halber Däne, schritt Peter durch die Östergade. Schon bei der ersten Promenade vertraute er Sigrid an, welchen Schabernack Onkel Bischoff ihm in bezug auf ihre Person gespielt habe. Sigrid Pummernickel von vor 15 Jahren! Die wahre Sigrid lachte von Herzen darüber und freute sich wie ein Kind darauf, den treuen Freund des Vaters bei der Hochzeitsreise aufzusuchen. Als das Brautpaar an diesem Abend in Waldgrens Gesellschaft nach Marienlyst zurückkehrte, brachte Herr Söderberg ihnen ein Telegramm entgegen, Onkel Bischoffs Antwort auf Peters Verlobungsnachricht. Der vergnügte Alte wollte es selbst vorlesen, doch Karin, plötzlich belebter, als je, nahm es ihm ganz resolut aus der Hand und las mit zitternder, erhobener Stimme: »In Schnattersheim großes Erdbeben vor Jubel. Schnatter fließt rückwärts. Tante Linda und ich grüßen alle. Es lebe Peter, der Entdecker, und Sigrid, die ihn sehen lehrte.«
