
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Länger wie Elefant und Nashorn wird das Flußpferd (Kiboko der Suahelisprache – in der Mehrzahl: Viboko – und ol Măkaū der Masai – Mehrzahl: el Măkaunin) in Afrika erhalten bleiben. Nicht etwa weil es weniger verfolgt wird, wie jene, sondern weil ein großer Teil seiner Aufenthaltsorte – die riesigen Sumpfgebiete im Westen Afrikas – außerordentlich schwer zugänglich sind und noch auf lange Zeit bleiben werden.
Längst sind die Zeiten verschwunden, in denen auch in Nordafrika Flußpferde häufig waren. Der Name »Nilpferd« war damals durchaus gerechtfertigt, weil das Tier im Nilflusse selbst und seinem Delta höchst zahlreich war. Heute sind Nilpferd und Krokodil, letzteres wenigstens in größeren Exemplaren, aus dem Unterlauf des Flusses verschwunden und nur oberhalb Chartum noch zu finden.
Aber selbst in den großen innerafrikanischen Seenbecken, so im Viktoria-Nyanza, scheinen die Tage dieses riesigen Wasserschweines gezählt zu sein. Zwar sind Verordnungen erlassen worden, um im englischen Teil des Sees der völligen Vernichtung vorzubeugen, aber in nicht ferner Zeit wird das »Kiboko« im Viktoriasee so gut wie im Nil verschwunden sein.
Von höchstem Interesse ist die vor nicht allzulanger Zeit erfolgte Auffindung einer Zwergform des Flußpferdes an der Westküste Afrikas, in Liberia. Dieses Tier erreicht nur eine sehr geringe Größe und soll, den dürftigen Angaben zufolge, die wir über seine Lebensweise besitzen, paarweise in den Strömen des Urwaldes leben.
Auch das gewöhnliche Flußpferd dürfte bei näherer Untersuchung in noch mehrere Unterarten zerfallen; je nach den betreffenden Stromgebieten scheint es mir in Größe, Aussehen und Gewohnheiten zu differieren.
Herodot berichtet Buch VIII Kapitel 26, daß schon damals beim Nilpferd stets Risse in der Epidermis beobachtet wurden, und spricht die Vermutung aus, daß diese durch die Schnitte scharfer Schilfgräser entstünden. Diese Risse habe ich auch zuweilen gesehen, und da ich dasselbe bei den Nashörnern – niemals dagegen bei Elefanten – gefunden habe, so möchte ich glauben, daß gewisse noch unbekannte Erreger hier eine Rolle spielen.
Von den Tagen Herodots an bis zu unserer Zeit besitzen wir eine große Anzahl von Mitteilungen der Reisenden über das Flußpferd, die mehr oder minder stets übereinstimmen in der Ansicht, daß das Tier bösartig, gefährlich und angriffslustig sei. Der letzte klassische Zeuge hierfür ist unser genialer Brehm, doch dieser hatte es im besonderen mit bereits vielfach beschossenen Flußpferden zu tun.
Es ist leicht erklärlich, daß ein so großes, eine angenehme und vollkommen gefahrlose Schießgelegenheit auch für den Nichtjäger gebendes, und eine so erhebliche Menge von Fleisch lieferndes Tier, von den Reisenden oder ihrer Begleitung beschossen worden ist, wann und wo es auch immer möglich war.
Namentlich zur Trockenzeit, wenn die Flußpferde dicht gedrängt gewisse tiefere Tümpel im Flußbett oder kleine Seen bewohnen, bieten sie einer gewissen Sorte von »Nimroden« eine erwünschte Jagdgelegenheit.
Da tödlich getroffene Tiere augenblicklich zu Boden sinken und erst in anderthalb bis zwei Stunden, je nach der Wärme des Wassers, durch die Verwesungsgase wieder an die Oberfläche gehoben werden, werden in vielen Fällen eine weit größere Anzahl dieser Tiere getötet, als selbst gute und loyale Jäger beabsichtigen.
Ein Offizier der ostafrikanischen Schutztruppe, der umfangreiche zoologische Sammlungen in verschiedenen Gebieten Deutsch-Ostafrikas veranstalten konnte und außerordentlich viel Gelegenheit zur Jagd fand, hat mir selbst erzählt, daß er im Anfange seines afrikanischen Aufenthaltes zum ersten Male auf einen mit Flußpferden besetzten Tümpel stoßend, darin völlig gegen seinen Willen über dreißig Stück in kurzer Zeit getötet habe. Er wurde von dem Häuptling der betreffenden Landschaft an eine tiefere Stelle im Flußbette geführt, sah dort mehrere Flußpferde auftauchen, schoß auf sie und glaubte, da er nicht das geringste Resultat seiner Schüsse wahrnahm, sein Ziel verfehlt oder keine tödlichen Stellen getroffen zu haben. Immer wieder sah er die von ihm vermeintlich beschossenen Tiere auftauchen, bis er endlich aus Mangel an Munition sein Feuer einstellen mußte. Einige Stunden darauf trieben dann die Kadaver von über dreißig Flußpferden an die Oberfläche.
Dies konnte freilich nur einem Unerfahrenen passieren. Aber wie oft wird sich Ähnliches ereignet haben und sich noch ereignen angesichts der vielfach so geringen weidmännischen Schulung neuer Ankömmlinge in den Kolonien und von seiten der gewerbsmäßigen Wildschlächter!
Was hier aus wahrheitsgetreuem und ehrlichem Munde berichtet worden ist, wirft ein schlagendes Licht auf die Ursachen des Verschwindens mancher Tierarten.
Die Zähne des Flußpferdes sind weit härter als das vom Elefanten herstammende Elfenbein, und eine Zeitlang wurden künstliche Zähne für Menschen aus ihnen gefertigt. Die fortschreitende Technik weiß jedoch heute bessere Zahnsurrogate herzustellen, hat aber leider noch immer nicht einen Ersatz für Elfenbein zur Herstellung von Billardbällen zu finden gewußt. Der alte Le Vaillant bemerkt schon in seinen »Reisen« vor mehr denn 100 Jahren:
»Man darf sich nicht wundern, daß die Europäer, vorzüglich die Franzosen, die Zähne des Flußpferdes zu einem wichtigen Handelsartikel machen, denn durch Hülfe der Kunst ersetzen sie die Natur und glänzen auf das schönste im Munde eines artigen Frauenzimmers.«
Im Jahre 1896 fand ich die Eingeborenen an den Buchten des Viktoriasees im größten Einvernehmen mit den höchst zahlreichen Flußpferden und ohne jede Scheu vor ihnen. Es war ein höchst eigentümlicher Anblick, die auf Flößen die Fischerei ausübenden Eingeborenen inmitten der zahlreich um sie her auftauchenden Flußpferde zu sehen, während sich auf den Sandbänken zahlreiche riesige Krokodile sonnten.
Hier lernte ich zur Genüge und habe es später noch wiederholt bestätigt gefunden, wie es mir von Dr. R. Kandt ausdrücklich auch für gewisse Gebiete Zentralafrikas bestätigt worden ist, daß diese Tiere erst dann bösartig und aggressiv werden, wenn sie vom Menschen verfolgt und vielfach verwundet worden sind.
In einem Reisebericht finde ich die Angabe, daß die Gouvernements-Askari nächtlicherweile andauernd durch Abgabe von Schüssen die Flußpferde dem Lager fernhalten mußten! Es ist eigentümlich, daß ich selbst gar niemals durch die Tiere gefährdet worden bin. Manche meiner Lager waren unmittelbar am Sumpf und an Flußufern aufgeschlagen, wenige Meter von meinem Zelt trieben sich oft stundenlang neugierig schnaufende Flußpferde im Wasser umher, jedoch keiner meiner Leute kümmerte sich um sie, da ihr Herr es ja auch nicht tat!
Mehr noch! In zwei Fällen spazierte ein Flußpferd mitten in der Nacht in meinem Lager zwischen den Zelten meiner Leute hindurch, ohne irgend jemanden zu beschädigen, und nur in einem dritten Falle gab mein Posten auf ein Flußpferd Feuer, weil es tatsächlich, wie ich mich selbst überzeugt habe, mit seiner Schnauzenspitze meine Zeltleinwand neugierig berührte.
Hier hatte ich allerdings mein eigenes Zelt nur wenige Meter von dem Ausstiege von Flußpferden am Sumpfe aufschlagen lassen, während alle meine Leute weiter ab vom Wasser lagerten.
Ich begreife wohl, daß Reisende, die ihre Leute instruiert haben, auf jedes sich nächtlicherweile zeigende Tier zu feuern, anderer Ansicht sein werden. Da ich unweigerlich meine Posten auf das strengste zu bestrafen pflegte, wenn sie ohne Erlaubnis – selbst nachts – einen Schuß abgaben, so habe ich ein so völlig abweichendes Urteil mir bilden können.
Sehr erstaunt war ich, meine Wandorobbo ohne Besinnen einen von mir einst erlegten Flußpferdbullen aus einem ganz kleinen Wassertümpel herausholen zu sehen, obwohl sich noch zwei andere »Makaita« in dem Tümpel befanden.
Die Leute mußten sich dabei auf höchstens drei Meter Entfernung der Stelle nähern und die beiden überlebenden Flußpferde – die allerdings nicht von mir beschossen waren, aber doch in größter Vorsicht nur in Intervallen von etwa zwei Minuten prustend auftauchten – fast berühren!!
Auch diese meine Erfahrung wird vielleicht dazu dienen, allzu phantasievolle frühere Berichte etwas einzuschränken, zumal da ich Ähnliches öfters erlebt habe.
Höchst bemerkenswert ist das Verhältnis der Nilpferde zu den Krokodilen. Beide Tierarten leben im größten Einvernehmen, und auch die ganz jungen Flußpferde scheinen durch ihre Mütter so gut gegen die gefährlichen und riesigen Wasserechsen geschützt zu werden, daß sie vollkommen geborgen sind. Kaum aber ist ein Flußpferd verwundet, so ändern die Krokodile ihr Verhalten. Wenn ich ein Flußpferd erlegt hatte, erschienen die fein witternden Krokodile sofort stromaufwärts schwimmend.
Bei verschiedenen Gelegenheiten habe ich dies beobachten und namentlich in einem Falle das hochinteressante Schauspiel einer großen Ansammlung von Krokodilen auf einem erlegten Flußpferd genießen können.
Ich hatte ein altes Flußpferd geschossen, welches sofort durch die Strömung gegen eine Sandbank getrieben wurde und, durch die Wucht des Stromes auf den Sand gedrückt, über dem Wasser sichtbar war.
Die zwei mich begleitenden Leute sandte ich in das eine halbe Stunde entfernte Lager, um Hilfe und Stricke zu holen; ich selbst blieb allein zurück, hinter einem Baume versteckt am Ufer des Stromes, durch nur wenige Meter reißenden Wassers von meiner Beute getrennt. –
Bewegungslos lagen die mächtigen rundlichen Fleischmassen des getöteten Tieres auf der Sandbank, und die trüben Wassermassen führten höchstwahrscheinlich Schweißteilchen (Blut) weit flußabwärts mit sich, denn nach kurzer Zeit tauchten auf der ruhigen Wasseroberfläche im tiefen Unterlaufe des Stromes erst eine, dann mehrere Schnauzenspitzen von Krokodilen auf, um sofort wieder zu verschwinden.
Nach überraschend kurzer Zeit aber wurde ein etwa vier Meter langes Krokodil sichtbar, äugte einen Augenblick umher, verschwand dann wieder unter dem Wasser und kletterte gleich danach auf das Flußpferd hinauf.
Es war ein geradezu überwältigend unheimlicher Anblick, als aus dem rauschenden Strome so unvermittelt die gefährliche Echse auftauchte. Als sie aber nun den mit furchtbar dräuenden Zähnen bewaffneten Rachen öffnete und mit unbeschreiblicher Gier das Flußpferd zu packen versuchte, wich ich – das Ganze spielte sich nur wenige Meter von mir entfernt ab – unwillkürlich noch einen Schritt vom Flußufer hinter den Baum zurück.
Da ich mich aber vollkommen unsichtbar verhielt, so wurde mir gleich darauf der grandiose Anblick, auf so nahe Entfernung ungefähr zwanzig, fast alle gleich große, gegen vier Meter lange Krokodile auftauchen zu sehen, die nun an dem Flußpferde hin und her zerrten. Es gelang ihnen freilich nicht, die zähe, undurchdringliche Haut zu durchbeißen; nur ein Ohr und Teile der Schnauze, auch den Schwanz vermochten sie abzureißen. Die auf die sonstigen Teile der Epidermis gerichteten Bisse glitten sämtlich ab; erst beim Eintreten der in den Tropen überraschend schnell beginnenden Fäulnis würden ihre Bisse von Erfolg begleitet gewesen sein.
Der Anblick der sich um die Beute streitenden, auf- und untertauchenden gepanzerten Wasserbewohner war ein ebenso unheimlicher, wie in seiner Art unvergeßlicher und großartiger für den immer noch hinter dem Baume verborgenen Beobachter. Allmählich aber hatten die riesigen Tiere so sehr an ihrer Beute gezerrt, daß ich befürchtete, das Flußpferd könne von der starken Strömung dem tiefen Unterlaufe des Flusses zugeführt werden, wo es für mich verloren gewesen wäre.
In großen Strömen hat es nämlich nur dann einen Zweck, »Viboko« zu erlegen, wenn nicht allzu weit unterhalb der Schußstelle Sandbänke oder seichte Stromschnellen sich befinden, welche die abwärts treibenden verendeten Tiere aufhalten. Sind solche Stellen nicht vorhanden, so sind die erlegten Flußpferde für den Schützen verloren.
Ich ließ daher meine Büchse sprechen und schoß, immer vorsichtig verborgen bleibend, bis zur Ankunft meiner Leute innerhalb einer Stunde gegen fünfzehn Krokodile von dem Flußpferd herunter; im Besitze reichlicher Munition hätte ich wohl noch zehn mehr erlegen können.
Die Schnelligkeit, die das »Kiboko« auf dem Lande zu entwickeln vermag, ist geradezu erstaunlich und ebenso überraschend, wie die von den Elefanten und Rhinozerossen entwickelte ungeheure Schnelligkeit und Gewandtheit, – Eigenschaften, die sehr im Gegensatz zu der anscheinend so plumpen Erscheinung dieser Dickhäuter stehen.
Ich habe in nur zwei Fällen Flußpferde auf dem Lande flüchtig beobachten können, war aber überrascht von ihrer Beweglichkeit. Einmal bin ich auch von einem Flußpferd unter solchen Umständen hart bedrängt worden und nur knapp mit dem Leben davongekommen.
Ich hatte das Tier gegen Abend auf dem Lande angetroffen. Gegen meine Erwartung nahm es auf eine nicht sofort tödliche Kugel seine Richtung auf einen kleinen See, der hinter mir gelegen war, und nicht auf einen größeren, der nicht weit vor mir lag. In einem unheimlich fördernden Galopp kam das Tier direkt auf mich zu. Nur dem Umstande, daß es auf eine zweite Kugel hin abschwenkte, um bald darauf verendet niederzustürzen, habe ich meine Rettung zu verdanken, denn ich mußte gerade in dieser Situation abermals ein Versagen des Repetiermechanismus für den dritten Schuß meiner Büchse erleben.
In einem anderen Falle stieg ein von mir geschossenes Flußpferd wenige Meter von mir entfernt ans Land, öffnete den in des Wortes wahrster Bedeutung zähnestarrenden Rachen so weit wie möglich, sank aber dann verendet zusammen, eine Situation, die ich leider nicht im Bilde festzuhalten vermochte, da ich in diesem Augenblick über keine Platten verfügte!
Bemerkenswert ist eine ausgesprochene Neugierde der Tiere, die von den Eingeborenen sogar dazu benutzt wird, dieselben in die Nähe des Ufers zu locken. Hauptmann Merker hat mir erzählt, daß die Eingeborenen des abflußlosen Gebietes der Masaisteppe an gewissen Seen die Flußpferde durch den Ruf: Makau! Makau! anzulocken pflegten, worauf dann ganze »Schulen« der Tiere dicht ans Land schwimmend erschienen seien. Ich selbst habe früher an den Merkerseen Ähnliches beobachtet.
Übrigens liefert der Masainame des Flußpferdes: Makau, Plural: el Makaunin, wie mein so früh verewigter Freund Merker mir brieflich mitteilte, nach der Ansicht des Linguisten Johs. Deeg einen trefflichen Beweis der Wanderung des Masaivolkes durch das Niltal. Unter den Tiernamen keiner lebenden Semitensprache fand sich ein Wort, welches mit dem Masainamen des Flußpferdes zusammenzubringen gewesen wäre. Schließlich ergab sich des Rätsels Lösung in dem assyrischen Wort Ma – ak – ka – nu – ú (»Tier von Südägypten«).
Ich kann nicht leugnen, bei meinen zahlreichen Navigationsversuchen im gebrechlichen Faltboot auf afrikanischen Flüssen und Seen eine gewisse Angst vor den »umstürzlerischen« Bestrebungen der Viboko, wie auch der Krokodile empfunden zu haben. Niemals werde ich vergessen, mit welchen Gefühlen ich mitten auf dem Strome einst zwei Flußpferdköpfe wenige Fuß von meinem segeltuchüberzogenen kleinen Fahrzeug auftauchen sah! Nur bei einer Gelegenheit haben Krokodile mein Faltboot angegriffen und es umgestürzt, wahrend Flußpferde Ähnliches nie versucht haben. Einer der weit verbreitetsten zoologischen Irrtümer ist es, zu glauben, daß sich die Krokodile so sehr dem Auge des Beschauers darbieten, wie man es nicht selten gezeichnet und gemalt findet! Gerade in dem versteckten, heimlichen, tückischen Verhalten und Auftreten des Krokodils liegt seine ganze Gefährlichkeit, und durch dieses Verhalten flößt es dem Menschen jenes Grauen ein, das man schnell empfinden lernt, wenn man erst einmal einen Menschen vom Krokodil in die gelben, gurgelnden Fluten eines afrikanischen Stromes hat ziehen sehen. – –

Eine meiner glücklichsten Aufnahmen stellt ein altes, starkes Flußpferd auf dem Wechsel dar. Die erste Aufnahme eines Nilpferdes in voller Freiheit auf dem Lande erfolgte im Herbst 1903 in frühester Morgenstunde, bei hereinbrechendem Tageslicht, als das gewaltige Tier die schützenden westlichen Ndjirisümpfe wieder aufsuchte.
Namentlich auf den Wassern des Rufuflusses, dessen absolute Unschiffbarkeit mir jahrelang vor ihrer behördlichen Feststellung bekannt und in dessen Uferwäldern ich einer der ersten europäischen Jäger war, habe ich mehrfache Zusammentreffen mit »Viboko« erlebt.
Mit Vorliebe legen sich die Tiere auf Inseln innerhalb der Flüsse und Seen zum Schlafen nieder. Man findet auf diesen Eilanden oftmals Lagerstellen, welche anscheinend seit langer Zeit immer und immer wieder benutzt werden. Mit Geschicklichkeit verstehen es die Flußpferde, selbst an steilen Ufern emporzuklettern; tief eingetretene Wechsel, unter Umständen auch in andern Teilen Afrikas im Laufe unzähliger Jahre in weichere Steinarten gehöhlt, führen häufig zum Wasserspiegel hin. An solchen Stellen fand ich in den zum Viktoria-Nyanza führenden Flüssen schwere Fallklötze der Eingeborenen angebracht; durch die Wucht ihres Falles stoßen sie einen vergifteten hölzernen Stab in den Rücken der Tiere, welche, dem starken Gift dann bald erliegend, an die Wasseroberfläche des Flusses, in den sie sich geflüchtet, auftreiben.
Außerordentlich merkwürdig ist die Gewohnheit der »el Makaunin«, ihre Losung mit ihrem bürstenartig mit kurzen, steifen Borsten besetzten Schwanz hoch an Büschen aufwärts zu schleudern.
Solche Büsche bilden wohl »Poststationen«, wie bei vielen andern Säugetieren, und erleichtern das gegenseitige Auffinden der Individuen.
Im Jahre 1896 waren Flußpferds noch zahlreich im Nsoiafluß und im Athifluß in Britisch-Ostafrika; damals fanden sich auch an der Küste zwischen Dar-es-Salam und Pangani Flußpferde allenthalben. Ich sah sie einige Male auch in der Brandung des Indischen Ozeans und werde nie meine Überraschung vergessen, als ich beim Ausritt aus einem Kokospalmenwald vor mir auf dem Sande des Meeres einen vermeintlichen Baumstamm sich in ein Flußpferd verwandeln und das tiefere Wasser des Meeres gewinnen sah.

Transport des im Mai 1903 von mir gefangenen jungen, später im Berliner Zoo zu etwa 2/3 seiner Größe entwickelten Nashorns ins Lager.
So suchen die Flußpferde, den Seeweg benutzend, die verschiedenen ins Meer mündenden Flußästuarien auf und entledigen sich im Salzwasser wohl auch gewisser Parasiten.
Innerhalb des Flußdeltas an der Küste wurden dann auch seinerzeit Versuche gemacht, junge Flußpferde zu erbeuten, wobei leider unser bekanntester Tierhändler Hagenbeck seinen Sohn in kurzer Zeit den Fiebermiasmen erliegen sah. Vor vierzehn Jahren beobachtete ich noch im Hafen von Dar-es-Salam einige Flußpferde, die dort geschont wurden, und bei einem nächtlichen Ansitz in Gesellschaft des stellvertretenden Gouverneurs Herrn von Benningsen – meinem ersten Anstand in den Tropen – erschien ein Flußpferd in meiner unmittelbaren Nähe. Da unser Ansitz wilden Schweinen galt, so war ich selbstverständlich auf das höchste überrascht, so unvermittelt einen der Tierriesen Afrikas vor mir auftauchen zu sehen!
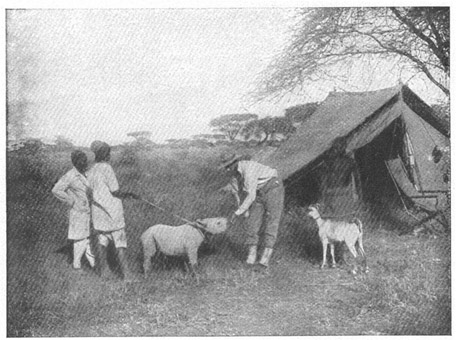
Bald hatte "Fatuma", mein kleines Nashorn, mich äußerst lieb gewonnen. Das Nashorn lebte später mehrere Jahre im Berliner Zoologischen Garten.
Die Aufzucht junger Nilpferde ist erheblich leichter wie die junger Nashörner und Elefanten; nichtsdestoweniger gelangten bis heute nur sehr wenige Exemplare aus Ostafrika in Gefangenschaft. Vor einigen Jahren unternahm es ein in portugiesischem Gebiete wohnender Europäer, ein altes, ausgewachsenes Nilpferd in einer Fallgrube zu fangen, um es lebend nach Europa zu bringen. Dies Unterfangen – die Fallgrube befand sich in unmittelbarer Nähe der Küste – scheiterte leider daran, daß das gewaltige Tier den Transportkasten, in den es glücklich hineinbefördert war, umwarf und dabei so zu Schaden kam, daß es einging. In allen diesen Dingen übertrafen uns die Alten; sie verstanden es, nicht nur Flußpferde, sondern auch alle anderen afrikanischen Tiere in ausgewachsenen Exemplaren in Mengen zu fangen, um sie in der Arena an ihren Kampfspielen teilnehmen zu lassen.
Die Witterung der Flußpferde ist, ihrer Verwandtschaft mit dem Geschlecht der Schweine entsprechend, außerordentlich gut. Wie ungemein jedoch das Riechvermögen ausgebildet ist, wurde mir erst dann völlig klar, als ich es unternahm, die Tiere bei Nacht zu photographieren. Wurden meine Versuche nicht unter Beobachtung der allergrößten Vorsichtsmaßregeln angestellt, so vermieden die Flußpferde die Nähe der Apparate und wählten andere abgelegene Ausstiege aus dem Wasser.
Wieder einmal wurde mir hier der Beweis eines überaus feinen, also hochorganisierten Geruchssinnes und seiner Anwendung bei einer Tierart gegeben, der der Laie angesichts ihrer plumpen, ungefügigen Massigkeit fein entwickelte Sinne nicht zusprechen würde.
Die unendlich weite Masai-Nyika bot mir so manche Herrlichkeit und so manchen Reichtum tierischen Lebens dar. So erinnere ich mich ganz besonders jener kleinen idyllischen Steppenseen, die hier und da in der Nyika versteckt, oft fast überreiches Tierleben beherbergen. Eine besonders auffallende Art gewaltiger Säuger, die Nilpferde, finden wir so zuweilen auf kleinem Raum zusammengedrängt, der Beobachtung viel zugänglicher wie in den großen Seenbecken, in denen sie zwar zu Hunderten oder Tausenden leben, aber sich dem forschenden Auge viel leichter entziehen können. Wohl kann man da in der Ferne zahlreiche Köpfe im Wasser auftauchen, kann den ihren Nüstern entweichenden Wasserstaub in zahlreichen kleinen Fontänen in der Sonne glitzernd beobachten. Aber das eigentliche Leben und Treiben dieser Giganten der Tierwelt spielt sich zur Nachtzeit, unsichtbar unserem Auge, ab. Anders in jenen kleinen Seen!
Mit Vergnügen erinnere ich mich jener Ansammlungen von Flußpferden in den vor einigen Jahren von Hauptmann Merker zwischen dem Kilimandscharo und dem Meruberge entdeckten versteckt gelegenen Seen. Ich selbst fand in diesen kleinen Seen noch im Jahre 1899 eine sehr große Anzahl von »Viboko«, wohl gegen 150 Stück.
Ich hatte seinerzeit vier Stück aus der großen Anzahl erlegt, um sie zu präparieren, und hätte mit größter Leichtigkeit wohl alle töten können, wenn ich gewollt hätte. In der trockensten Zeit auf nur wenige Quadratmeter große tiefere Stellen in den kleinen Seen beschränkt, mußten die Tiere sich wieder und wieder dem Schützen exponieren. Viele Stunden lang freilich wußten sie sich dadurch zu schützen, daß sie blitzschnell nur einen kurzen Augenblick – stoßweise – ihre Nasenventile über die Oberfläche emporstreckten, um sofort wieder zu verschwinden. Unter solchen Umständen ist ein tödlicher Schuß kaum anzubringen, wohl aber dann, wenn Augen und Ohren der Tiere nach einiger Zeit gelegentlich wieder sichtbar werden.
Es ist im höchsten Grade bemerkenswert, wie geschickt selbst für mehrere Stunden die Tiere es zu vermeiden wissen, irgendeinen Teil ihres Körpers, mit Ausnahme der Nasenspitzen, zu gefährden. Sie verstehen es so in den kleinsten Tümpeln überraschend gut, dem vielleicht nur einige zwanzig Schritte von ihnen entfernten Schützen lange Zeit fast unsichtbar zu bleiben. Nur ein Schnauben und Aufspritzen des Wassers hört und sieht der Jäger bei solchen Gelegenheiten; die Tiere vermögen lange Zeit mit einem Minimum von Luft hauszuhalten!
Im Jahre 1899 war es noch leicht, ihr Treiben in den Merkerseen zu beobachten. Wenig scheu spielten sie dort im Wasser herdenweise vereint bei hellem Sonnenschein umher. Namentlich die noch in Begleitung ihrer Mütter befindlichen Jungen waren so wenig ängstlich, daß ich sie zuweilen fast völlig aus dem Wasser emportauchend erblickte. Auch sah man sie zuweilen auf Sandbänken am Ufer im Sonnenschein ruhen. Einige jener Wasserbecken waren von so geringem Umfang, daß die Tiere in einer Entfernung von höchstens zwanzig Metern vom Beschauer auftauchen mußten. Häufig waren sie gleichzeitig von einer ganzen Anzahl von Flußpferden besetzt. Da war es dann höchst reizvoll, von der erhöhten Warte der umgebenden, steil aufragenden Uferhügel die Tiere stundenlang zu beobachten. Sie hielten gute Gemeinschaft mit der Schar der Wasser- und Sumpfvögel, die jene Seen belebten. Wie in einem zoologischen Garten, so nahe, so anschaulich boten sich all jene Tiere dem Schauenden dar. Aufs reizvollste kontrastierten da die fischenden, rosaroten Pelikane in Schwärmen von Hunderten mit den ungeschlachten Vierfüßlern! – Fern von allem menschlichen Tun und Treiben liegen auch heute noch jene Seen in stiller Einsamkeit im Geiste vor meinem Blick. Die Abendbrise trägt den scharfen, eigenartigen Geruch dieser salzigen, natronhaltigen Gewässer zu mir herüber. Düsteres Gewölk zieht herauf, die Nähe des massigen, finsteren Meruberges verleiht auch jenem vulkanischen Seeplateau häufig einen Wolkenschleier. Wieder erklimme ich einen der steilen Uferränder, und wiederum schweift mein Blick über die Wasserflächen. Aber vergeblich, die Zahl der die Seen belebenden Wasservögel hat sich zwar nicht vermindert, doch die Flußpferde sind verschwunden! Fand ich gelegentlich meiner letzten Reise noch eine kleine Anzahl, so hörte ich von Prof. Sjöstedt, dem schwedischen Forscher, der die Seen vor kurzem besuchte, daß die Nilpferde, die die Seen unbestritten seit grauen Zeiten ihre Heimat nannten, fast verschwunden sind. Die Buren haben alle getötet Vgl. auch Professor Yngwe Sjöstedt über die Wildvernichtung der Buren am Kilimandscharo in der »Täglichen Rundschau«, Berlin 1906. Professor Sjöstedt bereiste diese Gegenden, um die Fauna behufs Aufstellung im Kopenhagener Museum zu sammeln, und besuchte behufs Erbeutung einiger Flußpferde auch die Merkerseen. –. Einen traf ich schon vor Jahren hier an, unter den Flußpferden aufräumend (er nannte sich de Wet; ich bin überzeugt, daß er nie diesen Namen geführt hat!), er war im Begriff, den Rest der noch vorhandenen Flußpferde abzuschlachten, um die Zähne der Tiere und die in Streifen geschnittene Haut zu verhandeln.
Auf meine Nachricht an die Station Moschi wurde der Mann, der sich ohne irgendwelche Ausweispapiere schon sieben Jahre in allen Teilen Afrikas umhergetrieben hatte, auf Anordnung des mittlerweile vom Urlaub zurückgekehrten Hauptmanns Merker sofort verhaftet und zur Station gebracht. Hier erlegten indes seine Hinterleute die verfallenen Schußgelder. –
Diese kleine Begebenheit zeigt, wie unangebracht es ist, ausweislose Ausländer, mit Munition reichlich ausgerüstet, in das Innere reisen zu lassen, wo ihre Tätigkeit in keiner Weise kontrolliert werden kann. (Professor Sjöstedt fand die Buren nicht etwa angesiedelt, sondern dem Wilde folgend im Lande umherziehend!)
Das Mordwerk dieses Vorläufers haben andere erfolgreich fortgesetzt. Versuche, in ursprünglichen Gegenden Ansiedler heimisch zu machen, vertragen sich eben niemals mit einem Schutz ursprünglicher Tierwelt, sollte diese Tierwelt auch einsame Steppenseen bewohnen, die – wie es hier der Fall – noch so fern von menschlichen Ansiedlern in der Wildnis versteckt sind.
»Siehe, der Behemoth, den ich neben dir gemacht habe, frißt Heu, wie ein Ochse. Seine Knochen sind wie festes Erz, seine Gebeine sind wie eiserne Stäbe. Er liegt gern im Schatten, im Rohr und im Schlamm verborgen. Das Gebüsch bedeckt ihn mit seinem Schatten und die Bachweiden bedecken ihn. Siehe, er schluckt in sich den Strom und achtet es nicht groß; läßt sich dünken, er wolle den Jordan mit seinem Munde ausschöpfen.«
So berichtet das Buch Hiob. –
Aber auch dieses Wunder der Schöpfung vernichtet die moderne Zivilisation. – – –