
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Gerhart Johann Robert Hauptmann ist am 15. November 1862 in dem schlesischen Badeort Obersalzbrunn geboren, wo sein Vater, Robert Hauptmann, den Gasthof »zur preußischen Krone« besaß. Gerhart, der jüngste unter vier Geschwistern, erhielt seinen ersten Unterricht in der Schule des Ortes und kam dann mit seinen beiden älteren Brüdern auf das Gymnasium in Breslau, zeigte aber so wenig Sinn für die Schulgelehrsamkeit, daß er für den Beruf eines Landwirts bestimmt ward und zu diesem Zweck bei einem Onkel, einem Gutspächter, in Pension gegeben wurde. Aber der künstlerische Sinn in ihm verlangte nach Bethätigung, und so nahm ihn der Vater nach Breslau zurück, wo er diesmal die Kunstschule besuchen sollte. Auch hier scheint Gerhart sich in die Vorschriften der Anstalt nicht gefügt zu haben, denn er ward vorübergehend sogar vom Unterricht ausgeschlossen. Er gewann aber die Gunst eines Lehrers, des Professors Härtel, der ihm die Möglichkeit erwirkte, in Jena zu studieren. Dort war inzwischen Hauptmanns Lieblingsbruder Karl nach Absolvierung des Gymnasiums angelangt, und mit Freude nahm dieser den von ihm gleichfalls besonders geliebten Gerhart zu sich. Aber auch hier wollte dem jungen Künstlersmann die Wissenschaft nicht recht munden, und so suchte er Frieden für seinen dunklen Drang in einer weiten Reise. Von Hamburg aus, wo sein ältester Bruder mittlerweile Kaufmann geworden war, machte er eine Seefahrt, die ihn erst an die Küste Spaniens, dann aber nach Italien führte. Als er dann mit Bruder Karl die Reise an der Riviera entlang fortsetzte und schließlich in Neapel und auf Capri in Naturgenüssen schwelgte, fand er wohl Begeisterung und Anregung, aber nicht die gewünschte Ruhe und Klarheit. Heimgekehrt gewann er bald auf dem Hohenhaus in der Lößnitz bei Dresden sein Weibchen. In diesem Hause hatte erst der älteste Bruder, dann Karl sich die Braut geholt, und der dritte Bruder führte nun im Mai 1885 die dritte Schwester heim als ein zweiundzwanzigjähriger Freier. Dadurch kam endlich Ruhe in sein Leben. Der irdischen Sorge für alle 161 Zeiten entrückt durch das Vermögen seiner Erwählten, konnte er sich den Neigungen seines Geistes frei überlassen. Ein letzter Versuch, in Italien noch einmal die Bildhauerei zu erlernen, den er noch als Bräutigam machte, schlug fehl. Ein schwerer Fieberanfall erlöste ihn von den inneren Zweifeln. Ihm war jetzt klar geworden, daß die Dichtkunst sein Gebiet sei. Mit seiner jungen Frau zog er daher zunächst nach Berlin und dann nach dem Vorort Erkner. In jenen Tagen lernte ich ihn kennen, und eine Zeitlang verband uns aufrichtige Freundschaft. Oft besuchte er mich in Berlin, oft ich ihn in seiner freundlichen Villa, wo die geistreiche Gattin stets Anregung zu verbreiten wußte, und wo ich mit Hauptmann mich oft genug so in Gespräche von künftigen Plänen und Hoffnungen vertiefte, daß der Besuch sich mitunter auf mehrere Tage ausdehnte. Hauptmann selbst hatte damals gerade (1885) sein erstes Dichterwerk herausgegeben, sein »Promethidenlos«. Ich kann nicht sagen, daß die wirre und unklare Dichtung mich, der ich stets Klarheit als erstes Erfordernis der Kunst verlangte, sonderlich begeistert hätte. Aber der Verfasser interessierte mich mit seiner Fülle von keimenden Plänen. Was mir vor allen Dingen an ihm auffiel, und was jedem auffallen mußte, war sein starker sozial-ethischer Zug. Er sah sein ganzes noch junges Leben in diesem Lichte. Die Kindheitserinnerungen an den väterlichen Gasthof hielten ihm den Gegensatz zwischen reichen Badegästen und armen Ortseinwohnern fest; im Gymnasium tadelte er das Fernstehen der Wissenschaften vom Leben; an die jungen Künstler dachte er ungern, da sie meist ohne Ideale ihre Kunst betrieben; und selbst in die Erinnerungen an die wunderschönen Landschaften Italiens und Spaniens mischte sich ihm immer die Vorstellung der hungernden schmutzigen Menge des armen Volkes daselbst. Unter diesem Gesichtspunkt wurde auch sein wirres Jugendepos in gewissen Partieen genießbar. Es zeigt einen Jüngling, Selin mit Namen, der vom Vater davon fährt auf das Meer hinaus und, seinen Lebensgang rückwärts denkend, in seinen Erziehern die Peiniger sieht, die ihm Gewalt in seiner Entwickelung anthun wollten. Als Wegweiserinnen für die Zukunft winken ihm zwei Frauen, die eine mit dem Meißel: die Muse der Bildhauerkunst – die andere mit dem Schleier und dem Kranz: die Muse der Poesie. Selin schwankt zwischen beiden. Auf seiner Fahrt erblickt er an der spanischen Küste zum erstenmal das Laster in Gestalt sinnlos verkommener Frauen. In seinen Abscheu mischt sich sogleich das Mitleid. Zu einer Vision verschwimmt ihm der Anblick der Wirklichkeit, und er sieht in den Lüstlingen, die das Weib erst entweihen und dann verstoßen, die Mörder der Tugend. Er will eine neue Religion predigen, die auch die Dirnen in das Mitleid einschließt. Gleich auf dem Schiffe redet er begeistert davon, wird aber verkannt und verlacht. Auf Capri ergreift ihn mitten in der göttlich-schönen Natur mit doppelter Verzweiflung der Anblick der Hungernden und Verlassenen. Dem Weltschmerz will er sein Lied und sein Leben weihen. Auf den »Fels der Hoffnungslosigkeit« will er sich zurückziehen und von dort aus die Wahrheit predigen. Ein visionär vor ihm erscheinender Bergeinsiedler bestärkt ihn darin. Aber Selin begiebt sich aus der resignierten Stimmung wieder in das Leben zurück, beginnt wieder zu hoffen und erliegt 162 daher einer neuen Enttäuschung. Er wirft seine Leier ins Meer, wo die »Frau mit Kranz und Schleier« sie wieder herausholt und in den Himmel entführt, ihn auf ewig verlassend.
Und Hauptmann selbst huldigte damals dem Entsagungspessimismus durchaus. Er meinte, alle Reden, die man halten, alle Dichtungen, die man schaffen könne, würden die Menschheit doch nicht um ein Senfkorn vorwärts bringen. Bei alledem habe ich nie einen Menschen gesehen, dem das soziale Empfinden mehr in Fleisch und Blut, ja in das ganze  Nervensystem übergegangen war, als ihm. Nach Autodidaktenart las er alles, was von naturwissenschaftlicher, staatsmännischer oder theologischer Seite über Soziologie geschrieben wurde. Darwin und Marx waren seine Führer, ohne daß er aber zu einer bestimmten politischen Partei sich bekannt hätte. Die Religion verwarf er zwar als »morsche Stütze« und hielt sie für eine überwundene Sache, aber ein starkes religiöses Empfinden, das in seiner Knabenzeit von der herrenhutisch erzogenen Mutter und dem gläubigen, wenn auch nicht lippenfrommen Vater lebhaft entwickelt worden war, verriet sich doch überall. Auch mußte ihm klar werden, daß die befreiende Religion, die ihm vorschwebte, doch nur ein von allen Schlacken gereinigtes Urchristentum, wenigstens in moralischer Hinsicht, war. Und so trieb es ihn damals, ein Epos über Jesus von Nazareth zu schreiben. Da es ihm natürlich an Anschauung des Morgenlandes fehlte, so wollte er es ganz in die psychologische Seite drängen und faßte vorübergehend den wunderlichen Plan, ein Tagebuch des Judas Ischarioth zu schreiben, jenes ungetreuen Jüngers, der als tragische Figur seit alten 163 Zeiten bis auf die kraftgenialische Elise Schmidt beliebt war. Doch blieb es bei dem Plan!
Nervensystem übergegangen war, als ihm. Nach Autodidaktenart las er alles, was von naturwissenschaftlicher, staatsmännischer oder theologischer Seite über Soziologie geschrieben wurde. Darwin und Marx waren seine Führer, ohne daß er aber zu einer bestimmten politischen Partei sich bekannt hätte. Die Religion verwarf er zwar als »morsche Stütze« und hielt sie für eine überwundene Sache, aber ein starkes religiöses Empfinden, das in seiner Knabenzeit von der herrenhutisch erzogenen Mutter und dem gläubigen, wenn auch nicht lippenfrommen Vater lebhaft entwickelt worden war, verriet sich doch überall. Auch mußte ihm klar werden, daß die befreiende Religion, die ihm vorschwebte, doch nur ein von allen Schlacken gereinigtes Urchristentum, wenigstens in moralischer Hinsicht, war. Und so trieb es ihn damals, ein Epos über Jesus von Nazareth zu schreiben. Da es ihm natürlich an Anschauung des Morgenlandes fehlte, so wollte er es ganz in die psychologische Seite drängen und faßte vorübergehend den wunderlichen Plan, ein Tagebuch des Judas Ischarioth zu schreiben, jenes ungetreuen Jüngers, der als tragische Figur seit alten 163 Zeiten bis auf die kraftgenialische Elise Schmidt beliebt war. Doch blieb es bei dem Plan!
So war er durch und durch Gefühlsmensch. Die Dichtung erfaßte er von der Seite der Empfindung. Etwas Weiches, ja im guten Sinne Weibliches, war seiner geistigen Persönlichkeit schon damals eigen. »Die Dichter sind die Thränen der Geschichte«, sagt er von seinem Selin.  Daß sie auch der Donner und der Blitz der Geschichte sein können, wie Schiller, der geistige Freiheitskämpfer – den er nicht liebte – übersah er dabei. Lord Byron, der geniale Begründer der sozialen Weltschmerzbewegung, beschäftigte ihn viel, und wie das 19. Jahrhundert von jenem Romantiker direkt zum Realismus geleitet wurde, so erging es auch ihm. Den Weg von Saint Simon, dem religiösen Sozialreformator Frankreichs, dem »Neuchristen«, bis zu Zola, dem Naturalisten, machte er durch, wie ihn Europa durchgemacht hatte. In der naturalistischen Schilderung des Elends sah er die weckende Mahnung zur Menschenliebe und zur Hilfe, wie so viele seiner reiferen Zeitgenossen. Daß es ihm aber nur und immer wieder nur um die soziale Hilfe zu thun war, das ging aus allen seinen Aeußerungen hervor. Sogar das Dichten war ihm Nebensache, die soziale Erweckung Hauptsache. So schrieb er mir in das für mich bestimmte Exemplar des »Promethidenlos«:
Daß sie auch der Donner und der Blitz der Geschichte sein können, wie Schiller, der geistige Freiheitskämpfer – den er nicht liebte – übersah er dabei. Lord Byron, der geniale Begründer der sozialen Weltschmerzbewegung, beschäftigte ihn viel, und wie das 19. Jahrhundert von jenem Romantiker direkt zum Realismus geleitet wurde, so erging es auch ihm. Den Weg von Saint Simon, dem religiösen Sozialreformator Frankreichs, dem »Neuchristen«, bis zu Zola, dem Naturalisten, machte er durch, wie ihn Europa durchgemacht hatte. In der naturalistischen Schilderung des Elends sah er die weckende Mahnung zur Menschenliebe und zur Hilfe, wie so viele seiner reiferen Zeitgenossen. Daß es ihm aber nur und immer wieder nur um die soziale Hilfe zu thun war, das ging aus allen seinen Aeußerungen hervor. Sogar das Dichten war ihm Nebensache, die soziale Erweckung Hauptsache. So schrieb er mir in das für mich bestimmte Exemplar des »Promethidenlos«:
»Wohl möglich, daß es wirr Dir scheint,
ich will es nicht verneinen.
Doch ist das Leid, das es beweint,
wohl wert, darum zu weinen.
Und wenn Du weinst, wie ich geweint,
so wahr und echt, dann, Bruder, scheint
belohnt vollauf mein Dichten.
Auf Lob und Tadel, falsch und wahr,
ihr Freunde, will ich ganz und gar
verzichten.« –
164 Also das soziale Mitgefühl war seine Grundstimmung. Sie veranlaßte ihn, stundenlang der Genosse eines einsamen Bahnwärters zu sein, dessen stilles Leben im traumselig stimmungsvoll geschilderten märkischen Kiefernwald er in der Novelle »Bahnwärter Thiele« (1887, zuerst abgedruckt in der »Gesellschaft«) niederlegte. Er dichtete über einen Nachtwächter, der sich im Winter der Eisluft aussetzen mußte, einen Gesang, in dem es hieß, man habe diesem Manne zwar Brot gereicht, aber in das Brot den Tod hineingebacken. So glitt er langsam in das moderne Stoffgebiet hinüber. Dennoch waren es bis dahin historische Gestalten gewesen, die ihn gefesselt hatten. Tiberius, der so oft »gerettete« Tyrann des römischen Weltreiches, wurde noch einmal von Hauptmann im stillen Kämmerlein gerettet. Seiner Erziehung und Umgebung wurde »die größere Hälfte seiner Schuld« zugeschoben. »Römer und Germanen« war ein Drama aus dem Teutoburger Walde. Beide Arbeiten zeigten den echten Charakter der Hauptmann'schen Phantasie: den Bildhauercharakter. Die Personen waren alle in einzelnen Situationen unendlich scharf gesehen, aber immer nur in Situationen. Die Entwickelung fehlte. Es waren plastische, ruhende Gestalten, und noch bis heute hat Hauptmann diese Mängel seiner Phantasie nicht überwinden können. Er sieht immer Situationen, nie Entwickelungen. Diese Situationen aber bestrebte er sich möglichst scharf auszumalen. So führte er mich einmal in das Museum vor das Werk seines römischen Lehrers, das die vollendete Statue eines Menschen darstellt. Man glaubt, den Marmor atmen zu sehen, aber der Mensch ist nicht nur in keiner »Pose«, sondern auch in keiner Thätigkeit, ja nicht einmal mit einem bestimmten Ausdruck aufgefaßt. »Sehr lebenswahr«, sagte ich, »aber was thut dieser Mensch?« – »Nichts, er ist ein Mensch.« – Und das bewundert Hauptmann vor allem: Die Kunst, Menschen zu schaffen, auch wenn sie gar keine Idee verkörpern.
Wie außerordentlich stimmte das zusammen mit dem von Arno Holz soeben »entdeckten« Kunstgesetz. Auch Hauptmanns Kunst strebte von vornherein danach, nur Natur zu sein; und an dem Bildwerk jenes römischen Meisters hätte Arno Holz sein falsch verallgemeinertes Gesetz immerhin mit mehr Recht entwickeln dürfen, als an jener Kritzelei des talentlosen Knaben. Sonderbar – in Nieder-Schönhausen, im Norden von Berlin quälen sich Holz und Schlaf vergeblich ab, ihr vermeintliches Gesetz in künstlerische Thaten umzusetzen, und in Erkner, im Osten von Berlin, in gleicher Einsamkeit der märkischen Kiefernheide, häuft Hauptmann einen künstlerischen Entwurf auf den andern und sucht vergebens nach einem Wegweiser, der ihm sein dunkles inneres Drängen deute.
Er wurde damals noch hin und her geschleudert von einem Gegensatz zum andern. Hatte ich ihn heute verlassen als einen Kretzerschwärmer, so kam er mir morgen in seinem Garten mit einem Bande Byron entgegen und glaubte hier den rechten Lehrmeister gefunden zu haben. Auf seinem Tisch lag Bleibtreus Revolutionsbroschüre neben der Anthologie »moderne Dichtercharaktere« und dem Holzschen »Buch der Zeit«. Die erste persönliche Berührung fand er mit Kretzer, den er damals oft zu sich lud. Dann folgte er mir in den Verein »Durch«, 165 und bald las er seine halbfertigen Entwürfe, wie den »Bahnwärter Thiele«, einem junglitterarischen Areopag vor. Da fanden sich die Brüder Hart und andere Jüngere ein. Nach allen Seiten wurde in jüngstdeutscher Art die Theorie der Dichtkunst erörtert. In kleinen kritischen Aufsätzen für die akademische Zeitschrift wandte Hauptmann sich scharf gegen die bemalten Statuen oder half sich – da das kritische Eindringen seine Sache nicht war – bei einer Besprechung von Conradis »Liedern eines Sünders« mit der wenigsagenden Bemerkung, daß hier das Gute außergewöhnlich gut, aber auch das Schlechte außergewöhnlich schlecht sei. Wertvoller waren die Gedichte, die er für diese Zeitschrift beisteuerte, in denen sich seine weiche Romantik mit seinem sozialen Mitleid eigentümlich verquickte. Dabei trug er sich mit dem Gedanken, Schauspieler zu werden, und studierte den Hamlet bei einem der sonderbarsten Originale, die jemals durch die Welt gegangen sind: bei dem Theaterdirektor Alexander Heßler. Aus Straßburg um seines deutschen Kunststrebens willen unter der Aera Manteuffel gewichen, widmete Heßler sich damals den Wanderaufführungen des Herrig'schen Lutherspieles, oder ernährte sich durch Verleihen aus seiner reichen Theatergarderobe. Als er unter Hohenlohe wieder nach Straßburg zurückkehrte, begleitete ihn Hauptmann dorthin, um in naher Fühlung mit der Bühne seinen Theaterblick zu schärfen.
Zu Hauptmanns Berliner Bekanntschaften hatte auch Arno Holz gehört, jedoch erst zu einer Zeit, als mein Verhältnis mit jenem sich bereits gelockert hatte. Die beiden aber gehörten jetzt innerlich zusammen, denn nun hatte Hauptmann den Wegweiser gefunden. Nicht mehr der Dichter des »Buches der Zeit« war es, der ihn anregte, sondern der Erfinder des »konsequenten« Naturalismus. »Papa Hamlet« wurde für Hauptmann zur künstlerischen Offenbarung. – Wie erstaunte ich, als ich eine rühmende Hervorhebung dieses mir noch unbekannten Buches des mir noch unbekannteren Holmsen auf der ersten Seite eines Manuskripts fand, das mir der treffliche – leider bald darauf verstorbene – Verleger meiner dichterischen Erstlinge, der treuherzig ideal veranlagte Paul Ackermann zuschickte, als er die unlängst von ihm gekaufte Conrad'sche Buchhandlung in Berlin schnell in den Kreis der jüngsten Litteraturbewegung hinein rücken wollte. Die Handschrift war das Schauspiel »Vor Sonnenaufgang« von Gerhart Hauptmann. Trotz der mancherlei Mängel des Dramas riet ich natürlich warm zur Annahme, da für jeden Vorurteilsfreien hier ganz unverkennbar ein starkes Talent sich regte. Was anderen, die ihn nicht kannten, an dem Drama unverständlich war, mußte mir ja natürlich erklärlich sein: vor allem die Ruhe der Charaktere, die Korrektheit der Situationsschilderung und die Weichheit der Empfindung. Das Schwächste an Hauptmanns Erstlingsarbeit ist die Figur, die der Träger der Ideen sein soll. Und doch sollte das Stück ursprünglich nach ihm heißen. Dieser, Loth mit Namen, kommt im ersten Akt in einem schlesischen Dorf, das er zu nationalökonomischen Zwecken studieren und beschreiben will, zufällig in das Haus seines Jugendfreundes und lernt in ihm einen Abtrünnigen einstiger Ideale kennen. Hofmann hat sich nämlich mit der Tochter eines plötzlich reich gewordenen Kohlenbauern vermählt, ist dadurch in die Familie des dem Trunke ergebenen Dorfprotzen 166 hineingeraten, und die ganze Familie entfaltet sich im ersten Akt in bekannten, oft dagewesenen, aber hier sehr lebenswahr geschilderten Typen, deren Eigentümlichkeit der schlesische Erdgeruch ist: die protzige Schwiegermutter, die zweite Frau des stets sinnlos betrunkenen Alten; die immer speichelleckende »Stütze der Hausfrau«, die »Spillern«; der bis zur Idiotenhaftigkeit dumme, an Sinnlichkeit einem Pavian vergleichbare Nachbar Kahl, der ein unsittliches Verhältnis mit der jungen Schwiegermama Hofmanns hat; und der Herr Schwiegersohn selbst, der elegante, liebenswürdige Schwerenöter, der unter äußerlicher Bonhommie verabscheuungswürdige Habsucht, intrigante Sehlauheit und ekelhafte Sinnlichkeit verbirgt. Durch Betrug und raffinirte Gaunerei hat er sich zum reichen Manne gemacht. Seine Frau erscheint nicht auf der Bühne, sie ist das ganze Stück hindurch eine Leidende, die ihrer Niederkunft entgegensieht. Nur die arme Helene, Hofmanns Schwägerin, erweckt Sympathie. Sie, die bei den Herrnhutern erzogen ist, sehnt sich in dieser nach Fusel und Gemeinheit stinkenden Atmosphäre nach einem Menschen. Da kommt im rechten Augenblicke Loth. Recht hübsch führt er sich ein, vierschrötig – sein Programm, von dem sein Herz voll ist, auf der Zunge tragend; er verachtet als echter Demokrat den Luxus, trinkt keinen Tropfen alkoholischer Getränke, will immerwährend die Reichen belehren und bekehren und die Armen ausfragen über ihr Elend. Die Exposition ist gegeben. Ein junger Schiller hätte sie kühn ausgeführt, vielleicht folgendermaßen: Der Prediger des neuen Evangeliums, der in die Lasterhöhle kommt, sieht erst zu, dann greift er zum Mittel der Ueberredung, er wird ein Wortführer, endlich ein Anführer der Unterdrückten, und im Kampfe des Revolutionärs gegen den Zwingherrn des Geldes spielt die Liebe zu Helene ihre Rolle. – Weit gefehlt! Für Hauptmann giebt es nur Situationen. Der nächste Akt zeigt uns den Gutshof in seiner ganzen Naturwahrheit und der grenzenlosen Verkommenheit seiner Bewohner. Charakteristisch ist ein Gespräch Loths mit einem alten Arbeiter.
Loth. Es giebt wohl Heuernte heut?
Beibst (grob). De Aesel gihn ei's Hä itzunder.
Loth. Nun, ihr dengelt doch aber die Sense . . .?
Beibst (zur Sense) Ekch! tumme Dare.
(Kleine Pause, hierauf;)
Loth. Wollt Ihr mir nicht sagen, wozu Ihr die Sense scharf macht, wenn doch nicht Heuernte ist?
Beibst. Na – braucht ma ernt keene Sahnse zum Futtermacha?
Loth. Ach so! Futter soll also geschnitten werden.
Beibst. Woas d'n suste?
Loth. Wird das alle Morgen geschnitten?
Beibst. Na! – sool's Viech derhingern?
Loth. Ihr müßt schon ein bischen Nachsicht mit mir haben! ich bin eben ein Städter; da kann man nicht alles so genau wissen von der Landwirtschaft.
Beibst. Die Stadter glee – ekch; de Staadter, die wissa doo glee oals besser wie de Mensche vunt Lande, hä?
Loth. Das trifft bei mir nicht zu. – Könnt Ihr mir vielleicht nicht erklären, was das für ein Instrument ist? ich hab's wohl schon 'mal wo gesehen, aber der Name . . .
Beibst. Doasjenige, uf dan Se sitza?! woas ma su soat Extrabater nennt ma doas. 167
Loth. Richtig, ein Exstirpator; wird der hier auch gebraucht?
Beibst. Leeder Goott's nee. – A läßt a verludern . . . a ganza Acker, reen verludern läßt a'n, d'r Pauer. A Oarmes mecht a Flecka hoa'm – ei insa Bärta wächst kee Getreide – oaber nee, lieberscht läßt a'n verludern! – nischt thit wachsa, ok blußig Seide und Quecka.
Loth. Ja, die kriegt man schon damit heraus. Ich weiß, bei den Ikariern hatte man auch solche Exstirpatoren, um das urbar gemachte Land vollends zu reinigen.
Beibst. Wu sein denn die I . . . wie Se glei soa'n i I . . .
Loth. Die Ikarier? in Amerika.
Beibst. Doo gibbt's au schunn a sune Dinger?
Loth. Ja freilich.
Beibst. Woas iis denn doas fer a Vulk; die I . . . I . . .
Loth. Die Ikarier?! – es ist gar kein besonderes Volk; es sind Leute aus allen Nationen, die sich zusammengethan haben; sie besitzen in Amerika ein hübsches Stück Land, das sie gemeinsam bewirtschaften; alle Arbeit und allen Verdienst teilen sie gleichmäßig. Keiner ist arm, es giebt keine Armen unter ihnen.
Beibst (dessen Gesichtsausdruck ein wenig freundlicher geworden war, nimmt bei den letzten Worten Loths wieder das alte mißtrauisch feindselige Gepräge an; ohne Loth weiter zu beachten, hat er sich neuerdings wieder ganz seiner Arbeit zugewendet und zwar mit den Eingangsworten) Oost vu enner Sahnse!
Natürlich glaubt der Alte nicht, was Loth sagt, und erst, als jener ihm Geld giebt, wird er liebenswürdig. Die weiteren Szenen enthüllen nun die Zustände auf dem Gutshof mit neuen Niederträchtigkeiten und armen Duldern, der dritte Akt zeigt den Charakter Hofmanns in seiner ganzen Teufelei, der vierte bringt nur noch das Einzige, was sich als Handlung durch das Ganze hindurchzieht, die Liebe Loths zu Helenen. Immer mehr tritt naturgemäß Loth dabei zurück. Was ein Heldendrama sozialer Weltanschauung hätte werden können, wird nur eine Liebesgeschichte. Loth geht vom Reden nicht zum Handeln über. Er wird immer uninteressanter, er scheint ein Schwätzer, ein gewöhnlicher Zungendemagog zu sein. Dagegen immer herrlicher zeigt Helene ihren Charakter. Sie hat im ersten Akt Loth angestaunt als den ersten Menschen ihrer Bekanntschaft, der etwas anderes kennt als sinnliche Triebe, der sich »mit den normalen Reizen des Lebens begnügt«. Sie hat ihm zu Liebe sofort das Weintrinken aufgegeben. Wie er – wohl nur um alles umgekehrt zu thun, wie andere Menschen – erklärt, daß seine zukünftige Frau ihm zuerst ihre Liebe erklären müsse: da thut sie das wirklich. Sie will den einzigen Menschen, der in ihr Leben eintritt, nicht wieder von sich ziehen lassen. Alle Szenen zwischen ihr und ihm sind entzückend mitten in dem gemeinen Treiben: Blumen auf dem Mistbeet. Zu reizender Kindlichkeit erhebt sich das Liebesgetändel im vierten Akt. Hier muß männiglich erkennen, daß das verfehlte Stück dennoch das Werk eines Dichters ist. Dann aber kommt der Umschwung. Der Zufall greift noch einmal ein und läßt noch einen zweiten Jugendfreund Loths erscheinen, der als Arzt auch gerade hier praktiziert. Von ihm erfährt Loth, daß die ganze Familie Helenens durch erbliches Trinken vergiftet ist. Zu Loths Programm aber gehört es, daß er nur eine reine, gesunde Nachkommenschaft zeugen will. Also darf er Helene nicht heiraten. Das also ist – voll Erstaunen erfährt es der Leser oder Hörer – der eigentliche Zielpunkt des Stückes. Was wie eine soziale Tragödie ausgesehen hatte, kommt auf eine 168 medizinisch-soziologische Spitzfindigkeit heraus, wie sie der greise Ibsen manchmal in seine Ideendramen nebenbei verflicht. Und die Enttäuschung wird noch ärger, als Loth ganz einfach davongeht. Während Helene in ängstlicher Ahnung zwischen ihm und dem Krankenbett der Schwester hin und her läuft, schleicht er sich feige davon. Ja, feige! Denn, wenn er auch seinen Prinzipien zuliebe die Braut nicht heiraten will, hat er nicht zum mindesten die moralische Pflicht, sie ihrer schmachvollen Umgebung zu entreißen? Sie sehnt sich ja gar nicht nach Sinnlichkeit – die hätte sie zur Genüge; sie sehnt sich nach Reinheit und Freiheit! Aber selbst wenn Loth das auch nicht mag, ist er nicht wenigstens  verpflichtet, mündlich von ihr Abschied zu nehmen? Und wenn er selbst dazu zu feige ist, verdient das herrliche Mädchen nicht mindestens schriftlich eine Erklärung seines Thuns? Statt dessen macht er es sich bequem, schreibt ein flüchtiges Lebewohl auf einen Fetzen Papier und – geht. Bei allen Aufführungen, die ich von dem Stücke gesehen habe, hat man hier den unheldenhaften Helden ausgelacht – auch viele Anhänger des Dichters konnten nicht anders. Man sagt sich unwillkürlich: Wenn er so leicht gehen kann, warum dann soviel Aufhebens von der Liebe machen? Viel Lärm um nichts! Zum mindesten den Seelenkampf müßte man doch sehen. Den Monolog Shakespeares und Schillers verschmäht Hauptmann; nun, dann hätte er andere Mittel finden müssen. Aber er überläßt alles dem Schauspieler, und kein Garrik würde solchen Seelenkampf durch frei erfundenes stummes Spiel in solchem Augenblick verständlich machen können. Nein, der Grund dafür liegt darin, daß Hauptmann seinem Erstlingshelden, dem Agitator, hier nicht nachempfinden kann. Den Marquis Posa ins Naturalistische zu übersetzen, ist nicht seine Sache. Es giebt zwar genug flammenheiß redende und flammenheiß empfindende Weltverbesserer gerade in unseren Tagen, trotz des Naturalismus, aber die Feuerköpfe kann Hauptmann nicht dichterisch verstehen. Und nun gar die Theoretiker! Er kennt nur das still empfindende Gemüt, darum mußte ihm der weltumstürzende Mann mißlingen, 169 darum aber mußte ihm auch das leidende Weib trefflich gelingen. Helene – das ist in einem Wort die Ausbeute des Sonnenaufgangsdramas. Die Schilderung der verkommenen Zustände ist an sich sehr gut geraten, aber sie ist nicht neu. Zola und Tolstoj haben dergleichen längst geboten. Die protzenhaften Bauern sind auch längst bekannt und der Hofmann desgleichen. Die Figur, nach der die junge Generation eigentlich verlangte, der Messias der Arbeit, ist mißlungen, aber ganz und gar eigenartig erscheint das leidende Mädchen mitten unter den brutalen Gewalten. In dieser Art wenigstens ist sie neu. Und wie wahr, wie innig wahr ist sie! Wie klar und notwendig ist ihr Ende! Verlassen von einem ehrlosen Schwätzer mitten in der Welt der Gemeinheit, sucht sie den Tod und muß ihn suchen. Die ganze leidende Menschheit erscheint symbolisiert in der Gestalt dieser Helene. –
verpflichtet, mündlich von ihr Abschied zu nehmen? Und wenn er selbst dazu zu feige ist, verdient das herrliche Mädchen nicht mindestens schriftlich eine Erklärung seines Thuns? Statt dessen macht er es sich bequem, schreibt ein flüchtiges Lebewohl auf einen Fetzen Papier und – geht. Bei allen Aufführungen, die ich von dem Stücke gesehen habe, hat man hier den unheldenhaften Helden ausgelacht – auch viele Anhänger des Dichters konnten nicht anders. Man sagt sich unwillkürlich: Wenn er so leicht gehen kann, warum dann soviel Aufhebens von der Liebe machen? Viel Lärm um nichts! Zum mindesten den Seelenkampf müßte man doch sehen. Den Monolog Shakespeares und Schillers verschmäht Hauptmann; nun, dann hätte er andere Mittel finden müssen. Aber er überläßt alles dem Schauspieler, und kein Garrik würde solchen Seelenkampf durch frei erfundenes stummes Spiel in solchem Augenblick verständlich machen können. Nein, der Grund dafür liegt darin, daß Hauptmann seinem Erstlingshelden, dem Agitator, hier nicht nachempfinden kann. Den Marquis Posa ins Naturalistische zu übersetzen, ist nicht seine Sache. Es giebt zwar genug flammenheiß redende und flammenheiß empfindende Weltverbesserer gerade in unseren Tagen, trotz des Naturalismus, aber die Feuerköpfe kann Hauptmann nicht dichterisch verstehen. Und nun gar die Theoretiker! Er kennt nur das still empfindende Gemüt, darum mußte ihm der weltumstürzende Mann mißlingen, 169 darum aber mußte ihm auch das leidende Weib trefflich gelingen. Helene – das ist in einem Wort die Ausbeute des Sonnenaufgangsdramas. Die Schilderung der verkommenen Zustände ist an sich sehr gut geraten, aber sie ist nicht neu. Zola und Tolstoj haben dergleichen längst geboten. Die protzenhaften Bauern sind auch längst bekannt und der Hofmann desgleichen. Die Figur, nach der die junge Generation eigentlich verlangte, der Messias der Arbeit, ist mißlungen, aber ganz und gar eigenartig erscheint das leidende Mädchen mitten unter den brutalen Gewalten. In dieser Art wenigstens ist sie neu. Und wie wahr, wie innig wahr ist sie! Wie klar und notwendig ist ihr Ende! Verlassen von einem ehrlosen Schwätzer mitten in der Welt der Gemeinheit, sucht sie den Tod und muß ihn suchen. Die ganze leidende Menschheit erscheint symbolisiert in der Gestalt dieser Helene. –
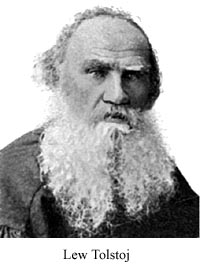 Als das Schauspiel gedruckt worden war, wurde es – samt jener oben erwähnten Widmung an Bjarne P. Holmsen – zunächst der »Freien Bühne« eingereicht. Gleichzeitig überreichte Paul Ackermann es seinem Landsmann Theodor Fontane und meinem Freunde Reicher. Fontane schrieb sehr bald einen höchst merkwürdigen Brief an den Autor. Er erkannte warm und voll an, daß hier der wirkliche Naturalismus zum erstenmal vorhanden sei. Mit vollem Rechte stellt er Hauptmann in Gegensatz zu Ibsen, denn Ibsen ist ja niemals Naturalist gewesen! Und so wurde denn dem altehrwürdigen Kritiker der Vossischen Zeitung erst an dem Hauptmann'schen Schauspiel der Begriff des dramatischen Naturalismus klar. Und er hob dies sehr rühmend hervor. Dann aber sprach er im Schlußsatze aus, daß es ihn selbst vor dieser neuen Kunst grause und daß er froh sei, als alter Mann nicht mehr hinabsteigen zu müssen in die Arena. Immerhin machte der Brief einen gewaltigen Eindruck auf das litterarische Berlin. Im Café Kaiserhof, dem Tummelplatz aller schöngeistigen Müßiggänger, ging dieser Brief von Hand zu Hand; und von hier aus eilte durch alle ästhetischen Kreise Berlins die Nachricht wie ein Lauffeuer: Der alte Fontane hat einen ganz jungen und unbekannten Dichter für den Erwecker einer neuen Kunst erklärt. – Ganz aufgeregt aber war Emanuel Reicher:
Als das Schauspiel gedruckt worden war, wurde es – samt jener oben erwähnten Widmung an Bjarne P. Holmsen – zunächst der »Freien Bühne« eingereicht. Gleichzeitig überreichte Paul Ackermann es seinem Landsmann Theodor Fontane und meinem Freunde Reicher. Fontane schrieb sehr bald einen höchst merkwürdigen Brief an den Autor. Er erkannte warm und voll an, daß hier der wirkliche Naturalismus zum erstenmal vorhanden sei. Mit vollem Rechte stellt er Hauptmann in Gegensatz zu Ibsen, denn Ibsen ist ja niemals Naturalist gewesen! Und so wurde denn dem altehrwürdigen Kritiker der Vossischen Zeitung erst an dem Hauptmann'schen Schauspiel der Begriff des dramatischen Naturalismus klar. Und er hob dies sehr rühmend hervor. Dann aber sprach er im Schlußsatze aus, daß es ihn selbst vor dieser neuen Kunst grause und daß er froh sei, als alter Mann nicht mehr hinabsteigen zu müssen in die Arena. Immerhin machte der Brief einen gewaltigen Eindruck auf das litterarische Berlin. Im Café Kaiserhof, dem Tummelplatz aller schöngeistigen Müßiggänger, ging dieser Brief von Hand zu Hand; und von hier aus eilte durch alle ästhetischen Kreise Berlins die Nachricht wie ein Lauffeuer: Der alte Fontane hat einen ganz jungen und unbekannten Dichter für den Erwecker einer neuen Kunst erklärt. – Ganz aufgeregt aber war Emanuel Reicher:
170 »Wie lange habe ich diesen Stil in die Schauspielkunst hineinzutragen versucht! Wie habe ich die schön stilisierten Reden der Menschen absichtlich zerhackt, um sie natürlicher zu machen! Hier endlich finde ich alles dies schon vor.« So ungefähr sagte er begeistert zu mir, und mit seinem ganzen stürmischen Temperament drang er in den immer noch schwankenden Brahm, der bedenklich den Kopf schüttelte, als ich ihm auf seine Frage nach Hauptmanns Vorbildung nicht einen schulgerechten akademischen Entwickelungsgang bei diesem nachweisen konnte. Die Gründe, die den Leiter der Freien Bühne endlich bewogen, das Stück anzunehmen, hat sein Amanuensis Schlenther folgendermaßen ausgedrückt: »Nicht die ästhetische und soziale Tendenz des außergewöhnlichen Stückes, sein schrankenloser, noch schlackenreicher Naturalismus und sein schwer durchsichtiges Lebensprogramm sollte belohnt werden, sondern der kühne Wagemut des Dichters, aller Konvention und aller Schablone gründlich zu entsagen, und der geniale Versuch, ein neues und volles Leben in dramatische Formen zu fassen.« – Durch seine Artikel in der »Nation« wußte Otto Brahm die weitesten Kreise auf das Stück aufmerksam zu machen, und schon vor der Darstellung wurde das Buch viel gekauft und gelesen; aber als die Aufführung endlich am 20. Oktober 1889 vormittags 12 Uhr im Lessingtheater vor sich ging, da hatte sich das wunderbarste Publikum der Welt zusammengefunden.
Die aufgeregten Jüngstdeutschen zogen ins Theater hinein wie in eine Schlacht. Hier galt es ihnen jetzt, mit Händen und Füßen der naturalistischen Kunstanschauung den Sieg zu erklatschen und zu ertrampeln. Aber auch die Schar der Gegner war kampfbereit. Ja einige derselben hatten sich im wirklichen Sinne des Wortes ausgerüstet, nämlich mit sogenannten »Radau-Flöten«. Der bekannte Arzt und Journalist Dr. Kastan brachte sogar in der Tasche verborgen eine richtige Geburtszange mit, um sie im geeigneten Momente diesmal zu einem anderen als ärztlichen Zweck gebrauchen zu können. Zu allgemeiner Enttäuschung ging der erste Akt ganz friedlich vorüber. Die Familienszene in Hofmanns Hause hatte ganz gut gewirkt, Loths lange Reden waren stark gekürzt, und über seine ungeschickte Redensart des häufig wiederholten »Wo waren wir doch stehen geblieben?« hatte man auf beiden Parteien gelächelt, aber Helenens (Else Lehmann) zum Schluß seelenvoll hervorgepreßtes »O, nicht fort! Geh nicht fort!« hatte sogar ergriffen. Die Gegner verhielten sich schweigend und ließen den Autor dreimal vor seinen klatschenden Anhängern erscheinen. Aber das genügte diesen nicht, und so lärmten sie denn so lange, bis sie den Widerspruch geweckt hatten. Und nun gab sich alt und jung und rechts und links dem jungenhaften Vergnügen hin, mit Radau-Flöten und Stiefelabsätzen den neuen Mann zu empfangen, wenn er auf der Bühne erschien. Von Akt zu Akt wuchs der Lärm. Schließlich lachte und jubelte, höhnte und trampelte man mitten in die Unterhaltungen der Schauspieler hinein, und als der Höhepunkt des Stückes sich nahte, erstieg auch das Toben seinen Gipfel. Hier kam die Stelle, wo auf der Bühne nach einer Hebamme gerufen wurde, und hier zog jener Arzt sein Instrument aus der Tasche, um es auf die Bühne zu werfen. Rasender Tumult erhob sich. Einige wollten 171 ihn aus dem Theater werfen, andere traten für ihn ein. Man spielte das Stück mühsam zu Ende, lachte den Helden des Dramas aus und jubelte doch wieder den Verfasser hervor – um dann zu zischen. – Natürlich hatte das alles zur Folge, daß von dieser Aufführung in Berlin wochenlang gesprochen wurde und zahllose Mitglieder dem Verein zuströmten, nur um so etwas Interessantes auch einmal erleben zu können. Und die tollsten Vorgänge sorgten dafür, daß die Sache nicht in Vergessenheit kam. Da schloß der Verein den Dr. Kastan aus, dieser aber klagte und mußte auf Gerichtsbeschluß wieder zum Mitglied gemacht werden. Dann aber sandte er freiwillig seine Mitgliedskarte zurück, und als man ihm nun sein Eintrittsgeld wieder zustellen wollte, da lehnte er auch dies ab mit der Bitte, man möge es einem Verein zur Besserung von Gewohnheitstrinkern übermitteln. Da schrieb man über die politische Bedeutung solcher ästhetischen Umsturzbewegungen, und in ganz Deutschland bekannt war der Name des jungen Mannes, der als der »krasseste Naturalist«, als der »Dramatiker des Häßlichen«, als der »poetische Anarchist«, als der »unsittlichste Bühnenschriftsteller des Jahrhunderts« verdammt, oder als »Reformator der Kunst«, als der »Erlöser der Dichtung« gepriesen wurde. Schlenther aber schrieb in seiner leichten, oberflächlichen Manier jene Flugschrift: »Wozu der Lärm? Genesis der freien Bühne« (Berlin 1889), worin er das innerste Wesen Hauptmanns verkannte, wenn er schrieb: »Wie man Ibsen mit seinem Gregers Werle in der »Wildente« zusammenwarf, so warf man Hauptmann mit seinem Loth zusammen.« – Jeder, der diesen Hauptmann vor seinem Schauspiel »Vor Sonnenaufgang« nahe gekannt hat, weiß, daß Wort für Wort seines Loth sein damaliges Evangelium ausmachten. Dagegen rühmt Schlenther: »Alle alten, gebrechlichen Eselsbrücken des deutschen Schauspiels, wie Monolog, Beiseitesprechen, sind umgangen.« Nun, das »Beiseitesprechen« ist von ernst zu nehmenden deutschen Dichtern nur sehr selten angewendet worden. Den Monolog aber hat Hauptmann in seinem Drama doch nicht ganz überwunden. Am Schlusse des ersten Aktes spricht Helene, ganz allein auf der Bühne stehend, jene Worte, die gerade bei der Aufführung ergreifend wirkten: »O! nicht fort! – O! nicht fort, geh nicht fort!« Und im Augenblick, wo Loth den Entschluß gefaßt hat, seine Helene zu verlassen, heißt es:
Loth (wendet sich, bevor er zur Thür hinaustritt, noch einmal nach rückwärts und nimmt mit den Augen noch einmal den ganzen Raum in sein Gedächtnis auf. Hierauf zu sich) Da könnt' ich ja nun wohl – gehen. (Nach einem letzten Blick ab.)
Nun – ist das nicht der handgreifliche Beweis, daß auch Hauptmann nicht auskommen kann, ohne seine Personen »zu sich« sprechen zu lassen? Und dann – was heißt überhaupt Eselsbrücke? Bisher ist der geistig bedeutende Teil der Menschheit sich darüber einig gewesen, daß die Monologe in Shakespeares »Hamlet« und in Goethes »Faust« das Schönste und Tiefste ausmachen, was die Weltlitteratur besitzt. Herr Schlenther aber, der nur immer an das banale Handwerkszeug der Technik denkt, sieht in diesen weisheitsvollen Versen nur den Ausdruck für ein technisches Ungeschick dieser größten Meister, und das Schönste, was sie auf die goldene Tafel der Weltdichtung geschrieben haben, wischt er mit plumpem 172 Ellbogen herunter, nur weil es nicht in seine schulmeisterliche Vorstellung von der Technik des Dramas paßt.
Jedenfalls konnte das Stück, obgleich es in Buchform schnell zahlreiche Auflagen erlebte, sich doch niemals die Bühne erobern. Der Theaterunternehmer Rosenfeld pachtete das Belle-Alliancetheater auf einige Wochen, um dort nur dies viel besprochene Stück zur Aufführung zu bringen. Auch hierfür fehlte es nicht an unfreiwilliger Reklame. Alle Zeitungen verbreiteten sich über das Unternehmen. Mit Bezug auf die poetischen Namen der beiden Bühnenleiter der Häuser, in denen das Stück nun gegeben war, witzelten die unlängst begründeten »Lustigen Blätter«:
Sonnenaufgangsblume.
Was eine richt'ge Blume ist,
die schlägt sich immer durch die Welt;
Weist man sie aus dem Blumenthal,
so wandert sie ins Rosenfeld. –
Aber diesmal half der Blume ihre Wanderung nichts. Nach einer tumultreichen neuen Erstaufführung, die freilich nur ein schwacher Abglanz derjenigen in der »Freien Bühne« war, erlahmte das Interesse sehr bald, und Direktor Rosenfeld mußte die Vorstellungen abbrechen, nicht lange nachdem sie begonnen hatten. Dagegen sein Genosse aus jenem Witzvers sollte bald als der Entdecker des ersten erfolgreichen neueren Dramatikers gelten. Ja, das Lessingtheater, in dem die Freie Bühne an einem Vormittage Hauptmanns »Sonnenaufgang« zu Tage gefördert hatte, sah einige Zeit später an einem regulären Theaterabend dem ersten Schauspiel Hermann Sudermanns mit ganz geringen Erwartungen entgegen.
Das Stück hatte seine besondere Vorgeschichte. Blumenthal selbst hatte in seiner großen Not und Verlegenheit um ein zugkräftiges Schauspiel den schon bekannten jungen Romandichter aufgefordert, es einmal mit einem Drama zu versuchen; als ihm aber dieser seine »Ehre« einreichte, da schüttelte der bühnenkundige Direktor den Kopf und wünschte eine Umarbeitung. Sudermann zog es vor, die Handschrift dem Berliner Theater anzubieten, aber auch Barnay sagte nein. So mußte denn doch umgearbeitet werden, und Blumenthals Vorschläge mögen dabei stark berücksichtigt worden sein. Dennoch versprach sich dieser noch immer wenig von der Aufführung, und auf das äußerste erstaunt sah er den ungeheuren Erfolg, der diesen Abend zu einem denkwürdigen in der deutschen Theatergeschichte machte. Vom nächsten Morgen an war der Sieg des Realismus auf der deutschen Bühne für einige Jahre entschieden. Die Revolution in der Litteratur, die Jahr auf Jahr weitere Kreise gezogen hatte, setzte zum erstenmal einem der ihrigen die Krone eines weithinstrahlenden Erfolges aufs Haupt. Aber dieser eine war nur ein einzelner Mann gewesen, der bis dahin nirgends einer Richtung oder Clique sich angeschlossen hatte und der daher auch von allen Richtungen und Cliquen mit Mißtrauen betrachtet wurde. Vor der Hand aber konnte er sich darüber hinwegtrösten mit dem Bewußtsein, daß sein rasch über hundertmal aufgeführtes Schauspiel ihn in der weitesten Oeffentlichkeit als den Begründer einer neuen Bühnenkunst erscheinen ließ.
173 Das war nun allerdings eine irrige Meinung. Eine neue Kunst brachte das Stück weder der Form noch dem Inhalte nach. Von der Holz'schen Technik, die Hauptmann sich zu eigen gemacht hatte, sehen wir bei Sudermann nichts. Dehnen sich Hauptmanns Akte wie breite Ebenen aus, so spitzen sie sich bei Sudermann pyramidenartig zu; sprechen bei Hauptmann die Menschen über alles, wofür sie  Interesse haben, – so zwingt Sudermann die seinen, nur von dem zu reden, was der Zweck des Stückes ist; und diese Reden – bei Hauptmann recht wortreich, um naturwahr zu sein, sind bei Sudermann knapp, um dramatisch zu sein; der Gang des Schauspiels aber – bei Hauptmann nur aus Situationen bestehend, die ein Naturbild geben, – ist bei Sudermann konstruiert, um eine Idee zu verwirklichen – und diese Idee ist die Erörterung des Ehrbegriffs.
Interesse haben, – so zwingt Sudermann die seinen, nur von dem zu reden, was der Zweck des Stückes ist; und diese Reden – bei Hauptmann recht wortreich, um naturwahr zu sein, sind bei Sudermann knapp, um dramatisch zu sein; der Gang des Schauspiels aber – bei Hauptmann nur aus Situationen bestehend, die ein Naturbild geben, – ist bei Sudermann konstruiert, um eine Idee zu verwirklichen – und diese Idee ist die Erörterung des Ehrbegriffs.
Zu dem Zwecke wird Folgendes gebaut: In einem Berliner Hause wohnt vorn der Kommerzienrat Mühlingk, hinten der arme Papparbeiter Heinecke. Das Geld ist im Vorderhause die Beherrscherin der Weltanschauung – im Hinterhause ist es die Armut. Jede der beiden Familien hat zwei Kinder – Sohn und Tochter – und von jedem dieser beiden Paare ist ein Kind durch die Weltanschauung der Eltern verdorben, eins aber hat sich darüber emporgearbeitet: im Hinterhause ist der Aufsteigende der Sohn und die Tochter die Sinkende – im Vorderhause verkommt moralisch der Sohn, während die Tochter sich klärt. Diese vollständige Regelmäßigkeit des Baues wird dadurch nicht gestört, daß im Hinterhause noch eine ältere Tochter vorhanden ist. Denn wie sie und ihr Mann das Herz der armen Alma im Hinterhause verderben helfen, so ziehen im 174 Vorderhause die beiden Freunde Hugo und Lothar den jungen Kurt immer tiefer in ihren Bannkreis der äußeren Korrektheit und inneren Hohlheit. Ja, auch die Liebe spinnt ihre Doppelfäden ganz parallel diesem Gange der Handlung: der gute Sohn aus dem Hinterhause und die hochherzige Tochter aus dem Vorderhause lieben sich von frühster Kindheit an; und der oberflächliche Sohn aus dem Vorderhause und die leichtsinnige Tochter aus dem Hinterhause haben ein Verhältnis miteinander! Dieser vollständigen Regelmäßigkeit des Planes entspricht endlich eine ebenso vollständige des äußeren Aufbaus, der die Akte vorn und hinten genau abwechseln läßt: der erste und dritte Akt spielen im Hinterhause – der zweite und vierte im Vorderhause. Die Grundidee des Dramas aber spricht eine Figur aus, die eigens nur zu diesem Zwecke in die Handlung hinein erfunden wurde und mit beiden Parteien in nahe Verbindung gebracht ward: das ist Graf Trast, der Herzensfreund Robert Heineckes aus dem Hinterhause, der Geschäftsfreund des Kommerzienrats Mühlingk im Vorderhause. Diese so planmäßig und geschickt ersonnene Fabel spinnt sich nun leicht folgendermaßen ab:
Der alte Heinecke im Hinterhause erwartet seinen Sohn. Er klebt und malt ihm ein Willkommenschild, Mutter hat einen Kuchen gebacken, die älteste Tochter Auguste und ihr Gatte Michalsky kommen zum Besuch – da stürmt der Sohn herein und sinkt gerührt in die Arme der Eltern. Er war jahrelang als erster Kommis des Kommerzienrates Mühlingk in Indien und hat für dessen faulen Neffen Benno die Kaffeeplantagen geleitet. Hoch schlägt ihm das Herz im Elternhause, aber bald merkt er, daß hier etwas nicht in Ordnung ist: jedesmal wenn das Gespräch auf das Vorderhaus kommt, lacht und tuschelt man. Schwester Alma tänzelt als junge Sängerin herein – mit Erstaunen, das bis zur Entrüstung wächst, hört Robert davon, daß der junge Kurt Mühlingk die Alma oft heimlich in seinem Wagen mitnimmt. Der eintretende Graf Trast erkennt schnell in der Schwester seines Freundes das Mädchen wieder, das er gestern abend in einem öffentlichen Balllokale aushalten wollte, das ihm aber ein junger Kavalier als älterer Besitzer streitig machte. – Daß dieser junge Kavalier Kurt Mühlingk war, stellt sich im zweiten Akte heraus, wo Trast und Robert ihren Besuch im Vorderhause machen. Während der Graf ins Kontor des Kommerzienrats geht, frischt Robert seine Jugendliebe mit der edelherzigen Eleonore wieder auf, und wie Robert dann im Kontor verschwindet, hat Graf Trast ein Gespräch mit Kurt und seinen aufgeblasenen Freunden; wie er dem geckenhaften Lothar das Prahlen mit seinem Reserveleutnantstum verweist, rächt sich dieser schnell, indem er die Vorgeschichte des Grafen, der im selben Regiment Offizier war, kundgiebt. Graf Trast hat als junger Leutnant einmal in einer lustigen Nacht 90 000 Thaler verspielt, hat diese »Ehrenschuld« nicht bezahlen können, ist mit schlichtem Abschied entlassen worden, wanderte aus, wurde Kaufmann und schwang sich durch geschickte Spekulation zum sogenannten »Kaffeekönig« empor. Hätte der junge Lothar diesen letzten Teil der Lebensgeschichte des Trast gekannt, so würde er ihn nicht gereizt haben. Trast aber überrascht nun die jungen Herren mit seiner ganz neuen Auffassung des Ehrbegriffes. 175
Trast. Was wir gemeinhin Ehre nennen, das ist wohl nichts weiter, als der Schatten, den wir werfen, wenn die Sonne der öffentlichen Achtung uns bescheint. – Aber das Schlimmste bei allem ist, daß wir soviel verschiedene Sorten von »Ehre« besitzen als gesellschaftliche Kreise und Schichten. Wie soll man sich da zurechtfinden?
Lothar (scharf). Sie irren, Herr Graf! Es giebt nur eine Ehre, wie nur eine Sonne und einen Gott. Das muß man fühlen, oder man ist kein Kavalier!
Trast. Hm! Gestatten Sie, daß ich Ihnen eine ganz kleine Geschichte erzähle. Auf einer Reise durch Mittelasien kam ich in das Haus eines tibetanischen Großen. Ich war bestaubt und wegmüde. Er empfing mich, auf seinem Thronsessel sitzend, neben sich sein junges, liebreizendes Weib. Ruhe aus, Fremder, sagte er, mein Weib wird dir ein Bad rüsten, und hierauf wollen wir Männer uns zum Mahle setzen. Und er ließ mich in den Händen des jungen Weibes. – – Meine Herren, wenn ich je im Leben Gelegenheit hatte, meine Selbstbeherrschung zu erproben, so geschah es in jener Stunde. – Als ich die Halle wieder betrat, was fand ich da? Die Gefolgschaft in Waffen, dröhnende Stimmen, halbgezückte Schwerter. Du mußt sterben, ruft mein Gastfreund, du hast die Ehre meines Hauses tödlich beleidigt, denn du hast das Wertvollste, was es dir bot, verschmäht. – Sie sehen, meine Herren, ich lebe noch, denn schließlich entschuldigte man mich mit den mangelnden Ehrbegriffen der europäischen Barbaren. (Man lacht.) Wenn Sie einen unserer modernen Ehebruchsdichter sehen, grüßen Sie ihn von mir, und ich schenk' ihm diesen Konflikt. –
(Alle lachen, man geht allgemach nach links hinüber.)
Trast. Meine Herren, ich wünsche nicht für frivol gehalten zu werden. Den Rätseln der Gesittung nachzuspüren, ist sittlich an und für sich . . . Sehen Sie, nun liegt es außerdem im Wesen der sogenannten Ehre, daß sie nur von wenigen, einem Häuflein Halbgötter, besessen werden darf; denn sie ist ein Luxusgefühl, das in demselben Maße an Wert verliert, in dem der Pöbel wagt, es sich anzueignen.
In demselben Augenblicke, wo diese theoretische Erörterung über die Unmöglichkeit eines feststehenden Ehrbegriffs stattgefunden hat, tritt ein furchtbarer Ehrkonflikt in die Handlung ein. Robert erfährt am Schlusse des Aktes, daß seine Schwester Alma von Kurt Mühlingk verführt worden ist. Die Auseinandersetzung zwischen beiden jungen Männern und Roberts Forderung einer Genugthuung liegt im Zwischenakt. Im Anfange des dritten Aufzuges weiß Robert alles, sucht aber vergebens seine Eltern mit seiner Entrüstung zu erfüllen. Nur komisch pathetisch schimpft der alte Arbeiter:
Heinecke. Ja, ja, die Alma! Dazu is man in Ehren jrau geworden! Aber ick hab's stets jesagt: Das Vorderhaus wird uns ins Unglück stürzen.
Frau Heinecke. Vater, weine nicht! (Sie halten sich umschlungen.)
Robert (für sich). Daß einem das Herz nicht bricht!
Heinecke. Ah, ick weene nicht! Ick bin der Herr im Hause! Ick weeß, wat ick zu thun habe! – Armer Krüppel hält auch auf Ehre! Mir soll das passieren? Meine Dochter? Die soll wat erleben! (Schwingt die Ofenkrücke.) Meinen Fluch werd' ick ihr jeben. Meinen väterlichen Fluch! 176
Frau Heinecke (welche die Betten aufräumt). Na, na!
Heinecke. Ja du! Du verstehst von Ehre jar nischt. (Schlägt sich auf die Brust). Da sitzt nämlich die Ehre. Auf die Straße werd ick ihr stoßen in Nacht und Nebel hinaus!
Robert. Soll sie da ganz verderben? Vater!
Frau Heinecke. Laß ihn man reden. Er meint's nich so schlimm!
Robert. Willst du nicht nach ihr sehen? Sie fürchtet sich wohl, uns vor die Augen zu treten.
Frau Heinecke. Schlafen wird se!
Robert. O!
Frau Heinecke (geht an die Kammerthür). Alma! (Keine Antwort.)
Robert. Um Gottes Willen! Man hätte sie nicht allein lassen sollen.
Frau Heinecke (hat die Thür geöffnet). Wie ick dir sagte, sie schläft.
Robert. Sie kann schlafen! –«
Ja, sie kann schlafen; denn Gewissensbisse fühlt sie überhaupt nicht. Auch ihre Reue, wie ihr Bruder sie ins Gebet nimmt, ist ebenso erheuchelt, wie die scheinbare Entrüstung des Vaters. Dagegen spricht sie im Trotze die Wahrheit, wenn sie von sich sagt:
»Ich weiß janz jut, was ich spreche . . . Ja, bin jar nicht so dumm! Ich kenn' das menschliche Leben . . . Warum haste dich so? . . . Ist das nicht ein Unsinn, daß man hier sitzen soll wegen jar nischt? – Kein' Sonn, kein' Mond scheint 'rin in so 'nen Hof. – Und rings um einen klatschen se und schimpfen! . . . Und keiner versteht was von Bildung . . . Und Vater schimpft und Mutter schimpft . . . Und man näht sich die Finger blutig! . . . Und kriegt fünfzig Pfennig pro Tag . . . Das reicht noch nicht mal zus Petroleum . . . Und man ist jung und hübsch! . . . Und möcht jern lustig sein und hübsch angezogen jehn . . . Und möchte jern in andere Sphären kommen . . . Denn ich war immer fürs Höhere . . . Ja, das war ich . . . Ich hab immer gern in die Bücher gelesen . . . Und wegen's Heiraten! Ach du lieber Gott, wen denn? – So einen Plepejer, wie sie dahinten in de Fabrik arbeiten, will ich gar nich . . . Der versäuft doch bloß den Lohn und schlägt einen . . . Ich will einen feinen Mann, und wenn ich den nicht kriegen kann, so will ich lieber jar keinen . . . Und Kurt ist immer fein zu mir gewesen . . . Da hab' ich keine ruppigen Worte gelernt . . . Die hab' ich hier im Haus' gelernt. Und ich will 'raus hier. Ich brauch' dich überhaupt nicht mit deine Wachsamkeit . . . Mädchen, wie ich, jeht nich unter!« –
Und so ist denn Roberts Bekehrungsarbeit an seiner Familie ganz vergebens. Wohl versprechen ihm seine Eltern, mit ihm auszuwandern nach Indien und die entartete Tochter mitzunehmen; wohl versprechen sie, den Michalskys keinen Einfluß mehr zu gestatten – aber kaum ist Robert ins Nebenzimmer gegangen, um ein wenig zu schlafen, so werden erst Michalskys freundlich empfangen und dann – auch der alte Kommerzienrat Mühlingk. Und hier folgt die krasseste Stelle des 177 ganzen Stückes: Der noble Herr bringt vierzigtausend Mark Geld, und die Familie Heinecke küßt ihm dafür die Hände.
Was hilft es dem armen Robert, daß er den Seinigen ihre schreckliche Handlungsweise klar machen will, sie verstehen ihn doch nicht. Graf Trast kommt dazu, und merkwürdigerweise giebt er Mutter Heinecke die Hand und sucht den empörten Robert zu beruhigen, indem er ihn davon führt. Und im vierten Akt, wieder im Vorderhause angekommen, entwickelt er seine Ansicht über diesen Fall mit folgenden Worten:
Trast. . . . Sag mal, muß ich, der Aristokrat, dich, den Plebejer, Duldung gegen die Niederen lehren? Mein Lieber, verachte die Deinen nicht. Sage nicht, daß sie schlechter sind, als du und ich . . . Sie sind anders, weiter nichts . . . In ihren Herzen wohnt ein Empfinden, das dir fremd ist, in ihren Köpfen malt sich ein Weltbild, das du nicht verstehst. Sie darum verurteilen, wäre vorwitzig und beschränkt . . . Und damit du's endlich weißt, mein Sohn, in dem Kampfe gegen die Deinen bist du von Anfang bis zu Ende im Unrecht gewesen.
Robert. Trast, was sagst du?
Trast. Ich erlaube mir; . . . Du kommst aus fremden Ländern, wo du dich im Verkehr mit Gentlemen neunmal gehäutet hast, und verlangst von den Deinen, daß sie dir zuliebe von heut auf morgen einfach aus der Haut fahren sollen, die ihnen von Anbeginn glatt und schlank auf dem Leibe gesessen hat . . . Das ist unbescheiden, mein Junge . . . Und deiner Schwester ist vom Hause Mühlingk thatsächlich die Ehre wiedergegeben worden, die Ehre nämlich, die sie gebrauchen kann. – Denn jedes Ding auf Erden hat seinen Tauschwert . . . Die Ehre des Vorderhauses wird vielleicht mit Blut bezahlt – vielleicht, sage ich, – die Ehre des Hinterhauses ist schon mit einem kleinen Kapital in integrum restituiert. (Da Robert zornig gegen ihn auffährt.) Iß mich nicht auf . . . Ich bin noch nicht fertig . . . Welchen andern Sinn hätte die Jungfrauenehre, um die es sich hier handelt, als dem künftigen Gatten eine gewisse Mitgift von Herzensreinheit, von Wahrhaftigkeit und Neigung zu verbürgen? Denn nur zum Zwecke der Heirat ist sie da . . . Nun frage gefälligst in der Sphäre nach, der du entstammst, ob deine Schwester mit dem Kapital, das ihr heute in den Schoß fiel, nicht eine weit begehrenswertere Partie geworden ist, als sie jemals gewesen.
Robert. Trast, du bist roh, du bist grausam!
Trast. Roh, wie die Natur, grausam, wie die Wahrheit. Nur die Trägen und die Feigen bauen à tout prix Idyllen um sich herum. Du aber hast mit all dem nichts mehr zu thun, drum gieb mir die Hand, schüttle den Staub der Heimat von den Füßen und sich dich nicht mehr um! –
Allmählich läßt sich auch Robert wirklich zu dieser Ansicht bekehren. Er verzichtet auf ein Duell mit Kurt, um nicht zum Mörder des Bruders seiner Geliebten zu werden; er leiht sich von Trast 40 000 Mark, um sie den Mühlingks wiederzugeben, und wie der junge Kurt ihn gar des Diebstahls beschuldigt, da tritt Eleonore kühn auf seine Seite, und wie Mühlingk sich anschickt, seine Tochter zu verfluchen, da fällt ihm Graf Trast in die Rede mit den Worten:
Nicht doch, Herr Kommerzienrat. – Warum wollen Sie sich mit Fluchen strapazieren? (Leiser) Und übrigens im Vertrauen; Ihre Tochter macht keine so schlechte Partie. Der junge Mann da wird mein Sozius und, da ich keine Anverwandten habe, auch mein Erbe! 178
Mühlingk. Aber – Herr Graf, – warum haben Sie das nicht – – –
Trast. (rasch drei Schritte zurücktretend, die Hände abwehrend) Ihren geehrten Segen erbitte ich schriftlich!
(Folgt den beiden zur Thür.)
(Der Vorhang fällt.)
Am angreifbarsten ist in dem ganzen Stück die Figur des Grafen Trast. Wenn dieser den jungen Heinecke auf das Thörichte eines Duells aufmerksam macht, wenn er darauf hinweist, daß er selber als ein äußerlich Ehrloser innerlich in seiner Ehre sich tadellos rein fühle, so liegt hier wieder ein Widerspruch vor. Graf Trast hat als junger Leutnant gespielt und sein Ehrenwort gegeben, die Schuld zu bezahlen. Daß er sie nicht bezahlen konnte, war nicht seine Schuld, aber – warum gab er jenes Ehrenwort? Er lebte ja selbst aus freier Wahl in Gesellschaft der jungen Spieler, die sich ihren eigenen Ehrenkodex zurecht gemacht haben. Er hatte ja selbst seine Menschenwürde an diesen Kodex angekettet – und er hat diese Gesellschaft nicht verlassen aus freien Stücken, sondern er war von ihr ausgestoßen worden, weil er sein freiwillig auf einen Unsinn verpfändetes Ehrenwort nicht halten konnte – er, der das Halten solch unsinnig gegebener Ehrenworte stets von seinen Kameraden verlangt hatte. – Daß er sich durch diese Ausstoßung nicht hat zur Verzweiflung treiben lassen, daß er ein thätiges Leben anfing und zur Vernunft kam, das war gewiß sehr erfreulich. Wenn er aber jetzt den jungen Renommisten gegenüber sich Gott weiß wie in die Brust wirft als stolzer Ehrenmann, so dürfte er damit schwerlich im Recht sein – denn er ist gewesen, was sie jetzt sind, und er ist dies jetzt nur darum nicht mehr, weil er aus der Gesellschaft gewaltsam ausgeschlossen wurde. Daher ist er denn auch ein Mann, der sich willenlos stets seiner Umgebung überläßt:
Nun pflegt mein Herz stets in dem Takte zu schlagen, welchen die Sitte des Landes verlangt, dessen Gastfreundschaft ich genieße. Denn ich mache mich gern zum Sklaven des Milieus. Im Orient halte ich mir einen Harem, in Italien steige ich bei Mondschein über Gartenmauern, in Frankreich bezahle ich die Schneiderrechnung und – Gott! – in Deutschland weise ich den Rückweg zur Tugend. – Ganz folgerichtig. Im Orient liebt man mit den Sinnen, in Italien mit der Phantasie, in Frankreich mit dem Geldbeutel, in Deutschland aber mit dem Gewissen.
So ist dieser Trast selbst ein blasierter Charakterschwächling, der alles von außen empfängt und die Welt für ein Narrenhaus nimmt, in dem der Vernünftige lächelnd mitspielen muß und nichts ernst nehmen darf. Diesem Typus klatschte das moderne Berlin jubelnd ungeheuren Beifall. Mit Freude erfuhr es von ihm in den Zeiten hochgehender sozialistischer Bewegungen, daß die untersten Klassen überhaupt keinen Ehrbegriff hätten, daß man alle an ihnen begangenen Sünden durch eine verächtlich hingeworfene Hand voll Gold ungeschehen mache, und daß in den glänzenden Salons des Vorderhauses selbst ein Graf, dem einmal ein Loch in das Kleid seiner Ehre gebrannt worden, dieses leicht wieder zudecken könne mit einem Mantel, genäht aus kühn zusammenspekulierten Millionen – und daß das Alles so recht sei.
179 So traf dieser blasierte Salonphilosoph in einem Punkte wenigstens mit dem blamierten »Loth« aus dem »Sonnenaufgangs-Drama« zusammen – beide erkennen sie die Welt als besserungsunfähig – beide verzichten sie auf alle Ideale und ergeben sich blind in ihr Schicksal. –
Immerhin hatte das Lessingtheater mit dem Sudermann'schen Riesenerfolg plötzlich der Freien Bühne den Rang abgelaufen. Hier ging man mit dem Entdecken neuer Talente nicht weiter. Nur mit den beiden Lehrmeistern Hauptmanns entschloß man sich eine Ausnahme zu machen. Die »Familie Selicke« von Holz und Schlaf handelt von einem Beamten, der am Weihnachtsabend vergeblich von seiner Familie erwartet wird. Die Mutter ist um ihr jüngstes todkrankes Kind bemüht; die älteste Tochter zeigt ein gewisses Interesse für einen jungen Theologen, der als Aftermieter bei Selickes wohnt. Die beiden jungen Söhne werden dem Vater entgegengeschickt, um ihn davon abzuhalten, daß er etwa trinken geht – aber vergebens! Dies der erste Akt! – Mit dem erwachenden kranken Kind plaudert in vorgerückter Morgenstunde die Mutter und die Tochter Toni; die beiden Jungen, die sich vor der Heimkehr des betrunkenen Vaters fürchten, werden mühsam zum Schlafen in der Kammer nebenan bewogen; dann kommt polternd und schwankend, mit Weihnachtsgeschenken beladen, der Vater heim; die Mutter reißt vor ihm aus, nach anfänglicher Liebenswürdigkeit beginnt er zu toben, die Tochter beruhigt ihn, und er schläft auf dem Sopha ein. Dann stirbt das kranke Kind, und man weckt ihn und die Söhne mit der Trauerbotschaft. Dies der zweite Akt! –
Die Mutter will verzweifeln, Toni ist ihr einziger Trost, und diese erklärt daher dem jungen Theologen, daß sie nicht seine Frau werden könne, da sie zu Hause als Versöhnerin unentbehrlich sei. Dies der dritte Akt! –
Dies handlungsarme, unendlich wortreiche, unerträglich breite Gemälde stellte natürlich an die Zuschauer ungeheuerliche Anforderungen in Bezug auf Geduld; namentlich, da bei aller Kleinmalerei doch auch hier wirkliche Mannigfaltigkeit fehlte. Auch die Figur eines »ollen Kopelke« bietet so wenig von den Eigenschaften eines Originals, daß sie zum Schatten verblaßt, wenn man sie etwa neben Fritz Reuters »Onkel Bräsig« hält. Ja, als – mit absichtlicher Verneinung der Grundregel aller Theatertechnik – dieser »olle Kopelke« am Schluß des Stückes noch einmal erschien, nachdem Toni und ihr Verehrer schon zu entsagen beschlossen hatten, und das letzte Fünkchen Handlung somit verglommen war, da wirkte diese letzte ganz belanglose Szene geradezu qualvoll und konnte jedem Vorurteilsfreien wieder einmal zu Gemüte führen, daß wie jede Kunst, so auch die dramatische gewisse, ihr innewohnende Gesetze hat, deren Aufhebung die Kunst selbst aufhebt.
Die Wirkung der »Familie Selicke« war die geringste von allen. Fontane erkannte in seiner Kritik in der »Voss. Ztg.« an, daß dieses Stück eigentlich das erste ganz neue sei, »wirkliches Neuland«, das zum erstenmal mit aller bisherigen dramatischen Technik zu brechen versucht habe – aber daß dieser Versuch gelungen sei, das vermochte er nicht anzuerkennen. Und das vermochte wohl 180 auch niemand. Selbst Paul Schlenther nicht in seiner Kritik in der Zeitschrift »Freie Bühne«.
Denn auch eine solche gab es nun. Das ungeheure Aufsehen, das die Vorstellungen im Verein »Freie Bühne« in der Oeffentlichkeit erregt hatten, brachte den geschäftskundigen Verleger S. Fischer auf den zeitgemäßen Gedanken, eine Zeitschrift unter dem gleichen Namen ins Leben zu rufen und zum Herausgeber den Mann zu machen, dessen einseitige Thatkraft den Liebhaberverein der Freien Bühne zu einer merkwürdigen litteraturgeschichtlichen Bedeutung erhoben hatte: Otto Brahm. Sein Redakteur wurde Arno Holz. Am 1. Januar 1890 erschien das erste der verhängnisvollen grünen Hefte, eingeleitet durch folgende Worte des Herausgebers:
»Eine freie Bühne für das moderne Leben schlagen wir auf. – Im Mittelpunkt unserer Bestrebungen soll die Kunst stehen; die neue Kunst, die die Wirklichkeit anschaut und das gegenwärtige Dasein. – Einst gab es eine Kunst, die vor dem Tage auswich, die nur im Dämmerschein der Vergangenheit Poesie suchte und mit scheuer Wirklichkeitsflucht zu jenen idealen Fernen strebte, wo in ewiger Jugend blüht, was sich nie und nirgends hat begeben. Die Kunst der Heutigen umfaßt mit klammernden Organen alles, was lebt, Natur und Gesellschaft; darum knüpfen die engsten und die feinsten Wechselwirkungen moderne Kunst und modernes Leben aneinander, und wer jene ergreifen will, muß streben, auch dieses zu durchdringen in seinen tausend verfließenden Linien, seinen sich kreuzenden und bekämpfenden Daseinstrieben. – Der Bannerspruch der neuen Kunst, mit goldenen Lettern von den führenden Geistern aufgezeichnet, ist das eine Wort: Wahrheit; und Wahrheit, Wahrheit auf jedem Lebenspfade ist es, die auch wir erstreben und fordern. Nicht die objektive Wahrheit, die dem Kämpfenden entgeht, sondern die individuelle Wahrheit, welche aus der innersten Ueberzeugung frei geschöpft ist und frei ausgesprochen; die Wahrheit des unabhängigen Geistes, der nichts zu beschönigen und nichts zu vertuschen hat. Und der darum nur einen Gegner kennt, seinen Erbfeind und Todfeind; die Lüge in jeglicher Gestalt. – Kein anderes Programm zeichnen wir in diese Blätter ein. Wir schwören auf keine Formel und wollen nicht wagen, was in ewiger Bewegung ist, Leben und Kunst, an starren Zwang der Regel anzuketten. Dem Werdenden gilt unser Streben, und aufmerksamer richtet sich der Blick auf das, was kommen will, als auf jenes ewig Gestrige, das sich vermißt, in Konventionen und Satzungen unendliche Möglichkeiten der Menschheit, einmal für immer, festzuhalten. Wir neigen uns in Ehrfurcht vor allem Großen, was gewesene Epochen uns überliefert haben, aber nicht aus ihnen gewinnen wir uns Richtschnur und Normen des Daseins; denn nicht wer den Anschauungen einer versunkenen Welt sich zu eigen giebt, – nur wer die Forderungen der gegenwärtigen Stunde im Innern frei empfindet, wird die bewegenden geistigen Mächte der Zeit durchdringen, als ein moderner Mensch. – Der in kriegerischen Tagen das Ohr zur Erde neigt, vernimmt den Schall des Kommenden, noch Ungeschauten; und so mit offenen Sinnen wollen auch wir inmitten einer Zeit voll Schaffensdrang und Werdelust dem geheimnisvoll Künftigen lauschen, dem stürmend Neuen in all seiner gärenden Regellosigkeit. Kein Schlagbaum der Theorie, kein heiliggesprochenes Muster der Vergangenheit hemme die Unendlichkeit der Entwickelung, in welcher das Wesen unseres Geschlechtes ruht. – Wo das Neue mit freudigem Zuruf begrüßt wird, muß dem Alten Fehde angesagt werden, mit allen Waffen des Geistes. Nicht das Alte, welches lebt, nicht die großen Führer der Menschheit sind uns die Feinde; aber das tote Alte, die erstarrte Regel und die abgelebte Kritik, die mit angelernter Buchstabenweisheit dem Werdenden sich entgegenstemmt – sie sind es, denen unser Kampfruf gilt. Die Sache meinen wir, nicht die Personen; aber wo immer der Gegensatz der Anschauungen die Jungen aufruft gegen die Alten, wo wir die Sache nicht treffen können, ohne die Person zu treffen, wollen wir mit freiem Sinn, der ersessenen Autorität nicht unterthan, für die Forderungen unserer Generation streiten. Und weil denn diese Blätter dem Lebenden sich geben, dem, was wird und 181 vorwärtsschreitet zu unbekannten Zielen, wollen wir streben, zumeist die Jugend um uns zu versammeln, die frischen, unverbrauchten Begabungen; nur die geblähte Talentlosigkeit bleibe uns fern, die mit lärmenden Uebertreibungen eine gute Sache zu entstellen droht; denn gegen die kläglichen Mitläufer der neuen Kunst, gegen die Marodeure ihrer Erfolge sind wir zum Kampfe so gut gerüstet, wie gegen blind eifernde Widersacher. – Die moderne Kunst, wo sie ihre lebensvollsten Triebe ansetzt, hat auf dem Boden des Naturalismus Wurzel geschlagen. Sie hat, einem tiefinneren Zuge dieser Zeit gehorchend, sich auf die Erkenntnis der natürlichen Daseinsmächte gerichtet und zeigt uns mit rücksichtslosem Wahrheitstriebe die Welt wie sie ist. Dem Naturalismus Freund, wollen wir eine gute Strecke Weges mit ihm schreiten, allein es soll uns nicht erstaunen, wenn im Verlauf der Wanderschaft, an einem Punkt, den wir heute noch nicht überschauen, die Straße plötzlich sich biegt und überraschende neue Blicke in Kunst und Leben sich aufthun. Denn an keine Formel, auch an die jüngste nicht, ist die unendliche Entwickelung menschlicher Kultur gebunden; und in dieser Zuversicht, im Glauben an das ewig Werdende, haben wir eine freie Bühne aufgeschlagen für das moderne Leben. –«
Für das moderne Leben – nicht mehr bloß für die moderne Kunst. So lange hatte man von einer »Revolution in der Litteratur« gesprochen. Jetzt schien es fürwahr, als ob eine wirkliche Revolution daraus werden sollte. Denn wie vorurteilsfrei und vielseitig auch die Verheißungen Brahms klangen, die Thaten, die er folgen ließ, zeugten von der Einseitigkeit seines eigenen Wollens; und daß jetzt auch noch die neue Einseitigkeit einer politischen Partei hinzutreten sollte, das zeigte die nächste Theatergründung, die in Berlin unter seiner Mitwirkung entstand. 182