
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
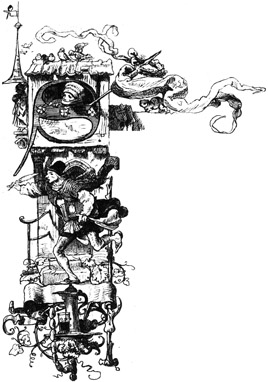
»So sind wir im reinen, ist alles abgemacht und da ist mir ein guter Dienst erwiesen. Hier sind fünf Goldgulden Geldes, die geb' ich Euch zum voraus am ganzen Lohn. Nun macht Euere Sach' gut und verliert den Mut nit!« Also sprach Herr Thoman von Bruckberg. Er saß zu München im Ammerthalerhof, es war im Jahr unseres Herrn 1475, und der, welchem die Rede galt, war einer, der schrieb sich Hans Seibold von Hochstetten.
»Viel Gott's trefflichsten Dank, Herr Ritter! Das macht mir freilich guten Mut«, sagte dieser ganz freudig. »Seit ich lobesamer Klosterschreiber zu Seldenthal war, hab' ich so viel Geld auf einmal nimmer zuhanden bekommen. Will's aber wohl anwenden. Ich sag' Euch, Herr Thoman von Bruckberg seid mir ohne Sorg', da wird keine Zeit verloren. Wie ich steh' und geh', nur mein Ränzlein dazu, dann mach' ich mich auf gen Landshut und müßt's doch ganz schlimm ergeh'n, so ich selbige Hochzeit nicht aufs genaueste beschriebe.«
»Des freu' ich mich und Euerer Lust zur Sache zumal!« war die Antwort. »Aber nehmt es nur nicht zu leicht. Es handelt sich um kein Prälatenessen. Da möchtet Ihr wohl leicht Bericht finden und geben von Keller und Küch'. Aber wo der Kaiser und soviel weltlich und geistliche hohe Herren eintreffen mit all ihrem Gefolge, geht's anders her und nimmt sich der zehnte keine Zeit, Euch Aufschluß und Kunde zu geben. Da kommt Ihr über einer Angelegenheit um die andere, damit ist mir aber nimmer gedient.«
»Dazu möcht' ich schier lachen, Herr Ritter!« fiel Herr Seibold ein. »Ich komm' doch hinter das Geringste. Nichts soll mir entgehen und Ihr sollt mir wohl zufrieden sein, daß Euch bedünkt, Ihr wärt dabei gewesen und hättet Stück für Stück selber gezählt. Ich sag' Euch, da muß Euch jedweds sein' Ort und gutes Verzeichnis haben. Fürs erste, was da an Kaiser, Fürsten, Grafen und Herren, ihren Gemahlinnen, Fräulein und sonstigem Gefolg vorhanden. Da soll nichts fehlen. Zum zweiten, allwo die und die speisen und wo Küche, Keller und Schenke et caetera. Zum dritten, wieviel Hennen, Lämmlein, Gäns', Tauben, Kälber, Schweinlein, Fisch, Krebs und was weiters. Zum vierten, was da derer und wie sie heißen, so vorsteh'n dem Silberzeug, Küch', Keller usw. Aufs fünfte –«
»Wohl, wohl,« unterbrach ihn Herr Thoman, »vergeßt mir aber auch nit, wo getanzt wird, wer da tanzt und wie viele.«
»Das könnt Ihr Euch wohl denken, daß ich auf das nicht vergess'!«
»Und die Geschenke, als an Silber, Gold, Edelgestein –«
»Auch nicht!«
»Rennen, Turnier, Narrenspiel, Streit, lustige Begebnis liegt mir wohl auch an, aber überall könnt Ihr die Augen nit han; mehr frommt mir stets zu wissen, was verzehrt wird. Da laßt Ihr mir aber nichts außer acht, ich sag's Euch, und sei Euch nichts zu gering!«
»Ha, ha, das versteht sich, nichts bleibt aus, Erbsen, Hirs, Wildpret, Zwiebel, Essig, Hacket, Stockfisch, Spezerei, Kaiser- und grobes Mehl, Weinbeer, Mandel, Feigen, item Safran, Zimt, Muskatblüh' und Zucker, ha ha, Herr Ritter, Ihr lacht und meint, da würf' ich alles durcheinander? Laßt mich nur machen, das soll alles in trefflicher Ordnung vor Euch stehn'n. Nun verlaß ich Euch.«
»Halt, daß Ihr mir den Wein nicht vergeßt – nur den nicht!«
»Wo denkt Ihr hin, Herr Ritter, ich soll den Wein vergessen!«
»Und auf den Krug und Humpen will ich's wissen – Wetter, die verdammte Gicht – ha, ha, muß ich alter Gesell daheim bleiben, wann's über des alten Ludwig seinen Wein hergeht! Blitz schlag' das Wetter in zehn Stückfässer, ärger mocht' mir nichts anwerden, denn jetzt das vermaledeite Reißen! Hab's mir aber wohl gedacht: Wie's zum Zechen geht, kommt mir der höllische Fluß in die Füße! Schlag der Satan drein, hätt' Angelegenheit über Angelegenheit und muß da im Liegstuhle Schmerzen beißen, statt kaiserlicher Bissen, und Wasser hinunterwürgen, statt des Weins! Nun, wer weiß, wozu 's gut ist! Ich sag's Euch, Herr Seibold, vergeßt mir nur nicht, was sie Malvasier verschwemmen, Muskatell und Rumanier, habt Ihr gehört, und wie sie dem vom Rhein zusetzen; vom Hofwein will ich auch Bericht, vom Ländischen auch bis zum Magenzwicker, dem von Landshut, ha, ha, und der Met muß auch dabei sein – Kreuz Teufels, ich wollt' – hei, gab's mir eben etliche Riß und Zuck, daß mir der Schweiß auf der Stirn steht – – jetzt geht, und so Ihr Euch nicht mehr hinausseht, wendet Euch nur an den Herzog Christoph, da wird's Euch in aller Art leichter!«
»Blitz Donners, ich bedarf keiner Hilfe!« rief Herr Seibold. »Ficht aus dein' Strauß, bringst Ruhm und Ehr' nach Haus! Ich komm' für mich allein zurecht und das ist mein Stolz – gehabt Euch recht wohl, Herr Ritter!«
»Daß Euch das Wetter! Gehabt Euch recht wohl – und reißt mir schier den Fuß vom Leib!«
Noch eine ganze Zahl lustig grimmiger Flüche ließ Ritter Thoman von Bruckberg ergehen, mittlerweil' sich Herr Seibold von Hochstetten empfahl und von dannen eilte, zum Ammerthalerhof hinaus und weiter in sein Losament. Das war im zweiten Haus links vor der Hochbrücke.
Dort richtete er sein Ränzlein zurecht. –
All dieses geschah zwei Tage vor Sankt Martin. Die Hochzeit aber, von der die Rede, war keine andere, als die des Herzogs Georg von Landshut mit der Hedwig von Polen.
Wie da Herzog Christoph mit dem polnischen Grafen verfuhr, ist schon jedem bekannt.
Nun soll hinwieder zur Nachricht kommen, wie's Herrn Seibold von Hochstetten mit seinem Wagestück erging, bis er alle List, Bosheit und viel Ungemach überwand, sein Mißgeschick in den Sand rannte, also den Sieg davontrug – und der Hochzeit Georg des Reichen ganzen Verbrauch so genau und treu beschrieb, daß nie genauer und treuer etwas beschrieben ward, und sich ganz Land Bayern was drauf zugute tut. Das Verzeichnis, welches Seibold von Hochstetten betreffs des Aufwandes bei Gelegenheit der Hochzeit Georgs des Reichen fertigte, nebst Angabe einzelner beschäftigter Personen ist im Original vorhanden und abgedruckt in Westenrieders Beiträgen.
* * *
Es war ein schöner Morgen.
Herr Seibold hatte zwar verwichenen Abend sein Ränzlein schon zurecht gerichtet, aber es ward wieder zweimal umgepackt, bis alles so lag und steckte, wie es sein sollte.
Dabei blieb es aber noch nicht.
Just hatte er das Ränzlein zum drittenmal geleert und lag alles umher, um wieder anders geordnet zu werden, als Herr Seibold von Hochstetten mit Schrecken sah, daß es Zeit zur Abreise sei. Er packte ein, so schnell er konnte.
In einem Wurf das Ränzlein um, seiner ehrbaren Hausfrau Euphemia Heierlein ein Gottbefohlen in ihre Kammer zugeworfen, drauf die Treppe hinab und eiligst durchs Tal fort und zum Isartor hinaus, damit er den Floß nicht verfehle.
Herr Seibold wählte nämlich den Wasserweg gen Landshut. Der war dazumal vornehm genug. Denn so die Herzoge und andere fürnehme Herren und Frauen gen Niederbayern reisten, setzten sie sich gar oft auf den Floß und schwammen auf der Isar von dannen. Das ist ganz lustig, wann die Sonn' scheint. Sonst aber nicht.
Wie nun Herr Seibold durchs Tal eilte, war ihm ganz glückselig zumut, denn das Reisen war ihm das liebste, und wär's auf ihn angekommen, wär' er auf selbiger Isar fort und fort gefahren »bis zur Donau, auf der weiter bis ins Osterland und zur Stadt Wien, von da durchs Ungarland und weiter bis ins Türkische gen Konstantinopolis. Das kann einer, so er will, und braucht dazu nichts denn Geld und Zeit, Mut aber auch, denn Wirbel und Wasserstrudel gibt's auf dem Weg genug, ungerechnet viel Überfäll', Zauberer, Gespenster und anders Gesind'« – so steht aus alter Zeit geschrieben.
Mit einemmal blieb Herr Seibold wie angewurzelt stehen.
Er hatte geringeres nichts vergessen, als alles. Das war sein Schreibbuch.
Wie der Blitz fuhr er herum und rannte zurück, das ganze Tal bis zur Hochbrücke, über die rechts hinüber in sein Wohnhaus – und über die zwei Treppen hinauf.
Entsetzlich riß er an der Glocke.
Aber Frau Euphemia war schon aus und in die Heilig-Geist-Kirche gegangen, des frömmsten Vorhabens, für Herrn Seibolds Unternehmen zu beten.
Davon wußte er nichts.
Zwei-, drei-, viermal riß er, niemand schloß auf.
»Die Unglückselige, wo ist sie denn hin?!« lallte Herr Seibold von Hochstetten. Er stürmte die Treppe hinab. »Richtig, auf dem Eiermarkt ist sie!« Und eilte rechts hinauf zum Talbruckertor, da hindurch und da war er alsbald auf dem Eiermarkt. Nach allen Seiten flog sein Blick durch das Gewühl von Bäuerinnen, Bürgersfrauen und Dirnen. Dabei strengte er sich gewaltig an. Denn seine Augen waren nicht die schärfsten. Mit einemmal glaubte er sie zu sehen und rief: »Frau Euphemia!« Zugleich tat er einen kuriosen Satz links herüber und schlug zwo ganze Eierstände zu Boden.
»Bitte tausendmal um Vergebung!« rief er. »Alle Wetter, was hab' ich da getan?!«
Mit Entsetzen sah er die Verwüstung und ganz verzweifelt fuhr er sich in die Haare. Aber kaum vermochte er's, denn urplötzlich war er von einer ganzen Schar wohlberedter Weiber umgeben, welche ihren Stimmen in keiner Weise Schranken setzten; nebstdem bemerkte Herr Seibold unter seiner Nase vier ansehnliche Fäuste, welche den zwo Eierständen-Besitzern angehörten, und lauteres, als das Geschrei um Ersatz, hatten des weiland Klosterschreibers Ohren noch nicht vernommen.
Da half kein Beteuern und Bitten. Herrn Seibold wurde keine Erhörung und drauf kaum soviel Raum, daß er gebrochenen Herzens zum Geldkätzlein greifen konnte. Der Schaden betrug das Wenige nicht, gleichwohl reichte es nicht ganz an einen Goldgulden. Aber wechseln, davon war keine Rede, die Zeit drängte – er händigte seinen Goldgulden aus, weissagte genaueste Abrechnung nach seiner Zurückkunft und drängte sich durch die Menge wieder dem Ratturm zu. Denn ihm war eingefallen, wo Frau Euphemia sein könne.
Weit ausholte er mit seinen wegesergiebigen Beinen und in kürzester Zeit befand er sich in der Heilig-Geist-Kirche.
Da kniete sie wirklich am Eisengitter, die Frau Euphemia Heierlein.
»Um's Himmels willen,« raunte er, »kommt, kommt schnell, Frau Heierlein!«
»Ihr seid noch hier, Herr Seibold?« flüsterte sie ganz erschrocken. »Was hat's denn gegeben?«
»Fallt mir nur nicht in Ohnmacht!« entgegnete er. »Es ist nur für mich schrecklich, nicht für Euch – mein Schreibbüchlein hab' ich vergessen!«
»Gleich!« sagte Frau Euphemia. Sie wandte sich aber wieder ab und betete zu Ende. Das war billig nicht zu ändern, und Herr Seibold stand wie auf Kohlen.
Endlich schlug Frau Heierlein in aller Frömmigkeit und ganz langsam das Kreuz, ging an den Weihbronn und benetzte sich. Als wahrhaft frommer Mann folgte Herr Seibold ihrem Beispiel – endlich waren sie außerhalb Heiliggeist.
»Wißt Ihr wohl, für wen ich betete?« sagte Frau Euphemia. »Für Euch!«
»So, für mich? Nun meinen besten Dank! Macht nur um's Himmels willen, daß wir des Wegs weiter kommen, sonst schwimmt mir der Floß von dannen und ich muß bis morgen oder per pedes bis Freising und Landshut. Ich bitt' Euch, eilt, eilt, mein Büchlein muß ich haben!«
»Ei was, müßt Ihr denn gerad' das Büchel haben? Find't ja zu Landshut g'nug!«
»Ja, wenn ich aber in dem Büchlein schon alles in Reih' und Ordnung gebracht hab', daß ich nichts weiter bedarf, denn verzeichnen, wie viel von dem und jenem – versteht Ihr mich denn nicht?«
»Ja, ja, versteh' schon. Wenn's so ist, braucht Ihr's freilich wohl. Aber lauft nicht so, ich geh' mich nicht so leicht, wie Ihr, Herr Seibold von Hochstetten. Wie kommt Ihr nur dazu, was liegen zu lassen, seid doch die Ordnung selber!«
»Und doch, doch! Weiß der Himmel, wie's zugegangen ist; der Mensch verliert halt den Kopf, wenn die Zeit druckt und drängt!«
Mit glaublicher Ungeduld folgte Herr Seibold, vielmehr ging er voraus, um so die Frau Euphemia zu flüchtigerem Schritt anzueifern. Aber sie ging um nichts weniger bedächtig. So kamen sie ans Haus, und als es die zwei Treppen anbetraf, konnte es Herr Seibold kaum erleben, bis Frau Euphemia auf der letzten Staffel war.
Wer wohlbeleibt und in reiferen Jahren, mag nicht so fast leicht Atem schöpfen. So ging's der Frau Euphemia. Sie griff aber doch möglichst bald in die schwarze Ledertasche, den Zimmerschlüssel zur Hand zu nehmen.
»Wo hab' ich denn den Schlüssel?« sagte sie.
»Werdet doch den Schlüssel nicht verloren haben!« rief Herr Seibold voll Entsetzen.
»Wenn er aber nicht drin ist in der Tasche«, entgegnete jene. »Nein, verloren hab' ich 'n nicht. Mir fallt's grad ein. Ich hab' ihn in der Hand getragen und auf den Betstuhl gelegt. In der Heilig-Geist-Kirch' muß er noch liegen.«
»So will ich hinüber und ihn holen.«
Nicht mehr als drei Sprünge über die Treppe tat Herr Seibold von Hochstetten – denn schon er am Ende der Vierziger war, besaß er doch noch ansehnliche Schnellkraft – und unten war er. Soeben wollte er zur Haustüre hinaus, als es ihm von oben nachrief: »Herr Seibold!«
»Was gibt's?«
»Ich hab' ihn!«
»So, Ihr habt ihn!«
In drei Sprüngen war er wieder oben. Frau Euphemia hatte den Schlüssel schon angesteckt, aber das Schloß wollte nicht gehorchen, sondern es knackte und knackte und es war doch nichts.
»Laßt mich aufmachen!« sagte Herr Seibold in tausend Ängsten. Er griff zum Schlüssel und arbeitete überaus heftig am Schloß. Es ging eben nicht, bis er zornig wurde und mit etlichen Kniestößen nachhalf.
»Zerbrecht mir nur die Tür' nicht!« grollte seine Hausfrau.
»Was da, Euere Tür'!« eiferte Herr Seibold. »Von meinem Knie, von Floß und Hochzeit sagt Ihr nichts, gelt! Hinein muß ich, und wenn das ganze Gebäu in Trümmer fällt!«
Endlich gelang es. Das Schloß gab nach und Herr Seibold stürzte mit drei Schritten in sein Losament. Auf dem Fenstersims mußte das Büchlein liegen. Denn auf dem Bett und Tisch war nichts mehr gelegen, das wußte er ganz genau.
Aber auf dem Sims lag auch nichts.
»Ja, was soll denn das sein, bin ich denn blind oder behext!« rief Herr Seibold – und suchte auf Stuhl, Kasten und bis hinters Ofenmäuerlein. Nichts war zu finden, unter, über und im Bett auch nicht. Das durchsuchte er bis in den tiefsten Abgrund, dabei wühlte und arbeitete er alles durcheinander, daß das Kissen auf die Bretter geriet; die Bettdecke lag ganz verwickelt drüber und der Strohsack lehnte zuletzt an der Wand, wie ein schauderhaftes Nachtgespenst.
»Ich bin außer mir!« rief Herr Seibold. »Gott sei dem gnädig, der mir das angetan hat. Das Büchlein hat keiner als der verteufelte Hindlmann oder der Strabler oder der Ringerle, der heillose Schwab, die drei waren gestern abends da und haben mir wieder einen Streich gespielt. Blitz Wetter, so was hat man von seinen Freunden – fragt mich der Ringerle, was es neu's gibt, erzähl' ich mein ganzes Vorhaben und spiel'n mir mittlerweile den Possen mit mein'm Büchlein. Da soll ja doch –«
»Seid nur nicht ungerecht!« fiel Frau Euphemia ein. »Das Büchel muß da sein.«
»Ja, wo denn nachher?«
»Habt Ihr denn im Ränzl schon g'schaut?«
»Im Ränzl? Ja, wie wird's denn im Ränzl sein?! Das ist's ja eben! Da oben hab' ich's gestern zweimal aufgepackt und zum drittenmal hab' ich's vergessen. Wie ich am Isartor war, hab' ich hingegriffen und da hab' ich's gleich gespürt, daß es nicht da sei.«
»Wer weiß, ist's doch im Ränzel«, tröstete jene. »Gebt her, laßt mich seh'n!«
»Nein, sag' ich, Ihr findet nichts! Einer von den dreien hat's!«
»So gebt Euch nur einen Augenblick Ruh'!« Mit prüfender Hand machte sich Frau Euphemia Heierlein an das Ränzl und sagte, am unteren Ende verweilend: »Da spür' ich was. Das muß's sein. Da habt Ihr's hineingepackt, unten, da!«
»Meiner Seel', da ist's!« rief Herr Seibold nach einem raschen Griff am bezeichneten Ort. »Jetzt soll ja gleich – renn' ich wie ein Narr in der Welt herum und such' mein Büchel und hab's schon. Daß Ihr mir dem Ringerle und Strabler nichts sagt und dem Hindlmann, ich sag's Euch, Frau Euphemia, das wär' das Wahre, die lachten mich das Wenige nit aus. Gott befohlen, wenn nur der Floß noch da ist!«
Rasch warf er sein Ränzlein gegen den Rücken, stürzte hinaus, die zwei Treppen hinab, über die Hochbrücke, dann fort, wieder denselben Weg, welchen er kürzlich zurückgelegt hatte und so weiter bis zum grünen Baum.
Als er ankam, war's die höchste Zeit, denn der Floß ging schon ab.
»Halt da!« rief Herr Seibold von Hochstetten. »Halt, sag' ich, da fahrt noch einer mit!«
»Habt Ihr schon bezahlt?« rief's hinter ihm – und eine mächtige Hand schlug ihm nicht allzusanft auf die rechte Schulter.
»Ich werd' schon zahlen!« rief er voll Zorn. Einen sehr großen Sprung machte er, so daß sich Herzog Christoph dessen nicht geschämt hätte – und Floß und weiland Klosterschreiber schwammen selbander von dannen.
* * *
Als Herr Seibold von Hochstetten zu Landshut seinen Einzug feierte, wimmelte es ihm nur so vor den Augen. Denn was erdenklich, das drängte sich lustig hin und her und strömte wieder nach vom Tor her, zu Fuß, Roß und auf Geführten – Bürger und Gesellen, Bauern und Bäuerinnen, alles drauf und dran und durcheinander. Dazu ein Schleppen und Rollen von Körben, Kisten und Fäßlein, hinwieder eine Schar Tiere, die blökten und schnatterten gewaltig, und hinterdrein mit lautem Ruf und geschwungenem Treib- oder Weisestock rotwangige Dirnen, die lachten mit dem ganzen Gesicht, oder stämmige Bursche – kurz, das war ein Getu' und Getreib' vom niedersten bis hoch – denn auch an Rittern, Reisigen, Gesandten und was erdenklich, war die Menge zu sehen, und das wiegt', wogt' und ritt, schritt und drängte durcheinander und war ein Gered', Geschrei und Gelächter, als wären drei Dutzend Jahrmärkte all' mitsamt und auf einmal.
»Da wären wir!« raunte Herr Seibold vor sich hin. »Das ist weiteres kein kleiner Lärmen, aber es tut nichts. Je toller, desto besser. Nur zugetobt, gebraust und hereingefahren, mir soll doch nichts auskommen!«
Er war nah an Sankt Martin, als er in der Ferne Trompetenschall und ungeheueren Jubelruf hörte. Alles drängte sich nach der Gegend und rief: »Der Kaiser, der Kaiser kommt!«
»Der Kaiser –?« rief Herr Seibold von Hochstetten. »Da muß ich auch dabei sein!« Und mitten durch einen rechten Knäul wollte er dringen.
»Was Henkers ficht Euch an?!« donnerte ihn ein scharfer Reitersmann an, dazu gab er ihm einen ansehnlichen Stoß zurück. »Wollt Ihr mehr sein, als andere? Wart, ich will Euch mauerbrechen, unsteter Gierhans!«
»Was bin ich? Ein Gierhans? Ich will Euch wohl sagen –«
Und wieder voraus wollte Herr Seibold.
»Hüt dich und seh hinter dich,« fuhr der andere dazwischen, »sonst schlag' ich dir eins, daß dich der Buckel drei Wochen juckt – was will der Gauch!«
»Bei Sankt Martin, selb solltet Ihr mir büßen,« schnaubte Herr Seibold, »aber ich vergeb' Euch, denn Ihr seid mit Blindheit geschlagen, sonst säht Ihr, daß einen Mann meinesgleichen was anderes treib' denn alleinige Neugier! Ich hab' ganz andere Pflicht und Aufgab', als Ihr meint, Ihr Eisenraßler, habt Ihr mich verstanden, Ihr – Ihr –?«
»Ha, ha, der Gesell gefällt mir! Was Wichtiges denn? Wollt Ihr dem Kaiser sein' Willkomm geben?«
»Das werd' ich Euch nicht auf weiter in Rechenschaft bringen – rührt mich an, wenn Ihr Mut habt, es soll Euch teuer zu steh'n kommen! Donnerwetter, wißt Ihr, wer ich bin? Weg da und Platz gemacht, ich bin Seibold von Hochstetten!« – Und nun am Reiterknecht vorbei und durchgedrängt. Er kam aber nicht weiter, als bis an das nächste Eck. Da ward er beiseite gedrängt und an der Wand schier erdrückt. Gewaltig rumort' und stritt er, aber es half nichts. Er stand wie angemauert, unfähig sein Büchlein aus dem Mantel zu holen, drin er es vor Landshut versenkt hatte, um alles möglichst aufzunotieren, was da einhergeritten käme.
Voraus ritt ein Zug Knappen, vier Trumpeter an der Spitze, drauf Fürsten, Grafen und Herren, dann zog der Kaiser Friedrich daher, ihm zur Seite sein Sohn Maximilian, nächst kamen wieder andere, Fürsten, weltlich und geistlich, und wieder Reisige, es war ein vortrefflicher Zug.
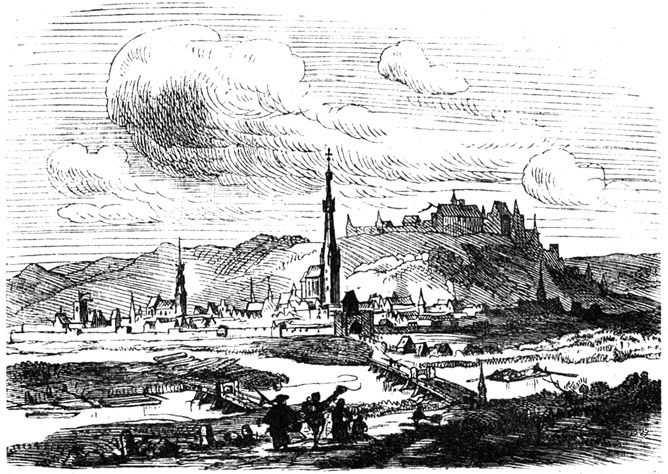
Landshut in alter Zeit.
Unbändiger Jubel brach los, alles wollte nah und näher sein, dabei ersah Herr Seibold seine Gelegenheit, riß sein Büchlein heraus und schickte sich an zu schreiben.
»Was schafft Ihr denn da?« sagte ein schalkhaft schauender, langbartiger Landsknecht. »Kennt Ihr sie denn alle? Ich mag Euch wohl zu Dienst sein!«
»Das soll Euch wohl gedankt sein!« antwortete Herr Seibold freudig und sagte in wenigen Worten seine Aufgabe. »Jetzt kommen die höchsten Herren – also – der Kaiser und der Erzherzog Maximilian, sein allerdurchlauchtigster Sohn – weiter –«
»Der ander' ist der Fürst von Anhalt. Schreibt nur!«
»So der ist's! Hab's schon.«
»Der dort ist der Erzbischof von Milan –«
»Was? Der Erzbischof von Milan! Wie kommt denn der daher?«
»Und der dort ist der Erbkunig von Jerusalem.«
»Was? Ihr wollt mich narren und für Euch soll ich mein Büchlein verklexen?!«
Hellauf lachte der Landsknecht und spottete: »Da schaut mir das Schreibervölklein! Narren soll Euch jedweder!«
Dabei ließ er sich weiter und beiseite schieben.
»Ha, du verdammter Lügenbot'!« zürnte Herr Seibold und wollte ihm nach.
»Bleibt, bleibt!« sagte einer hinter ihm, »das ist der lange Schramm mit dem Lüg- und Spottmaul, dem darf keiner was arg nehmen. Ich will Euch besser helfen!« –
»Lügt Ihr mich etwan auch an?« fiel jener ein. »Ihr seid auch solch ein Raßler. Aber ein ehrliches Gesicht habt Ihr. Meinetwegen. Wer war der hinter des Kaisers Sohn?«
»Der Herzog von Sachsen.«
»So – und der andere?«
»Das war der Bischof von Brixen.«
»Das laß ich mir ehender gefallen – Bischof von Brixen – und der nächst'?«
»Das ist der von Anhalt.«
»Der von Anhalt – weiter, der Dicke?«
»Das ist der Kunig von Cypria.«
»Was? Der Kunig von Cypria – Ihr wollt mich desgleichen narretei'n?!«
Der Landsknecht lachte und alles, was nahe war, lachte mit, in kurzem war der Zug vorüber und hinterdrein drängte die Menge, mitten unter ihr der Landsknecht.
»Das fängt gut an!« stammelte Herr Seibold von Hochstetten. Fort machte er sich, etliche Schritte weit, dann stand er still. »Wo will ich denn hin? Richtig, zum Herrn Gottfried Brunner. Der wird etwan nicht zu Hause sein. So versuchen wir's, er wird mich mit Freuden aufnehmen, so daß ich eine freie Herberg' hab' – wo wohnt er denn gleich? Richtig, dort unterhalb –.« Dann rasch, soviel möglich, weiter und um ein Eck und noch eins. Als er in die Gasse lenkte, waren der Leute weniger da.
»Ist das nicht – jawohl, er ist's!« raunte er vor sich hin. Mit etlichen Sätzen war er über der Gasse drüben. »Da ist er – wie er schau'n wird, wenn er mich zu Landshut erblickt! Den will ich weidlich überraschen – Gott zum Gruß, Herr Brunner!« Dazu gab er dem Manne einen leichten Schlag auf die Schulter.
Der wandte sich, sah ihn mit grimmigen Augen an und rief:
»Was soll's? Wer seid Ihr? Was wollt Ihr?«
»Ich –? Wer bin ich? Was seh' ich, seid Ihr nicht Herr Gottfried Brunner!« lallte jener. »Da bitt' ich Euch tausendmal um Vergebung. Bei allen Heiligen, ich hielt Euch für einen anderen, sonst hätt' ich Euch nicht berührt!«
»Das dank' Euch der Satan!« fuhr ihn der andere an. »Schert Euch Euerer Wege und seht ein andermal besser zu, sonst kommt Ihr mir so leichten Kaufs nicht weg! Ihr mögt auch sonderliche Freunde haben, daß sie solche Schläge hinnehmen.«
»Aber seid nur nicht so herb, ehrenwerter Herr!« gab Herr Seibold zurück. »Tut Ihr doch, als hätt' ich Euch mit dem Beil hinaufgeschlagen, es war ja nur ein lustig-freundliches Tätschlein.«
»Das wär' mir das rechte Tätschlein!« polterte der andere drauf. »Nennt Ihr das ein Tätschlein?« Dazu erwiderte er auf Herrn Seibolds Schulter, was jener der seinen hatte angedeihen lassen.
»Hei, Donners Blitz, so war's nicht!« rief Herr Seibold. »Das verbitt' ich mir! Das könnt' ich für eine absichtliche Beleidigung annehmen, versteht Ihr, wenn ich nicht sähe, daß Ihr ungemein gereizt seid. Also mag ich's Euch verzeihen, und damit Ihr aus Euerem Zorne herauskommt und ohne Groll von mir scheidet, will ich Euch noch was entdecken. Ich war selbst in großer Aufgeregtheit und sozusagen Verwirrung. Abgesehen davon, daß ich ein kurzes Gesicht habe. Also hört nur –«
»Was soll ich da lang' hören, wo ich seh'!« fiel der andere ein. »Da bedarf's nicht viel Erkennens, daß Ihr ein homo confusus seid!«
»Was, einen homo confusus nennt Ihr mich? – Ich sag' Euch, beleidigt mich nicht, sonst will ich Euch mit meinem Stoßdegen beweisen« – dabei schlug er an die Seite.
»Recht so,« fuhr jener auf, »nur gleich mit zur Stadt hinaus, ich will Euch fuchteln, daß die Federn davonfliegen!«
Dazu schlug er gleichfalls an die Seite.
»Aber seid nur nicht so toll!« rief Herr Seibold. »Tut Ihr doch, als gäb' es kein weiteres Verständigen, als die Stoßwehr. Hab' ich denn gesagt, daß ich schon beleidigt bin, ich verwahrte mich nur! Hört mich nur an, sag' ich, vielleicht werden wir noch die besten Freunde und zuletzt seid Ihr noch eines Tages stolz darauf, mich zu kennen, wann mein Büchlein in der Welt ist, daß Ihr sagen könnt, ich sei Euch keineswegs fremd.«
»Was für ein Büchlein ist das, homo confusissime?«
»Donners Blitz! homo confusissime sagt Ihr? Jetzt macht Ihr mich aber bald falsch! Doch ich seh', Ihr kennt mich nicht, ahnt nicht, was mir bei so trefflichem Unternehmen gleich beim Beginn widerfahren ist – ich sag' Euch, bei einem Unternehmen hie zu Landshut, daß es schier ein wichtigeres nimmer gibt!«
»Was da, kein wichtigeres!« fiel jener ein. »Ihr werdet wohl kein wichtigeres haben, denn ich!«
»Könnte doch wohl sein, hört mich nur erst an! Ich hab' nichts Geringeres vor, denn sämtlich Vorkommen, Kaiser, Fürsten und all' andere Personas, Essen, Trinken, Losament, gold- und silberne War' – das muß ich sämtlich beschreiben und in Verzeichnis bringen.«
»So, das müßt Ihr schaffen« – sagte jener um vieles freundlicher; »nun, und was habt Ihr denn schon von allem dem?«
»Ei, noch gar nichts, nicht das mindeste. Aber morgen mit dem frühesten will ich beginnen und es soll mir kein Weg zu weit, keine Tür verriegelt sein!«
»Das läßt sich wohl hören. Und wo beginnt Ihr? Bedünkt mich doch, Ihr müßtet voraus guten Bescheid haben, etwan viele Leute kennen, von denen Ihr Aufschluß erhaltet.«
»Ob ich Leute kenne, ei freilich, Ehrsamster!« sagte Herr Seibold, sehr froh über die eingetretene Ruhe und Freundlichkeit. »Seht, da hab' ich's ganz pfiffig angegangen. Hier hab' ich mein Büchlein, da ist schon so aufs nächste hin alles und jedwedes in genere verzeichnet, was Titul oder Namen anbetrifft, so daß ich die Quanta und was sonst nur hinschreiben darf.«
»Ei, das habt Ihr verzweifelt gut erdacht!« sagte der andere und blätterte. »Führwahr, all' das könnte besser nimmer angelegt sein – hm, hm, hm, – Kaiser, fremde, hohe Herren, so einreiten – weltlich, geistlich – Fürstenküche – hohes Mahl – Schenken – von dem, wo die Fürsten, Grafen, Herren und ihre Frau'n ihre Herberg' han!«
»Aber die Hauptsache, seht da –«
»Ganz richtig – von denen Zufuhren – seht doch, ein Artikel um den andern – was habt Ihr doch Euere Gedanken auf alles gerichtet!« –
»Das soll Euch soviel nicht in Wunder nehmen,« fiel Herr Seibold ein, »wär' nicht übel, so ich keine Kenntnis von all einzelnem hätte. Ihr wißt eben nicht, daß ich bis vor unlängst wohlweiser Klosterschreiber zu Seldenthal war. Nun gab's da Streit mit etlichen geistlichen Oberen; dacht' ich mir, gehst, willst eine andere Klosterschreiberei, find't sich gleich wieder was – tut aber vorerst nicht so fast Not, Ehrsamster, und verdienen uns so auch ein ehrlich Auskommen, dabei sind wir ein freier Mann, verstanden?«
»Ich versteh',« sprach jener, indem er sich ein wenig verbeugte, »hätt' ich gewußt, wen ich vor mir hab', wär' der Streit und Kampf nicht so hoch angewachsen, wohlweiser Herr – wie heißt Ihr doch –?«
»Seibold von Hochstetten, Euch zu dienen –«
»So, Seibold von Hochstetten, da seht doch, von Euch hörte ich schon mehrmals sprechen – ei, ei, das Unternehmen ist ja ganz trefflich und das Büchlein ganz ruhmeswert. Seht nur, seht nur – von denen Zufuhren am Lebendigen – Früchte – Schweinlein – Kälber, Schaf – Gäns', Hennen und Göcklein – Kräutl-War – und da wieder alle Arten Gewürz – seht doch, und hier wieder Silberzeug, Edelfrauen, Reisige« – er blätterte fort – »Futterzettel, Brennholz – Wein, richtig, ein jeder aufgezählt, ich sag' Euch, Herr Seibold von Hochstetten, darin und in allem seh' ich nichts von einem homo confusus –«
»Oder gar von einem homo confusissimus!« rief Herr Seibold ganz heiter. »Seht nur auch, was es da mit denen Leuten vel personis gut beschaffen ist, die mir Aufschluß geben können.«
»Ist schon wahr, selb gefällt mir noch aufs allerbeste. Herr Ebran beim ersten Keller. Ei ei, vom Herrn Lizentiaten Löffelholz wißt Ihr auch! Seht, von dem hab' ich jetzt rein nichts gewußt! So so, der Siegmund Layminger hat das zu besorgen – und den Herrn Leo Hohenecker habt Ihr auch erkundschaftet. Meiner Treu', ich sag' Euch, wohlweiser Herr von Hochstetten, wer das Büchlein hat, kann nimmer fehlgeh'n!«
»Freilich nicht! Und ich will Euch nur sagen, es stünde auch schon etwas weiteres drin, da bei Kaiser und Fürsten, wie sie einritten – aber da kamen ein paar freche Reitersleute über mich, die taten dergleichen, als kennten sie jeden, der da einherreite, und nennen mir die Gesellen ganz falsche Namen und Personals, als den Erzbischof von Milan, gar den Erbkunig von Jerusalem und den von Cypria, ich bitt' Euch, Ehrsamster! Da soll's doch gleich mit Keulen dreinschlagen in die kecke Soldiererbrut, die gewehrten Streuner die, es ist doch über alle Maßen! Jetzt mag ich schau'n, daß ich die Eingerittenen wieder ergründ', davor hätt' ich sie vor Augen gehabt und wär' nun alles in Richtigkeit.«
»Wann sonst nichts fehlt, mag ich Euch gerne dienen,« sagte jener, »ich hab' sie da auf ein Zettelein geschrieben. Gebt mir Eueren Rötelstift, der meine ist mir verloren gegangen, ich will sie Euch sämtlich hereinsetzen.«
»Ihr wolltet Euch selbst bemüh'n –«
»Ja, ich selbst; war ich fein unartig mit Euch, ist's nit mehr denn billig, daß ich's gut mach'. So! Seht Ihr, zuerst – der Kaiser. Ihm zur Seite sein Sohn Maximilian. Nächst kommt Markgraf Albertus – weiters und mit ihm Herzog Siegmund von Österreich.«
»Das laß ich mir gefallen. Die hätten wir also!«
»Die hätten wir! Auf die voraus kommt's nicht so fast an. Hinter den Vieren aber kam –«
»Den weiß ich, Herzog Jörg, der Bräutigam –«
»Ganz wohl, und der ihm zur Linken war der Graf von Württemberg.«
»So, der war's?«
»Ja, der und kein anderer. Nächst kam der Pfalzgraf Philipp – und mit ihm der Markgraf Friedrich von Brandenburg. Die anderen sind wieder nur so Grafenleute und Herrenvolk, das nähm' kein Ende. Seht Ihr, Herr Seibold von Hochstetten, nun haben wir das in bester Ordnung, das andere wird sich schon finden. Und damit viel Dank.« Dabei steckte er das Büchlein zu sich und den Rötelstift auch.
»Ha, ha, nun seid Ihr der homo confusus, Allerehrsamster,« sagte Herr Seibold, dem nichts Arges träumte; »wollt Ihr mir wohl mein Büchlein geben?«
»Was homo confusus, was Büchlein?« fuhr ihn jener an. »Ich frag' Euch, wollt Ihr mich endlich meines Weges zieh'n lassen?«
»Ja, was soll denn das bedeuten?« rief Herr Seibold. »Zieht, wohin Ihr wollt, aber habt die Gunst und seid mir mit meinem Eigen zu Diensten – ich will mein Büchlein!«
»Was habt Ihr denn stets mit Euerem Büchlein?« polterte jener. »Ihr kecker Geselle! Laß ich mir da in Herablassung etliche Namen sagen, schreib' sie selbst ein und will er tun, als gehörte das Geband sein. Macht, daß Ihr Euerer Wege trollt oder ich mach' Euch mit dem Stoßdegen Füße, Ihr überlästiger Gauch, am Ende ist das alles unwahr, was Ihr mir angegeben!«
»Ich Euch angegeben!« rief Herr Seibold. »Und das Büchlein Euer – da steht mir ja der ganze Verstand still. Ihr wollt's nicht herausgeben? So sollt Ihr's vor Gericht ausfolgen lassen, Ihr Ungeheuer von einem Falschspinner, so was ist mir doch noch nie begegnet! Wie könnt Ihr behaupten, daß das Euer Büchlein sei?«
»Schreit nur nicht so fast,« höhnte der andere, »behaupten oder nicht, mein oder nicht, das ist mir ganz gleich. Verklagt mich, wo Ihr wollt, ich will Euch wohl schlagen!«
»Und mit was wollt Ihr mich schlagen?«
»Mit dieser meiner Schrift«, fiel jener ein. »Ihr habt mir für gutes Geld die Titul alle hereingeschrieben, ich aber füll' sie aus, sämtlich diese Seiten und Reihen, versteht Ihr mich nun? Da streitet bis zum Jüngsten Tag! Ha, ha, Euere Müh' soll mir wohl frommen!«
»Habt Ihr denn den Teufel im Leib? Was wollt Ihr mit all dem?«
»Ah, das ist eine vernünftige Frage« – spottete der andere, »das will ich Euch wohl sagen. Wißt denn, daß ich ganz die gleiche Aufgab' und Absicht hab', wie Ihr. Deshalb bin ich hie zu Landshut und wovon ich keinen Bescheid hatte, das find' ich da in dem Büchlein trefflich gedeutet. Also nütz' ich's, und so Ihr mir in den Weg tretet, nehmt Euch in acht vor mir, denn ich machte keiner Zeit einiges Federlesen mit solchen, die mir den Pfad verrennen und mich von meinem Ziel abschneiden wollen!«
Dabei schlug er wieder gewaltig auf den Stoßdegen, riß ihn dann zur Hälfte heraus und ging lachend rasch davon.
»Halt, du verdammter Räuber!« rief Herr Seibold und stürzte nach, durchs Bauernvolk durch, so sich angesammelt hatte.
Just kamen etliche pfälzische Soldknechte daher.
»He da! holla Blitz Donnerkeil! was soll's da?« fragte der erste.
»Ihr seid es, Hollerausch!« entgegnete Herrn Seibolds Feind und gab ihm einen Wink – »ich weiß nicht, was der Geselle will, oder hat er den Verstand verloren? Dies mein Büchlein will er, drein ich die Hochzeit verzeichnen soll für den König von Böheim!«
»Das sollt Ihr?« Und die Reisigen gleich über Herrn Seibold her.
»So hört mich nur an,« rief dieser, »es ist ja nicht sein, sondern mein! Wenn Ihr ehrliche Kriegsleute seid, helft mir den Mann vor den Vogt zu bringen. Ich steh' für mein Sach', er muß herausgeben!«
»Wohlan denn, Herr Seibold,« polterte sein Feind, »aber nehmt Euch in acht, daß Ihr nicht mit Spott davonkommt!«
»Das wollen wir schon sehen, mir nach!«
Und voraus, des Weges kundig, Herr Seibold von Hochstetten, aber seinen Gegner nicht aus den Augen lassend, dabei in größter Wut – denn jener und die Reisigen schlugen zu öftesten Malen auf die Schwerter, so daß die Leute glaubten, sie brächten Herrn Seibold vor den Vogt, nicht aber er sie.
Griesgrämig wie ein Löwe saß der Vogt da.
»Brrr! was ist los!« schnaubte er. »Wer seid Ihr? Euch, Herr Seibold, kenn' ich von früherer Zeit! Brrr!«
»Wer ich bin?« antwortete Herrn Seibolds Feind. »Ich bin Pankratius von Znaim, des Pfalzgrafen Philipp Narr und Gaukler, berufen und erlaubt zu allen lustigen Streichen.«
»Was! des Pfalzgrafen Narr und Gaukler?« sagte Herr Seibold voll Schrecken.
»Ja der bin ich,« war die Erwiderung, »wessen Narr aber seid Ihr, daß Ihr mich vor den Vogt zieht und hab' ich Euch nichts getan! Herr Vogt, mit dem Mann steht's nicht richtig oder tratzt er mich. Er sagt, ich hätt' sein Büchlein, drein er der Hochzeit Verbrauch und auch Vorrat aufschreiben will, und ich weiß von nichts!«
»Wie könnt Ihr doch so reden, Herr Narr?!« erwiderte Herr Seibold. »Da hilft Euer Leugnen und Beteuern nichts, Ihr habt mir das Büchlein geraubt. Kehrt nur Eueres Mantels Tasche von innen nach außen, so Ihr den Mut habt!«
»Das mag ich wohl.« Und sogleich leistete jener Folge.
Da war nichts zu sehen. »Nun aber kehrt Ihr Eueres Mantels Tasch' von inn' nach außen, da wird sich zeigen, wer von uns zweien der Schelm und Tratzer ist. Seht Ihr, da ist Euer Büchlein, Ihr habt's bei Euch und werft mir Böses vor!«
»Das – das begreif' ich nicht!« lallte Herr Seibold. »Wie kam's denn da hinein?«
»Das weiß ich nicht, wohl aber weiß ich, daß Ihr sicher nicht minder gaukeln könnt denn ich, wo nicht gar zaubern. Denn Ihr habt mir all meine Bäll', Becher und Zingel geraubt, und ich hab' nichts bemerkt bis jetzt. Nur heraus damit!«
»Seid Ihr bei Trost, ich Euch Bäll' und Zingel rauben?«
»Das hilft Euch nichts und kein Sträuben! Auf da den Mantel! Seht Ihr, da stecken sie schon.«
Unter großem Gelächter der Umstehenden warf er sein Narrenwerkzeug auf den Tisch, eines ums andere. Wenn es schien, er sei zu Ende, fand er immer wieder etwas und stets Neues. Zuletzt holte er ganze Hände voll Federn aus des Klosterschreibers Sack und immer mehr, als wie von zehn gerupften Gänsen.
»Jetzt halt' ich's nimmer aus!« rief Herr Seibold. »Weg da, weg!« Und wollte hinausstürzen.
»Halt!« rief des Kaisers Narr. »Meine Äpfel will ich!«
»Was für Äpfel?« donnerte Herr Seibold, auf den Mantel schlagend. »Da ist nichts mehr drin, als mein Büchlein!«
»Wie könnt Ihr so unchristlich lügen?!« Und alsbald griff der Narr mit der Hand unter Herrn Seibolds Mantel und schüttelte ihm an ein Dutzend Äpfel aus der Tasche.
Ein mächtiges Gelächter erhob sich aufs neue.
Hinaus wollte Herr Seibold von Hochstetten. Aber an der Türe hielt er still und rief: »Ich hab' genug von Euch erduldet. Jetzt sagt mir dafür, ist das mit dem Einzug richtig oder habt Ihr mich auch angelogen und betrogen?«
»Das ist echt und wahr!«
»Gott sei Dank! Und Ihr habt nicht gleiche Aufgabe, wie ich?«
»Davor seid Ihr sicher,« war die Antwort – »aber ein anderer ist hier.«
»Blitz Donners, ist das wahr?«
»Wenn ich's Euch sage! Heinz von Höhenrain heißt er.«
»Heinz von Höhenrain! Also doch noch einer außer mir! Das ist ja zum Verzweifeln! Der macht mir die Leute maßleidig. Hab' ich soviel zu fragen, nun fragt der auch noch. Aber ich will ihm schon zuvorkommen. Der soll mir nicht Herr werden, und wie ich im Büchlein, hat er's sicher nicht in Richt und Ordnung!«
Er wandte sich und wollte fort.
»Halt, nehmt's doch mit Euer Büchlein!« rief der Narr.
»Ich hab's ja!«
»Was denkt Ihr! Da oben liegt's.«
»Wo liegt's, wo oben? Meiner Seel'!« Einen Satz in die Luft machte Herr Seibold, griff nach seinem viel strittigen Heiligtum und unter Jubel und Gelächter aller rings flog er zur Türe hinaus – hinab die Treppe und fort auf Herrn Gottfried Brunners Behausung zu.
Der war daheim und empfing ihn voll Freude des Wiedersehens. Herr Seibold aber erzählte ihm, was ihm seit kürzester Zeit seiner Ankunft begegnet sei und was er vorhabe.
Als jener alles gehört hatte, sagte er: »Ei, ei, Ihr wollt die Angelegenheit zu Landshut in Verzeichnis bringen?«
»Nun, was findet Ihr da sonderliches daran?«
»Nichts Sonderliches in der Angelegenheit selbst, aber es ist doch im Grund' schlimm beschaffen – ei, ei, selb ist mir gar nicht lieb.«
»Ich versteh' Euch nicht, was schadet's Euch?«
»Schaden, wißt Ihr, was schaden heißt, das eben nicht, indessen, was man so angefangen hat, laßt einer just nicht gerne liegen.«
»Ja, was habt Ihr denn angefangen? Ich stör' Euch sicher in nichts. Ich bin den ganzen Tag nicht daheim.«
»Ihr versteht mich noch immer nicht, die Sach' ist ganz anders und so. Selbiger Herr Thoman von Bruckberg hat mir den gleichen Auftrag gegeben. Als er hier war, war er schon zum voraus auf die Hochzeit geladen. Da sagt' er mir, jede andere Zeit wär's ihm gelegener gewesen; denn er fürchte, sein Zipperlein stelle sich bald wieder ein. Und da ließ er sich heraus, was lieb es ihm wäre, so ich ihm diesesfalls alles aufs genaueste in Verzeichnis und Beschrieb brächte. Nun hat er drauf vergessen, wie mich bedünkt –«
»Aber wa– was ist denn da zu tun? Nun, das ist ein schöner Wirrwarr, ich bin da und will aufzeichnen, dann ist einer da, der heißt Heinz von Höhenrain, sagt des Pfalzgrafen Narr – und nun Ihr auch noch! Aber wie mag ich fragen, Ihr habt den ersten Auftrag erhalten, demnach seid Ihr von uns zweien im bessern Recht.«
»Nein, Ihr habt's,« sagte Herr Brunner, »und Ihr sollt es haben. Ich bedarf des Geldes keineswegs, auch lautet Euer Auftrag bestimmter, denn der meine. Also schafft drauf los, und was ich Euch dienen und nutzen kann, das soll geschehen. Seht, da hab' ich schon mehreres verzeichnet, das dürft Ihr getrost einschreiben.«
»Ihr großmütiger Mann,« rief Herr Seibold von Hochstetten, »Ihr allertrefflichster Biedermann, laßt Euch umarmen!«
Er flog an Brunners Hals.
»Schon gut, schon gut,« sagte dieser, »bringt mich nur nicht um – und seht nur zu, daß Euch der Herr Heinz von Höhenrain nit mehr im Weg umgeht, als ich. Hab' selbst von ihm gehört, denn schreit er doch schon zwei Tage lang umher und verkündet allerorten sein Vorhaben. Er soll ein verwünscht zudringlicher, scharfer Geselle sein. Ich sag's Euch, habt wohl acht! Wann er eifersüchtig wird, ist er zu allem fähig – so kenn ich mich in ihm aus, ich hab' ihn nur einmal reden gehört. Morgen stellt Ihr Euch sogleich dem Landschreiber vor – davon sprechen wir noch – jetzt aber kommt und setzt Euch, Ihr müßt Euch ein weniges letzen!«
»Macht nur keine Umstände! Es hungert mich nicht so gewaltig – ha, ha, meint Ihr wohl, weil ich so gehetzt worden bin –?«
»Wohl wohl, Herr Seibold – he da, Winfriedl, trag 's Essen 'rein! Ihr kommt grade recht, Herr Seibold, ich kam erst nach Haus', da bin ich eine Stunde später dran als sonst – Winfriedl, 's Essen bring'« – Herr Brunner öffnete die Türe, dabei er mit dem halben Kopf hinaussah – »und einen Humpen Doppeltes – halt, Winfriedl!«
»Was?«
»Mir auch einen Humpen. Hast gehört – und gleich bringst du 's Essen!« Er schloß die Türe. »Erwartet nichts Besonderes, Herr Seibold, Rubenbrüh und ein Stück kalt Lämmernes, das ist das Ganze.«
In kurzer Zeit saßen Herr Brunner und Herr Seibold von Hochstetten beisammen. Herr Seibold bedurfte keiner großen Mahnung zuzugreifen und in Sachen des Doppelten ließ er es so wenig als sein Freund gebrechen, so daß der Winfriedl in Verlauf etlicher Stunden dreimal in das Kellerlein mußte. Darin lag Doppeltes in Fülle und Hülle.
* * *
Es schlug eben sechs Uhr, da war Herr Seibold schon auf den Beinen. Er hatte sich keine Zeit genommen, einen Morgenimbiß zu verzehren, sondern führte ihn mit sich. Das war ein Stück Lämmernes vom verwichenen Abend und ein Stück Brot.
Sein ganzes Herz schwamm in Freude und sein ganzer Sinn war voll Begierde nach Erfüllung übernommener Pflicht. Herr Gottfried Brunner hatte ihm auch neuen Mut verliehen, denn was immer Herr Seibold zu München ermessen konnte, war zwar treulich aufgegriffen worden – aber Herr Brunner wußte wieder weit mehr. Da waren nun schon die wichtigsten Dinge in das Büchlein eingetragen, die unabweislich zum Ziele führen mußten. Selbes Büchlein schlug Herr Seibold seelenvergnügt auf, während er den Herrn Resch aufsuchte. Der war hochansehnlicher, neuamtierender Landschreiber und hatte stetige Nachricht von allem, was von den Dörfern herbeigeschafft wurde. Was bisher zugefahren und getrieben, das wußte Herr Seibold von seinem freundlichen Herbergvater; nun galt es nur, von heute morgen an zu rechnen. Sämtliches wollte er sich vom Landschreiber zu zwei Zeiten des Tages erbitten, mittlerweil' aber all' anderem nachspüren. Dazu hatte er eben treffliche Fingerzeige erhalten. Er wußte, daß zum Tanzhaus die Ratsstube bestimmt und um ein mächtiges vergrößert worden sei und wer mit weiterer Ausschmückung allerart betraut gewesen. Desgleichen, daß Herr Friedrich von Helfenstein und Johann von Frauenberg den Tanz zu ordnen hätten. Durch die zwei konnte er unsäglich Vieles und Wichtiges erfahren, was sonst unergründlich blieb. Daß die fremden Grafen reiche Geschenke bekämen, war sicher. Also erschien es Herrn Seibold äußerst willkommen, auch die Namen der Herren erfahren zu haben, so mit der Hedwig von Polen gekommen. Die waren, als die vornehmsten, die Grafen von Lublin, Ostrorog, Sinoviz und Monawit. In betreff der Goldschmiede, bei welchen eingekauft werden könnte, hatte er auch Bericht. Die waren Heinrich Kessel von Köln am Rhein, der vielberühmte Herwart von Straßburg und Herr Peter von Linz. Weitere Specialia waren nicht minder willkommen, und da hatte sich herausgestellt, wer die Speisen zu des Kaisers Tafel trage. Hierzu waren bestimmt: Pfalzgraf Philipp, Markgraf Friedrich von Brandenburg und etliche andere; Graf Ulrich von Württemberg aber hatte das Vorschneideramt. Was die Fürstentische anbelangt, fehlte es Herrn Seibold wieder nicht in seinem Büchlein. Deren waren sechse, sonderlich zwei des Kaisers und der Braut Herzogs Georgs, der Hedwig. Weiters, wo das hohe Mahl genommen werde – das war in der Hofgerichtsstube – und wie da alles gülden ausgeziert und mit ausnehmend kostbaren Teppichen verziert sei. Nächst, wie der Braut Mahl in des Oberndorfs Haus stattfinde – da sei ihre Herberge. Und so mehr. Das war freilich alles in schlimmer Ordnung angegeben worden und nirgends ein Ganzes, aber soweit es möglich, hatte Herr Seibold jedes am rechten Orte bemerkt und sah künftiger Einreihung und Zusammenschreibung ohne alle Bangigkeit entgegen. Er war schon außerhalb des Tores gen München, woselbst er Herrn Resch zu finden glaubte, als er erst sein Büchlein zuschlug. Er sah umher, es war aber kein Herr Resch zu erschauen. Dagegen sah er in einiger Ferne mächtigen Staub aufwallen.
»Aha, da kommt schon wieder was dahergetrieben. Das wird aufgeschrieben und vom zu erholenden Reschischen Verzeichnis heute abend in Abzug gebracht. Man muß keine Gelegenheit vorüberlassen!«
Er konnte die Ankunft der Herde nicht erwarten, vielmehr ließ er sich etliche hundert Schritte nicht gereuen und in kurzem hielt er still vor der neuen Ankommenschaft. Die bestand aus einer großen Schar Gänse und einer weidlichen Zahl Rinder und Hammel.
»Halt!« rief Herr Seibold von Hochstetten. »Keinen Schritt weiter! Ich frag' Euch, Ihr dort, woher treibt Ihr das Getier und wieviel Stück habt Ihr?«
»Was kümmert das Euch?« antwortete der Gänsekönig. »Darum hat da herüben keiner zu fragen als der Resch!«
»Das ist nicht wahr,« rief Herr Seibold, »auf der Stelle sagt an, ich befehl' es Euch! Erstens, wieviel Gänse sind das?«
»Das sind sechshundert und eine.«
»Was, lügen wollt Ihr, das sind keine dreihundert, da kenn' ich mich wohl aus!«
»So zählt sie ab!«
»Das würde bald geschehen sein, wenn ich wollte. Damit Ihr's seht, zehn oder zwölfe in der Reih' und an die zwanzig Reihen, das wären an die zweihundert Gänse. Aber Ihr sollt reden! Blitz Donners, wollt Ihr reden, ich bin –«
»Das kümmert mich nichts, macht, daß Ihr von Wegs geht, seht Ihr nicht, wie sie die Häls' strecken? Daß sie Euch etwan fräßen, weil Ihr der Verwandtschaft die Flügel rupft!«
»Was? Ihr wollt witzig werden und mich beleidigen? Ihr nennt mich einen Federrupfer – Wetter, wenn ich's dem Herrn Resch sage!«
»Da kommt Ihr zum Rechten! Seid Ihr nicht der Klosterschreiber gewesen? Ich kenn' Euch gar wohl.«
»Und Ihr wagt dennoch so keck mit mir zu sprechen?«
»Seid Ihr es ja nimmer, haben Euch ja fortgeschickt!«
»Ha, das mir?!« rief Herr Seibold in gerechtester Wut, und wollte auf den Gänsekönig los. Er konnte aber nicht sogleich eindringen, denn die Gänse waren dicht aneinander gedrängt und mit jedem Schritt hätte er ihrer ein paar zertreten.
»Weg da, auseinander!« donnerte er. Und mitten hinein schleuderte er sein Büchlein, daß es ein Gewirr und Fliehen seitab gab. Der Gänsekönig und sein Begleiter hielten aber ihr Volk bald wieder zusammen und trieben die ganze Schar Gänse voran, so daß Herr Seibold in der Gänsegasse stand, bis alles vorbei war und der Gänsekönig schmähend, nicht eben am feinsten, vorüberstreifte.
Grimmiger Seele, aber unfähig seine Demütigung zu rächen, stand Herr Seibold.
»Da sieht man, was es ist, wenn man sein Amt aufgibt«, rief er vor sich hin. »Ha, der übermütige Bauer! Was soll ich nun? Die dort mit ihren Rindern und Hammeln machen etwan noch weniger Umstände. Ich könnte dem kecken Gesellen seinen Hals umdrehen.« Er hob sein Büchlein auf. »Herr Thoman, Herr Thoman, Ihr zahlt mich gut, aber weiß Gott, mich bedünkt, Ihr hattet recht, die fünfundzwanzig Goldgulden wollen verdient sein. Den Herrn Resch aber muß ich finden, da hilft nichts, und müßt' ich um die ganze Stadt laufen!«
Zurück eilte er und von Tor zu Tor, denn überall konnte Herr Resch sein, weil er die Oberaufsicht hatte. Doch überall wo Herr Seibold fragte, war er eben gewesen und wieder fort. Zuletzt befand sich Herr Seibold wieder in der Nähe des ersten Tores.
Er setzte sich an einem Grasrain nieder, zog sein Lämmernes und sein Stück Brot heraus und hielt sein Morgenmahl.
Bedeutend dachte er nach.
»Ei, ei,« murmelte er vor sich hin, »was soll mir denn am Ende dieser Herr Resch? Da kommt Ihr zum Rechten, hat er gesagt –? Ist der Herr Resch etwa auch so ein wild bißbeißiger Gesell'? Und was kommt bei der Kleinwirtschaft heraus? Warum nicht gleich dahin gewendet, wo alles in größerem verzeichnet vorliegt? Ich könnte warten mit derlei Verbrauchsdingen, bis das Ganze vorüber ist. Es gibt sonst noch genug zu tun und zu erforschen. Aber wer, wer denn gleich –?« Er schlug sein Büchlein auf. »Ich hab's schon. Der beste dazu ist der Sandizell. Der ist ein Ehrenmann und hat großen Einfluß. Er kennt mich auch, und am Ende ist's doch besser mehr in der Art zu erfahren, wie Herr Thoman von Bruckberg meinte. – Der meinte, die Sache sollte mir mehr von oben herab zukommen. Ei, da wär' ein Schreiben an unseren Herzog Christoph freilich tauglich gewesen – töricht, daß ich es aus Stolz ausschlug.« Sehr eifrig beschäftigte er sich mit einer Lammsrippe. »Indessen – indessen, ich denk', der Sandizell vermag auch was hier, vielleicht spricht er ein Wort mit Herzog Jörg. Das ist das beste, und da wird hoffentlich selbigem Herrn Heinz von Höhenrain auch der Weg abgeschnitten oder er kann mich doch nicht beiseite drängen.« Er schleuderte die letzte Lammsrippe weit ins Feld. »Aber wohin jetzt? Zum Sandizell ist's wohl noch zu früh. Ich hab's. Zum Herrn Posch, der kann mir in vielen Dingen wichtigen Aufschluß geben, dann geht's sogleich in die Weinkeller; nun da wird's mit dem Verzeichnen so für alle Fälle nicht weit gefehlt sein, ich wend' mich eben an Herrn Ebran. Richtig, so mach' ich's, dann geht's zu den Goldschmieden – drauf ist's etwan Zeit zum Grafen Sandizell. Oder auch vorher – nun es wird sich schon finden.«
Alsbald war er auf dem Weg durchs Tor, sein Büchlein fest unterm Arm und raschen Schrittes.
»Prost Erbkunig von Jerusalem!« erscholl es plötzlich.
Herr Seibold schaute seitwärts, da sah er den Landsknecht von gestern am Tor steh'n.
» Pereas, verteufelte Landplag'!« rief er und stürzte in die Stadt herein.
Im dritten Hause zur Linken wohnte Herr Posch.
Als Herr Seibold über einer Treppe war und geläutet hatte, öffnete ihm ein gar freundlich Weiblein die Türe.
»Ist Herr Korbinian Posch zu Hause, Allerehrsamste?« fragte er.
»Ei, denkt doch, fürtrefflicher Herr, grad' ist er ausgegangen«, war die Antwort.
»Und wo befindet er sich wohl zu der Zeit –?«
»Das kann ich Euch führwahr nicht sagen, wohllöblicher Herr«, fiel sein Gegenpart redselig ein. »Ich sag' Euch, das ist eben mein Zorn und Kummer, ja, das ist eine Not und ein Elend! Seit zehn, zwölf Tagen ist's, als ob die ganze Welt verkehrt wäre. Kein Imbiß morgens, kein Mittagsmahl, kein Abendbrot mehr in Ordnung. Ich sag' Euch, das ist ein Gehetz und Gerenn' und ein Geschreib', es ist für eine friedsame Hausfrau nicht zu ertragen –«
»Das glaub' ich, Ihr seid demnach Herrn Poschs löblich ehliche Wirtin. Hab' fürwahr nichts gewußt, wann war die Hochzeit?«
»Die Hochzeit war vor drei Wochen. Ja, seht, fürtrefflicher Herr, das Witibtum taugt auch nichts und so hat Herr Posch auch gesagt –«
»Also Herr Posch ist auch Witwer geworden?«
»Ei, freilich, seine Frau und mein Mann, die sind so fast zu gleicher Zeit gestorben, waren gar gute Menschen alle zwei, jetzt ist's grad' fünfviertel Jahr, daß sie tot sind – Gott hab' sie selig. Ich sag' Euch, ich hab' viel geweint, ach, soviel um meinen Mann, denn er war ein rarer Mann, der seinesgleichen sucht – nun seht, da reden wir so drüber, wie Herr Posch einmal nach Ingolstadt kommt, denn da bin ich her – also ich red' über meinen seligen Mann und der Posch über seine selige Hausfrau, und wie's da geht, auf einmal ist's uns hell geworden, daß wir uns geneigt sein könnten, so hat sich dann eins ins andere gegeben, das Meinige und Seinige hat ein hübsches Sümmlein ausgemacht, auf einmal sind wir Brautleut' gewesen, und wie ich Euch schon gesagt hab', vor drei Wochen war die Hochzeit.«
»So, nun bin ich ganz wohl unterrichtet«, sagte Herr Seibold, weitere Ergießungen befürchtend. »Wünsch' demnach von Herzen Glück! Ich muß wieder fort. Sagt mir nur, Frau Posch, wann ich ihn etwa treffen kann.«
»Ja, wann, wann! In einer Stund' oder in anderthalb kann's wohl sein, aber für gewiß kann ich's Euch einmal nicht sagen. Ihr habt ihn wohl nötig zu sprechen. Glaub's, glaub's, ich hätt' ihm auch schon wieder was zu hinterbringen, ja, denn wie er fort war, nicht zwei Augenblicke später, ist jemand gekommen – aber seht, man muß halt billig sein. Er hat's eben auch viel nötig, denn das Messen, Zählen und Wägen, das Austeilen und das Geschreibs und Federgekratz, es ist gar nicht zu sagen, ja, Ihr sollt nur das Buch sehen, was da alles drin steht – alles von der herzoglichen Hochzeit.«
»Also es betrifft die Hochzeit? Könnt ich da wohl einen Blick in das Buch werfen?«
»In das Buch, nun, warum denn nicht –?«
»Das ist ganz trefflich, allerehrsamste Frau Posch,« fiel Herr Seibold ein, »weiter will ich eigentlich gar nichts von Euerem lobesamen Gemahl. Seht, in kurzem gesagt, ich hab' die Aufgabe, die ganze Hochzeitsangelegenheit für eine vornehme Person zu beschreiben, und da wär' mir vielleicht von mehr Seiten auf einmal geholfen.«
»Ei, das ist ja ein leichtes,« war die Erwiderung, »nichts leichter als das. Hätt' ich's nur da, ich wollt's Euch gleich zeigen. Ich sag' Euch, da fehlt kein Lot an Mehl, Hirsbrein, Reis, Gerste, Haberschwend und Erbsen, und die feinere War', wißt wohl, Weinbeer', Mandeln, Rosinen, Feigen, Datteln, Honigseim, Muskatblüh', Safran und die kostbare Spezerei – wär' schon recht, so mein Mann nicht alles aufschrieb, ist er ja von je an Ordnung gewöhnt, da hat ihm noch niemand was nachgesagt, jetzt erst –«
»Ich versteh', versteh',« unterbrach sie Herr Seibold, dem es im ganzen Kopfe saust' und brauste, so geläufig ward er von Frau Poschs Zunge bedient – »in einer Stunde will ich wieder anfragen, jetzt hab' ich einen allzu wichtigen Gang und hab' keine Zeit zu verlieren. Habt nur die Gunst und sagt Euerem Gemahl, Herr Seibold von Hochstetten sei dagewesen und komme wieder.«
»Wie, was? Ihr seid Herr Seibold von Hochstetten?« rief Frau Posch. »Ihr seid etwan gar derselbe Herr Seibold, so voreinst des Lengscheits Töchterlein heiraten wollte und dem sie treulos wurde? O mein Himmel, wieviel hab' ich von der Sach' reden hören – also wahr ist's? Mit dem kaiserlichen Trumpeter ist sie davon?«
»Ja, ja, mit dem ist sie davon – aber ich bitt' Euch –«
»Nein, ich sag' Euch, man möchte den Verstand verlieren, mit einem Trumpeter! 's ist gar nicht zu glauben, solch einen Mann für einen Trumpeter wechseln! Und wie ich gehört hab', hat's noch weiters Aufsehen gegeben, Streit und Rumor, nein, was Euch das geschmerzt haben muß –«
»Das könnt Ihr wohl denken, aber es ist nun auch verschmerzt. Wenn ich wiederkomme und Ihr wollt mehr wissen, will ich's Euch gerne sagen, Frau Posch, jetzt hab' ich wirklich keine Zeit –«
»Ich will Euch sicher nicht aufhalten,« gab Frau Posch zurück, »ich weiß gar wohl, was die Zeit wert ist, ich sag' aber nur soviel und mehr sag' ich nicht. Wenn's nicht doch mehr fromm treue Weibswesen gäb' als böse, geschäh' uns Haß, Zorn und Erniedrigung ganz recht. Ganz recht und gerecht, sag' ich Euch, Herr Seibold von Hochstetten. Aber das dürft Ihr glauben, so wie Lengscheits Töchterlein sind Gottes Dank nicht alle! O, ich weiß selber zwar mehre, sechse langen nicht aus, die auch schönst ehelicher Verbindung ausrissen – aber die mehren sind anders, das nehm' ich auf mich – genug könnt' ich da aufzählen, die große Ausdauer, Treue und Geduld erwiesen haben, ich selber hab's auch erwiesen bei meim ersten Mann, Gott hab' ihn selig! Ich sag' Euch, da hätt' kommen dürfen, wer gewollt hätt', zehn kaiserliche Trumpeter, einer grader gewachsen als der andere, mir all eins, der Dietrich Stöcklein hat mein Mann werden müssen und sonst wollt' ich keinen, nicht ein Blick wär' Euch auf einen anderen gefallen und hab' keinem Menschen von meiner heißen Lieb' gesagt – hört, Herr Seibold, so was tut weh, wenn man die Lieb' so in der Stille verbeißen muß. Nun, das werdet Ihr mir wohl glauben. Aber so muß es sein, das bringt Segen und Vertrauen. Das hat der Herr Posch auch gewußt, und soviel weiß ich für gewiß, weil ich bei gutem Vermögen bin – deshalb hat er mich aber allein nicht genommen, das kennt man gleich –«
»Ja freilich, das kennt man gleich – aber ich versichere Euch, Frau Posch –«
»Wohl, wohl, Ihr müßt fort, ich weiß – aber seht, das hat mich zumeist erfreut, daß er mich mit meiner Tochter genommen hat. Das ist der beste Beweis. Die müßt Ihr kennen! Bis Ihr wiederkommt, ist sie schon zu Haus, Anastasia heißt sie, ich sag' Euch, schön ist sie eben nicht, aber hübsch, brav, tugendsam, und wenn einer um die freit, treuer kann er nichts mehr finden. Die tritt ganz in meine Fußtapfen – da kommt sie grad' – Stasi – Stasi!«
»Was ist's?«
»Mach', daß du 'raufkommst. Weißt, wer da ist?«
»Ja, wer denn?«
»Der Herr Seibold von Hochstetten, weißt, dem seine Marie mit 'n kaiserlichen Trumpeter davon ist!«
»Ei sieh', was nit gar! Den muß ich aber seh'n!«
Ziemlich rasch kam Jungfrau Anastasia über die Treppe herauf. Scharf faßte sie Herr Seibold ins Auge. Vom Hübschen vermochte er nicht gar viel zu entdecken, wohl aber eine nicht unbemerkbare Wölbung gegen den Nacken zu; auch spielten ihm die Haare der Jungfrau glaublich mehr ins rötliche, denn ins schwarze, und obschon das Lächeln der Anastasia an und für sich nicht für unangenehm gelten mochte, so war es doch für Herrn Seibolds Auge kein hinreichender Vorzug.
»Aber das freut mich, Herr Seibold!« rief die Jungfrau. »Also Ihr seid's?«
»Ja, ich bin's, ich muß nur bedauern –«
»Nun kann ich Euch nicht helfen,« rief Frau Posch, »Ihr müßt hereinkommen!«
»Aber wenn ich Euch sage, ich habe unmöglich Zeit – in einer Stunde –«
Aber es war alles vergebens. Er ward hineingezogen.
»Stasi, trag ein Voressen herein,« befahl Frau Posch, »und hol' einen Humpen Brauns herauf. So lassen wir den Herrn Vetter nicht fort!«
»Vetter, wie so denn Vetter?« sagte Herr Seibold, während er in die Stube geschoben ward.
Woher Ihr unser Vetter seid? Das wißt Ihr gar nicht?« erwiderte Frau Posch. »Mein Mann hieß Stöcklein, und sein Schwager war der Emeriz, der war in Herzog Ludwigs Diensten. Demselben Emeriz sein nächster Vetter hat eine Goller gehabt, die war meine Bas', und der Goller ihre Schwester hat eine Leutwein gehabt, die war Eueres verstorbenen Stiefbruders Tochter oder Schwester, ja, die Schwester war's –«
»So ist die Verwandtschaft –?«
»Ja, so ist sie.« – Nun weiß jeder, wie's geht, wenn eine Schnur Granaten oder Perlen bricht; so viel hundertfach sprang's und schlüpft' es von der Frau Posch beredten Lippen. Dabei befand sich Herr Seibold auf dem Stuhl und am Tisch, er wußte nicht wie, und mußte essen und trinken, er mochte wollen oder nicht.
Drüber verstrich Zeit um Zeit. Wer nicht nach Hause kam, war Herr Posch. Endlich hielt sich Herr Seibold nicht mehr, und blitzschnell erhob er sich – denn außer dem Bedenken seiner kostbaren Zeit bemerkte er, daß Frau Posch auffallende Versuche machte, sein Augenmerk auf die Vortrefflichkeit der Anastasia und auf den Nutzen ihrer baldigen Vermählung zu richten, wobei es nicht an wehmutsvollen Beteuerungen fehlte, wie bedauernswert das Schicksal der Hagestolzen oder Witwer werde, wenn die Zeit des Alters heranrücke.
»Ich muß fort – ich muß!« rief er.
»Ja, Ihr sollt fort, Herr Seibold« – sagte Frau Posch, »sogleich sollt Ihr fort, aber bedenkt recht, was ich Euch eben alles gesagt habe, nicht wahr, Ihr bedenkt's?«
»Das werd' ich freilich bedenken,« rief Herr Seibold, »ich werd' es sicher nicht vergessen können!«
»Versteh' ich Euch recht – Ihr wolltet –? Meine Anastasia gefiele Euch, nicht wahr, Ihr sagt selbst, sie ist eine treffliche Jungfrau?«
»Ganz vortrefflich, ganz unübertrefflich – aber –«
»Was aber, nichts aber, Herr Seibold – grad' heraus mit der Sprach – Ihr seid zwar nicht mehr ganz jung, aber was tut es; sie schlagt es nicht so hoch an. Ich weiß gewiß, sie schlagt gleich ein – ich und mein Mann geben ihr zweihundert Goldgulden mit – ist auch nicht zu verachten – erklärt Euch, Herr Seibold, dann ist die Sache in Richtigkeit – mein Mann hat nichts drein zu reden, er tut alles, was ich sag'. Also, Mut gefaßt, Ihr sagt ja?!«
»Ja, wozu soll ich denn ja sagen?« rief Herr Seibold.
»Zur Heirat!«
»Zur Heirat? Ich kann doch nicht zwei zugleich haben. Ihr wißt wohl nicht, daß ich verheiratet bin? Ich bin zwar da allein und zu München war ich auch etliche Zeit allein, aber es trifft oft so zu, denn Arbeit und Geld ist an mehr Orten zu finden. Meine Hausfrau sitzt zu Erding und meine Kinder auch. Also seht Ihr wohl, daß ich die große Ehr' nicht annehmen kann – nun behüt' Euch Gott – wenn möglich, komm' ich in etlichen Stunden wieder.« Hinaus und fort stürzte er.
»Wohin nun? Blitz Donners, das war weiters kein Schrecken. Die wär' die Rechte, die Anastasia. Da ist meine Frau noch golden dagegen und ist doch auch nicht vom Grünzeug. Und das Gesurr und Gezwitscher und Geplapper. Heiliger Gott, weil ich nur da draußen bin, mich sieht er nimmer im Haus, selbiger Herr Posch. Aber wohin denn? Richtig, in die Keller und zuerst in den Fürstenkeller.
Bald war er dort.
»Ist Herr Ebran da?« rief er hinein.
»Was Ebran, was gibt's schon wieder?« antwortete eine mächtige Stimme weit heraus. »Soll einer alles tun und überall sein – ich kann nicht ab!«
»Was wollt Ihr?« sagte einer hinter Herrn Seibold mit nicht minder mächtiger Stimme. »Was seh' ich, Ihr seid's, Herr Seibold? Wie kommt Ihr wieder nach Landshut, was wollt Ihr?«
»Fürtrefflicher Herr Hans Perghofer,« entgegnete Herr Seibold, »Ihr seid mir zum größten Trost. Ich möchte nur wissen, wieviel, das heißt vorher, was da alles für guter Wein im Keller liegt, versteht Ihr wohl, und wenn Ihr dann die Freundlichkeit hättet, mir von dem was mitzuteilen –«
»Ich versteh',« fiel Herr Perghofer lächelnd ein, »soll zwar nicht sein im betreff des Fürstenkellers, weil sonst überall Speis' und Wein frei ist, aber auf ein weniges kommt's da nicht an –«
»Ihr mißversteht mich!« rief Herr Seibold. »So ist's nicht gemeint. Ich will nichts verabreicht, ich will nur sehen, was da liegt, weil ich es ins Verzeichnis bringen muß.«
»So kommt selbst und macht nicht so viel Flausens, und so Ihr dabei ein Kelchglas erwischt, wird's Euch wohl auch nicht beleidigen. Schaut nur auf, daß Euch nichts begegnet – weg da, seht Ihr nicht, daß drei Fässer daherrollen?
Herr Seibold und Herr Perghofer schritten alsbald hinab.
Da wimmelte es von Fässern.
»Also, was wollt Ihr wissen? Macht's aber kurz, denn ich hab' keine Zeit.«
»So will ich's Euch kurz sagen.« – Da bedurft es nur weniger Worte.
»Also wohl, dort ist der Malvasier, dort ist Muskateller, der Frauen halber – sechs Eimer, aber ich weiß, er reicht nicht. Dort die lange Reih' ist's lauter Rheinfall – darauf der Vernetscher – dort der Hopfwein, seht Ihr, grad' über die Straß' und links hinein, an die vierzehnhundert Eimer. Der Met steht da ganz drüben – wozu das gar so aufs Haar –?«
»Aber ich muß es wissen«, beteuerte Herr Seibold.
»Was da, kommt daher und laßt Euch vor der Hand nichts grämen mit der Schreiberei. Trinkt lieber, Herr Seibold!«
Er goß ein mächtiges Kelchglas voll, das bot er dem Kellergast, sich ein gleiches, und stieß an: »Freut mich, daß ich Euch wieder einmal seh, sollt leben!« Dabei trank er sein Glas auf die Neige aus. »Laßt Euch nur Zeit zum Eueren, ich hab' dort zu schaffen.« Damit ließ er Herrn Seibold steh'n und schritt mit der Laterne, die er in der Hand trug, hinweg.
»So haltet nur einen Augenblick!« flehte Herr Seibold. – »Ich seh' ja nimmer vor- und rückwärts!« Aber es war vergeblich. Herr Perghofer war schon um die Ecke und bald mit Arbeit beschäftigt.
»Da haben wir's wieder!« grollte Herr Seibold. »Statt daß ich was Genaues erfahre, erfahr' ich wieder nichts, und nicht einmal den herrlichen Wein kann ich mit Ruhe trinken. Das wär' das Wahre, wenn mich ein anderer da im Finstern allein träf' und säh' mich trinken. Meiner Seel', 's ist schad', so schnell zu trinken, aber 's muß sein!«
Er setzte an und trank. Nicht dreimal setzte er ab, so war das mächtige Kelchglas leer.
»Ha, ha, wer will, der kann«, sagte er. »Ich hab's meinerzeit auch ganz wohlverstanden. Meiner Seel', das gibt Kraft, daß es aus der Weis' ist! Blitz, der beißt ein und brennt wie Feuer. Weiß der Satan, was das für ein Flammengekoch ist, so was ist mir mein Lebtag nit fürgekommen. Wenn ich nur draußen wär'! Was wollt' ich denn da herin – in die Rechnerei muß ich. Ha, ha, Herr Ebran, das gefallt mir weiters ganz gut, Ihr habt mich so grob angefahren, dafür hab' ich mich ja ganz wohl an Euerem Wein gerächt!«
»Was habt Ihr?« donnerte eine gewaltige Stimme in sein rechtes Ohr. »Wer seid Ihr und was habt Ihr da zu tun?« Es war Herr Ebran, der war von der Seite gekommen. »Her da mit Licht, da hat sich einer hereingeschlichen!« Alsbald waren ihrer sechse um Herrn Seibold. Herr Ebran aber nahm dem einen die Laterne ab und hielt sie über des Gefangenen Haupt.
»Ihr seid's, Herr Seibold? Was Teufel ficht Euch denn an? Das hätt' ich nicht von Euch erwartet.«
»So laßt mich nur reden und alles aufklären!«
Und Herr Seibold erzählte, wie alles hergegangen.
Großes Gelächter schlug auf, Herr Ebran aber zog ein blechernes Maß vom Gürtel und sagte: »Für den Schrecken müßt Ihr belohnt werden.« Machte sich auch gleich daran, vom kostbarsten einzuschenken, der zu finden war. »So, jetzt trinkt, Herr Seibold, auf gutes Vernehmen und nichts Böses im Gedächtnis. –«
»Ich kann nicht, auf Ehr', ich kann nicht,« fiel jener ein, »und es war ja nicht so bös von Euch gemeint – was soll ich da vergeben und vergessen?«
»Desto besser, aber trinkt nur!«
»Aber ich kann nicht, dort der Herr Perghofer hat mir ein Kelchglas voll eingeschenkt, das hat mir ganz arg zugesetzt, ich sag's Euch!«
»Ei, was Flaus und Ausflucht,« herrschte Herr Ebran, »Ihr wollt mir doch nicht des Kellers Ehr' versagen? Weiß der Himmel, was Tückischen Euch der Perghofer eingeschenkt – der da soll Euch gleich wieder zusammenrichten.«
»So meint Ihr, Feuer soll Feuer vertilgen?« lallte Herr Seibold. »Meinetwegen, einen Schluck will ich wagen.«
»Einen Schluck? Das wär' das Rechte! Heda! mir auch ein Kelchglas – sollt leben, Herr Seibold! Nun, was meint Ihr? Das ist unser bester Malvasier, trinkt und macht Euch kein Gewissen draus – der hundertste Becher ist mein, davon geb' ich, wem ich mag!«
»Da – da habt Ihr ein köstlich Leben,« lallte Herr Seibold, »Malvasier, den hab' ich genug nennen hören, aber getrunken hab' ich noch keinen – das ist ja ein Weinlein, hei! sag' ich Euch – das ist ja ein Gewächslein zum Verstand verlieren – wenn ich ein großer Herr wär', ich tränk'« – einen ungeheueren Zug tat er – »nicht ein Tröpflein anderen tränk' ich, als den Malvasier da!«
»Also wohl, laßt die Gelegenheit nit von hinnen!« mahnte Herr Ebran. »Eingeschenkt – ausgetrunken! Herr Seibold, nur herzhaft drauf los, denn ich kann nimmer weilen, im Keller darf ich Euch nicht allein lassen.«
»Ganz recht, ganz und gar einverstanden, fürtrefflicher Herr Ebran,« entgegnete jener, »nur um dies – dies eine bitt' ich Euch – seht Ihr, da in das Büchlein, das Büchlein da, seht Ihr, nicht wahr? seht Ihr, in das Büchlein muß ich alles aufzeichnen, was da in – in –«
»Laßt doch das Büchlein und die Schreiberei!« herrschte Herr Ebran wieder, zugleich er ihm das Büchlein aus der Hand nahm und es derb auf das Faß neben Herrn Seibold legte. »Trinkt aus, ich muß fort – oder kommt, ich trink' Euch noch einmal zu!«
»Nu, meinetwegen,« kam's zurück, »wer kann denn da widersteh'n, wenn einer da den Wein da – den! Seht Ihr, daß ich auch was vermag, ha ha, Herr Ebran? Habt Ihr gesehen? Und wie ich da steh', meiner Seel' – da steh' ich, wie ein – wie ein kerzengrader La– Landsknecht – und den Mut, sag' ich Euch! Jetzt soll mir da einer herkommen, so ein so– solcher reisiger Raßler da mit seinem Übermut, ha, ha, der soll mir Augen machen, der Gesell – daß ich ihn doch gleich tot und durch und durch stäch' – und des – Pfa– Pfalzgrafen Narren, ah dem wollt' ich – dem wollt' ich auch sein Teil geben, wenn er mir wie– wieder Äpfel aus dem Ma– Mantel schütteln möchte –«
Ein großes Gelächter brach los, dagegen Herr Seibold zu großem Ergötzen aller gewaltig protestierte. Was aber nichts half. Mehr geschoben, als gehend, kam er zur Kellertreppe.
Die ging es noch erträglich hinauf.
Auf der drittletzten Stufe sagte Herr Ebran: »Also wünsch' ich, daß Euch der Feuerwein und Malvasier wohl bekomme. Wollt Ihr Euch ein wenig ausruh'n, dort ist ein schattiges Plätzlein.«
»Wie werd' ich denn aus– ausruh'n?« entgegnete Herr Seibold mit äußerst ungelenksamer Zunge. »Ich hab' k– keine Zeit, ich mu– muß zum Gr– Grafen San– Sandizell –«
Dabei stand Herr Seibold auf der letzten Stufe. Plötzlich war's ihm, als würde die ganze Welt vor seinen Augen zu Dunst und Nebel, und was sonst um eines weingesegneten Mannes Haupt dreht und taumelt, das fand sich bei Herrn Seibold treulich ein. Unbewußt wie, gelangte er um die Ecke des Kellers herüber und sank auf den Steinsitz unter grünem Laubwerk.
Einen schalkhaften Blick sandten Herr Ebran und Perghofer auf das Opfer ihres Scherzes und wandten sich dann ihren weiteren Geschäften zu.
Herr Seibold von Hochstetten aber nickte und nickte, sein Haupt gelangte stets in schiefe Richtung, und allgemach folgte der ganze obere Teil des Leibes nach.
Da lehnte er, sanft entschlummert.
* * *
Mittag war lang vorüber, als Herr Seibold von Hochstetten erwachte.
Er rieb die Augen und schaute in halber Verwunderung umher, indem er sich rasch von der Bank erhob. Erst allmählich erinnerte er sich genauer, was alles vorgefallen.
»Das soll mir nie und nimmer begegnen,« sagte er, »der verwünschte, übermäßige Wein, und gar im Keller. Daß ich nicht daran dachte. Und was ich Zeit verlor.« Er lenkte um die Ecke, mußte aber erst über etliche Stückfässer steigen, welche mittlerweile vorgerollt worden waren. Dann erst konnte er fort und hinaus.
»Wohin wollte ich doch? Richtig, zum Sandizell.«
Fort eilte er. Mehrmals fragend und einigemal irregeführt, erreichte er endlich das rechte Haus.
Der Graf trat eben aus der Tür. –
Tief beugte sich Herr Seibold und trug sein Anliegen vor.
Ganz günstig lautete des Grafen Antwort. Der schilderte auch den Heinz von Höhenrain, wie Herr Brunner getan, als einen kecken, zudringlichen Gesellen und versprach Herrn Seibold einige Bevorzugung. Fragte auch darauf, wie er seine Sache denn angelegt habe, und auf geschehene Andeutung verlangte er das bewußte Büchlein zu sehen, und Herr Seibold griff in die Tasche.
Da war das Büchlein nicht zu finden.
»Wo – wo hab' ich es denn hingebracht –? Beim Himmel, das hab' ich verloren!«
»Wo wart Ihr denn zuletzt?«
»Wo ich war, gnädigster Herr Graf, – ich – was fällt mir bei! Das Büchlein muß im Fürstenkeller auf dem Malvasierfaß liegen. Der verwünschte Herr Ebran, jetzt entsinn' ich mich!«
»So eilt, daß Ihrs wieder gewinnt,« sagte der Graf, »und findet Euch in einer Viertelstunde wieder hier ein, ich komme bald wieder.« Damit ließ er Herrn Seibold steh'n und ging links die Straße entlang. Herr Seibold aber holte aus und stürzte dem Fürstenkeller zu.
»Am Ende ist er gar noch geschlossen«, sagte er atemlos vor sich hin.
Der Keller war aber offen. Herr Seibold ohne weiteres hinein und auf eine Laterne zu, die etlichen gehörte, so sich unfern zu tun machten. Herr Seibold suchte dort und suchte hier. Nirgends eine Spur von seinem Büchlein.
»Weiß von euch keiner, wo mein Büchlein hingekommen ist?« fragte er, sich jenen nähernd, welchen die Laterne gehörte und die ganz verwundert auf sein Treiben und Suchen geschaut hatten. »Dort, liebe Leute, dort auf dem fünften Faß ist es gelegen – ihr wißt wohl nicht, wer ich bin, ich bin Seibold von Hochstetten, den der Herr Ebran –«
« Ihr seid Herr Seibold?!« sagte einer lächelnd. »Habt Ihr ausgeschlafen? Und das Büchlein dort auf dem Faß gehörte Euch?«
»Ja wem soll's denn sonst gehören? Gebt's nur heraus und tut mir die Freundschaft!«
»Warum nicht, wenn's da wär',« lautete die Antwort, »aber Ihr kommt zu spät!«
»Was sagt Ihr, zu spät?«
»Da war einer und hat es mitgenommen.«
»Mitgenommen, mein Büchlein entführt – wer war der Freche, wo ist er?«
»Das weiß ich beides nicht,« kam's entgegen, »es war eben so einer da, der fragte Herrn Ebran um alles mögliche, was für Wein da sei und wieviel, drauf kam Herr Ebran auf Euch zu sprechen und daß Ihr Euer Büchlein liegen gelassen. Wie er drauf das und jenes erfahren und Herr Ebran ihm das Büchel zeigte, riß er's ihm aus der Hand und rannte damit fort, und jetzt wißt Ihr's. Lupf das Faß, Wendelin – lupf – weg da, Herr!«
»O du grauenvolle Welt«, rief Herr Seibold. »Wie konntet Ihr das geschehen lassen?!«
»Was weiß unsereiner,« schnurrte ihn jener an, »wir haben keine Zeit, dem Geschreibs nachzulaufen.«
»Dem Geschreibs!« rief Herr Seibold noch aufgebrachter. »Wißt ihr, daß das schändlich ist, verabscheulich, und spotten wollt ihr auch noch? Ihr, ihr Raubesbegünstiger, wart', ich sag's dem Grafen von Sandizell!«
»Was sind wir, Raubesbegünstiger?« Und gleich einen Satz auf Herrn Seibold hin tat der andere. Seine Genossen folgten dem Beispiel.
Einen Schrei des Zornes und gerechter Angst zugleich stieß Herr Seibold aus und rannte, die Laterne in der Hand, dem Ausgang zu. Seine Verfolger stürzten ihm nach.
»Wart, du Schreiberseel',« hallte es Herrn Seibold in die Ohren, »willst des Fürsten Wein trinken und seine Diener und Leut' lästern!« Dazu flog etwas an seiner Seite darnieder, das hätte ihn zu Boden geschlagen, so's ihn getroffen. Wie der Blitz wandte sich Herr Seibold, ließ es an einer gehörigen Verwünschung nicht ermangeln und schleuderte die Laterne hinunter.
Wutschnaubend sprang der Getroffene die Treppe herauf.
Aber Herr Seibold war schon fort.
Sein ganzes Herz kochte Rache. Nur eines milderte seine entsetzliche Wut. Herr Heinz von Höhenrain hatte ihm sein Büchlein zwar entführt, aber eben dies sollte des Feindes Untergang herbeiführen. »Der Graf von Sandizell soll es erfahren,« warf er vor sich hin. »Das bricht dem Gesellen das Genick, das kommt überall herum, jeder nimmt sich vor ihm in acht und man sagt ihm nirgends mehr das geringste!«
Als er an das Haus zurückkam, war der Graf nicht da. Er wußte nicht, sollte er warten oder oben in der Kanzlei nachschauen.
Er wählte letzteres. Der Graf war nicht da. Herr Seibold klagte seine Ungeduld, ihn zu treffen und sein Vorhaben, ihn vor dem räuberischen Herrn Heinz von Höhenrain zu warnen – was er den Herren in der Kanzlei desgleichen angedeihen ließ.
» Ihr seid Herr Seibold von Hochstetten? sagte drauf der eine.
»Das ist doch ein kecker Gesell!« sagte ein anderer.
»Wer ist ein kecker Gesell?«
»Der Herr Heinz von Höhenrain, denn sonst war es sicherlich keiner. Hört nur, Herr Seibold, der Graf hat Euch an uns empfohlen und uns aufgetragen, Euch soviel möglich, jenem aber nichts mitzuteilen. Das muß der Schelm erfahren haben, ist heraufgekommen, schrieb in wenigen Minuten allerlei ab und rannte wieder fort –«
»Ja, warum habt Ihr's denn zugelassen, daß er etwas abschrieb?«
»Weil er sich Seibold von Hochstetten nannte.«
»Kreuz, Blitz, zehntausend Teufel!« rief Herr Seibold. »Meinen Namen stiehlt er mir auch noch. Wo ist er hin, wann ist er fort –?«
»Nicht drei Minuten sind's, und dort hinüber rannte er. Es mag ihm bang geworden sein, der Graf könnte zu bald wiederkommen. Denn wir sprachen davon.«
»Wie schaut er aus? Ich bring' ihn um!«
Flüchtige Beschreibung wurde ihm, und wieder neu aufkochend von dreifacher Wut stürzte da Herr Seibold hinaus, hinab und von dannen, voll Begierde, seinen grimmig gehaßten Feind ausfindig zu machen. Straß' auf, Straß' ab. Nichts zu sehen.
»So eil' ich zum Vogt! Den Gesellen laß ich gefangen setzen!« Seines Weges weiter eilte Herr Seibold, aber er mußte alsbald nachlassen, denn er geriet in ein großes Gedränge. Das hatte sich angesammelt und gaffte auf etliche Fürsten, die vorüber und auf Besuch zur Braut, der schönen Hedwig von Polen, ritten. Dabei war der Bräutigam Herzog Georg selbst, weiters Herzog Christoph von Bayern, der Pfalzgraf Philipp nebst anderen, und mit ihnen ritten in prachtvollen Gewändern zwo polnische Grafen, der Graf Ostrorog und Monawit.
Soeben glaubte Herr Seibold seinen Feind zu erblicken. Aber er konnte nicht durch die Menge dringen.
Als die Fürsten und Grafen vorüber waren, wollte er sich sogleich durcharbeiten, aber es war ihm wieder nicht möglich, durchzukommen, soviel er auch rang und zwängte. Zuletzt ward er hinausgedrückt und ganz erschöpft lehnte er sich eine Zeitlang hochatmend ans nächste Haus. Tausend Gedanken der Rache durchzuckten sein Haupt, aber keiner schien ihm ganz ausführbar. Auch die Anklage beim Vogt schien ihm von geringem Erfolge, denn wie sollte man sich auf große Verfolgung einlassen, wo offenbar kein Mensch denselben Wert auf das besagte Büchlein zu legen schien, als er selbst und Herr Heinz von Höhenrain? Und wie bald mußte man des Suchens müde werden, da Herr Heinz sicher auf seiner Hut sein mochte. »Und wenn alles gelänge,« raunte er vor sich hin, »wie kann mir der Geselle weiters schaden, wenn auch er nichts zu schaffen vermöchte – und wieviel Zeit verlier' ich – es bleibt vor allem anders nichts, denn ein neues Büchlein anschaffen.«
Auf sprang er, auf den nächsten Meßkram eilte er zu und kaufte ein neues Büchlein und einen trefflichen Stift dazu.
»Das soll mir nimmer verloren geh'n und geraubt werden«, sagte er, das Büchlein beifällig betrachtend. »Beim Sandizell erfährt er im übrigen auch nichts mehr, der Räuber. Wohl aber ich. In einer Stunde ist der Graf sicher wieder in der Kanzlei, dann wird mir sämtliches im ganzen und großen zu Handen gestellt. Weiters kann mir der Graf auch noch von Nutzen werden, da fehlt's gewiß nicht. Vordersamst geh' ich an was anderes. Dazu bedarf ich hoffentlich keiner Empfehlung, ein Mann, wie ich, empfiehlt sich von selbst am besten, wenn's nicht gerade bei Fürsten ist.« Einen Blick warf er umher. »Ich hab's schon – jetzt befass' ich mich mit den Goldschmieden und Abenteurern. Bei denen will ich ergründen, was an Goldwar' und Geschmeide los ist. Dort ist Herrn Kessels von Köln Gewölbe.«
Sogleich auch über die Gasse und fein artig zu Herrn Kessel hinein. Dem teilte er seine Absicht mit und fragte, was bisher an die Fürsten verkauft und zu Geschenken bestimmt sei.
Darauf erwies sich Herr Kessel ganz handsam, sagte auch, er werde später nach München kommen und habe nächst überaus Teuerem noch manch anderes Schöne zu geringerem Preise, wie es für Bürger und ihre Frauen recht sei. Dabei sollte ihn Herr Seibold dort und da voraus ankündigen, falls er vor ihm nach München zurückkehre. Drauf zeigte er ihm ein Verzeichnis gekaufter Kostbarkeiten und versprach ihm unbedingte Mitteilung. Er legte es aber wieder hinweg, eben als es Herr Seibold zur Hand nehmen wollte, und sagte: »Was habt Ihr denn da für ein armseliges Ringlein, ehrenwertester Herr Seibold von Hochstetten? Möcht' ich doch fürwahr ein besseres tragen als ein wohlangesehener, gelehrter Mann! Seht, da hab' ich einen Ring, der ist sicher wie für Euch gemacht, und ich will Euch einen ganz billigen Preis machen, weil Ihr mir hinwieder nützen werdet.«
»Aber ich bedarf keines Ringes,« antwortete Herr Seibold, »ich habe selbst noch zwei treffliche Ringe zu Hause. Was tu' ich denn mit dem auch noch dazu?«
»Ihr scherzet nur, wohlgelahrter Herr!« erwiderte Herr Kessel. »So Ihr zu bescheiden seid, Ringe zu tragen, sind es doch andere nicht. Seid doch Euerer Absicht eingedenk – für ein goldenes Ringlein läßt gar mancher von großem Eigensinn ab –«
»Ich versteh', ich versteh'« – entgegnete Herr Seibold, »obschon ich Euch offen gestehe, ich habe ebensowenig Absicht als Kenntnis, zu bestechen –«
»Da seid Ihr doch ein wenig ungeschickt, bester und wohlweiser Herr,« fiel Herr Kessel ein, »am Ende wird Euch aber doch nichts übrig bleiben, dort oder da, denn es gibt gar eigene Leute. Ich meine wohl, daß Ihr den hübschen Ring und meinen guten Rat nicht von Euch weiset –«
Im selben Augenblick trat Herr Johann von Frauenberg herein.
Tief verbeugte sich Herr Kessel.
»Ihr macht doch stets Geschäft,« sagte jener, »hier sind meine dreißig Goldgulden – was habt Ihr denn seit heute schon alles losgeschlagen?«
»Ah, ich bin ganz wohl zufrieden, gnädigster Herr«, gab der Goldschmied zurück. »Gleich da Ihr mich verließt, hab' ich die große silberne und vergoldete Scheuer verkauft –«
»Was Ihr sagt, die um zweihundert Goldgulden – wem wird sie zuteil, habt Ihr nichts erfahren?«
»Wohl, wohl, der Graf Ostrorog bekommt sie zum Geschenk. Um die elfte Stund' hab' ich die zweit große verkauft, die wird dem Grafen Monawit. Im kleinen ging's Viertelstündlein um Viertelstündlein fort – und seht, gnädigster Herr, da ist schon wieder ein trefflicher Freund, der sich vielleicht noch an Euere Gunst und Gnade wenden wird, denn er hat eine trefflich große Aufgabe und möchte Eueren Aufschluß in dem oder jenem dankbar annehmen. Er ist auch ein sehr gelehrter Mann – nun, da drückt man gern die Augen zu und läßt sich billig finden. Ihr vergebt schon, gnädiger Herr, daß ich den Handel ausmache. Wohlweiser Herr Seibold von Hochstetten, Ihr botet mir –«
»Ich bot Euch –?«
»Richtig, Ihr botet mir zwei Goldgulden für diesen schönen Ring – er sollte dritthalb gelten – aber es mag sein, hier ist er.«
»So – hier ist er – in der Tat –?« Herrn Seibold von Hochstetten ruckt' und zuckte es durch den ganzen Leib und wie auf Kohlen stand er. Aber es war keine Zeit zu verlieren, alles Zweckdienliche fuhr ihm in tausend Gedanken zugleich durch den Kopf, voraus der Gedanke an den guten Eindruck, den seine scheinbare Wohlhäbigkeit auf Herrn Johann von Frauenberg machen könne – mit unterdrücktem Seufzer griff er zum Geldkätzlein und legte die zwei Goldgulden hin.
»So, Herr Kessel,« sagte er, »wenn ich Euch dann wegen der anderen Sache bitten dürfte – will aber, wie sich von selbst gibt, untertänig warten, bis der gnädigste Herr mit Euch verhandelt hat.«
»Da sollt Ihr nicht lange warten«, sagte Herr Johann von Frauenberg. »Ich hab' nur ein kleines Anliegen an Euch, Herr Kessel.«
»Das ist zum voraus erfüllt, unweigerlich« – war die Entgegnung. »Was befehlt Ihr?«
»Ei, ich bin da von einem, des Namens Heinz von Höhenrain, dringend gebeten worden, mit Euch zu sprechen. Derselbige Heinz beschreibt die Hochzeit und möchte deshalb aller Dinge kundig werden. Seid nun so gut und gebt ihm allein näheren Bericht über alles, was Ihr verkauft, anderen aber, die sich weiters zudrängen, nicht. Damit Gott befohlen, Herr Kessel, ich rechne drauf, sonst kömmt mir der Gesell noch einmal.«
Damit verließ Johann von Frauenberg das Gewölbe.
Wer die ganze Zeit über wie versteinert dastand, war Herr Seibold von Hochstetten.
»Ja, wo – wo soll denn das hinaus?« lallte er. »Ihr werdet bei mir doch eine Ausnahme machen und mir alles mitteilen –?«
»Ich Euch? Nach dem, was hier vorgefallen?« sagte Herr Kessel. »Wie könnt Ihr doch so zudringlich sein? Hab' ich Euch nicht freundlich genug bedient und Euch diesen Ring um zwei Goldgulden abgelassen? Hab' ich Euch nicht an den von Frauenberg empfohlen? Wißt Ihr, was das heißt? Ihr werdet mir doch nicht anmuten, Euch zulieb' mein Wort zu brechen? Ich habe Euch zwar einiges in Aussicht gestellt – aber –«
»Ha, Ihr Abgrund von Falschheit!« rief Herr Seibold. »Also gar nichts wollt Ihr mir Mitteilen? O, Ihr gottloser Gesell, Ihr verwünschter Katzenbuckel, und lügt den Leuten ihre Goldgulden aus dem Sack, die Euch gar nichts anfeilscht haben!«
»Was, Ihr hättet nichts angefeilscht?« fuhr Herr Kessel auf, »ich werde –«
»Nichts werdet Ihr, als mich nimmer länger bei Euch sehen!« donnerte Herr Seibold. »Euer Blutgeld habt Ihr, damit fahrt hin!«
Hinaus eilte er.
»Halt, den Ring!« ließ ihm Herr Kessel boshaft folgen und eilte etliche Schritte nach.
Windschnell fuhr Herr Seibold herum und wieder auf ihn zu.
»Tut mir's etwa an und schreit so laut, daß die Leute glauben, ich hätt' einen Ring entführt –!«
Schon waren etliche stehen geblieben. »Was gafft ihr da, ihr Herren?« donnerte Herr Seibold. »Da gibt's nichts, als daß ich einen Ring liegen ließ, den ich gekauft habe. Blitz Donners geht euerer Wege – gekauft hab' ich ihn, das sag' ich!«
Dabei riß er Herrn Kessel von Köln den Ring aus der Hand und stürzte fort.
* * *
Herr Seibold von Hochstetten war ganz außer sich. Er rannte und rannte schon über eine halbe Stunde, ohne ein Ziel zu haben, all über die Kreuz und Quer. Zuletzt warf er sich auf einer Bank, nächst einer offenstehenden Haustüre nieder.
Der Gedanke an alle Leiden, welche ihn noch treffen könnten, tagte mehr und mehr in seinem Haupte. » Und wenn ich mich nun auch an des Sandizells Kanzlei wende,« raunte er vor sich hin, »wenn sie mir Aufschluß gibt, wenn ich auch von Herrn Brunner alles schon Abgeschriebene noch einmal abschreibe und das Neue dazu, was ist's dann? Wo treff' ich den Herrn Resch, und so ich ihn treffe, wer weiß, was da wieder zutrifft – und sagt er mir alles, was hab' ich dann? Doch nur Stück- und Trümmerwerk, denn sobald ich wieder neues finde, wischt's mir gewiß wieder unter der Nase weg. Noch ein einziges Unglück und ich lasse die ganze Angelegenheit fahren – – oder soll ich mich doch an den Herzog Christoph wenden? Wollt' ich doch den Sandizell bitten, daß er mit Herzog Georg spräche – ich Tor, red' mit ihm und vergesse darauf – richtig, ich wende mich an den Herzog – jetzt sogleich will ich fort und sehen, was zu tun und wie ich zu ihm gelange.« Während er dies vor sich hin sagte, war er längst das Augenmerk aller Vorübergehenden gewesen, ohne darauf zu achten. Rasch erhob er sich und wollte fort.
Im selben Augenblick kam Herr Resch daher. Der erkannte ihn sogleich, freute sich des Wiedersehens und fragte um dies und das, daraus wohl zu ersehen, daß er von Herrn Seibolds Anwesenheit und etlichen Unglücksfällen flüchtige Kunde gewonnen hatte.
Herr Seibold machte seinem Herzen mit Wonne Luft. Da er aber vorbrachte, daß er bei nächster Veranlassung sein ganzes Vorhaben aufgeben werde, tröstete und ermahnte ihn jener, lobte seinen Entschluß betreffs des Herzogs Christoph, bedeutete ihm jedoch, heute und morgen werde er nicht vorkommen. Im übrigen möchte er nicht das einzelne verachten, denn alles lasse sich weiterhin ergänzen und dann gebe es zuletzt doch ein Ganzes.
Diese Anrede ermunterte Herrn Seibold wieder ein wenig, so daß er fragte, ob ihm Herr Resch zur Zeit in etwas dienlich sein könne, ehe er zu ihm in sein Losament komme, um Ausgedehnteres in Sachen des Geflügels und der Vierfüßigen zu erfahren.
»Allerdings kann ich Euch etwas mitteilen,« sagte Herr Resch, »wie die hohen Herren an der Tafel gereiht sind, selb hab' ich mir eben selbst aufgeschrieben.«
»Das ist trefflich, also habt die Gunst.« Und sogleich nahm Herr Seibold sein Büchlein heraus. »Tretet ein wenig hieher unter die Tür,« setzte er bei, »es ist der Leute wegen, die gaffen zu sehr.«
»Wohl, wohl, also habt acht! Wer am ersten, zweiten und dritten Tisch, hab' ich genau erfahren, – es soll Euch aber nachträglich werden, wie's mit den übrigen beschaffen. Am ersten Tisch sitzen obenan –«
»Obenan –«
»Des Kaisers Majestät!«
»Des Kaisers Majestät!«
»Dann der Markgraf Albrecht und Herzog Siegmund von Österreich – der Salzburger Erzbischof –«
»Hab's schon.«
»Dem Kaiser zunächst rechter Hand Herzog Jörg, der Bräutigam.«
»Hab's schon.«
»Das Essen trägt Markgraf Friedrich zu Brandenburg –«
»Und mehr andere,« fiel Herr Seibold ein. »Graf Ulrich von Württemberg ist der Vorschneider. Jetzt nur gleich den zweiten Tisch!«
»Obenan Erzherzog Maximilian von Österreich – aber lieber Herr Seibold, gerade fällt mir ein, daß ich noch etwas Wichtiges zu besorgen habe. Ihr entschuldigt mich wohl, so ich Euch verlasse. Den Zettel lass' ich Euch, den könnt Ihr mir wieder bringen. Da ist er – laßt Euch bald sehen, etwa morgen um die siebente Stunde. Gehabt Euch wohl und verliert den Mut nicht!«
Fort eilte er.
»Komm' schon, komm' schon!« ließ ihm Herr Seibold folgen. »Na, ist doch wieder einmal ein Ehrenmann erschienen, der's redlich meint, oder bei dem ich mindest kein Unglück zu fürchten hab'. Da steht doch alles vor mir geschrieben und kann's mir doch kein Mensch drehen, wenden und streitig machen. Nun sogleich ans Abschreiben! Also Erzherzog Maximilian. Dann kommt Herr Burian von Guttenstein – – ist des Königs von Böheim Botschafter. Benebst – zwei Woiwoden, der Graf Ostrorog und Landsoz – nun der dritte Tisch. Viktoria, da ist eine ganze Schar, das ist ja ganz fürtrefflich. Ha, ha, Herr Heinz von Höhenrain, das wär' so ein Fund für Euch, ah, das möchtet Ihr wohl, wenn Ihr's bekommen könntet – Blitz Donners, hat der Resch da eine Menge Ding' und Angelegenheit notiert, mir alles ganz unschätzbar, Blitz Donners, sag' ich, an den Resch muß ich mich halten!«
»Ich auch!« erklang es hinter ihm. Zettel und Büchlein wischten ihm aus der Hand und hinaus, ihn beiseite schiebend, eilte eine Gestalt.
»Ist das der Teufel oder – das ist Heinz von Höhenrain!« rief Herr Seibold. Und sogleich einen Satz vorwärts und ihm nach. Schon war jener um die nächste Ecke. Als Herr Seibold umbog, war der Herr Heinz von Höhenrain wie verweht und versunken. Beide Hände in den Haaren, stand Herr Seibold wie versteinert, so daß er eine Schar Soldknechte nicht gewahr wurde, welche daherkam. Einer, ihm zunächst, schob ihn beiseite und rauschend zog die Schar weiter.
»Ha, jetzt – jetzt halt' ich's nimmer aus! Auf meiner Sache liegt Fluch und aber Fluch! Meinetwegen siedet und bratet, röstet und backt, sitzt und turniert, tut, was ihr wollt, hoch und nieder, mir alles eins, und brumm' der Ritter Thoman von Bruckberg oder lach' er, mir wieder eins, alles, alles, ganz und gar eins! Gleich hol' ich mein Ränzel, nicht eine Stunde länger bleib' ich in Landshut, und dabei bleibt's!«
Voll Grimm schlug er seinen Schlapphut seitwärts und, ohne einen Blick weiter nach rechts und links zu senden, geradewegs fort, dann links herüber und wieder rechts bis zu Herrn Brunners Behausung. Die Treppe flog er hinauf und riß mit aller Gewalt an der Glocke.
Niemand öffnete.
»Wetter, hört mich denn niemand?« grollte er. »Wart', du verteufelter Winfriedl, ich will dir Ohren machen!« Dreimal mit aller Macht riß er am Glockenstrang.
»Was Art ist das?« polterte eine Stimme, mittlerweile das Sprechtürlein aufging. Eine ziemlich derbe, lange Nase ward sichtbar und zwei grimmige Augen sahen heraus. »Wer seid Ihr und was wollt Ihr?«
»Mein Ränzel will ich!«
»Seid Ihr von Sinnen?« war die Antwort. »Da ist kein Ränzel, und ich kenn' Euch nicht!«
»Ich kenn' Euch auch nicht,« rief Herr Seibold, »aber deshalb will ich doch mein Ränzel! Oder – oder ist denn das nicht Herrn Brunners Behausung? Ja freilich ist sie's, hab' ich doch eine ganze Nacht darin zugebracht!«
»Kommt Ihr aus der Schenke? Da ist kein Herr Brunner! Macht, daß Ihr Eueres Weges geht, Ihr kecker Trunkstreuner, Ihr Ruhestörer, Ihr –«
»Was bin ich? Ein kecker Trunkstreuner, ein Ruhestörer?« rief Herr Seibold wütend.
»Ja, das seid Ihr, ist's Euch nicht recht?«
»Nein, 's ist mir nicht recht!« Und gleich Herr Seibold mit der Hand ins Sprechtürlein und fest über diejenige Nase her.
Gewaltiges Geschrei erhob der treffende Besitzer, aber Herr Seibold ließ sich nicht irremachen und es an etlichen ansehnlichen Rucken nicht fehlen. Als er losließ, war die Schlacht noch keineswegs zu Ende, denn während sich der innerhalb über Herrn Seibolds Hand machte, erging sich dieselbe in mannigfaltigsten Griffen und Rütteln, wozu ein sehr langer Knebelbart trefflichen Behelf und Anhaltspunkt darbot. Ein entsetzlicher Schlag auf Herrn Seibolds Hand machte weiterer Kampfeslust ein Ende. Er zog sie schnell aus dem Sprechtürlein, fuhr die Treppe hinunter und schoß in das nächste Haus, wo Herr Brunner wohnte.
Heftig zog er an der Glocke.
Aber auch hier ward nicht geöffnet.
In wahre und gerechte Wut geriet Herr Seibold. Aber die Wut war vergeblich, Herr Brunner und der Winfried, keiner war zu Hause.
»Und ich geh' doch nicht mehr fort.« Fest stand Herrn Seibolds Entschluß. Er eilte die Treppe hinunter und setzte sich auf die Stufen. »Da sitz' ich und da bleib' ich sitzen und müßt' ich die ganze Nacht dasitzen.«
Ungestört saß Herr Seibold, schier eine Stunde lang.
Mit einemmal bemerkte er, daß er außer seinem Zorn noch ein anderes Gefühl empfinde. Das war jenes nicht geringer Eßlust.
»Wenn ich nur was zu speisen hätte,« sagte er, »ich hab' Hunger, daß ich in die Staffeln beißen möchte. Mach ich mir da die schönsten Hoffnungen auf was Guts ich umsonst in Landshut bekäm', weil's allerorten auf Herzog Georgs Kosten geht – und zu meinen sämtlichen Leiden komm' ich zu keinem Bissen Brot. Wie wär's, wenn ich in den Elefanten hinüberginge, der ist nicht weit weg. Ich kann herüberschau'n – kommt dann der Winfriedl daher, nehm' ich mein Ränzlein, laß dem Brunner Lebewohl sagen und drei Stunden Wegs mach' ich heute doch noch – richtig, und dem Herrn Brunner laß ich sagen, ich wollte nichts mehr wissen, die Beschreibung für Herrn Thoman von Bruckberg sollte nur er vollführen, ich brächte dem die Nachricht.«
Rasch entschlossen erhob er sich. Bald war er in der Schenke zum Elefanten. Den Wirt dachte er von früher her zu kennen.
Aber es war ein neuer da.
»Braunes und einen Schnitz Hammelbraten auf des Herzogs Kosten!« rief er und wollte aufs Fenster zu. Da war aber alles voll von Gästen. Kein Platz war leer, als in der hintersten Ecke bei der Ausschenke.
Es währte nicht lange, so war er bedient.
Gewaltig fiel er über sein Opfer her und raunte vor sich hin, während er mit Messer und Gabel sehr lebendig zu Werk ging: »Du verwünschte Gaunerseel' von einem Heinz von Höhenrain, hätt' ich dich nur erwischt, ich hätte dich gezaust und zerrissen und zerstochen, daß kein Fetzlein an dir ganz geblieben wär'! In der Mitte hätt' ich dich auseinandergerissen, du kreuzblitz gotteslästerlicher Schurke du, der ehrlichen Leuten ihr Handwerkszeug raubt und Hohn mit ihnen treibt!«
Einen tüchtigen Schluck tat er.
Eben setzte er das Stutzglas nieder, als der Elefantenwirt zu ihm trat und fragte, wie ihm die Kost schmecke.
»Fürtrefflich und schmackhaft ist's«, sagte Herr Seibold. »Wie lange seid Ihr auf der Schenke?«
»Drei Wochen«, war die Antwort.
»Also wohl, sonst müßt' ich Euch kennen, denn ich war lange Zeit hie zu Landshut. Alljetzt aber bin ich mehr zu München. Ist Euere War' auch so gut, wenn's um der Leute Geld geht und nimmer auf Herzogskosten?«
»Das könnt Ihr wohl glauben, wär' wohl recht! Laßt mich nur fein empfohlen sein, wann Ihr wieder zu anderer Zeit kommt, oder so Ihr hört, daß ein anderer gen Landshut zieht.«
»Soll nicht fehlen«, sagte Herr Seibold. »Das heißt, letzteres – denn ich selber komm' so bald nimmer. Das sag' ich Euch. Noch heute mach' ich mich auf den Weg gen München. Ich hab' an die zehn Jahr hie verlebt und nun hab' ich an Tag und Nacht satt bekommen. Von dem Landshut will ich nichts mehr wissen.«
»Was ist Euch denn so arges begegnet?« fragte der Wirt.
»Ja, da gäb's viel zu erzählen«, erwiderte jener. Einen ziemlich ansehnlichen Bissen Hammelbraten führte er dabei zum Mund. »Ich – ich sag' Euch nur soviel, es mag einer die beste Absicht und das – das trefflichste Unternehmen haben, wann der Teufel einen Boten schickt, ist doch alles vergebens. Seht, da hab' ich eine Angelegenheit, die mir guten Namen und fünfundzwanzig bare Goldgulden trüg' – glaubt Ihr, ich könnte die Sach' ehrlich durchfechten? Nein, da rennt einer herum, schneidet mir alle Wege ab, plagt und verhöhnt mich und raubt mir all' mein Behelf und Schreibwerkzeug.«
»Da habt Ihrs nicht gut getroffen«, sagte jener. »Seht, grad' so geht's einem, der hat sein Losament bei mir. Der soll die Hochzeit beschreiben, was da alles verzehrt wird oder in Vorrat ist, weiters Tanz, Getafel, Geschenk –«
»So!« rief Herr Seibold. » Das hat Euer Gast zu schaffen?« Dabei ließ er die Gabel fallen. – »Wie – wie heißt denn derselbige Hochzeitbeschreiber?«
»Heinz von Höhenrain heißt er«, war die Antwort. »Sonst ein lustsamer, lebendiger Herr, gar scharf im Kopfe, das sag' ich Euch, und überaus freundlich ist er. Was hilft's? Er hat einen Feind, sagt er, der ihm überall in den Weg tritt und Verwirrung schafft, verschwärzt hat er ihn sicher auch schon an mehr Orten, glaubt er – 's ist nicht lange her, daß er da war – und wo er hinkommt, sagt Herr Heinz von Höhenrain, da sei der andere schon stets gewesen und mach' ihm seine Angelegenheit zunicht, daß er nichts mehr in Erfahrung bringe.«
»So sagt er?« knirschte Herr Seibold.
»Und das ist erst nicht alles. Denn zweimal hat er ihm schon seine Büchlein geraubt, und er hab' aller möglichen List und Gewalt bedurft, bis er sie wieder gewonnen.«
»So – also geraubt hat ihm der andere seine Büchlein? In der Tat, das hat er?« rief Herr Seibold. »O der Unverschämte!«
»Ja, das ist fürwahr unverschämt«, entgegnete der Elefantenwirt. »Den Herrn Seibold von – wie heißt er gleich – richtig, Seibold von Ofenstetten soll ja doch das Donnerwetter –«
»Was Ofenstetten – Seibold von Hochstetten heißt der Ehrenmann!« rief jener.
»Jawohl, Ehrenmann!« spottete der Wirt. »Aber es soll ihm so gut nicht ergeh'n, sagt Herr Heinz von Höhenrain. Wann ihn der Heinz trifft, ist er imstand und sticht ihm eines hinein. Das glaub' ich sicher – ich sag' Euch, der Herr Heinz zieht leicht vom Leder, hab's selbst gesehen.«
»Also umbringen will er ihn?« rief Herr Seibold. »Das wagt er laut auszusprechen, der Drangsalierer, der Spähvogel, der Räuber!«
»Was sagt Ihr? Spähvogel, Räuber nennt Ihr meinen Gast?!«
»Ja, ja, ja –« donnerte Herr Seibold, »nun hab' ich doch einen Zeugen, er geht auf Mord aus! Wißt Ihr, wen Ihr vor Euch habt? Ich bin Herr Seibold von Hochstetten, ich bin es selbst, auf welchen der Elende Lüg' über Lüge häuft, der mir meine Büchlein geraubt hat, versteht Ihr? Er hat sie mir geraubt, nicht ich sie ihm! Habt Ihr verstanden? Kreuzblitz, Donners, zehntausend Elefanten, auf der Stelle nehmt jedes böse Wort zurück, so Ihr über mich gesagt habt!«
»Wüßt' nicht warum!« war die trotzige Antwort. »Was soll ich Euch besser und mehr glauben, denn meinem Herbergsmann, so mir ausrichtete, Herr Hans von Frauenberg lasse ihn mir anempfohlen sein? Versteht Ihr, und aus dem Böhmischen hat er Brief und Vorweis zu seinem Auftrag für einen mächtigen Grafen –«
»So, für einen mächtigen Grafen? Was kümmert's mich! Er ist deshalb doch –«
»Nichts ist er, als ein trefflicher, feiner Mann,« tobte der Wirt, »mittlerweil' Ihr da hereinkommt und Schreck, Rumor und böse Nachrede aufschlagt. Schert Euch hinaus, oder ich mach' Euch Fußwerk, Ihr verlogener Gesell, Ihr!«
»Was, einen verlogenen Gesellen nennt Ihr mich?«
Auffuhr Herr Seibold und warf sich auf den Elefantenwirt. Längst hatte sich alles in die Nähe gezogen. Nun aber gab es ein großes Getümmel für und gegen. Gewaltsam wurde Herr Seibold zurückgerissen, der Wirt desgleichen. Aber er rang sich wieder los und drang auf Herrn Seibold ein.
»Laßt mich,« schnaubte er, »weg da, seid ihr Gäste, laßt den Wirt angreifen? Fort da, etliche, holt die Scharwache, der Gesell muß in die Keuche!«
Zwei von des Wirts Partei stürzten fort. Herr Seibold aber war alsbald auf einem Tisch und donnerte herab: »Holt sie nur die Scharwache, das soll Euch teuer zu stehen kommen! Ich bin wohlbekannt bei den Herzogen von Ober- und Niederbayern, ein Ehrenmann bin ich, weiland Klosterschreiber von Seldenthal, leb' als freier Mann und kann mir kein Mensch was nachsagen!«
»So, Klosterschreiber wart Ihr?« höhnte der Wirt. »Warum seids Ihr's denn nimmer, was habt Ihr denn etwan angestellt, daß sie Euch davonschickten?«
»Angestellt?!« Einen Sprung vom Tisch machte Herr Seibold, und im nächsten Augenblick waren er und der Elefantenwirt im heftigsten Kampf. Unglaubliches Geschrei erfüllte die Stube, nach allen Seiten hin wandten sich jene, die Menge aber ward zuletzt bis an die Türe gedrängt.
Nun aber fuhren ihrer viele übereinander, denn gewaltsam ward die Tür aufgestoßen.
»Scharwach', Achtung!« erscholl es. »Was ist da los?«
»Seht ihr's nicht?« rief der Wirt. »Da ist ein fremder Gesell hereingekommen, lästert die Welt und greift mich in meinem eigenen Haus an! Wer weiß, was er ist, er nennt sich einen Klosterschreiber und will Seibold von Hochstetten heißen!«
»So heißt er auch«, fielen mehrere ein. »Und ein Ehrenmann ist er von je gewesen, wir bezeugen's, da bleibt er!«
»Schweigt oder ihr geht mit!« donnerte der Führer. »Ihr folgt mir, Herr Seibold, oder wer Ihr sonst sein mögt!«
»Das ist nicht vonnöten,« fiel Herr Seibold ein; »ich stell' mich jederzeit freiwillig.«
»Nichts da,« war die rauhe Erwiderung, »macht Euch auf, sonst gebrauch' ich Gewalt!«
»Aber fragt doch erst bei Herrn Brunner da drüben, der steht gut für mich!«
»Was Brunner, was gutsteh'n, fort, zum letztenmal, oder ich laß Euch fesseln!«
»Fesseln?!« rief Herr Seibold. »Wohlan, ich geh', aber such' doch einer, ob er nicht den Herrn Brunner trifft, daß er seine Schritte tut – nun denn in Gottes Namen, wenn's nicht anders sein soll!«
Er verließ die Stube, alles drängte sich nach.
Da der Schwarm gegen das Gefängnis einlenkte, rannte einer herüber und rief: »Was gibt's da?«
»Das ist der verdammte Heinz von Höhenrain!« donnerte Herr Seibold. »Ha, du Teufel, jetzt kommst du mir nimmer aus!« Dabei wollte er ausreißen und auf seinen Feind losstürzen. Aber die mächtige Hand seiner Begleiter verhinderte ihn an der Sättigung seiner Rachelust. Ein Getob' und Gelächter schlug auf, und Herr Seibold setzte zornglühend seinen Leidenspfad fort.
Eine Türe tat sich auf – Herr Seibold trat ein – die Türe fiel wieder ins Schloß, drei Schlüssel knarrten – die Menge verlief – und Herr Seibold war in gänzlicher Einsamkeit.
»Ich eingesperrt!« lallte er. »Ich, der unschuldigste aller Menschen.«
Lange, wie angewurzelt, stand er. Dann fuhr er auf, den Kerker mit langen Schritten messend. Aber es war nicht viel zu messen, denn über den dritten Schritt mußte er nach allen Seiten schon das Bein überschlagen und umkehren in einer anderen Richtung.
Stunde um Stunde verfloß. Seine Ungeduld wuchs mit jedem Augenblick und alles war ihm begreiflicher, als daß er nicht vor den Vogt gebracht werde, damit er sich verantworten könnte – und daß Herr Brunner nicht käme, ihm die Früchte seiner Vermittelung anzukündigen und ihn in die Freiheit zurückzuführen.
Es war schon um die neunte Stunde, als sich ein Schubfensterlein in der Wand öffnete und ihm ein Krug Wasser hereingesetzt ward.
»Was? Wasser wollt ihr mir geben, als wär' ich schon verurteilt?!« grollte er durch die Öffnung in der Wand. »Donnerwetter und was soll's sein? Glaubt ihr, ich bleib euch die ganze Nacht herin? Ob ihr sogleich –!« Sein weiterer Grimm wurde nur von seinen vier Mauern vernommen.
Denn das Schubfensterlein fiel knarrend ein.
Wer Unrecht erlitten, erfaßt Herrn Seibolds Gemütsbewegung, wechselnde, stumme Verzweiflung und hinwieder erbitterte Rührigkeit. Bald warf er sich auf den Sitz von Holz, bald fuhr er auf und in eine Ecke, bald am Gitterfenster zwängte er sich empor, denn er war in beständiger Erwartung, es möchte doch jemand kommen und ihm Befreiung ankündigen. Aber so auch von Zeit zu Zeit mehrere vorüberschritten, stehen blieb keiner.
»Herr Brunner hat offenbar nichts davon erfahren,« rief er vor sich hin, »sonst müßte er ein Zeichen von sich geben, er müßte!«
Herr Brunner hatte es in der Tat sehr spät erfahren, was vorgefallen. Dazu stand auch die Sache so, daß augenblicklich nichts zu erzielen war. Sein erster Gang war also wohl zu Gericht, da war jedoch Tür und Tor verschlossen. Es blieb ihm demnach nichts übrig, als Herrn Seibold zu vertrösten.
Eben war letzterer wieder am Gitterfenster, weil er Schritte hörte. Es waren die des Herrn Brunner. Der wollte herein. Aber die Wache ließ sich weder durch gute Worte noch Geld bewegen und wies ihn an das Fenster, insoferne er etwas zu sagen habe.
Es blieb keine Wahl. Herr Brunner goß ein volles Maß des Bedauerns in das Gefängnis, versprach, morgen mit dem frühesten die nötigen Schritte zu tun, versicherte, daß man auf etliche Erholungen, namentlich des Büchleins wegen, entsprechenden Wert legen werde, und daß für Herrn Heinz von Höhenrain sicher die Zeit der Strafe kommen werde. Damit wünschte er wiederholt Ruhe, Geduld und Ergebung und verließ den Steinantritt, auf welchem er gestanden.
Kaum war er fort, stand ein anderer auf dem Stein und höhnte hinein: »Habt Ihr gehört, Herr Seibold, was der Herr sagte? Die Zeit für Heinz von Höhenrain wird kommen, daß er gestraft wird. Ha, ha! Das mag Euch trösten! Gute Nacht, Herr Seibold, laßt Euch's wohl träumen, Ihr hättet mich schon!«
Einen großen Schrei des heftigsten Grimmes sandte Herr Seibold zum Gitterfenster hinaus.
Sein Feind aber lachte in teuflischer Wonne auf, er verschwand – und gähnende Grabesruhe stellte sich ein.
Sprachlos vor Staunen über das Unmaß von Bosheit ließ Herr Seibold vom Fenstersims ab und taumelte zur Bank.
* * *
Die Nacht verstrich, der ganze kommende Morgen – und Seibold ward immer nicht befreit. Herr Brunner ließ sich keinen Gang gereuen, aber es schien, als hätte er Herrn Seibolds Schicksal übernommen. Wohin er sich wendete, – der und jener nicht da – und Herr Heinz von Höhenrain, der mit ihm zusammengeführt werden sollte, war nicht ausfindig zu machen. Zuletzt gelang es Herrn Brunner dennoch die vorläufige Befreiung zu erwirken. Er mußte aber gutstehen, daß jener sich sonder Erlaubnis nicht von Landshut entferne. Diese Verfügung war durch die Einstimmung des Elefantenwirtes ermöglicht. Letzteren hatte Herr Brunner bei nachbarschaftlicher Liebe beschworen, und so hatte er sich beschwichtigen, auch durchblicken lassen, daß er von weiterer Verfolgung der Sache absehen wolle, so sich Herr Seibold beruhige.
Herr Brunner eilte, so schnell er konnte, seinem Freunde die Türe des Gefängnisses öffnen zu lassen. Es war schon um Mittag. Vieles war vorgefallen, was Herr Brunner selbst gerne mit angesehen hätte, als was Vermählung und all anderes betraf.
»Ihr werdet auf der Stelle frei!« rief Herr Brunner durch das Eisengitter hinein. Als er in den Eingang trat, war niemand da, als ein Soldknecht. Der schritt mit seiner Hellebarde ab und zu. Der Gefängniswärter aber war fort, das und jenes mit anzuschauen. In kurzem, statt augenblicklicher Befreiung, mußte Herr Seibold gefangen bleiben und es schlug drei Uhr, eh' er ins Freie kam.
In stummer Verzweiflung folgte er seinem Freunde, der ihn tröstete und vieles erzählte – auch vom baldigen Turnier des Herzogs Christoph mit dem Polen.
»Aber Ihr seid sicher bei Eßlust?« fragte er dann. »Oder habt Ihr schon zu Mittag gegessen?«
»Zu Mittag?« fragte Herr Seibold, »ich hab' nicht nur nicht zu Mittag gegessen, sondern auch nicht gefrühstückt und gestern abend nicht zu Nacht gespeist. Sie haben mir nichts gegeben, als heute morgen dies Stück Brot. Aber ich hab' es nicht gegessen. Dies Brot muß für ewige Zeit aufbewahrt werden, solange es Hochstetten in der Welt gibt. Wollt Ihr mir gestatten, so geh' ich in die nächste Schenke und stärke mich. Dann geh' ich zu Euch und werfe mich aufs Lager, denn ich bin todesmüd' und habe die ganze Nacht kein Auge geschlossen. Ein neues Büchlein will ich mir auch kaufen.«
»Also wollt Ihr doch nicht alles aufgeben?«
»Nein, nein, nein, dableiben will ich jetzt gerade!« rief Herr Seibold, »vielleicht hat sich mein Unglück erschöpft. Morgen, eh' ich ausgehe, ist im Büchlein wieder alles rubriziert, all' Euere Mitteilungen sind eingetragen. Dann wart' ich nur das Turnier ab, wovon Ihr mir sagtet – meinetwegen hauen und stechen sie sich einander tot – ich geh' in kein Getümmel mehr, denn will ich mir was aufschreiben, geschieht sicher wieder ein Unglück. Ihr werdet mir's schon sagen, wie und was – versteht Ihr, ich aber wende mich zur Fischerei und womöglich an die Hofküchen wegen des Hochzeitsmahles!«
»Aber das Turnier sollt Ihr einmal nicht versäumen,« sagte Herr Brunner. »Ist's doch eine Sache, die im ganzen Reich herumkommen wird. Ihr seid nur übel gestimmt. Mit dem Hochzeitsmahl dürftet Ihr billig warten bis übermorgen. Ist's vorüber, bekommt Ihr das Verzeichnis weit leichter. Kommt, da ist eine Schenke – und hier ist der Schlüssel zu unserer Haustür – eßt und trinkt, daß Ihr zu Kräften kommt, dann geht heim und schlaft! Bis Ihr wieder erwacht, will ich selbst mit dem Grafen Sandizell reden, wie Euch am besten zu dienen sei, daß Ihr Euch nicht soviel plagen müßt. Das beste wäre freilich, Ihr hättet Euch sogleich anfangs an Herzog Georg oder Christoph gewendet. Aber so Ihr auch jetzt wolltet, ist noch nicht beizukommen, mindestens bis übermorgen. Also seid nur getrost, der Sandizell läßt Euch nicht fallen, im übrigen müßt Ihr Euch eben die Müh' nicht reuen lassen, und wo möglich werde ich zu dem und jenem ein Wort sagen, daß Ihr kommen würdet – dann weiß man von Euch und Ihr werdet leichter angehört. Damit gehabt Euch wohl!«
Herr Brunner ging seines Weges, Herr Seibold in die nächste Schenke. Wunderbarerweise war's ihm gegönnt, sein Mahl ruhig zu verzehren. Drauf säumte er nicht länger, begab sich auf den Heimweg, kaufte sich ein neues Büchlein, und, als wär' ein besserer Stern aufgegangen, nicht das geringste widerfuhr ihm, bis er in Herrn Brunners Losament gelangte.
»Haben sie Euch doch wieder 'rauslassen, Herr Seibold von Hochstetten?« sagte Winfriedl.
»Ja, Herr Winfriedl, sie haben mich doch wieder herausgelassen«, antwortete jener, in seine Stube tretend.
Einen Fuß stellte er auf den Braun-Lederstuhl, gab sich einen Schwung und dalag er der Länge nach auf dem Bett.
Eh' fünf Minuten verstrichen, schlief er und furchtbare Träume mochten über ihn hereinbrechen. Denn gewaltig runzelte er die Augenbrauen, mehrere halbe Worte augenscheinlichen Zornes lallte er und die Hände ballte er öfters oder er bewegte sie, wie in wilder Angriffslust.
Offenbar sah er seinen Feind vor sich.
»Aber das ist ein harter Schlaf«, meinte Winfriedl, der das alles mit ansah, und näherte sich. »Meine Mutter hat mir gesagt, wenn einer hart schlaft und schwere Träum hat, soll man ihn aufwecken. Das tu' ich. Herr Seibold – Herr Seibold!« Dabei rüttelte er ihn am linken Arm.
»Was, angreifen wollt Ihr mich, Herr Heinz –?!« rief Herr Seibold, mit dem rechten Arm holte er mächtig aus und ein riesenhafter Schlag erscholl auf des Winfriedl Angesicht. Mit einem Schrei des höchsten Schreckens wollte Winfriedl das Weite gewinnen, aber er vermochte es nicht. Denn halb schlaftrunken fuhr Herr Seibold auf, faßte ihn mit aller Gewalt und rüttelte ihn unter Ausbrüchen grimmiger Wut, bis er ganz zu sich kam, worauf sich alles aufklärte.
»Ich bitt' Euch tausendmal um Vergebung,« sagte Herr Seibold – »Herr Winfriedl, Ihr hattet die beste Absicht, ich weiß – ich danke Euch, Verehrtester –«
»Ist gern geschehen,« sagte der Winfriedl – »recht gern – wünsch' beste Ruhsamkeit –«
»Ich dank', ich dank'.« Und im Augenblick lag Herr Seibold wieder auf dem Bett.
»Tut mir – sehr leid, sehr leid« – sagte er, nachdem er schon die Augen geschlossen hatte und sie noch einmal öffnete.
Wer aber nicht mehr da war, war Herr Winfriedl.
* * *

Um vier Uhr nachmittags hatte sich Herr Seibold zur Ruhe begeben. Viele, viele Stunden später wachte er auf. Da war es zehn Uhr morgens.
Bis er seinen Morgenimbiß, welcher bereit stand, zu sich genommen, weiters sein Büchlein eingerichtet hatte, verflossen wieder ein anderthalb Stunden. Es drängte ihn auch nicht so sehr aus dem Haus. Denn obschon er sich anders besonnen hatte und das Turnier mit ansehen wollte, dabei er gar nicht begreifen konnte, daß er gestern bei all seinem Zorn so wenig Wert auf dasselbe gelegt, dachte er doch, vor Mittag käm' es nicht zum Rennen.
Er irrte aber.
Als er das Haus verließ, in dem er sich ganz allein befunden hatte, und eine Straße weiter kam, strömten ihm schon die Menschen entgegen, ungeheuerer Jubelruf erscholl, und er vernahm, wie es dem Polen im Kampfe mit Herzog Christoph ergangen sei.
»Um das erhabene Schauspiel hat mich der verwünschte Elefantenwirt gebracht«, zürnte Herr Seibold. »Aber nun ist's einmal so«, setzte er milder bei. »Gott sei nur gedankt, daß deutsche Kraft und Geradheit über die gottverdammte fremde List gesiegt hat. O Herzog Christoph, was seid Ihr ein Held, was seid Ihr die Ehre und der Ruhm dieser und aller Lande! Ha, das entschädigt mich für alle meine Leiden und gibt mir neuen Mut zu meiner Sache! Also wohin jetzt? Die Grafen und alle die vornehmen Herren sind jetzt nicht zu haben, des Sandizell Kanzlei ist sicher auch noch geschlossen, denn die Schreiber waren gewiß beim Turnier, und jetzt ist's ein Gered' und ein Erzählen und ein Gejauchz' – da ist's also nichts. Wohin denn also –?« Er tat etliche Schritte weiter. Dann nahm er plötzlich einen rascheren Tritt. »In die Steckengasse!« sagte er.
Sogleich darauf streifte er an jemand.
»Ach, Herr Leo Hohenecker!« rief er ganz erfreut.
»Ihr seid doch noch gestern frei geworden! Erst da Ihr eingesperrt wurdet, hörte ich von Euerer Anwesenheit. Könnt glauben, daß ich teil an Euerem Schicksal nahm. Jetzt eben wollte ich Euch heimsuchen. Ihr wohnt beim Herrn Brunner. Ich hab' auch etliche Gänge für Euch gemacht – aber mehr konnte ich nicht, als für Euch und Euere Ehrenhaftigkeit einstehen, und da gebrach's mir an Zeit, ehevor ich zu den rechten Leuten kam. Ihr wißt ja wohl, ich hab' auch Geschäfte –«
»Viel Dank, viel Dank,« erwiderte Herr Seibold, »weiß schon, daß Ihr ein Ehrenmann seid, der seinen Nebenmenschen dienlich sein mag, wo und wie er kann. Und weiß, daß Ihr Geschäfte habt, ha, ha, nicht wahr, Ihr habt's mit den Fischen?«
»So ist's. – Wo geht Ihr denn hin? Kommt Ihr ein wenig und schaut Euch bei den Fischen um –?«
»Gern, o gern«, fiel Herr Seibold ein. »Ihr kommt mir höchst erwünscht! Was für Fische habt Ihr denn alle?«
»Nun was, lauter gute. Hechte, Karpfen, Schlei'n, Braxen, Sälblinge, Huchen, Waller, das wär'n Euch weiters Gesellen – was soll ich da alles aufzählen. Krebse auch, die schwere Menge.«
»So, so, Krebse? Nun ja, versteht sich – habt wohl auch von den großen aus Welschland –?«
»Ei gewiß und sicher!«
Bald später befanden sich beide in der herzoglichen Fischerei.
Da wimmelte es von Butten, Kufen, Ständern und Netzwerk Gleich rechts drüben wogte und krappelte es gewaltig durcheinander. Dort waren die kleinen Krebse. Das waren in die Tausend und Tausende.
»Ei, ei, wißt Ihr, daß mich das kindisch freut«, sagte Herr Seibold. »Das Gewühl und das Gearbeit' seh ich für mein Leben gern – und speisen, speisen – ich sag' Euch, eine solche Krebsscher', lieber ist mir gar nichts!«
»Nun schaut Euch recht um, fragt und schreibt auf, was Ihr wollt – ich hab' dort was zu schaffen, soviel ich seh'. Wollt Ihr die Seekrebse – die sind hier herüben und die Hummer.«
Dabei verließ ihn Herr Leo Hohenecker.
»Seekrebse und Hummer, was hat er gesagt, Hummer? Was müssen denn das für Tiere sein? Die muß ich gleich sehen!« Er eilte an den bezeichneten Ort. »Kreuz, Blitz, Donners, das ist ein Volk! Man soll gar nicht glauben, daß die Natur solche sonderliche Tiere hervorbringen kann, was Wetter, schau'n die Gesellen aus!«
Eine Weile betrachtete er sie und erlustigte sich ungemein an dem Gekrabs und Gescharr und Gezieh'.
»Ha so, das sind ganz närrische, ganz absonderliche Kameraden!« Er konnte sich nicht versagen, sie ein wenig zu irren und zu necken. Das ging vorerst ganz gut von statten und wuchs Herrn Seibold der Mut jeden Augenblick. Aber der Krug geht zum Brunnen, bis er bricht. Eh' sich's Herr Seibold versah, waren seine zwo Zeigefinger zwischen zwo mächtigen Scheren, daß er laut aufschrie. Während er sich bemühte seines Feindes los zu werden, fuhr er mit seinem Mantel über die Genossen seines Angreifers und von diesen klammerte sich alsogleich eine gute Zahl an. Einer aber von den größten machte Anstalt, Herrn Seibold durch Mantel und Ärmel hindurch zu begrüßen.
An Finger und Arm zugleich und dazu die ganze übrige Schar, das war eben keine Kleinigkeit, und Herr Seibold konnte nicht umhin, in einen sehr hörbaren Hilferuf auszubrechen.
Allerorten rannten die Fischer auf ihn zu, Herr Leo Hohenecker war auch dabei.
»Was habt Ihr denn da gemacht?« rief letzterer.
»Helft mir nur von den Ungetümen!« flehte Herr Seibold. »Hätt ich keine Handschuhe an, meine zwo Zeigefinger wären wurz weg! Hei, Teufel Dings, und macht nur, daß mir der Elefant da von meinem Arm' wegkömmt!«
Ein großes Gelächter schlug auf, dabei nicht versäumt ward, ihn von seinen zwei ärgsten Feinden zu befreien. Es kostete gleichwohl einige Mühe.
»Und nun die, die verwünschten Gesellen da!« rief Herr Seibold. »Seht Ihr denn nicht, daß mein ganzer Mantel voll Krebse hängt – Blitz, Wetter, da hat mich schon wieder einer in der Arbeit – weg damit – ich will von der Sach' auch nichts mehr wissen, da hab' ich wieder kein Glück, schier, daß ich Hand an meine Aufgabe lege.«
Es währte etliche Minuten, eh' Herr Seibold aller Krebse los war, und so zornig und bestürzt war er, als er dem Ausgange der Fischerei zueilte, daß er einen riesengroßen Kalter übersah, der halb über den Weg stand. Nicht sanft schlug er nieder und wenig fehlte, wäre er völlig in selbigen Kalter gefallen, drin die größten Hechte hin- und herschwammen.
»Ging mir just noch ab,« rief Herr Seibold, »daß mich die Hechte bei lebendigem Leibe fräßen!« Auf raffte er sich, so schnell er konnte, und eilte unter allseitigem, gutmütigem Zuruf des Bedauerns hinaus.
Erst als er draußen war, fiel ihm der sonderbare Zustand seines Mantels auf. Zur einen Hälfte war er ganz durchnäßt, in der Gegend des einen Arms aber und auf der sämtlichen einen Seite und Länge hinab war ein Riß um den anderen.
»Ich bin ja wie in einem Sieb!« klagte Herr Seibold. »Das ist mir wieder eine schöne Angelegenheit, 's ist nur gut, daß die Sonne warm scheint.«
Er nahm den Mantel ab und wand ihn aus. Plötzlich fiel ihm sein Büchlein ein. Rasch griff er in die Manteltasche.
Wo – wo ist denn mein Büchlein!« Es war nirgends zu finden. »Herr, heiliger Gott – das ist mir sicher zu den Hechten ins Wasser gefallen!«
Er warf den Mantel auf den nächsten grünen Grasfleck, unweit zweier Wachthunde, eilte in die Fischerei zurück und schaute in den Hechtkalter.
Richtig sah er, was er suchte, aber auch wie die Hechte drauf losschwammen oder dranstießen.
»Wart', ich will euch, wart', ich will euch!« grollte er vor sich hin, streifte schnell den Ärmel auf und griff ins Wasser.
»Was geht da vor?« donnerte es ihm ins Ohr. Just war ein Fischergehilfe eingetreten, der von allem früheren nichts, vom Büchlein aber am wenigsten wußte, und gewaltig packte er Herrn Seibold am Arm, gerade an der Stelle, wo sich vorher der Seekrebs heimisch gemacht hatte.
»Was soll das, was packt Ihr mich denn so wütend?« flehte Herr Seibold – »ich will ja nichts als –«
»Nichts als Hechte stehlen!« fuhr ihn jener an. »Das soll Euch teuer kommen!«
»Was? Ich Hechte stehlen?« rief Herr Seibold, während alles zusammenlief. »Ich schwöre Euch –«
»Fort da einer, um die Wache! Oder haltet ihn, ich hol' sie –!«
Es war Herrn Seibolds Glück, daß Herr Leo Hohenecker auch herbeigekommen war. Diesem erzählte Herr Seibold, was er gewollt und wie sein Büchlein ins Wasser gekommen sein müsse.
»Was da, glaubt ihm nicht«, polterte der Fischergehilfe. »Das ist die alte Ausrede – drin liegt's, aber er hat's mit Absicht hineingeworfen.«
»Wie könnt Ihr mir so schnöde List nachsagen?!« fuhr Herr Seibold auf. »Ob Ihr das sogleich zurücknehmt! Wißt Ihr, wen Ihr vor Euch habt? Ich bin Herrn Leo Hoheneckers, Eueres Herrn, Freund und nenne mich Seibold von Hochstetten.«
»Der seid Ihr?« gab jener zurück, einen Blick auf seinen Herrn und Gebieter werfend, der ihm abwinkte. »Wenn's so ist, so ist's was anderes, will auch Euer Unheil nicht vermehren, habt ja schon genug gehabt –«
»Was geht das Euch an?«
»Soviel als andere! Die Stadt spricht davon, also red' ich auch davon!«
»Schweigt!« befahl Herr Leo Hohenecker.
»Wohl, wohl,« war die Antwort, »soviel hat man von bester Absicht. He da, drei heraus, das Faß herein!«
Und schritt mit ihrer drei hinaus. Voraus, sehr rasch, Herr Seibold von Hochstetten – der hatte vorher noch einen kecken Griff getan und sein Büchlein wieder erobert.
Als er hinauskam, eilte er sogleich auf den bewußten Grasfleck. Wie angewurzelt blieb er stehen – denn sein Mantel war verschwunden.
»Man hat mir meinen Mantel geraubt!« lallte er. »Alle Wetter, wo ist er hin, wo ist der freche Räuber!« Er wollte eben zur Vortüre hinaus – als er ein Knurren und zu gleicher Zeit ein unbändiges Lachen hinter sich vernahm. Er wandte sich und sah das Unerhörteste – nichts Geringeres als dies. Die zwei Wachthunde hatten sich über seinen Mantel gemacht, waren in Kampf geraten, hielt ihn der eine an dem, der andere an jenem Ende und zerrten und zogen und knurrten hin und her, da und dorthin – es war entsetzlich anzuschauen.
»Ha, ihr Teufel!« schrie Herr Seibold außer sich vor Wut, stürzte auf sie zu und schleuderte sein Büchlein dahin. Aber es fruchtete nichts mehr, als daß die zwei Tiere wie der Wind davon und zur Vortüre hinaus scheuchten, dabei sie den Mantel hinter sich herschleppten – und da Herr Seibold in unsäglicher Eile sein Büchlein aufgehoben hatte, dann aber gleichfalls hinausstürzte, mußte er in der Ferne nicht allein den früheren Anblick, sondern einen noch gräßlicheren bezeugschaften. Denn es waren gegenwärtig nicht mehr zwei Mantelzerrer, vielmehr hatte sich gegen ein halbes Dutzend neuer Kampfgenossen eingefunden, welche ihre Kraft und Begierde vor einer großen Menge Menschen an den Tag legten, die unter Frohlocken zuschauten.
»Seid ihr auch Christen, ha,« rief Herr Seibold, hinzustürzend, »daß ihr eines Mannes Eigentum mit Wonne vernichten seht?! Her da, weg da, meinen Mantel will ich!«
Und drauf los und seinen Mantel ergriffen. Im selben Augenblick aber war der letzte Widerstand des Mantels zu Ende. Längst war er schon zerrissen und zerfetzt, jetzt fuhr er in so viel Stücke, als vierfüßige Kämpfer dagewesen waren. Hiebei riß der eine ein solches Stück ab, daß vom ganzen Mantel auf der Walstatt nichts liegen blieb als ein Gewickel von Tuchstreifen sehr ungleicher Breite und Länge. Mit allem übrigen jagten die Mantelräuber davon. Mit dem letzten derselben kämpfte Herr Seibold in unaussprechlichem Grimm, konnte ihm aber seine weitere Beute nicht abringen, vielmehr erzweckte er nur eine weitere Teilung, bei der ihm der Stehkragen des Mantels mit zwei langen Tuchbändern in Händen blieb. Mit der Gebärde gerechtester Verzweiflung, die keine Worte zu finden vermochte, schleuderte er seine Errungenschaft zu Boden, aber er fand keineswegs, daß man seinem Schmerze die gehörige Gerechtigkeit widerfahren ließ. Im Gegenteil. Zu seiner wenn möglich noch größeren Entrüstung mußte er sehen, daß sich ein und der andere über die Streifen hermachte, sie auf den Schlapphut steckte oder sonst loses Spiel trieb – nächst drängte sich ein Soldknecht hindurch, schlug ein derbes Lachen auf und rief: »Ihr seid's! Herr Erbkunig von Jerusalem? Mir müßt Ihr auch was lan!«
»Ihr wollt mich wieder verspotten?« fuhr Herr Seibold auf.
Gar wohl erkannte er den Mann.
»Was ist denn da los?!« rief wieder eine andere Stimme. »Gebt mir doch auch was!«
»Kreuz, Blitz, Teufels Donnerwetter, zehntausend Räuber!« donnerte Herr Seibold. – »Das ist der Heinz von Höhenrain! Jetzt kommt Ihr mir nimmer aus!« Und wollte auf ihn zu. Aber er ward weggedrängt, es half kein Drohen, kein Erklären, er konnte nicht durch die jubelnde Menge, die von der Gerechtigkeit seines Grimmes keine Ahnung hatte. Im nächsten Augenblick sah er die Reste seines weiland Mantels hoch auf einem Spieße, fort rannte der Soldknecht damit, daß die Streifen weit ausflatterten, die ganze Menge aber hinterdrein, lachend, lustig tobend, und einer um den andern sprang hoch, sich ein Stücklein abzureißen. Zuletzt schleuderte jener die wallende Zierde des Spießes fort, daß sie weit weg zu Boden fiel. Drauf warf sich gleich eine ganze Zahl, riß und rang sich ab um Streif, Stück und Schleißlein und trug's mit Siegesjubel davon.
»Das ist zuviel, zuviel!« stotterte Herr Seibold. »Und das ärgste, das ärgste von allem – was hab' ich denn verbrochen, daß mich das Unglück, der Spott so verfolgen darf – ha! der heillose, der unerhörteste aller Gauner, die 's auf der ganzen Welt gibt – der Satanas von einem Heinz von Höhenrain, der hat's auch mit angesehen! Mitgetan hat er, er, der mich ins Gefängnis gebracht hat! Und jetzt steh' ich da im bloßen Kamisol, wie ein Vogel ohne Federn. Kreuz Blitz, Donners, was ist da zu tun?«
»Da ist nichts zu tun, als Ihr kauft Euch einen neuen Mantel«, erklang's hinter ihm. »Wünsch Euch guten Abend, Herr Seibold!« Dazu einen kleinen Schlag auf die Schulter.
Rasch wandte sich Herr Seibold. Es war, als ob ihn der Blitz träfe – wen sah er? Niemand anderen, als Herrn Heinz von Höhenrain, der flüchtigster Ferse fort und um die nächste Ecke eilte.
»Nach, nach, nach muß ich ihm!« Mit wutersterbender Stimme lallte es Herr Seibold und folgte.
Herr Seibold, von der Ecke weg, die ganze Straße hinab stürzen, Haus um Haus in die Türen schaun, wo immer sie offen standen – hinüber, herüber – fragen hier, dort, den, jenen – nichts war vom Heinz von Höhenrain zu ergründen.
Fort war er, verschwunden, wie das erstemal.
Ganz verwirrt ließ sich Herr Seibold auf die nächste Bank nieder und erzählte teilnehmenden, älteren Leuten in ziemlich abgerissener Rede, was ihm begegnet sei.
Es blieb nichts übrig als sich beim nächsten Trödelkram einen Mantel zu kaufen. Der Standherr war der gelbe Aaron. Selbiger stammte aus dem Jerusalemitischen, hielt sich aber zumeist in Land Franken auf und gab es sonstwo Geschäfte, ließ er sich aber auch weiter in die Welt zerstreuen.
»Gebt mir einen handsamen, doch wohlfeilen Mantel!« sagte Herr Seibold. »Mit dem, so ich zuletzt getragen, ist mir ein Unglück begegnet. Ich sag' Euch, man soll's kaum glauben!«
»Nu, was sellst es nit glaaben?« kam's entgegen. »Hett' doch a jeglich sein Schicksal – na wa so? Kummt eppes Krumms sou über die Quer, maußt'r nit schmolln – nu was! Worum? Hab'n zerrissn ä Mäntelein, hab'n gerüttlet, hab'n knurrt, gezog'n, hab'n geschüttelt – was schad's Aich, versteht'r, da Ihr seid ä Mann, ä Mann, der hat Geld – kaaft Ihr wieder ain anders Mäntelein –«
»So meint Ihr, und meinen Zorn rechnet Ihr für nichts!« fiel Herr Seibold ein.
»Wo so Zorn, wozu grauß Geraisch und Romor? Um was? Wo so? Was soll'n sag'n wir, wann wir sain doch ehrliche Jüden und sain geriss'n und sain gezupft und sain gerupft und sain zerhackt und zersplitt', as lang ist zu denk'n in der Zait! Nu wa – sollste nichts tun, denn schmoll'n und sain brummig und scheltst und klagst de – nu wa, werd's besser? Sag' ich Aich, da ist –«
»Was ist? Nichts ist!« zürnte Herr Seibold. »Ich will nichts als einen Mantel. Da seh' ich einen, der wär' nicht übel und viel kosten wird er auch nicht – wenn er mir nur nicht zu kurz ist – dafür geb' ich Euch einen Goldgulden.«
»Wann ich Aich geb' die War', will ich doch sain kein ehrlicher Mann – geb' ich doch nicht von mir das Gewand.«
»Warum hängt Ihr ihn denn daher? Oder verlangt Ihr mehr?«
»Also Ihr wollt hab'n das Gewand?«
»Nu ja, ja, macht's nur richtig, was kost' er?«
»Also wann Ihr wollt hab'n das Mäntelein, versteht Ihr, das ich möcht' behalten für einen andern, sollt Ihr's hab'n um anderthalb Goldgülden.«
»Wetter, das ist verzweifelt viel Geld!« seufzte Herr Seibold. »Sagt mir nur eins, bedeucht Euch der Mantel nicht selbst zu kurz für mich?«
»Wo so, zu korz? Ist doch schöner's zu seh'n auf der Welt nichts als solich ä hauche, lange, versteht 'r, solich ä vornehme Größ', versteht 'r, und solich ä korz Mäntelein.«
»Wetter, daß Euch – da habt Ihr das Geld –!« Herr Seibold zahlte, warf den Mantel um, steckte sein Büchlein in die Seitentasche und ging rasch seiner Wege.
Er war nicht dreißig Schritte weit gekommen, als er bemerkte, daß die Leute stehen blieben und ihn mit sonderbaren Blicken betrachteten, und als er sich einmal umwandte, sah er, daß man ihm nachschaue.
»Ei, ei,« murmelte er vor sich hin, »am Ende ist der Mantel doch zu kurz, alle messen mich!«
Unschlüssig stand er, als er Herrn Brunner des Weges dahereilen sah.
»Ah, Ihr seid hier zu finden?« sagte Herr Brunner. »Ei, was hab' ich denn eben von Euch gehört, die Hunde haben Euch Eueren Mantel zerrissen – ah, da habt Ihr schon wieder einen – beim Himmel, Herr Seibold, was seh' ich denn da! Den Mantel habt Ihr beim gelben Aaron dort gekauft? Was fällt Euch denn ein?«
»Nicht wahr, Ihr findet ihn auch zu kurz für meine Gestalt, und geht er denn gar so knapp –? Er hat eben auch wenig gekostet – ich sag' Euch, was das Geld dafür anbelangt, ist der Handel nicht schlecht – anderthalb Goldgulden, das ist in der Tat wenig.«
»Was wenig!« sagte Herr Brunner. »Den Mantel könnt Ihr einmal und in Ewigkeit nicht tragen!«
»Ja, warum denn nicht? Ich lass' halt oben einen Breitkragen ansetzen, da sieht man den eingesetzten Teil nicht und unten wird er um soviel länger –«
»Was lang, was kurz,« erwiderte jener, »nur herunter damit, wenn Ihr nicht wollt, daß halb Landshut zusammenläuft. Das ist ja der Mantel vom schwarzen Barnabas, den sie vor drei Jahren hinausgestäupt haben. Seit der Zeit hängt er beim Levi unterhalb Sankt Martin und hat ihn kein Mensch gekauft. Nun kommt er an den gelben Aaron, der hätt' ihn mit fortgenommen – und Ihr Unglückseliger kauft ihn!«
Das Wort »schwarzer Barnabas«, und Herr Seibold den Mantel von den Schultern reißen, das war eins gewesen. In unsäglichem Grimme stürzte er auf den Trödlerstand zu.
»Wie könnt Ihr mir den Mantel aufhängen?!« donnerte er in denselben. »Ha, Ihr hinget mir des Teufels feuerroten Mantel um und schnalltet mir einen Bocksfuß auch noch dazu an, so Ihr nur ein Geschäft macht!« Zugleich wickelte er den Mantel zusammen und schleuderte ihn Herrn Aaron aus dem Jerusalemitischen an das langgebartete Haupt. »Auf der Stelle gebt mir meine anderthalb Goldgulden heraus oder ich verklage Euch!«
»Nun was groß Geschrai, was Meluha,« rief Herr Aaron, »habt Ihr doch gewollt das Gewand. Hab' ich Aich gesagt, das Gewand geb' ich Aich nit, habt Ihr gerufen, das Gewand wellt Ihr, hab' ich Aich gesagt, wann Ihr wellt' das Gewand, verlang' ich anderthalb Goldgülden. Na wo? Hab' ich Aich nicht gesagt, daß ich möcht' geben das Mäntelein an andere Lait – nu was, wo List, wo Betrug?«
»Und dennoch habt Ihr mich betrogen!« rief Herr Seibold – »laßt mich doch, Herr Brunner, der Jude muß mir mein Geld wieder geben!« Und drang auf den gelben Aaron ein. Der erhob ein unsinniges Hilferufen und ergoß sich in alle möglichen Verwünschungen, von denen übrigens niemand etwas verstand. Die Schlacht hätte sicher nicht anders als mit dem Umsturz des ganzen Trödlerstandes und unausweichlicher Verwicklung sämtlicher Juden und Christen geendet, wenn nicht glücklicherweise der Vogt des Weges geritten wäre. Der sprengte gleich an und trennte mit seinem mächtigen Rufe, was da in Streit lag.
Er hörte beide Teile an und schnaubte dann: »Jude, Geld herausgeben. Brrrr! Oder verlangt Ihr mehr, Herr Seibold? Brrr! Dann wird die Summe ermessen – der Mantel aber konfisziert – brrrrrr!«
»Das soll er, das ist recht!« rief Herr Seibold. »Ich verlange mehr, ich verlange im ganzen zehn Goldgulden. Was über mein eigenes Geld ist, werde ich den Armen verabreichen lassen.«
»Also das wollt Ihr? Brr!«
»Ja, ja, ich will's! Her da, Jude, her da, sag' ich, mit den anderthalb Goldgulden, im andern wirst du auch nicht lang zaudern!«
»So nicht«, herrschte der Vogt. »Ihr verlangt im ganzen zehn Goldgulden. Brr! Drum habt Ihr ihn anzuklagen! Die anderthalb aber –«
»Was? Zuletzt nähmt Ihr sie zu Gerichtshanden?« rief Herr Seibold. »Nein, das soll nicht geschehen, weiß der Himmel, wann ich da wieder zu meinem Geld käme! Ich will lieber nichts von allem weiteren wissen – her da, Jude, mit dem Geld für den Mantel, dann sind wir fertig!«
»Auch recht!« versetzte der Vogt. »Gelber Aaron, heraus mit den anderthalb Goldgulden! Brr!«
»Und was soll ich haben kain' Ersatz?« rief der gelbe Aaron. »Allerhauchgnädigster Herr – nu was? Seht Ihr doch liegen umher all' mein Sach' und Gewand, ist mir zerdrückt und zerarbait', ist mir verderbt und zerrissen. Das und jenes, und bin ich doch worden vergriffen ganz mit Unrecht – hab' ich nicht g'sagt, daß ich ihm nicht will geben das Mäntelein? Nu, wo so Betrug, nu wo so List und Schalkhait? Hat er's doch wöll'n haben von ihm selbst und hat mich dann gefaßt und hat mir verderbt mein gut Gewand und all' meine War'. Wann ich auch bin ein armer Jüd, nu – bin ich doch ein Mann, der hat erworben sein Wenig's mit Plag und viel Sorg', und hab's erworben mit viel Schwaiß und viel Müh' und hab' ich doch gegeben für ein jed's mein gut's Geld – nu was, soll ich mir lassen zerzausen, zerknittern, zerarbaiten, zerschaben, zerfetzen soviel gute War', daß ich hab' zr raiben und zr legen und zr klopfen über einen halben Tag? Nu, wo so – was soll ich geben zarück das Geld, da ich verlang' Schadensersatz?«
»Also Ihr verlangt Schadensersatz? Wie viel? Brrr!«
»Nu, was werd' ich verlangen? Will ich doch kommen in korzem aus der Sach' – verlang' ich anderthalb Goldgülden.«
»Brr, brr! So wird der Schaden abgeschätzt werden. Vorerst bezahlt das Geld!«
»Ja, das soll er!« rief Herr Seibold.
Unaussprechlich ungern zog der gelbe Aaron das Geld hervor.
»So, jetzt wird sich Euer Schaden schon herausstellen.«
Dabei wollte Herr Seibold das Geld nehmen.
»Halt, so nicht – Wetter, Schadensersatz! Wird der Schaden geschätzt – was bleibt, wird Euch zu Handen gestellt. Brrr!« Der Vogt steckte die anderthalb Goldgulden ein und ritt davon, den Mantel warf er seinem Begleiter zu.
Wie versteinert stand Herr Seibold eine Zeitlang.
»Das ist zuviel, zuviel!« stammelte er. »Kommt, kommt, Herr Brunner, kommt!!«
Und durch die Menge drängte er sich, Herr Brunner folgte.
Mit einemmal blieb Herr Seibold steh'n.
»Was fehlt denn schon wieder –?« fragte Herr Brunner.
»Was fehlt?« rief Herr Seibold von Hochstetten. »Mein Büchlein, das steckt im Mantel – halt, Herr Vogt, Herr Vogt, einen Augenblick habt die Gunst!«
Und nach stürzte er. Erst weit weg holte er den Vogt ein und erst nach vielfachem Brrrr ward ihm das Büchlein ausgehändigt. Es war in einem ganz jämmerlichen Zustande.
»Neues kauf' ich mir keines mehr. Das wird getrocknet.« Und zurück eilte er. Mit nicht zu heiterem Gesicht erwartete ihn Herr Brunner. »Ums Himmels willen, am Ende verderb' ich's mit Euch auch!« sagte Herr Seibold hochatmend.
»Nun, laßt doch, wo denkt Ihr hin – mir scheint nur eines, aus der ganzen Sache und Absicht zu Landshut erwächst Euch kein Segen und Erfolg.« Bei diesen Worten schlug Herr Brunner den Weg heimwärts ein. »Mein Rat ist, laßt mindestens diesen Tag vorübergehen und mischt Euch weiters in nichts. Denn ist das Unglück im Zug, nimmt's nicht so leicht ein Ende. Mit dem Grafen Sandizell hab' ich noch einmal gesprochen. Ihr sollt weder mich, noch den Resch, noch den Posch brauchen, über den Verbrauch bis zur Stunde Euerer Anfrage bekommt Ihr von ihm selbst Auskunft. All' anderes könnt Ihr von morgen an an dem und jenem Ort erfahren, aber heute tut um keinen Preis mehr einen Schritt!«
»Aber das Hochzeitsmahl, bedenkt nur –!«
»Laßt es auch bis morgen! Ihr kommt heute nicht in die Hofküche, stellt es an, wie Ihr wollt. Es könnte vielleicht sein, wenn Ihr einen Gruß von mir brächtet, aber Ihr verwirrt Euch und alle miteinander, und geh' es auch wie immer, Ihr bekommt doch kein Speiseverzeichnis! Es hängt zwar an der Wand, aber man erlaubt Euch kaum, es abzuschreiben – laßt es gut sein und kommt mit mir. Ich habe soviel zu tun gehabt, daß ich noch keinen Bissen über meine Lippen brachte seit dem Frühimbiß. Ihr habt wohl auch Hunger?«
»Hunger, daß ich alle Juden der Welt mit den Zähnen zerreißen möchte,« sagte Herr Seibold, »und etliche tausend Christen auch dazu. Laßt uns in eine Schenke gehen! Wohin denn?«
»Da drüben unter das Zelt in den ›blauen Türken‹!«
»Recht so. In den blauen Türken – du Blitz, Hagel, Donners, gottslästerlicher Aaron du – aber sagt nur, Herr Brunner, was mach' ich denn in Sachen eines Mantels? Ich kann doch nicht im Engwams und Kamisol herumgehen, wie ein Leierer oder sausiger Landfahrer!«
»Dafür laßt mich sorgen,« war die Antwort, »ich schick' nach Haus um meinen Mantel. Ich hab' zwei.«
Sie traten unter das Zelt zum blauen Türken, nahmen ein kleines Mahl ein, und eh' es zu Ende war, kam schon der Winfriedl mit dem Mantel daher. Mittlerweile war das Büchlein Herrn Seibolds im warmen Sonnenstrahl wieder in erträglichen Zustand gekommen, zugleich aber das Verlangen, es zu bereichern, in dessen Besitzer wieder sehr mächtig angewachsen. Und wiewohl Herr Brunner die Bitte wiederholte, heute nichts mehr vorzunehmen, sondern sich mehr mit Betrachtung zu zerstreuen, und ihm riet, nicht zu versuchen, ob er beim Hochzeitsmahl zuschauen könne, da er dort ohne allen Zweifel in Streitigkeiten gerate, weil er zu fest aufgeregt sei – dessenungeachtet konnte Herr Seibold seine Begierde nicht bändigen und eröffnete Herrn Brunner: » Dies eine müsse heute noch geschehen. Er dringe mit aller Bestimmtheit in die Kaiserküche und das andere werde sich schon fügen.« Da Herr Brunner keine Zeit hatte, länger zu beschwichtigen, und keine Gewalt, Herrn Seibold aufzuhalten, ließ er von weiteren Bemühungen ab. Herr Seibold nahm den schwarzen Wurfmantel seines Freundes um, versenkte sein Büchlein in die Tasche und versprach, wenn möglich, um die achte Stunde, wenn nicht früher, daheim zu sein.
Herr Brunner ging seinen Geschäften nach, um bald nach Hause zu kommen, wo es ungemein viel zu rechnen gab, und wohin sich der dienstfertige Winfriedl gleichfalls begab, nachdem er vorerst die Überbleibsel des Mahles in nähere Besichtigung genommen hatte. Herr Seibold hingegen schlug seinen Weg rasch gegen die Kaiserküche ein, wobei er jedoch einen kleinen Umweg machte, um unferne vom gelben Aaron vorüberzukommen.
Einen furchtbaren Blick der Entrüstung schleuderte er auf den Juden hinüber. Seinen Mantel kühn über die Schulter werfend und einen Arm fest aufstemmend, blieb er stehen. Zu seinem drohenden Blick noch einen der erhabensten Verachtung gesellend, gab er seiner linken Schulter einen ansehnlichen Ruck und setzte seinen Weg fort, wobei er nach rückwärts den ganzen Reichtum seines Mantels zur Anschauung des gelben Aarons brachte.
* * *
Als Herr Seibold an die Kaiserküche gelangte, dachte er wohl nicht, daß er nicht allein an der Schwelle seines eigenen höchsten, sondern auch fremden Unglückes befindlich sei, welch' letzteres sich von ihm herschriebe.
Es ist nicht etwa so, daß Herrn Seibolds Unglücksfälle nur unter der Menge bekannt worden waren, auch die hohen und höchsten Herren hatten ein und das andere erfahren. Dies war gleichwohl so ohne näheren Zusammenhang und denselben unter so verschiedenen Umständen zugekommen, daß nichts weiteres denn augenblickliche Heiterkeit entstand. Dann schlug sogleich wieder etwas anderes darüber weg. Wie es nun sein wollte, Herzog Christoph, der in gar trefflicher Stimmung war, erfuhr das meiste, hörte von Herrn Seibolds Absicht und war gesonnen, ihm seine Mühen zu erleichtern, hatte auch vor, ihn rufen zu lassen – und hätte er die leiseste Ahnung gehabt, daß zu Herrn Seibolds Angelegenheit Ritter Thoman von Bruckberg die Veranlassung gegeben, wäre ersterer schon entboten worden. Aber so erging's ihm wie den anderen Fürsten, es kam wieder etwas Neues, darüber war die Sache Herrn Seibolds beiseite gesetzt oder vergessen und es bedurfte einer ganz anderen, weit gewaltsameren Veranlassung, bis dieser in seine Nahe gelangte.
Item, Herr Seibold an die kaiserliche Küche kommen und ohne weiteres eintreten wollen, war eins. Seine vielen Niederlagen hatten ihn bei zu großer Untertänigkeit nichts Zweckdienliches erblicken lassen. Vor allem aber glaubte er aus längerem Mittagsgespräch mit Herrn Brunner entnommen zu haben, daß es zwar keineswegs ein leichtes sei herausfordernd zu Werk zu gehen, daß aber gleichwohl der mehr Aufschlüsse gewinne, welcher mit seiner Sache den Befragten Zu dienen scheine, als jener, welchem sie ohne eigenen behilflich sein sollten. Es war deshalb Herrn Seibolds Absicht durch eine gewisse, vorausgesetzte Berechtigung zum Eintritte, seiner Sache die nötige Bedeutsamkeit zu geben, und wenn es auch zweifelsohne in ganz Ober- und Niederbayern keine bescheidenere, harmlosere Seele gab als die seine, so war sie doch in einem Zustande der Gereiztheit, daß sich Herr Seibold für einen der ausgesuchtest kecken und schalkhaftesten Kumpane halten zu dürfen glaubte.
Wie gesagt, ohne weiters wollte er eintreten, nachdem eben ein langer Zug, mit allen möglichen Speisen belastet herausgetreten war.
»Halt da, was habt Ihr da drin zu tun?« fuhr ihn der Wache haltende Reisige an.
»Das will ich Euch wohl sagen,« antwortete Herr Seibold äußerst keck, »ich habe wichtige Verhandlung mit des Kaisers Koch zu pflegen. Haltet mich keinen Augenblick auf, es betrifft des Kaisers Hoch- und Prachtessen – nebst viel anderen Dingen!«
»Passiert!«
Und Herr Seibold war in der Hofküche. Stolz schritt er vorwärts. Da war ein Gerenn' und Gedränge von Köchen und Küchenjungen sondergleichen und hatte es jeder so wichtig, daß es zu anderer Zeit Herrn Seibold sicher an Mut gefehlt hatte, jemand anzusprechen. Aber jetzt war er ein anderer Mann. Ohne die geringste Furcht wendete er sich an den nächsten und sagte: »Wo finde ich Seiner Kaiserlichen Majestät hochberühmten Koch, Herrn Konz?«
»Den könnt Ihr nicht sprechen,« war die Antwort, »er ist noch mit seinem Meisterwerke beschäftigt.«
»Wie, er ist noch nicht damit zu Ende?« fragte Herr Seibold sehr herausfordernd. »Wie ist's möglich? Der herzogliche Koch, welcher die berühmte, welsche, süße Brüh' macht, damit er ihm den Preis abzugewinnen gedenkt, ist wohl schon fertig!«
»Das kann wohl sein,« war die Entgegnung, »aber mit süßer Brüh' ist's nicht, wie mit geziertem Gebäck, dabei es auf die Hauptsache, die den Sieg verleihen soll, zuletzt ankommt, und diese Hauptsache darf früher nicht geschaffen werden, als kurz eh' das Meisterwerk zur Verspeisung gelangt.«
»Also sobald wollt Ihr das Gebäck und die welsche Brüh' zum Kampfe vor den Kaiser setzen. Hörte ich doch, es sollte erst am Ende der Tafel geschehen.«
»So war's bestimmt, aber der Kaiser hat es so befohlen – habt Geduld, Herr Konz wird solange nicht mehr ausbleiben, dann versucht Euer Glück, aber Ihr werdet nicht beikommen – seht – dort eilt er gerade heraus und an den Süßschrank!«
Wie ein Pfeil geradeaus, so schoß Herr Seibold durch Köche und Küchenjungen auf Herrn Konz zu.
»Was wollt Ihr?« fragte dieser. Eine Pfanne mit herrlichem Süßzeug in der Hand haltend, war er schon wieder im Abgehen begriffen, blieb aber bei seiner Anrede gebieterisch stille stehen.
»Ich hab' Euch einen Gruß von Herrn Brunner zu melden,« sagte Herr Seibold, »und wir beide, Herr Brunner und ich, wünschen Euch zum voraus Glück zum Sieg in Sachen Eueres Meistergebäcks über diejenige welsche süße Brüh. Benebst läßt Euch Herr Brunner ersuchen, Ihr möchtet mir mehrfache Mitteilungen in Sachen der sämtlichen Speisen machen, damit ich sie in Verzeichnis bringen kann, und zwar zu ewigem, weitverbreitetem Gedächtnis inmitten eines Buches, das seinesgleichen nicht hat und nicht haben wird.«
»So? Und Herr Brunner empfiehlt Euch?« antwortete Herr Konz. »Ihr seid gut empfohlen. Ich kann mir wohl denken, wer Ihr seid – schon gut, schon gut. Jetzt habe ich aber keine Zeit zu verlieren, Euch die geringste Mitteilung zu machen. Wie Ihr das wohl selbst einseht. Denn es handelt sich nicht allein um einen Sieg überhaupts, es handelt sich vielmehr um eine gänzliche Vernichtung des herzoglichen Koches. Verstanden?«
Diese hochmütigen Worte erregten in Herrn Seibold lebhaftesten Groll.
»Daß ich im allgemeinen,« fuhr der Koch fort, »das heißt in mehr irdischer Kochkunst, den Sieg davontrug, scheint schon gegenwärtig – will heißen bis Mitte des Mahles – keinem Zweifel mehr unterworfen zu sein. Wie hoch aber all' dies unter meiner Herrschaft Erschaffene über allem dem steht, was Herzog Ludwigs Koch, Herr Tobias Hilkertshofen, gekocht, ebenso unvergleichlich erhaben wird, soll und muß jenes mein Gebäckmeisterwerk über all mein übriges Meisterwerk zu stehen kommen. Ja, es ist keine Frage, daß es nie eines Fürsten und eines Kaisers Koch in anbetreff des Halbbräunens, Anlaufenlassens – und Hochblauens, weiters des Bitterkochens, Antreibens, Schaumierens, Kurzüberwerfens, Halbdünstens, Tremulierstaubens, Raschröstens, Unterwürzens und was sonst wunderbar und ganz neues Regulativ, Zusammensetzung und Traktierung ich erdacht – auch nur zur ersten Stufe dieser meiner Kunst gebracht hat oder bringen wird. Was aber gar zur Anlegung der letzten Hand an besagtes mein Gebäckmeisterwerk gehörig ist, wird von keinem auch nur im geringsten erfaßt werden, wieviel weniger wird es ein zweiter nach mir zu vollführen imstande sein. Ja, es fragt sich sogar, ob ich selbst ein zweitesmal das leisten könnte, was ich jetzt zu leisten imstande bin – wie es von denen Poeten heißt: ›Von Augenblickes Gunst hat er sein Reimwerk gewunnen – das hätt' er nimmermehr, hätt' er sich viel besunnen!‹«
»Von all dem bin ich fest überzeugt«, sagte Herr Seibold ein wenig boshaft. »Der Ruhm Eueres Meisterwerkes wird sich hierorts und weithin verbreiten. Es ist nur schade, daß jenes Euer besagtes Meisterwerk seinen höchsten Triumph mit gänzlich seinem Untergange bezahlt, statt daß es der staunenden Nachwelt aufbehalten bleibt!«
»Das ist es eben!« entgegnete Herr Konz. »Meine Kunst ist die erste, die vortrefflichste und erhabenste in der Welt, aber die vergänglichste in ihren Werken. Unser einziger Lohn und fürtrefflichster Preis ist das eigene, erhabene Bewußtsein, denn selbst die Beschreibung eines Meisterwerkes gibt der Nachwelt keinen genügenden Begriff. Ich habe Euch schon gesagt, ich habe keinen Augenblick Zeit zu verlieren – wollt Ihr aber die Gunst schätzen, in meiner Nähe sein zu dürfen, während ich sozusagen die letzten Anwürfe mache, so sei es Euch gestattet. Ihr könnt Euch damit des näheren Anblicks erfreuen, Euch in die Tiefe meiner Gedanken versetzen und einen Begriff gewinnen, wie hoch meine Kunst über jeder anderen steht. Denn es ist keine Hexerei, einen Dom zu bauen, allwo jeder Stein in sich mächtig und fest ist und sichtlich eins vom andern getragen wird – es ist aber eine ganz andere Angelegenheit, aus Marzipan und flüchtigem Schaum, aus Früchten und schwebendem Laubwerk zu erbauen, was ich erbaut, als daß sich sozusagen jedwedes selbst tragt, und daß das Flüssige auf leicht zergehendem Boden schwankt, hinwieder das Festere auf dem Flüssigen Halt nimmt.«
»Das ist ungemein wunderbar!« sagte Herr Seibold.
»Das ist es und im höchsten Grade! Und weil ich sehe, daß Ihr geneigt seid, mein Werk zu durchdenken, will ich Euch gestatten, mit Beschreibung besagt meines Werkes Euer Schreibebüchlein zu zieren und nicht so fast zu meinem, als sozusagen Euerem Ruhme ein Merkliches beizufügen.«
Er schritt in das Seitengemach zurück, aus dem er vorher gekommen.
»Du heilloser Gesell!« raunte Herr Seibold vor sich hin, »du sollst mir jetzt gerade nicht unsterblich werden! Kein Wort Beschreibung von all deiner Arbeit. Seht doch, ich müßte mir ein Glück daraus machen! Und zuerst beklagte er sich über die Vergänglichkeit seines Ruhmes – Kreuz, Blitz, Donners, du zwiezüngiger, hochmütiger Gauch du, so lassen wir doch nicht mit uns verfahren!« Darauf folgte er Herrn Konz.
Der schloß die Türe, deutete langsam auf das Meisterwerk und sagte, während Herr Seibold, die Hände auf dem Rücken, hinschaute: »Zu diesem Anblick seid Ihr berufen – Ihr ganz allein, einen ausgenommen – einen artigen, würdigen, feinen Mann – dem ich die Beschreibung des ganzen Kunstwerkes gab. Ihr habt aber den Vorzug, daß Ihr alles selbst betrachten und beschreiben dürft.«
»So, das nennt Ihr einen Vorzug?« rief Herr Seibold. »Glaubt Ihr denn, Ihr habt einen Rangen vor Euch? Und tut Ihr doch, als wär' erhabener nichts denn Euch zu dienen, statt daß Ihr mir dankbar sein müßtet, so ich Euerer Angelegenheit für alle Zeiten Erwähnung tu'?«
»O – ho!« fuhr Herr Konz auf. »Wißt Ihr, vor wem Ihr steht –? Doch ich will's Euch zugute halten. Ihr Herren von der Feder seid alle über einen Leisten gebogen. Ihr seid auffahrerisch und wild, sonst aber ganz ehrenwerte Leute, denen ich meine Achtung nicht versage.«
»Das laß ich mir soweit gefallen«, entgegnete Herr Seibold. »Damit sei Euch auch Euer Hochmut vergeben, Ihr müßt aber ein für allemal bedenken, daß Ihr einen wohlgelahrten, des Schreibens und aller Dinge durchaus kundigen Mann vor Euch habt, und daß es ein großer Unterschied ist, von wessen Feder Ihr beschrieben werdet und in wessen Hände und » wie weithin« das fragliche Scriptum et Compositum zu gelangen bestimmt ist. Ich frag' Euch nun, Herr Konz, erstens: Wollt Ihr mir die Beschreibung des Meisterwerks zustellen oder nicht? Wenn ja, so sollt Ihr auf die ehrlichste Weise unsterblich werden. Zweitens, wollt Ihr mir sämtlich den Speisezettel anvertrauen oder nicht?«
»Was versteht Ihr unter ehrlichster Weise?« fragte Herr Konz. »Der Mann, so vor kurzem da war, verlangte fünf Goldgulden für seine Bemühung. Wie viel verlangt Ihr?«
»Was Wetter, daß der Blitz in Euere kecke Zunge schlage!« rief Herr Seibold. »Ich mich von meinem Auftraggeber bezahlen lassen und von Euch noch einmal? Ihr glaubt, ich lobe Euch um Geld? Blitz, Donners, nehmt Euer Wort zurück oder ich komm' in Wut, daß ich Euch Euer ganzes Meisterwerk zu tausend Fetzen haue!«
Von oben bis unten maß ihn Herr Konz. Dann sah er ihn an, indem er sehr gnädig und beifällig lächelte.
»Das gefällt mir« – sagte er, »und beweist mir, daß Ihr nicht so arg seid, als man Euch mir geschildert hat. Ich liebe diesen Stolz. Ihr werdet die Beschreibung bekommen. Wollt Ihr den Speisezettel haben, so soll er Euch werden. Sobald Ihr ihn abgeschrieben habt« – er rief einen Gehilfen an die geöffnete Türe, dem er den Auftrag gab, fraglichen Zettel abzugeben – »sobald Ihr ihn abgeschrieben habt, dürft Ihr Euch wieder bei mir melden lassen – und ich will Euch gnädigst gestatten –«
» Melden lassen dürfte ich mich?!« rief Herr Seibold. »Ihr wolltet gnädigst gestatten? Auf mir, der nichts von Euch verlangt, wollt Ihr herumtreten und verfahrt zwiefach hochmütiger jetzt, als da Ihr meintet, Ihr hättet mir meine Mühe zu bezahlen? Tut Ihr doch, als wärt Ihr – Blitz, Donnerkeil, ich sag' Euch –!«
»Halt da, was für eine Sprache führt Ihr?« donnerte des Kaisers Koch. »Zügelt Euere Zunge oder ich komme mit meiner Macht und Herrschaft an, daß Ihr wie ein Schlagball hinausgeschleudert werdet!«
»Das sagt Ihr mir?!«
»Ja, das sag' ich Euch, Herr Heinz von Höhenrain!«
»Was, Heinz von Höhenrain?« stotterte jener mit wutbebender Stimme. »Spricht der Bosheits- oder der Hohnteufel aus Euch? Wie könnt Ihr wagen, mir eines solchen Elenden Namen aufzubürden, da ich nicht anders heiße denn Herr Seibold von Hochstetten!«
»Wie könnt Ihr so schamlos lügen?!« tobte der Koch entgegen. »Herr Seibold von Hochstetten seid Ihr nicht, sondern Ihr seid offenbar Heinz von Höhenrain, wie ich von Anfang dachte. Und jetzt seh' ich es bestätigt, weil Ihr den trefflichen Herrn Seibold so herunterwürdiget. Ich habe schon gestern gehört, wie Ihr, Herr Heinz, den unschuldigen Seibold von Hochstetten verfolgt, aber ich hab' Euch nun den besten Trotz gespielt. Wißt also, der, welcher vor Euch hier war und dem ich genaueste Einsicht gab, war der, für den Ihr Euch kecklich ausgebt, versteht Ihr, er war Herr Seibold von Hochstetten.«
Unaussprechlicher Grimm und Verzweiflung fesselten Herrn Seibolds Zunge und am ganzen Leib zitterte er.
»Seht Ihr, wie Ihr dasteht und kein Wort erwidern könnt?« fuhr des Kaisers Koch fort. »O, man kennt Euer ganzes Getreide gar wohl und Euere List ist fadenscheinig! Erst erregte Euere Bosheit gegen Herrn Seibold Spott und Gelächter, in kurzem aber gerechtem Unwillen – nun seid Ihr soweit, daß man Euch auf Eueren Namen keine Tür mehr öffnet. Und da geht Ihr nun her und raubt dem armen, von soviel Unglück verfolgten Herrn Seibold seinen Namen, damit Ihr dort und da hinein könnt, und damit man Euch glaube, habt Ihr die schamlose Verwegenbeit und zieht auf Euch selbst los.«
»Träum' ich denn oder wach' ich?« lallte Herr Seibold von Hochstetten. »Ihr behauptet, ich sei nicht Seibold von Hochstetten – ich, der ich Euch vom Herrn Brunner –«
»Was da, Herr Brunner,« fiel der Koch ein. »Ihr seid Heinz von Höhenrain und niemand anderer. Herr Seibold hat mir alles erzählt, hat Euch auf das genaueste beschrieben und mir geklagt, daß Ihr ihm heute schon einmal seinen Namen mißbraucht habt. Und hättet Ihr mich nicht so demütig um den Zettel angegangen, hätt' ich Euch auf der Stelle hinausgewiesen. So dachte ich mir aber, Ihr solltet erst schreiben, dann wollte ich Euch gelegentlich den Kopf gehörig waschen, Ihr gottvergessener, namenräuberischer Gesell, Ihr! Ich hätte gute Lust, ich ließe Euch von der Wache erfassen und in den Turm werfen, damit Ihr auch in Erfahrung bringt, was und wie Herrn Seibold zumute war, da er Euretwegen vom Elefanten weg ins Gefängnis mußte.«
»Und ich hätte gute Lust, Euch durch und durch tot zu stechen!« fuhr Herr Seibold auf, indem er an seinen Stoßdegen schlug. »Ich fordere Euch auf, meinen Worten zu glauben – ich bin nicht Heinz von Höhenrain, der gottlästerliche Schurke, ich bin Seibold von Hochstetten! Auf der Stelle glaubt es mir, oder Kreuz, Blitz, Donners, zehntausend Hagelwetter, ich stech' euch alle miteinander tot!«
»Hinaus mit ihm!« donnerte Herr Konz die sämtliche Schar der Köche und Gehilfen an, welche sich längst versammelt hatten und von welchen ein jeder mit einer der Küche entsprechenden Waffe versehen war.
»Öffnet die Tür' und werft ihn in die Hände der Wache!«
»So meint Ihr!« tobte Herr Seibold voll früher nie empfundener Kampflust, riß den Stoßdegen heraus und fuchtelte die Köche und Gesellen zurück, selbst einen, der einen langen Bratspieß hatte – drauf fuchtelte er wie der Blitz vor Herrn Konz herum, so daß sich der Besagte mit seiner Pfanne verteidigen zu müssen glaubte – dabei derselben alles süße Gemisch entströmte, Herr Konz aber ein übers anderemal »Mord, Mord!« schrie.
Der Ruf »Mord« war das Zeichen eines allgemeinen Angriffes. Alle ringsumher warfen sich mit Teigwalger, langgestabtem Eisenrain, Rösten und Bratspießen auf Herrn Seibold. Der tat einen Ungeheuern Satz beiseite, stürzte auf den einen Küchengehilfen zu, welcher den Küchenzettel in der Hand hielt, entriß ihm denselben und ergriff dann die Flucht, wobei er gewaltig nach rückwärts focht. Aber er kam nicht weit, denn zu wirklichem Gebrauche des Stoßdegens war er nicht geneigt, und die Menge wäre jedenfalls zu groß gewesen, als daß er sie sämtlich hätte ermorden können, so er auch gewollt hätte. Dabei war ein Geschrei und Getobe, daß er ganz verwirrt wurde, nebstdem er auch hie und da einen Stoß, Schlag oder Ruck bekam, der ihm die Bedeutsamkeit seiner Feinde hinlänglich bewies. Zum Übermaß seiner Bedrängnis waren auch zwei Reisige im Hereinkommen und verringerten ihrerseits das Geschrei keineswegs.
»Schlagt ihn tot, nehmt ihn fest, ermordet ihn!« rief Herr Konz dazwischen – »laßt ihn nicht fort, entreißt ihm den Speisezettel –!«
»Ihr seid unser Gefangener!« donnerte es Herrn Seibold in die Ohren und schon fühlte er sich ergriffen. »Fort da mit uns! Wer ist Er, wie heißt Er?«
»Heinz von Höhenrain heißt er!« rief des Kaisers Koch.
»Lüge, Lüge, dreitausendmal gelogen – ich bin es nicht –!« Aber Herrn Seibolds Ruf und Beteuerung hatte keinen Erfolg, um so weniger, als zwei Gassenvögte auch noch hereinstürzten. Draußen hatte sich schon viel Volk angesammelt, und bei einem raschen Blick durchs Fenster sah Herr Seibold gar die Scharwache auch noch anrücken. Vergeblich war all sein Widerstand.
»So will ich folgen,« rief er – »aber Ihr werdet sehen, ob ich im Unrecht bin – oder dort des Kaisers Koch! Laßt mich nur einen Augenblick Atem schöpfen! Hier schwöre ich, ich bin Seibold von Hochstetten und nicht Heinz von Höhenrain! Schickt auf der Stelle zu Herrn Brunner versteht Ihr, zu Herrn Gottfried Brunner, der wird bestätigen, was ich sage! Seht nur, wie freundlich ich mit ihm stehe, hier dieser Mantel ist von ihm – den hat er mir geliehen –«
»Herab mit dem Mantel,« fuhr der eine Gassenvogt darein – »das kann eitles Gerede sein!«
»Laßt ihm den Mantel!« rief's von anderer Seite, »er kann ihn ja nicht mehr wegleugnen, so er ihn etwa geraubt hat.«
»Auch recht, fort da!«
»Und meinen Küchenzettel will ich!« donnerte des Kaisers Koch.
»Den sollst du nicht mehr haben!« Für einen Augenblick machte sich Herr Seibold ein wenig freier und knitterte unter heftigen Kämpfen den Küchenzettel zusammen, der ward ihm stets neu bestritten, aber der größte Teil blieb ihm, während er den anderen ins nächste Feuer schleuderte.
Da ging er sogleich in Flammen auf.
Das Stück aber, welches Herr Seibold von Hochstetten gerettet, steckte derselbe im Getümmel unbemerkt zu sich.
»Verrat, neuer Verrat!!« ließ es Herr Konz erschallen. »Schleppt ihn fort – fort – Herr Gott – an was denk' ich jetzt! Da liegt all' meine süße War' – Gezier – und – Sulzein – ich bin des Todes! Das büßt Ihr mit jahre – mit jahrelangem Gefängnis – wo nicht mit dem Leben – –!«
Mit verzweiflungsvollen Blicken starrte er bald auf seine leere Pfanne, bald auf den Boden. Herr Seibold aber rief ihm zu: »Büß' ich, was ich will, Ihr habt es schon gebüßt, Ihr hochmütiger, Ihr betrogener Tor, der mir beweisen will, ich sei nicht ich selbst, sondern ein anderer, und zwar mein ärgster Todfeind!«
Keck schlug er auf seinen Schlapphut, daß er seitwärts auf den Kopf geriet, warf seinen Mantel zu reichem Faltenwurf über die Schulter und setzte bei: »Jetzt sind wir hoffentlich daran, daß die Sache vor die Fürsten kommt – mir bangt nicht!«
Und hinaus inmitten der Gassenvögte und Reisigen schritt er.
Viel Volkes strömte nach.
Bald öffnete sich die Türe vor ihm, welche ihm schon bekannt war. Den Gefängniswärter erblickend blieb er steh'n und rief: »Nun, Ihr werdet mich doch kennen, das frag' ich Euch, der ich für Heinz von Höhenrain gelten soll. Bin ich Heinz von Höhenrain oder bin ich Seibold von Hochstetten?«
»Was schert 's mich!« war die rauhe Antwort. »Vorwärts, hinein da!«
Herr Seibold trat majestätisch ein, wie ein siegesfreudiger Märtyrer – und knarrend fiel die Tür ins Schloß.
* * *
Als Herr Seibold von Hochstetten zu München vom Thoman von Bruckberg Abschied nahm, sagte der letzte, wie jeder weiß: »Wer weiß, wozu 's gut ist!« Nämlich – daß er selbst nicht bei der Hochzeit anwesend sein könne.
So war es auch wirklich eingetroffen. Denn soviel Ungemach Herr Seibold zu Landshut erlebte, soviel Treffliches war Herrn Thoman zu München begegnet, das heißt, in Sachen des Herrn Christoph, für den er gar vieles zu besorgen hatte. Gar hatte auch sein Zipperlein um ein bedeutendes nachgelassen und er bemerkte aus allem, daß ihn das wilde Schmerzensungeheuer nur noch etlichemal schütteln und kneipen, dann aber zum gänzlichen Rückzug blasen werde. Er setzte sich demnach mit freudig hoffnungsvollem Gemüte hin und schrieb an Herzog Christoph gen Landshut, wie folgt:
»Groß Untertänigkeit, ehrsurcht vnd willigsten dienst zum voraus, durchleuchtigister Herr Hertzog. Wie dann all Euerer kraft vnd unvergleichlichen ruhmes sich ninderst ein Mann höcher erfreuete, dann ich, das wißt Ir, vnd strittet Ir mit wem Ir da wöllt, wüßt' ich wohl, wo der sieg wär'. Davon hie zeit und raumshalben mer nit zu schreiben.
» Item Herr Hertzog, weil ich nit gen Landshut kommen kunnte, aus grund vnd ängstigunt eines sichern Reißens halben, als Ir wol wißt, daß es mich zeitweis aufs ärgist behaften will, also hab' ich da zwar vil des Besten entbehrt. Hat aber sein guts gehabt vnd vermein das gern auf mich ze nemen, da ich Ew. desto bessere kundschaft senden kan. Selb ist aber die:
»Ir sagtet mir, Herr Hertzog, es wär Euch schier genehm, so der Ilsung die viertausend Goldguldn vorstrecket. Da hab ich seinerzeit vnd ehendest gen Augspurg geschriebn. Das was er nit ze Augspurg, wie mir das sein Faktor vermeldet. Wie ich dann die Botschaft las, was ich zum besten nicht erfreut, weil ich Ew. Dienst nit vollfürn künnt. In selber zeit kamen ir zwo andere ein, der Rehlinger und Langenmantel in anderer angelegenheit. Drin mocht inen wol dienen. Des waren sie fast froh vnd würfe ich sodann ein steinlein von wegen dessen, daß Ihr Herr Hertzog eines geld benötigt wärt, vnd der Ilsung leider nit ze Augspurg sei. Drauf sagt der Rehlinger: Wie er da froher nit sei, denn Ew. durchleuchtigiste gnadn zu diensten zu werden, und wann Ihr zwainzigtausend goldgulden bedürftet, möcht er di summa minder nit ausantworten, sint er großer Verehrung für Ewr. ruhmb vnd tugend voll ist vnd mer nit wöllt, denn Euch ein gefallens ze ton. Möchtet demnach on alle sicherhait das geld einfassen vnd wiederumb erlegen, wanns Ew. auf das genehmst vnd leichtiste ankäm. Hinz was ich ganz erfreut – vnd machte die angelegenheit richtig auf viertausend goldguldn, die summa wölln die zwo der Rehlinger vnd der Langenmantel zu jeder stund mitsammen auszahln auf Ew. hertzogliche Gnaden handschein. Vnd was der ein wie der ander schier bös, daß Ine der Ilsung stets fürkomme, wann sie doch Peede reiche kaufherrn seind vnd Ihr tätet also fremd, daß Ir sie nie in einer sach ansprächet.
»Da mügt Ir nun wol erkunden, hoher Herr, wie trefflich Ewere angelegenhait stat.
» Item ich hab' auch den köstlich fein Schmarald, daß Ir überlästig worden vnd gern verkauft hett, um zweihundert goldguldn verkauft, da Ew. anmit das geld zukommet. Sagt der abenteur, so mirs abgenommen, bessers wär ime noch nichts wiedrfahrn, weil er solicher schmarald gern wie brod von den ständen kaufet, der künig in böheimb hett ein groß verlangen nach solchem gestein vnd wöllt große Geschenke damit gethun, als zwo lange kettn von eitel schmarald vnd rubbinstein, alldies zu einer trefflichen brautgab. Habt mir dabei dank nit fast zu sagn, Herr hertzog, dann ich kein leisigen Schritt tat, vielmehr der abenteurer zu mir kamb. Wie dann das glück will, kommts büschelweis. Nächst ich der angelegenheiten froh was, dacht' ich, wann das rädl laufend, wärs wol nit sonderlich, es träf noch was zu. Des mocht ich einer halben stund zeit nicht gedacht han, trifft das wohl trefflich ein, denn es kumt der von schellenberg an die herberg geritten. Der wollt gen landshut vnd mir nach, weil er nit wußt, daß ich da zu Münchn sei. Nächst ich das Fenster aufgethon vnd grüß ihn fein. Da was er fast froh, mich hie zu sehn vnd seines weitern wegs zu sparn vnd kam eylends herauf. Also ward ich inne, daß der Heiner von Grabenstett, dem Ir Herr Hertzog in fürstlicher huld 500 fl. verliehen vnd sein mühl aufgepaut habt, gute erbschaft gemacht vnd nindest ein andern sinn gehabt hett auf das erst, denn zuvörderst Euch Ew. Darlehn, so Ir ime auf bessere zeiten vnd für verloren gabt, zurückzeantwurtn. Also brachte der amtmann das Geld mit, hie Ew. Gnaden anliegend. Darzu der müller Ew. fürstl. Gnaden heil vnd segen entbeut von seim gepet vnd kind vnd kindskindern. Da ich nun wol erseh, daß mir vil guts aus mein reißendem Fuß erwachsen ist, sint ich Ew. vil geldes entsenden mag vnd dem amtmann sein zeit erspart. Item von wegen des großen anleihens vom Rehlinger vnd Langenmantl sollt Ir in kürzister zeit bedient sein, da Ir aber gnädigst anherschreibn wöllt, was eintreffene geld ich Ewr. davon gen landshut senden soll, wo Ir es nit hie ze Münchn liegen lasst, bis Ir selbs wiederkert. Draus erseht Ihr mein lieb, ehrfurchtigkeit vnd frohen muth, wann ich Euch zu Diensten sein mag, wo da will.
»Ew. herzogl. Gnaden
vntertänigst, ganz dienstwilligister
»
Thoman v. Bruckberg.«
P. S. »Item hocher Herr, ich Zweifel vil nit, daß sich einer namens seibold von hochstetten an Ew. Gnaden gewend't hatt. So dem wär oder folgende eintref, bitt ich zu sein gunsten, ime sein demütig bitten zu erfüllen oder ein fügniß zu tun, daß Ir ine rufen lasset, so er sich etwan scheuet an Euch zu kommen. Das ist, ich hab demselben seibold einen auftrag geben, daß er die Hochzeit in Beschreibung nämb, was da sämtlich verbraucht wirdet und ist genannter seibold ein rechter ehrnmann, frühern zeiten klosterschreiber zu seldenthal, aber eins gestreits auszukommen, hinweggangen vnd bis auf weiters sein Brod an mehr orten redlich verdienend. Wo es ime dem seibold dann in mer sach vnd angelegenheit nit zu recht gehn möcht, als ich ime wol voraussagt, das versprochen geld sei so fast leicht nicht zu gewinnen, wüßt ich Ew. Fürstl. Gnadn vil Dank so Ir ime ein erleichterung in seiner arbeit vnd vorhabn zukommen lasset, als beim Grafen von sandizell oder noch höcher, all das in Ew. gnädigstem Ermessen, daß er dann mit besserer einsicht vnd überschau zu werk gehn möcht. Damit wär mir selbsten ein gunst vnd gnad erwisen, weil ich nit zu landshut sein kann vnd doch jedes Dings genauisten Berichts ganz begierig bin.« –
Als Herzog Christoph dieses Schreiben erhielt und gelesen hatte, ward er seines Inhaltes sehr froh, erinnerte sich dabei sogleich wieder, daß er sein Augenmerk selbst schon auf den unglückseligen Herrn Seibold von Hochstetten gerichtet habe, und fragte die nächsten Diener, indem er sie aus dem Vorgemache berief, wie die Angelegenheit mit jenem neuerlich stehe? Da erzählten die Diener, was sie alles erfahren hatten. Von der neuesten Gefangenschaft konnten sie aber noch nichts mitteilen. Denn zu der Zeit als Herzog Christoph fragte, hatte das Hochzeitsmahl noch nicht begonnen und erst während desselben fand Herrn Seibolds Kampf in der Hofküche statt.
»Sobald das Mahl vorüber, sucht ihn auf und bringt ihn zu mir,« sagte Herzog Christoph, »ich will seh'n, wie ihm zu helfen ist. Wo immer ihr ihn vorher trefft, fragt sein nächstes Begehren und begleitet ihn dahin. Jedenfalls sorgt, daß er ein fast gutes Mahl gewinne in einer der beiden Küchen des Kaisers oder des Herzogs. Ich nehm's auf mich.«
Unviel später ging es zum Hochzeitsmahl, und was sich bis zur Hälfte Zeit desselben begeben, sonderlich daß Herr Seibold zum zweitenmal eingesperrt war, ist wohlbekannt.
Mittlerweile nun Kaiser, Fürsten, Braut und Bräutigam und alle anderen hohen Herren und Damen tafelten, sich in nichts eines Bösen versahen, sondern aßen und tranken, der trefflichsten Musika zuhörten, gar lustsam redeten und von Herzen lachten, sobald des Pfalzgrafen Philipps Narr und Gaukler tolle Streiche machte – mittlerweile die alle froh und frei tafelten, Herr Seibold hingegen im Gefängnis saß – war Herr Heinz von Höhenrain auf großer Schalkheit Pfaden gewesen, wie sich in kurzem zeigen wird. Dabei war es an des Herzogs Georg Koch ausgegangen, es wird sich aber desgleichen herausstellen, wer den ganzen Anlaß gegeben hatte.
Nachdem Herr Seibold fortgeführt war, bedurfte des Kaisers Koch, Herr Konz, längerer Zeit, bis er sich zu fassen vermochte, und nur die unbedingte Notwendigkeit, sein Werk sogleich zu vollenden, gab ihm die Kraft, Hand anzulegen. Aber er fühlte nur zu bald, daß das selbstwillig flüchtige Hinwerfen und gezwungene Eile zwei gewaltig verschiedene Dinge seien. Alles mißlang, nichts gefiel ihm. Zuletzt brachte er was zu Wege, keineswegs just das, was er ursprünglich gewollt und wozu er den Stoff in bewußter Pfanne geholt, aber in der Verteidigung gegen Herrn Seibold ausgegossen hatte – indessen doch wohlschmeckend genug, wie er meinte, und auch in Ansehung des Gedankens preiswert. Selbes war ein wundersames, wellengleiches Gemisch von zerstoßen' oder gespaltenem Gewürz und mehrfarbiger Süßigkeit. Aus den Wellen ragten dort und da Felsen auf, durch welche man teilweise hindurchschauen konnte, und an denen anmutige Zweige mit grünem Laub und roten Steinkornellen gar zierlich emporwucherten. Zuhöchst oben aber, auf einem mittleren Felsen und vor einer großen Sonne von Rauschgold, stellte er eine fliegende Viktoria, die eine Krone auf der einen Hand trug, während die andere eine gewaltige Posaune hielt, drein die besagte Viktoria blies. Das Werk an sich war voll von Gängen, Stufen, Altanen, hinwieder freien Plätzen, daraus turniert wurde und an Rittern, Damen, Türken und was erdenklich, hie und da auch wilden Tieren, an allem dem fehlte nichts. Das Ganze aber wurde von einem ungeheuern Elefanten getragen, auch war da Teil um Teil abzuheben. Im Innern waren in aller Art und Weise bereitete Früchte zu sehen, die stellten eins und das andere vor – Krebse, Fische, Wickelkinder, Türkenköpfe, Vögel, Rüstungen und was weiters. Das wechselte aufs bunteste ab, und wer das Werk sah und über- und durchschaute, der mußte billig gestehen, es sei zwar ein großer Durcheinander, aber es sollte einer herkommen und es Herrn Konz nachmachen.
Als Herr Konz daran war, das allerletzte Tüpflein zu machen, öffnete er die Tür, ließ sämtlich seine Untergebenen eintreten, überließ das Werk etliche Minuten ihrer Bewunderung, wobei er sich selbst in einige Entfernung stellte. Mit einemmal nahte er sich langsamen Schrittes, nahm einen zierlichen Lorbeer, der aus feinstem, gefärbtem Zitronate gebildet war, lüpfte den Arm und setzte denselben mit leichtgeschwungenen zwei Fingern, indem er den rechten Fuß weit vorsetzte, seinen ganzen Oberleib aber sehr weit zurückbeugte, auf die Krone der Viktoria. Hierauf trat er drei Schritte zurück und sagte, den Zeigefinger der Rechten ausstreckend: »Hier ist es, vollendet, was in allertiefster Einsamkeit erdacht, ersonnen und erfunden worden ist – hier ist es, jeder sieht es und keiner will glauben, daß es in kürzester Zeit nicht mehr sein wird. Wenn die Nachwelt davon hört, wird sie es nicht glauben. Aber sie wird es doch glauben müssen! Denn dieses Werk ist schon auf das genaueste in Beschreibung gebracht und ich werde des Kaisers Majestät bitten, auf diesejenige Beschreibung, welche ich dem wahrhaftigen Herrn Seibold von Hochstetten in Gunst verabreichte, und welche er in sein Büchlein zu Kopei brachte, allerhöchst sein kaiserliches Wappen und Insiegel drucken zu lassen. Aber ich sage euch, ihr, wie ihr da voll Erstaunen stehet, was hilft zukünftig auch den erhabensten Häuptern unserer Kunst alle diesejenige Beschreibung? Wird ja doch niemand vermögen, ihnen etwas Ähnliches zu erschaffen! Ja! Denn es ist ein Unterschied zwischen denen Geistern, wie ist ein Unterschied zwischen Wasser und Wein. Nein, kein zweites Werk dieser Art wird entstehen – vergeblich wird alles Bestreben sein! Die Tat ist geschehen – das Ereignis ist da – und was im Haupt eines einzelnen zusammentraf, das trifft in dem eines anderen nimmer wieder zusammen. Ja, das Werk wird verschwinden! Aber was sollen wir in Seufzen ausbrechen, da mindest seine Beschreibung festgestellt ist und alle Nachkommen davon sprechen werden? Ja, wer weiß, sollen doch auch sie es sehen. Denn es wird sich ein Meister finden, welcher meinen Aufriß in Bildnuß bringt und sämtlich die Beschreibung zum genauern darunter setzt. Wie, wann ich aber das auch nicht erzwecken wollte? werdet ihr fragen. Frage ich dann, wie so und um was weniger wird der Ruhm meiner Tat bleiben? Bedarf es großer Taten Bildnuß? Also möcht' ich mich doch schier solcher Frage verwundern. Wer sieht da alle die Kaiser, Könige und Fürsten, so voreinst da gewesen, und ihre Taten, da sie sämtlich längst verschwunden und von dannen sind? Frage ich, ist ihr Ruhmb und Ehr' des geringer – oder weiters angestritten? Nimmermehr! Und ist Ruhmb und Ehr' dieserjenigen ihrer Kriegsleute geringer, dieweil und sofern man ihre Namen nicht weiß? Nimmermehr, sage ich! Nunmehr erkennt ihr, was ich sagen will. Es ist aber nichts anderes, denn dieses: Hier steht mein Werk, und mein Namen und Verdienst werden zu keiner Zeit vernichtet sein – hinwieder werdet auch ihr unsterblich sein, gleichwohl man euere Namen nicht kennen wird, sint ihr sämtlich zwar nicht jeder ein Meisterwerk erschaffen konntet, ich euch aber zu meinen Helfer und sozusagen Kriegsleuten, Amtierern oder was sonst gebraucht habe. Also laßt uns in Zuversicht in die kommende Zeit schau'n, in der wir nicht mehr sind, wie dann hinwieder diejenigen unserer Kunst, so später leben, ehrfürtig auf uns zurückschau'n werden, so nunmehr in dieser Zeit leben. Dieses Augenblickes seid nun für und für eingedenk – damit hab' ich euch all Unschützbarkeit und trefflichen Wert Unserer und Künftiger auf das gerechtest und deutlichste zu steter Bewahrung in Fürtrag gebracht – und damit seid ihr in Gnaden entlassen.«
Unmittelbar nach den letzten Worten schien Herr Konz so erschöpft, daß er sich an das nächste Gesims lehnte und mit der rechten Hand in die Haare fuhr, in welcher Stellung er einige Zeit hochatmend verweilte, bis er, während die letzten der Köche und Gehilfen das Gemach verließen, in den nahestehenden Stuhl sank. In dem lag er mit sehr tief gesenktem Kopf, als wollte er sterben.
Als er die Türe gehen hörte, richtete Herr Konz sein Haupt allmählich auf, und da er sich allein sah, erhob er sich ungemein kräftig. Er setzte sich aber sogleich wieder, da er bemerkte, es komme einer zurück.
»Was gibt es –?« sagte er ganz schwach.
»Zeit ist's, die Trager sind da«, war die Antwort.
»Die Trager? Der große Moment ist gekommen! Das gibt mir meine Kraft wieder! Herein sag' ich – herein da!«
Alsbald ward Herrn Konzens Meisterwerk auf eine wohlgezierte Tragbahre gesetzt und hinausbefördert. Viel Menge Volkes drängte sich von allen Seiten zu, ward große Verwunderung wach und mit lauter Stimme prophezeiten die meisten, Herr Konz werde zweifelsohne den Sieg erringen. All' das sah und hörte er gar wohl vom Fenster aus. Daran stand Herr Konz – die linke Hand auf die Hüfte gesetzt, den rechten Fuß wieder um ein bedeutendes vorgestreckt, die Rechte auf der Brust und das Haupt hielt er merklich nach rückwärts gerichtet. Im ganzen stand er mehr von der Seite, als gerade auf das Volk zu. So hatte er den Kaiser und gar manchen Fürsten zu öfteren Malen stehen sehen.
Sein Meisterwerk verschwand und deutlich konnte man von der Straße aus sehen, daß ihn dieser Augenblick auf das tiefste erschütterte. Denn er machte eine zweifache Bewegung mit der rechten Hand über das Antlitz weg, deren erste besagtes, unabwendbares Verschwinden und ein Lebewohl bezeichnete – die zweite aber mehr eine Nässe seiner Augen verriet, indem er dieselben wischte. Dies letzte ging aber, wenn auch hinlänglich sichtbar, doch so schnell vor sich, daß man offenbar erkannte, Herr Konz wolle seine Rührung nicht unbedingt an den Tag legen.
Eben wollte er sich von selbst abwenden, als er besonderen Grund dazu erhielt. Denn die Tür öffnete sich wieder und eintraten Herr Heinz von Höhenrain – vielmehr in seinen Augen Herr Seibold von Hochstetten – und ein Diener Herzog Christophs.
»Ruhm und Ehre sei Euch!« rief Heinz von Höhenrain. »Das Volk ist ganz toll über Euer Werk. Großer Mann!«
»Ich danke Euch« – sagte Herr Konz sehr erschöpft – »wer weiß, muß ich meinen Ruhm teuer bezahlen – mein ganzer Kopf ist in Schwäche verfallen, also viel und unglaubliches hatte ich zu denken. Was wollt Ihr?«
»Ich bin Herzog Christophs von Bayern Diener, Stephan Leipold,« sagte Herrn Heinzens Begleiter, »und komme in des Herzogs Auftrag, Euch diesen Mann auf das nachdrücklichste zu empfehlen. Wir hatten Auftrag, ihn zu suchen, auch damit er ein treffliches Mahl gewinne. Da fragte ich, und da war der Gefragte er selbst, den ich suchte, Herr Seibold von Hochstetten. Herzog Ludwigs Koch ist nicht sein liebster Mann, sagt er, sonst hätt' ich ihn in die fürstliche Hofküche geführt. Er wollte weit lieber zu Euch. Also tut Herzog Christophs Wunsch und Geheiß, er will's Euch gnädig gedenken, so Ihr den Ehrenmann recht wohl bewirtet.«
»Das will ich freilich mit Freuden tun!« entgegnete Herr Konz. »Der Ehrenmann – ich kenn' ihn schon, denn er war schon hier. Denkt Euch, kömmt da ein frecher Geselle herein, stiehlt dieses Ehrenmannes Namen, wagt es, sich Seibold von Hochstetten zu nennen – und ist kein sterblich Wörtlein wahr, vielmehr ist es ein gewisser Heinz von Höhenrain, vor dem ich wohl gewarnt worden bin. Aber ich bin zu mild, ich lasse ihn nicht sogleich hinausschleudern, und was folgt daraus – ha, ich kann es Euch gar nicht entsetzlich genug beschreiben – aber seid nur getrost, vortrefflicher, ehrenwertester – das Leugnen half ihm nichts – er sitzt fest im Turme, dieser Herr Seibold.«
»Das tut mir in der Seele leid!« sagte Herr Heinz. »Ich sag' Euch, Herr Konz, ich taugte zu keinem Richter, denn, statt daß ich der Bösewichte Taten streng bestrafte, bräch' ich vielmehr in Tränen aus. Wollt Ihr mir nun einiges gutes Labsal geben, so bin ich keineswegs abgeneigt, sint ich des Tags über soviel Gelauf' und Gerenn' und so unglaublich viel Gestreit und Getu' selb verwünschten Heinz von Höhenrains wegen hatte, daß ich kaum ein Stücklein Brotkrume über die Lippen brachte, und ich kann Euch versichern, daß ich seit vier Uhr morgens auf bin.«
»Ich bedauere Euch ungemein,« sagte Herr Konz; »aber Euere Mühen sollen nicht sonder Erfolg sein – ich weiß, was ich sage –.«
»Ihr seid voll von Güte und Geneigtheit,« erwiderte jener, »ich denke aber selbst, wie Ihr sagt. Hier in meinem Büchlein, das mir der Schelm mehrmals raubte und das ich nur mit vielen Mühen wieder errang, hab' ich schon alles Mögliche verzeichnet – und ich habe meine Sache so klug und treu ins Auge gefaßt, daß ich schon an dem genug hätte, was ich jetzo hab', falls es mir unmöglich wurde, etliche Tage länger zu bleiben – denn ach! ich fürchte, durch die Kunde vom Tod meines Bruders leider abgerufen zu werden. Doch werde ich mich dann in Kürze wieder einfinden und das Nötige ergänzen.«
Diese Absicht hatte aber Herr Heinz keineswegs innerlich. Vielmehr dachte er weiter an nichts, als noch etliche Rubriken in sein Büchlein zu machen, aufs ungefähr hin eines Tages den Verbrauch in Anschlag zu bringen und dabei aufzuschreiben, was und wieviel ihm für gut dünke. Denn bis derselbe, so ihm den Auftrag gegeben, hinter sein Lügengespinst käme, währe es lange Zeit genug – beweisen, daß er gelogen, gehöre nicht zu den leichtesten Dingen, und könnte es auch geschehen, so wäre er dann, wer weiß wo. So dachte er und sein ganzes Trachten ging vordersamst nur auf zwei Dinge. Die waren, daß Herr Selbold so lange als möglich eingesperrt bleibe und daß ihm selbst gegenwärtig ein kaiserliches Essen aufgepflanzt werde.
Der Diener Herzog Christophs leerte ein Glas trefflichen Weines, das ihm Herr Konz bot, und nahm eine ansehnliche Gabe gebratenen Geflügels mit sich.
Herr Heinz von Höhenrain aber saß alsbald am Tisch und harrte, was Gutes ihn erwarte. Da wurde aufgetragen und Wein aufgepflanzt, daß sich hätte der Tisch biegen mögen.
Als alles in Ordnung war und sich Herr Heinz und des Kaisers Koch wieder allein befanden, fragte der letztere mit ungemeinem Eifer und ganz leise:
»Nun, das hat sich ja gang trefflich für Euch herausgestellt, Herr Seibold, mein allerwertester Herr – ha, ha, habt Ihr aber auch darin Wort gehalten, was Ihr mir verspracht, als Ihr zum erstenmal bei mir wart?«
»Ihr meint wegen Herzog Ludwigs Koch –?«
»Wohl, wohl! Habt Ihr ihn recht verrückt, verwirrt und toll gemacht?«
»Das will ich wohl meinen«, entgegnete Herr Heinz. »Ich sag' Euch, Herr Konz, wenn mich nicht so barbarisch hungerte, wollt' ich Euch die Menge erzählen, daß Ihr Euch den Leib halten müßtet vor Lachen – ich sag Euch er ist verloren.«
»Ha, ha, ha, das ist ja ganz gute Botschaft! Sagt doch, was habt Ihr denn veranlaßt, daß Ihr glauben könnt, er sei verloren?«
»Ei, das ist ganz einfach« – erwiderte jener – »ich hab' ihm den Kopf so voll angeschwätzt, daß er nichts merkte, als ich ihm eine Handvoll Staubsalz in die süße welsche Brüh' warf, just als er sie zum letzenmal versucht und für fertig erklärt hatte – so daß sie abkühlen und sich ein Häutlein drüber bilden sollte –«
»Ihr seid ein unglaublicher Ehrenmann!« fiel Herr Konz ein. »Das muß dem Gesellen den Hals brechen, der Einfall war fürwahr erhaben – ich sag' Euch, das richtet ihn zugrunde, denn etwas Ärgeres kann es nicht geben, als dem Kaiser eine kalte süße Brüh' versprechen und dann wird ihm eine gallbittere vorgesetzt. Das soll Euch wohl gelohnt werden – doch jetzt eßt, und was Ihr nicht essen könnt, das steckt zu Euch, da ist nirgends ein Mangel.«
»Das werd' ich wohl tun müssen und wär' in meinen Augen fast töricht, es auszuschlagen,« sagte Herr Heinz, sich zum Essen anschickend, »denn ob der Kaiser um das mehr oder weniger hat, hat soviel nicht zu bedeuten.«
»Ha, ha und mehr auch nicht« sagte Herr Konz hinzu – »ha, ha, Ihr versteht mich – was glaubt Ihr denn, das ist kein so schlimmer Platz! Ihr sollt es auch wohl empfinden, denn es bleibt nicht bei denen etlichen Goldgulden, die ich Euch gab.«
»Das sieht Euerer Großmut ganz gleich«, sagte Herr Heinz von Höhenrain, der schon in aller Essensarbeit begriffen war. »Ihr seid ein Ehrenmann, aber dabei ein ungeheuer feiner Kopf, das hab' ich gleich gesehen.«
»Und ich sah das Gleiche an Euch, verehrtester Herr Seibold von Hochstetten«, erwiderte jener. »Seid aber nur so gut und vergeßt mir nicht zu bemerken, was ich unglaubliche Bosheit und Widerwärtigkeit zu ertragen hatte und wie hinwieder das Volk jauchzte und stürmte und ganz außer sich geriet, da es mein Pracht- und Meisterwerk dahintraqen sah.«
»Schon gut, soll schon geschehen.«
»Wollt Ihr erwähnen, was Gefahr des Fortschaffens war, wie ein Unglück um das andere nur durch ein Wunder abgelenkt, wie des Herzogs Koch Späher ausschickte oder gar etliche Dutzend, die auf das Meisterwerk schmähen sollten, daß aber das Volk sie voll höchsten Unwillens davon trieb, versteht Ihr und dergleichen – das kann keineswegs schaden.«
»Es ist zwar nichts von allem dem wahr, aber es hat nichts – es hat nichts – zu sagen«, versetzte Herr Heinz von Höhenrain, während er aus Leibeskräften drauf losspeiste. »Ich bin zwar stets wahrheitsliebend – indessen handelt sich's hier nicht so fast« – einen großen Bissen führte er zum Munde – »versteht Ihr – nicht so fast um das – um das, was wirklich geschehen ist – als was bei der geringsten Veranlassung« – er tat einen ungemein großen Zug aus einem Handhumpen, der mit trefflichstem Weine gefüllt war – »das nenn' ich einen Wein – ja, was will ich denn sagen – richtig, als was bei der geringsten Veranlassung hätte geschehen können.«
»Ganz Euerer Meinung.«
»Das dachte ich mir sogleich. Der Narr von einem Seibold – ich wollte sagen, der Narr von einem Heinz von Höhenrain soll nur bei seiner ungestümen Art bleiben und bei seiner Derbheit, ha, ha – ich sag' Euch, Herr Konz, 's ist doch alles nichts gegen unsere Verschlagenheit. Ha, ha, ha!«
»Ganz sicher, ganz sicher« – fiel Herr Konz rasch ein, nicht minder lustig, denn sein Gast – »weil es Euch nur schmeckt.«
»Und wie!! Aber ich werde dankbar sein – ich sage Euch, Herr Konz, es wird eigentlich das ganze Büchlein nur Euretwegen geschrieben sein« – dabei steckte er zwei gebratene Hühner nach links in seinen Mantel und einen Krug Malvasier – weiters schüttete er eine merklich große Rain Süßwerk hinein, während er einen gebackenen Hecht in die rechte Manteltasche versenkte, welche so tief war, daß weder der Hecht, noch ein Dutzend große Krebse eine besondere Völle verursachten. »Ja, seht Ihr, Herr Konz,« fuhr er fort, indem er speiste, »ich bin so: Wer mir dient, dem dien' ich wieder. Wer mir aber nichts gibt oder in den Weg tritt, dem bin ich sonderlich nicht geneigt und so fromm ich bin, wie Ihr, ich beiß' um mich, daß es ein Graus ist. Wenn mir aber –« es setzte wieder einen riesigen Bissen und zwar vom gleichen Teller, aber von was anderem, denn vorher – er hatte nämlich von dem Verschiedensten zugleich herausgenommen – »wenn mir aber einer gar meinen Namen stehlen will und sich Heinz von Höhenrain, ich wollte sagen Seibold von Hochstetten, zu nennen wagt, so soll den Gesellen schon das blaue Donnerwetter erschlagen. Ich werde ihm aber schon ankommen. Für diesen Raub meines Namens verlange ich Schadloshaltung – ich verlange zehn Goldgulden, und Gott sei ihm gnädig, wenn er nicht herausrücken will. Denn so bin ich, sag' ich Euch, Herr Konz. Wenn ich in meinem Recht bin und es will einer nicht mit dem Gelde heraus, so bin ich ein Gesell, wie der leibhaftige Teufel. Da kehr' ich Euch alles um, sag' und schreib' ganz anders, als ich beim besten Willen vorhab', und geh's dann, wie da wolle, ich bin einmal so. Ich besteh' aus eitel Ehrgefühl, und wann mir da meine Ansprüche versagt werden, da kann ich Euch boshaft werden, als wär' ich ein Hauptschelm.« Bei diesen Worten verschwanden drei große Tafeln Marzipan und ebenso viele Zimtbrote, nebst sechs großen Äpfeln in Herrn Heinz von Höhenrains Manteltaschen. »Ich will Euch aber wohl sagen, woher ich so leicht griesgrimmig werde« – fuhr er unter weiterem Speisen fort – »das schreibt sich von meiner guten Herkunft, und daß ich mich soviel für andere aufgeopfert habe und dafür selten das geringste bekam. Ich sag' Euch aber, ich hätt' es nicht vonnöten, mich so zu plagen, wenn der verwünschte Herr Heinz von Höhenrain nicht wäre. Ich sag' Euch, ich wär' ein reicher Mann – er hat mich um eine ganze Erbschaft gebracht, der gotteslästerliche Geselle.«
»Jetzt versteh' ich erst«, fiel Herr Konz ein. »Als ich solch eine Frage stellte, was er für genaue Beschreibung meines Werkes verlange, da ich Euch fünf Goldgulden bezahlt hätte, ward er ganz grimmig und rief da so was von Bestechung oder dergleichen.«
»Seht Ihr, was er für ein reicher Mann ist!« erwiderte jener. »Der tückische Geselle, ich weiß es ja!«
»Doch läßt er sich von dem bezahlen, der ihm den Auftrag gegeben hat.«
»So, also doch. Nun, seht Ihr, was das für ein Schelm ist. Er hat Geld über Geld und läßt sich doch bezahlen – mir aber, der ich von meiner Arbeit leben muß und von einem hochansehnlichen Geschlecht stamme, mir verrennt und versperrt er alle Wege.« Sein Mantel verschlang wieder mehre treffliche, tragbare Speisen, und da die zwei Taschen im Verlauf gefüllt waren, schien nicht allein eine dritte, sondern noch eine vierte Tasche vorhanden zu sein, um weiteres aufzunehmen. »Ja seht, Herr Konz,« fuhr er fort, indem er sich über eine neue Reihe Speisen machte, »das nenn' ich eine Wohltat, so ein Ehrenmann sein Herz ausschütten kann. Ich sag' Euch, alles muß ich mir mit tausend Mühen erwerben – aber, wie berühmt ich schon gar manchen gemacht habe in Schrift und Wort – denn das sag' ich Euch, was das Loben betrifft, da überflügelt mich so leicht keiner – hab' ich doch selten soviel bekommen, als ich redlich verdiente – und soll's mir etwa noch einmal begegnen? Einen solchen Undankbaren will ich vor der ganzen Welt zu Trümmern hauen, daß kein guter Fetzen an ihm bleibt. Ihr seid der erste, der sich, was man nennt, redlich zu mir verhält, und habt mir auch fünf Goldgulden gegeben, indessen, wielange wird das Geld währen? Wenn ich's doch bis gen Eger oder gar Prag bringen könnte oder bis gen Leipzig, denn dahin wende ich mich zuerst, versteht Ihr? Aber bis dahin – ich mag gar nicht daran denken – Ihr erlaubt schon, daß ich diesen mäßigen Schinken zu mir stecke.«
»Immerhin, steckt nur ein,« sagte Herr Konz, »und damit Ihr seht, ich sei nicht so undankbar, als viele andere, so sagt mir's, eh' Ihr von hie abgeht, dann sollt Ihr nicht ohne trefflichen Zehrpfennig ausnehmend für die Reise davonkommen, damit Ihr Euer sonstiges Geld spart.«
Tief beugte sich Herr Heinz von Höhenrain, aber mit Worten konnte er nicht füglich antworten, denn eben war er aufs lebhafteste mit einem Gänsebein beschäftigt, welches er an beiden Enden hielt.
Plötzlich schob er den Gänsefuß ein, indem er sagte: »Was soll ich mich da plagen, wo Hülle und Fülle ist? So was ist immer für andere Zeiten gut, daß man was zu nagen und zu beißen hat. So – der ganze Gansschenkel kann auch noch dazu hinein, es hat noch gar vieles Raum. So – auf Euch zu kommen, so seh' ich wohl, daß Ihr ein Mann von höherer Gesinnung seid, als andere, denen ich diente. Ich bin nur begierig, was Ihr Augen machen werdet, so Ihr von des herzoglichen Koches Verzweiflung lesen werdet – und sollte er selbst, wie nicht, den Sieg davontraqen, brächte es Euch doch keinen Nachteil. Denn ich lasse ihn jedenfalls besiegt werden. Das soll hinterdrein nur zum Streit kommen, ha, ha, da ist alles weit auseinander und was da Zeugen?! Fern ab lauft das Büchlein in vielen Abschriften durch die Welt und bis der andere einen findet, der da ein Gegenbüchlein schriebe, o du lieber Himmel, bis dahin ist alles fest und richtig und hundertmal wieder abgeschrieben. Seht Ihr, so seid Ihr Euerer Sache ganz sicher. Also Ihr habt gesagt, Ihr werdet mir noch ein fünf, sechs Goldgulden dazugeben – so, das ist groß gedacht – aber ich sag' Euch, wie ich erst alles schildern werde in betreff des Kaisers, da Euer Meisterwerk aufgetragen worden, ich sage Euch, selb soll seinesgleichen suchen –.«
»Und wie gedenkt Ihr's zu schildern? Eßt nur!«
»Ich esse schon – also hört, selb werde ich etwan so beschreiben. Werde ich sagen: Wie da der Kaiser dasselbige Meisterwerk zu Gesicht bekam, ward er auf das äußerste erstaunt und unglaublich betroffen, sagend, verbalia, das heißt zu deutsch, dies sind seine illius, des Kaisers, Imperatoris, eigene Worte, verba ipsissima: Item es sagt der Kaiser: ›Solich wundersamen Werkes hätten wir Uns nimmer versehen, obgleich Wir wußten, daß Unser Koch, Herr Konz, der Meister und König aller Köche in gesamt Römisch und Deutschem Reiche sei. Haben auch sonst in keiner Schrift gelesen, daß etwas Gleiches je erschaffen worden. Darauf sind Wir fast stolz, daß Wir den Mann zu den Unserigen zählen.‹ Fahr' ich dann fort: Wie dann Seine Kaiserliche Majestät einen Schnitz und Löffel voll auf seinen güldenen Teller gebracht und selbe Sulzein versucht und mit kaiserlichem höchst eigenem Munde verkostet, ward er ersichtlich und unverkenntlich auf das höchste beweget, nachgehends er merklich allerorten umhergeschaut, gleichwie sagend, das sei noch über alle Erwartung. Hätte auch einem Diener gewinkt, und ihm was ins Ohr gesagt, darauf selbiger Diener eilends hieher zu Euch gekommen und des Kaisers Lob und Preisverkündigung hintergebracht hat. Hätte aber des Kaisers Majestät sich mittlerweilen zu Herzog Jörgen Bräutigam verlauten lassen: ›Wüßten Wir nur, daß ein anderer halb so trefflich sei, wie selbig Unser und des Reichs erster Koch, Herr Konz, möchten Wir etwan diesen andern zu Uns nehmen, Herrn Konz aber in wichtige Landesdienste, auch zu sonderlich hohen Ämtern bringen, denn es fehlt ihm nirgends an tiefem Wissen, Verstand und Witz. Ist aber nicht wohl tunlich, weil kein anderer vorfindlich.‹ Auf diese Worte hätt' sich dann Herzog Jörg tief verneigt, sagend: ›Kaiserliche Majestät, ich seh' wohl, daß Herr Konz des größten Verdienstes voll ist und ist mein Koch nirgends und in keinerlei Vergleich zu bringen, schon ich nicht Zweifel trag', daß er auch nicht zu den letzten in seiner Kunst gehört. Item erkenn' ich aber selbst an, daß er nur ein Zwerglein ist, hinwieder Herr Konz als ein Riese erscheint.‹ Seht Ihr, Herr Konz, so laß ich den Kaiser und die andern über Euch sprechen. Ich wollte aber nur, Ihr wärt dabei, wann ich von Landshut hinweg bin und spreche mit den Leuten von Euch. Ich sag' Euch, Herr Konz, da soll ich kein Biedermann sein, ich sag' Euch, diese Flasche Cyper soll mir in der Hand zerplatzen, während ich sie zu mir stecke, wenn Euch da nicht zum mindesten an die fünfhundert Menschen zusammenlaufen, so gewaltig will ich rumoren – und wehe dem, der Euch je mit einem Wort zu nahe tritt.«
»Also Ihr wärt in jeder Weise geneigt, Part zu halten gegen alle meine Feinde?« fiel Herr Konz rasch ein.
»Das versteht sich. Muß ich Euch denn nicht lieben, so Ihr mir auch nicht die höchste Ehrerbietung abgewonnen hättet?« entgegnete jener. »Habt Ihr einen Feind, so nennt ihn nur, ich will dem Gesellen genug zu schaffen machen.«
»Ich könnte Euch küssen«, rief Herr Konz. »Wohlan, so nehm' ich Euch beim Wort! Der Herzogs Koch wagt es, mich besiegen zu wollen. Da könnt Ihr Euch wohl denken, wie und ob ich ihn hasse. Doch hab' ich noch einen weit ärgeren Feind, der ist aber nicht hier.«
»Wo ist er?« rief Herr Heinz von Höhenrain. »Heraus damit, ich stech' den Gauch tot, und wär' er in lauter Eisen vernietet!«
»Das sollt Ihr eben nicht,« kam's zurück; »wenn Ihr zuwege bringt, daß er vor Wut und Ärger am Gallenfieber stirbt, ist's mir auch genug. Und das wird er sicher, Euch aber ist's ein leichtes, mir diesen Dienst zu erweisen. Versteht Ihr? Damit Ihr aber bei gutem Mute bleibt, will ich Euch meine Großmut – ich will sagen, meine Dankbarkeit – alsogleich beweisen, Ihr versprecht mir also treueste Besorgung?«
»Gleich soll mich der Teufel holen!« sagte Herr Heinz, »nur heraus mit der Angelegenheit. Was ich versprochen, das hab' ich noch nie unterlassen, wenn ich als Ehrenmann dafür bezahlt wurde.«
»Wohlan –« Herr Konz zog seine Geldkatze und zählte drei Goldgulden Geldes auf den Tisch. »Hier, Herr Seibold von Hochstetten, hier ist die Hälfte Eueres Reisepfennigs. Ich werde noch heute einen Brief schreiben. Den gebt Ihr selbsteigen ab an des Goldschmieds Hesebein Töchterlein zu Leipzig. Eh' Ihr abreiset, empfangt Ihr noch drei Goldgulden. Nun, was meint Ihr?« Er zog die Geldkatze langsam zusammen und legte sie auf den Tisch, während er sich fragenden Blickes darauf stützte.
Herr Heinz von Höhenrain führte mit der einen Hand einen Löffel voll Reisbrei, mit Kubeben und Zimt verwürzt, zum Munde, während er mit der anderen das Geld ergriff, beugte sich darauf wieder sehr tief und sagte, das Geld zu sich steckend: »Nun seh' ich, es ist eine Liebesangelegenheit. Das ist mir gerade das allerliebste – das heißt, wenn ich einem Ehrenmanne zu guten Zwecken dienlich sein kann, ist mir nichts zu heilig und zu keck.«
»Ihr seid ein heillos schalkhafter Gesell!« entgegnete Herr Konz. »Am Ende ist Euch da nicht wohl zu trauen?«
»Da seid Ihr sehr irre!« versetzte jener. »Ich bin mir mit einemmal getäuscht genug gewesen, seit der Zeit hasse ich das ganze Weibsengeschlecht – drum dürft Ihr keine Sorge tragen!«
»Also wohl – den Brief gebt Ihr des Goldschmieds Töchterlein. Meinem Feind aber, des Herzogs zu Sachsen Koch, dem Loschewitz, der mich viel verfolgt hat und mir zuletzt die Jungfrau abwendig machen wollte, demselben Loschewitz sagt Ihr: Derselbige Herr Konz, den er mit Teufelslist beim Herzog ausgestochen habe, sei seit zwo Monden in des Kaisers Diensten, anjetzt schon ein gar wohlhäbiger, an Ansehen aber unvergleichlicher Mann geworden, und ehe vier weitere Wochen verstrichen, käm' er gen Leipzig und hole Hesebeins Tochter. Da könnt' er dann sehen, was ihm all seine List und Bosheit gefrommt. Ha, ha, was meint Ihr zu der Sache?«
»Der Gesell wird vor Wut bersten,« rief Herr Heinz von Höhenrain, »und ist's ihm vollauf gerecht und gesund! Das beste bedünkt mich aber, Ihr ließet das Schreiben nicht lange sein und schriebt sogleich – wer weiß, was Euch heute noch alles aufhält.«
»Ist auch wahr!« Und Herr Konz eilte in die nächste Ecke um Feder und Papier.
»Ha, ha, selb ist ganz lustig,« sagte Herr Heinz, »ich sitze da, speise aufs trefflichste und der Narr von Herrn Seibold – ich wollte sagen, der Narr Herr Heinz von Hochstetten, will sagen Höhenrain, sitzt im Karzer und bläst Langeweile, mittlerweile wir in goldener Freiheit ganz trefflichen Schabernack erdichten.«
»Ja, das ist fürtrefflich«, entgegnete Herr Konz.
Im selben Augenblick ward es auf der Straße sehr laut.
»Was ist denn da los?« rief Herr Konz und eilte ans Fenster. »Wer kommt denn da gerannt? Das ist ja gar der gotteslästerliche Zettelräuber, der verwünschte Heinz von Höhenrain! Ist er denn frei geworden?!«
Aufsprang Herr Heinz von Höhenrain.
»Und wer – was Wetter, da stürmt ja die Scharwache nach!«
»Die verfolgt ihn eben.«
»Nein, seht Ihr denn nicht, daß er ihr winkt? Oder sollte er sie äffen –? Was soll denn das bedeuten?«
»Was es bedeuten soll?« rief Herr Heinz, der die Sache besser zu durchschauen glaubte. »Das werden wir sogleich wissen. Ich sage Euch, er ist entsprungen und sie verfolgen ihn. Er soll nicht entkommen – schaut nur hinaus, Herr Konz, da sollt Ihr Euere Freude erleben.«
Herr Konz rieb sich voll Freude die Hände und rief hinab: »He, Ihr kecker Gesell, Ihr werdet nicht lange mehr laufen!«
Mittlerweile hatte Herr Heinz seinen Hut ergriffen, nebstdem aber noch etwas, das war Herrn Konzens Geldkatze – die hatte derselbe im Eifer liegen lassen – rannte hinaus und die Kaiserküche hindurch, dabei er rief: »Auf, auf, her da, mir nach, Ihr Herren – he da, ruckt an mit den Bratspießen, es gilt den Heinz von Höhenrain zu fangen, der Eueren Herrn beschimpft und beraubt hat!« Und gleich zur Küchentür hinaus, da machte er dem Reisigen gehörigen Lärmen, daß der mit der Lanze ausfiel, um dem vermeinten Heinz den Weg zu wehren, sobald er herein wolle – der rechte Herr Heinz aber durchs Vortor hinaus, dann links herum – keineswegs aber auf Herrn Seibold zu, vielmehr auf die entgegengesetzte Seite – und fort war er.
Er war eben auf der einen Seite verschwunden, als Herr Seibold von Hochstetten von der andern dahergerannt kam, hinter ihm drein die Wache, unter der aber Herzog Christophs Diener, welcher kurz ehevor in der Kaiserküche gewesen war, und beide riefen Herrn Konz einiges zu, was ihn plötzlich in die Meinung versetzte, er sei etwa doch der Spielball irgendeiner schnöden List geworden. Zugleich fiel ihm seine Geldkatze ein. Er tat einen Satz an den Tisch. Weg war sie. Zwanzig Goldgulden Geldes waren drin gewesen – und nun alles fort. Es schwindelte ihm, daß er in den Stuhl sinken mußte, während er einen lauten Schrei des Schreckens ausstieß, der, durch die offene Tür wohl vernommen, sogleich etliche Köche hereinzauberte.
»Räuber – Räuber!« lallte Herr Konz. – »Soll ich wirklich betrogen – sollte, der da bei mir war, sollte er etwa nicht Seibold von Hochstetten gewesen sein, sondern ein anderer, am Ende gar der Heinz von Höhenrain! Ha, welche Schande, welch ein Unglück! Der Gesell raubte nicht allein mein Geld – nein, er trüge meine Schmach voll Hohnes in die ganze Welt hinaus – setzt ihm nach, nach setzt ihm –!« Und sprang auf, um seine ganze Schar wiederholt anzueifern und selbst nachzueilen.
Eben wollte er hinaus, als die Wache hereinkam, voraus Herr Seibold von Hochstetten und Herzog Christophs Diener.
»Wo ist der Schurke!« donnerte Herr Seibold von Hochstetten. »Halt da! Herr, des Kaisers Koch, ich frag', wo ist der Elende, so es wagte, sich bei des Herzogs Diener für mich auszugeben, der sich offenbar vorher schon bei Euch für mich ausgab und nun von Euch statt meiner bewirtet worden ist?! Kreuz, Blitz, Donners, ich eingesperrt für diesen Teufel aller listigen Teufel, leid' Hunger, Durst, Ärger, Gram, Verzweiflung und Demütigung und er lebt in Saus und Braus und ist alles Hohnes und Siegesgeschreies voll! Ich frag' Euch, wo ist der Schelm, heraus damit, oder Ihr sollt mich kennen lernen – ich frag' Euch, wo ist er?«
»Das ist's ja eben«, rief Herr Konz nicht minder empört, als Herr Seibold. »Fort ist er, Euch zu fangen, für den er sich ausgab. Als er Euch kommen sah, machte er sich mit dem Vorwande davon, aber ich sah ihn nicht vorne heraus, er muß um die Hofküche herum sein. He da, es sind ihm doch etliche nachgeeilt? O, der Schurke! Noch etliche von Euch fort an alle Stadttore, daß sie geschlossen werden, daß er nicht hinauswischt – o, der unergründliche Schelm ißt, trinkt, lügt, steckt alle Taschen voll und zuletzt raubt er mir noch meine Geldkatze, zwanzig Goldgulden und etliche hab' ich mir schon abschwätzen lassen!«
Hinaus eilten noch mehrere Köche und Küchengesellen, desgleichen sämtlich die Scharwache, Herrn Heinz von Höhenrain in allen Richtungen zu verfolgen.
Aber es war so leicht nicht, einen Mann seinesgleichen zu erwischen, und er wußte die Sache durch etliche, welche ihm begegneten, noch besser zu verwirren. Das ging er so an. Er versetzte sie in Meinung, er selbst eile dahin, die Scharwache zu finden, um den verwünschten Heinz von Höhenrain gefangen zu nehmen, der sich in der Nachbarschaft verborgen habe. Dabei bezeichnete er einen abgelegenen Hofraum und eilte fort. Die anderen aber wollten vorher zusehen, ob die Scharwache etwan in anderer Richtung zu finden sei, eilten, was sie konnten, und riefen, als sie wirklich draufstießen: »Uns nach, uns nach, ihr sucht den Heinz, dort ist er!« Und gleich voraus, jene und Scharwache hinterdrein, den Hof abgeschlossen und alles durchsucht. Da fand sich nichts. Also galten die etlichen für Helfer und Hehler und wollte sie die Scharwache festnehmen. Drüber gab's einen ganzen Zusammenlauf, unglaubliches Geschrei, Streiten und Beteuern, bis es sich augenscheinlich herausstellte, daß die etlichen den Heinz von Höhenrain gar nicht kannten und daß er es wohl selbst gewesen sei, der sie irregeführt habe, wie es etwan vorzeiten der Eppelein von Gailingen mit seinen Verfolgern angerichtet. Unterdessen aber hatte sich Herr Heinz nicht allein bis unweit vom Judentor salviert, sondern er war bei so trefflich spitzbübischer Besonnenheit, daß er sich eines Kleppers versah, der nächst einer Haustür angebunden war. In die Haustür hinein, einen Augenblick drin geblieben, dann langsam heraus und den Klepper losgebunden, als wäre er sein eigen, hinaufgesetzt, langsam zum Tor hinausgeritten, dann aber den Stoßdegen heraus, etliche Streiche rechts und links mit der flachen Klinge, daß die Mähre ganz toll ward – und davongesaust.
Mittlerweil' es geschah, erfuhr Herr Konz, wie Herr Seibold aus dem Gefängnisse befreit worden sei. Das hatte dieser Herrn Leo Hohenecker zu verdanken. Derselbe hatte den Rumor gehört, Herrn Seibold von ferne erkannt und sogleich den Irrtum zu heben gesucht, als er die Leute im Wahne sah, daß der Gefangene Herr Heinz von Höhenrain sein solle. So war er da und dorthin gelaufen, stand gut, daß eine Verwechslung vorliegen müsse, und hatte die Freude, Herrn Seibold in kürzester Zeit zu befreien.
Vergeblich hatte er sich aber darauf bemüht, Herrn Seibolds Gemüt in einiger Ordnung zu erhalten. Der war nicht zu bändigen gewesen und hatte nichts vor Augen, als Rache an seinem Feind und Namensräuber, der statt seiner ins Gefängnis sollte – Herzog Christophs Diener, welcher von Herrn Leo gehörige Auskunft bekommen, sollte zum Überfluß Bestätigung geben, daß er er selbst und nicht ein anderer sei, die Scharwache, welche des Weges kam, war gefolgt – und wie bekannt, waren sie dann sämtlich zur Kaiserküche geeilt.
Da jeder, Herr Konz und Herr Seibold, sein Erlebtes für das ärgste hielt, der beiderseitige Hauptfeind aber nicht mehr da war, so konnte es nicht fehlen, daß zuletzt sie selbst aneinander kamen.
Eben erhoben sich schon die beiderseitigen Hände, um auf Worte Taten folgen zu lassen, als Herr Martin Hollar, von des Kaisers Diensten, hereineilte.
»Was bringt Ihr?« rief Herr Konz – »ist er gefangen?«
»Ich weiß von keiner Gefangennehmung,« war die Antwort, »ich bringe ganz was anderes. Macht Euch auf eine Schreckensbotschaft gefaßt!«
»Ich bin des Todes – mein Meisterwerk hat des Kaisers Mißfallen!« stammelte Herr Konz. Es ward ihm schwindlig und wieder in den Stuhl fiel er ganz gerade herab. Da saß er, beide Hände auf den Knien und steif wie eine Leiche. – »Sprecht – sprecht, Herr Hollar –!« lallte er. Es war aber, als hätte ihn der Schlag auf die Zunge getroffen.
»So hört denn«, sagte jener. »Euer Turmwerk und Meisterstück wird vor den Kaiser gesetzt, des Herzogkoches welsche Brüh desgleichen. Was geschieht? Beides steht nicht allzulange, so stürzt Euere Viktoria von der Höhe herab und vor den Augen des Kaisers in die welsche Brüh'.«
»O Himmel!« rief Herr Konz, halb auffahrend. »Und der Kaiser –? Was sagte der Kaiser, frag' ich?«
»Nichts soll er über eine Minute lang gesagt haben«, war die Antwort. »Sollt' er aber dann doch was gesagt haben, so kann ich's Euch nicht berichten, denn sobald ich das alles erfuhr, vergaß ich, im Schrecken für Euch, länger zu warten und eilte daher, Euch die Botschaft zu bringen.«
»Nichts hat er gesagt? O, ich weiß mir genug!« klagte Herr Konz. » Nichts, gar nichts. Also geriet er in Zorn, in Grimm, in Wut, daß er kein Wort finden konnte? Ich bin ein geschlagener Mann, ich komme in Ungnade, das ganze Reich ist verhöhnt in des Kaisers höchster Person. Die Viktoria fällt vor des Kaisers Augen herunter. Was wird man da hineinlegen? Die Viktoria, welche seinen Ruhm bedeutet, die Viktoria fällt in die welsche Brüh'. Das ist eine unermeßliche Anspielung, Vorbedeutung! Man wird mich einer Verschwörung bezichtigen, die zum Zweck hat, dem Kaiser öffentlich Mißtrauen zu verschaffen. O Himmel, o Himmel! Ich – ich bin schuld an allem, was daraus erfolgt, wenn sich der Kaiser grämt – ja, er kann vor Schrecken erkranken, er kann sterben – und ich, heißt es, ich bin schuld, man nennt mich einen Kaisermörder!! Führt mich fort, sperrt mich ein! O, was muß ich erleben – und – und wer ist am Ende schuld an allem? Hätt' ich mich nicht verteidigen müssen, so wär' mein erstes Süßzeug verwendet worden und nie und nimmer wär' die Viktoria herabgefallen. Aber das zweite war ein flüchtiges Gemisch, keine überlegte Arbeit, ich war schon konfus – ja, das war ich, wütend war ich – und wer brachte mich in diese Konfusion? Niemand« – dabei fuhr er ganz auf und auf Herrn Seibold von Hochstetten zu, »niemand, als Ihr – o – o, des Herzogs Koch trägt offenbar den Sieg davon – und Untergang ist mein Los – Untergang und Besiegtheit.«
»Halt! selb ist noch nicht ausgemacht, Herr Konz,« fiel Hollar ein, »soviel ich dann doch hörte, hat der Kaiser sich mit der Brüh' bedienen lassen, und da er einen Löffel voll zu sich genommen, soll seine Majestät das Haupt ansehnlich geschüttelt und dazu gesagt haben: ›Da ist ja etwan gar Salz zu verspüren?‹«
»Herr, heiliger Gott, was fällt mir bei!« rief Herr Konz – »die Brüh' war nicht süß genug – gar Salz, sagte der Kaiser –?!«
»Ja, so heißt es,« bestätigte Herr Hollar, »und er soll ein ziemlich saueres Gesicht gemacht haben.«
»Ich bring' Euch um vor Wonne!« Herr Konz war im Begriff, ihn zu umarmen, als eine laute, drohende Stimme hörbar wurde. Es drängte sich jemand durch Köche und Küchengesellen herein.
Es war niemand anderer, als des Herzogs Koch, Herr Tobias Hilkertshofen.
»Find' ich Euch?!« donnerte dieser. »Ha, Ihr Verräter, Ihr Quintenmacher, Ihr sollt meiner Rache nicht entgehen!«
»Was wagt Ihr da zu sagen?!« donnerte Herr Konz entgegen.
»So kann ich wohl zu Euch sprechen«, fuhr jener in wildestem Grimme fort. »Eine Teufelslist habt Ihr gebraucht, meinen Sieg zu untergraben, mittlerweil' Ihr mir versprochen hattet, jederart in freier Weise unserer Kunst zu streiten. Ihr aber habt mir einen Gesellen zugeschickt, des Namens Seibold von Hochstetten – der hat sich mit Satanslist an mich gemacht, seine Zeit ersehen und kein anderer, denn er, kann's gewesen sein, der mir in die glorreich süß und gewürzte welsche Brüh' Salz gestreut hat, daß sich des Kaisers ganzes Gesicht verzogen haben soll.«
»Was hör' ich da?« rief Herr Seibold. »Ihr, Salz, Brüh', Seibold, wie kommt das wieder zusammen?!«
»Schweigt Ihr!« polterte der Koch.
»Ha, des schnöden Vorwurfs!« rief Herr Konz. »Ich verachte Euer wahnwitzig Gerede, Herr Hilkertshofen, denn ich bin zu groß und erhaben in meiner Kunst, als daß ich solcher Kniff, Pfiff, Quinten und Arglist sondergleichen bedürfte – ha, es bedarf nur eines Wortes und Ihr seid aufs Haupt geschlagen! Hier steht Seibold von Hochstetten – ich frag' Euch, ist er bei Euch gewesen und habt Ihr Beweis, daß ich ihn zu Euch sandte, auf daß er Euch Salz in die Brüh' streute? Ich sag' vielmehr ganz anders. Ihr bezichtiget mich der List, ich aber kehr' das Spiel um und bezichtige Euch schnöder List. Keinen Augenblick setz' ich einen Zweifel, daß Ihr ihn zu mir hergeschickt habt, damit er mich an Vollendung meiner letzten Arbeit verhindern und mich verwirrt machen sollte, auf daß ich mit meinem Meisterwerk zuschanden würde.«
»Was sagt Ihr?« tobte Herr Tobias Hilkertshofen. »Ich Euch diesen Mann geschickt? Nimmermehr –«
»So habt Ihr mir denselbigen anderen geschickt,« fiel Herr Konz ein, »der mich belogen, betrogen, beraubt hat, meine ganze Geldkatze hat er mir entführt.«
»Den Blitz auf Euere freche Zunge! Gott's stärkstes Unwetter soll mich auf der Stelle erschlagen, wenn ich so was zu verantworten hab'!«
»So waltet eine unermeßliche List über uns beiden.«
»Was soll das?«
»Was das soll? Das soll heißen, es könnte sein, daß hier dieser angebliche Herr Seibold von Hochstetten –«
»Freilich, freilich ist er es – schweigt, sag' ich, Herr Seibold, ich befehl' es Euch – Euch aber sag' ich, in der Sache ist unglaubliche Verwirrung, doch soviel bedünkt mich und anders kann es nicht sein: Dieser hier sandte Euch den Heinz von Höhenrain zu und der Heinz von Höhenrain sandte mir diesen da zu – oder wie es sonst erging, wurden wir, ein jeder, verwirrt gemacht, und zuletzt ging alles aufs Geld hinaus. Jetzt stellt sich der da, als wüßt' er nichts und sei vom anderen verfolgt und am Ende teilen sie meine Geldkatze.«
»Ha, Ihr unergründlicher Bösewicht,« rief Herr Seibold, »jetzt ging all' Schreck, Pein, Wut und Verbrechensstraf' an mir aus, der ich der unschuldigste Mensch auf der Welt bin, unsäglich viel durch diesen Heinz von Höhenrain erlitten habe und der ich ein Mann bin, für den Herzog Christoph selber einsteht!«
»Was, den könnt' Ihr gar wohl getäuscht haben«, rief Herr Konz. »Ihr seid doch einverstanden, und keiner von euch beiden ging auf Beschreibung der Hochzeit aus, ihr wolltet nichts, als meine Geldkatz'!«
»Ich bring' Euch um!« raste Herr Seibold. »Ich mit dem einverstanden, der mich sozusagen vom ersten Schritt an mit List, Bosheit und Raub verfolgte?! Er hat mir mein Büchlein – ha, was seh' ich –? Da liegt es, das ist mein allererstes Büchlein, das hat der Schelm hier verloren! Seht Ihr, da schaut her, geht der auf Euer Geld aus, der solchen Scharfsinn, so viele Treu' und Umsicht anwendet, all' diese Namen, Titul und Reihen anzulegen, auf daß all Vorkommendes nur darunter gesetzt werden mag? Blitz, Donners, da schaut her, sag' ich, das ist meine eigene Schrift!«
»Und diese hier unten ist wieder eine andere.«
»Ja, 's ist die Schrift dieses gottverwünschten Heinz von Höhenrain, aber das ist's ja eben, er hat mir das Büchlein geraubt.«
»Ha, ha, geraubt? Euere zwei Schriften in einem Büchlein – und da vorne der Einzug hat wieder eine andere Schrift.«
»Kreuz, Blitz, Donners, das ist ja die Schrift des Pankraz von Znaim. Habt Ihr denn von der Sache nichts gehört?«
»Da findet sich der Satan zurecht – Ihr seid einverstanden, dabei bleibt es.«
»Ja, dabei bleibt es«, wiederholte polternd Herr Tobias Hilkertshofen.
»Nein,« schnaubte Herr Seibold, »dabei bleibt es nicht, den Schimpf ertrag' ich nicht, ihr sollt zur Verantwortung gezogen werden!«
»Das soll Euch blüh'n!« donnerten die zwei Köche.
»Der Kaiser soll entscheiden, dies Büchlein hab' ich in München gekauft, der Krämer soll Zeuge stehen!«
»Der Satan soll's!« Mit rascher Hand entriß es ihm des Herzogs Koch.
»Mein Büchlein!« Und schon hatte sich der Kampf entsponnen, hin und her und hinaus in die Kaiserküche, dabei der Ruf: »Zum Kaiser, zum Kaiser!« ein über das andere Mal ertönte. Urplötzlich flog das Büchlein aus Herrn Hilkertshofens Hand in das nächste Feuer. Herr Seibold gleich durchgedrängt und mit kecker Hand ins Feuer gegriffen. Schon hielt er es siegreich und hoch in der Hand und wollte hinaus, als es ihm Herr Konz entriß und weitweg in ein anderes Feuer schleuderte. Da ging es in Flammen auf, ehe sich Herr Seibold nähern konnte. Drauf erfolgte von allen drei feindlichen Seiten neues Geschrei und Getob, der Ruf: »Zum Kaiser!« verdoppelte sich mit Macht und hinaus stürzte Herr Seibold von Hochstetten, hinter ihm Herr Konz und Hilkertshofen – und was alsbald Menge Volkes nachdrängte, das kann sich jeder denken.
* * *
Um Mitte des Hochzeitsmahles war die Tafel auf eine Zeit unterbrochen und sonstiger Kurzweil Raum gegeben worden, woran Braut und Bräutigam und so viele Fürsten und Herren vom Kaiser dazu entboten, teilnehmen sollten. Wär's auch nicht so gewesen, die wilde Angelegenheit der drei Feinde hätte eine Unterbrechung bewirkt. Kaiser Friedrich und alle Fürsten waren alsbald unterrichtet, was da vorgefallen, wie um Gehör und strenges Gericht gefleht werde, und schien das alles, was hin und her behauptet ward – als des Heinz von Höhenrain Schelmstreiche und Flucht, der Köche Verzweiflung und Herrn Seibolds Leiden – so bunt und fraglich und verwirrt, daß sich sämtliche ein trefflich und lustsames Vorkommen erwarteten.
»Also laßt sie heraufkommen,« sagte der Kaiser, »wir mögen uns fast letzen, so sie recht hintereinander rucken!«
Alsogleich eilten etliche Diener hinaus.
Der Kaiser aber fuhr fort: »Was Wir da mehr gehört vom Seibold von Hochstetten, soll er ein unbescholtener Mann sein; so daß man sich bösen Einverständnisses nicht versehen dürfte. Wenn's so ist, hat er ein unglaubliches Mißgeschick, daß ihn alle Welt in Wirrnis bringt und er hinwieder alle anderen Menschen. Kennt ihn einer von euch Fürsten und Grafen?«
Da sagten Herzog Ludwig und Georg von Niederbayern manche gute Worte.
Darauf trat Herzog Christoph vor und sagte: »Kaiserliche Majestät, auch ich weiß Bericht. Ich kenn' denselben Seibold von Hochstetten zwar keineswegs von Persona, was ich aber in wenigen Worten über ihn selbsteigen von einem trefflichen und mir ganz wohl vertrauten Mann gelesen, so sich Thoman von Bruckberg schreibt, also ist vom Seibold von Hochstetten nur das beste zu halten und derselbe für einen Ehrenmann anzuerkennen, solange er schon von Seldenthal hinweg ist. Was früher, haben Herzog Ludwig und Georg belobt.«
»Also wär' seiner ein guter Bericht« – erwiderte der Kaiser. »Doch was ist's mit dem Heinz von Höhenrain? Es ist Uns etwan halb erinnerlich, es habe sich der Seckendorfer seiner angenommen?«
»Wenn's so ist, Kaiserliche Majestät,« entgegnete Herzog Christoph, »also mag er sich die Anempfehlung sonder Zweifel erschlichen oder sonst betrüglich selber verfaßt haben.«
»So wird es wohl sein«, sagte der Kaiser. Dazu winkte er des Pfalzgrafen Philipp Narren, dem Pankraz von Znaim, und sagte ihm was ganz leise, darauf dieser forteilte.
Im nächsten Augenblick wurde der drei Feinde Ankunft im Vorsaale gemeldet und sofortiger Eintrittsbefehl wiederholt.
Als sie eintraten, fielen Herr Konz und Tobias Hilkertshofen vor dem Kaiser auf die Knie nieder, Herr Seibold von Hochstetten aber beugte sich nur, so tief er konnte.
»Also, was ist da vorgefallen?« fragte der Kaiser, den zwei Köchen andeutend, sie sollten sich erheben. »Wir sind zwar zum Teil schon unterrichtet, wollen aber in kaiserlichen Gnaden nun weiter und näheres vernehmen.«
Da erzählten auf seinen Wink die zwei Köche nacheinander in großem Eifer, was sie betraf und was Meinung sie hätten. Als sie zu Ende waren, winkte der Kaiser Herrn Seibold von Hochstetten. Worauf dieser mit verwunderlichem Fluß der Rede all sein Unglück erzählte, vom ersten Schritt zur Reise bis zum gegenwärtigen Augenblick, so daß sich der Kaiser und alle anderen viel ergötzten und verwunderten, wie einen Mann soviel treffen könne. Hinwieder wurde aber auch anerkannt, er habe seine verwirrte Angelegenheit nicht allein mit großer Deutlichkeit, sondern auch ganz geziemender Heiterkeit vorgetragen, anmit sich selbst das Zeugnis eines Mannes von guter Lebensart ausgestellt.
Das war weder von Herrn Konz noch Herrn Tobias Hilkertshofen erwartet worden, vielmehr sie auf ein ausnehmend heftiges Gehaben Herrn Seibolds gerechnet hatten. Indessen vernichtete all dieses ihre Hoffnung keineswegs, daß Herr Seibold dennoch unterliege, wie unterhaltlich auch seine Relation gelautet und wie rein er sich auch zu waschen gesucht habe.
Als demnach Herr Seibold zu Ende war, mittlerweil' auch des Pfalzgrafen Narr wieder eintrat und der Kaiser nach einiger Zeit fragte: »Nun, Konz, was sagt Ihr dazu und beschuldigt Ihr den Mann noch, wie vorher –?« hob Herr Konz zwei Finger in die Luft und sagte:
»Kaiserliche Majestät, all was da dieser sein sollende Seibold von Hochstetten von sich her erzählte, mag wohl so sein – in Sachen meiner aber macht es keinen Unterschied. Also sei dem, wie da wolle, er ist und bleibt die Schuld an meinem, Euerer Kaiserlichen Majestät untertänigsten Knechte, unsäglichen Unglück. Wohl hab' ich vernommen, daß die Viktoria von meinem Meisterwerk herabgestürzt und Euere Majestät hochgnädigst drob so erzürnt zu werden geruhte, daß allerhöchst Euer Mund keinen Laut zu sprechen vermochte, das heißt, für gut hielt. Also bring' ich keineswegs in Anschlag, was Unglück oder Glück diesen Mann sonst und vorher betroffen. Ich seh' nichts anderes an, denn Euerer Kaiserlichen Majestät Grimm, Unmut und meines Ruhmes gänzlichen Untergang – und flehe um ganz scharfe Rache an diesem sein sollenden Herrn Seibold von Hochstetten.«
»Und verlangt Ihr auch Rache?« fragte der Kaiser Herrn Hilkertshofen.
»Ganz und gar und alleruntertänigst demütigst zu vermelden,« war die Antwort, »flehe ich um dasselbe, Kaiserliche Majestät. Denn nimmer glaublich erscheint es mir, daß jener andere, das heißt, jener sein sollende Heinz von Höhenrain, sonder alles Einverständnis dieses sein sollenden Seibold von Hochstetten zu mir gekommen ist und in mein, der welschen Brüh', unvergleichlichstes Meisterwerk etwan eine Handvoll Staubsalz warf. Wie dann solches ungezweifelt sein muß, da ich sicher nichts dergleichen tat, sonst und auf dem ganzen Weg bis zur kaiserlichen Tafel niemand Fremder, Treuloser beizukommen vermochte, mir aber wohl zu untertänigsten Ohren gedrungen ist, wie Ihr Euch, Kaiserliche Majestät, über Inhalt des Salzes in selb süßer Brüh' kopfschüttelweise auszusprechen geruht habt!!«
»Und was verlangt Ihr, Seibold von Hochstetten? fragte der Kaiser.
»Kaiserliche Majestät,« antwortete dieser, »ich flehe vordersamst um nichts anderes, als dies. Laßt mich in den Kerker werfen, zehn Jahre lang darinnen verweilen und mir sodann dies mein Haupt abschlagen, so mir nachzuweisen ist, daß ich nicht allein in dieser Angelegenheit das beste und reinste im Sinn hatte, daß ich mich des geringsten in List und Schelmstreichen erging, und daß ich all mein ganzes Leben hindurch auch nur ein einzigesmal von Gesetz, Recht und heiligster Pflicht eines ehrbaren christlichen Mannes abgewichen sei. So viel sag' ich und mehr nicht. Was wild aber mein Gemüt auch nach Rache begierig war, der Zeit ich von der Kaiserküche bis daher, als zu meinem Herrn und Kaiser, gelangte – angesichts Euerer genügt's mir aufs beste, so Ihr meinen Worten Glauben schenkt, meine Ehre ins reine stellt und diesen beiden – je Euerer Kaiserlichen Majestät und des durchlauchtigsten, hohen Herrn Herzogs Koch – nichts entgelten lasset, wo all ihr Ruhm und Vorzug zum Entscheid kommen soll.«
»Das ist wohl gesprochen«, sagte der Kaiser. »Demnach erklären wir Euch, bester Überzeugung nach, für jeden Fehles ledig und schuldlos und loben Euch für all Euere frühere Zeit. Drob haben wir guten Bericht vernommen durch Herzog Christoph von Bayern.«
»Habt Dank, mein kaiserlicher Herr und Gebieter!« rief Herr Seibold. »Habt Dank, allergnädigster Herr Herzog!«
»Nun sollt auch ihr beschieden sein«, fuhr der Kaiser fort, indem er sich zu den beiden Köchen wendete. »Einer wie der andere von euch ist der Ruhmbegierde und Rachelust so voll, daß es schier verwunderlich nicht wäre, etwan ihr selbst gegeneinander gehetzt hättet und das Opfer euerer List geworden wärt. Das liegt Uns aber hie nicht an und wollen es auf ein näheres nicht in Betracht bringen – vielmehr es eueren eigenen Herzen zu stillem Bekenntnis übergeben und anheimstellen. Weil ihr aber alsoviel Schrecken und Pein erlitten und in der Sache eueren Ruhm erblickt, mögen Wir euch ein tröstlich Wort spenden. Ihr beide habt verloren – und beide habt ihr es gewonnen. Die welsche Brüh' war zu sauer, das Wellenwerk, so Wir drauf in Versuch brachten, hinwieder zu süß. Also habt ihr beide verloren. Weil aber die Viktoria in die Brüh' fiel und sie in einigem versüßte, fanden Wir die Brüh' bald ruhmeswert – und hinwieder Wir des Turmes Versuch taten, mundete uns ein Bissen aufs beste und glich sich eins im anderen in soweit ganz wohl aus. Das ist Unsere Meinung. Also können Wir zwar keinem den Preis allein zuerkennen – wohl aber euch selb zweit in Anerkennung doch über alle anderen Köche halten. Die tun's euch sicher nicht gleich und dürft ihr guter Belohnung euerer Mühen und großen Aufwandes an Erfindung gewärtig sein.«
Drauf wandte er sich zu Herrn Seibold und sagte:
»Ihr seid Uns als ein ganzer Mann erschienen. Von Unsertwegen wöllen Wir Euch zwanzig Goldgulden bewilligen, dieweil Ihr Uns mit Euerer Leiden Fürtrag trefflich erlustigt habt. Was steht Euch nun noch zu Herzen?«
»O allergroßmächtigster Kaiser und Herr, so Ihr mir's möglich machtet – –!« rief Herr Seibold mit freudig unterdrückter Stimme, hielt aber ein, zugleich er vertrauensvoll fragend auf Herzog Christoph blickte.
Der verstand ihn sogleich und sagte: »Kaiserliche Majestät, ich seh' gar wohl, was ihm am Herzen liegt. Das ist: Jedes Dinges Kenntnis von hochberühmter Hochzeit allhier zu Landshut. Haben wir's getroffen, Herr Seibold von Hochstetten? Bitten so Kaiserliche Majestät und folgend unsern lieben Vettern, Herzog Ludwig, Befehl zu erteilen, daß ihm, dem Seibold, all und jedes Verzeichnis zur Einsicht anheimgegeben werde, auf daß er nach soviel Müh', Plag und Schrecken in weiterer Ruh' und Sorglosigkeit vom ersten bis zum letzten beste Kenntnis erlange und selb sein vorhabend preiswürdiges Büchlein zur Ausführung bringen könne, wie er es für den Thoman von Bruckberg zu leisten unternommen hat. Bitten auch weiters, daß ihm Zeit seines Aufenthalts aus des Kaisers Majestät Hofküche treffliche Speisung und des besten Weins in Fülle verabreicht werde, damit ihm weiters guter Mut erwachse und bei sämtlich seiner Arbeit die Leibeskraft nicht schwinde.«
»Das soll geschehen,« war des Kaisers Antwort, »und ist auch fast billig, da sein listiger Feind verspeist hat, was ihm, dem Seibold, gebührte. Also mag er sich nun in desto besserer Ruhe und sonder Gewissensangst munden lassen, was Unser Koch, der Konz, ihm vorsetzt.«
»Dank, tausend Dank, mein allergnädigster Kaiser und Herr! Dank, allergnädigster Herr Herzog Christoph!« sagte Herr Seibold, von Wonne ganz durchglüht.
Der Kaiser aber winkte des Pfalzgrafen Philipp Narren, Pankraz von Znaim, und sagte: »Nun, Konz, ich will Euch ersetzen, was Euch der Heinz von Höhenrain geraubt hat – wie viel ist es?«
»Zwa– zwan– nein – achtundzwanzig Goldgulden – Kaiserliche Majestät« – stotterte Herr Konz.
»Zahlt sie ihm aus, Pankraz,« befahl der Kaiser – »und daß des Herzogs Koch seines Schreckens Ersatz habe, ihm gleich soviel!«
Voll Freuden empfingen die zwei besagtes Geld.
»Und nun händigt dem trefflichen Seibold von Hochstetten zwanzig Goldgulden aus!«
»Ei, wie kann ich 's, Kaiserliche Majestät,« rief der Narr und Gaukler, »da er mir sie schon entrissen hat?«
»Was hab' ich?« rief Herr Seibold. »Ich Euch etwas entrissen? Ich weiß von nichts!«
»So, Ihr wißt von nichts? Habt Ihr nicht eben einen geschickten Griff getan und nicht allein Euer, vielmehr auch mein Geld geraubt? Nur heraus da, weg mit Euerem Mantel, seht Ihr, da drin ist es, hört Ihr's nicht klingen?«
»Mei – meiner Seel', da ist was drin!« lallte Herr Seibold und nahm es heraus – »aber Majestät, ich kann beschwören –« zugleich gab er das Geld dem Pankraz von Znaim.
»Was wollt Ihr beschwören?« rief Herr Pankraz. »Da nehmt Eure zwanzig Goldgulden – das andere ist mein Geld – so – aber damit sind wir nicht zu Ende! Ihr seid ein Schalk, der mich hie vor des Kaisers Majestät und allen Fürsten überlisten will, daß ich etwan gar meinen Dienst verlöre – he, ich hab' eine feine Nase und ein scharfes Auge und hab' alles weitere wohl gesehen!«
»Ja, was denn noch?«
»So, was noch? Habt Ihr nicht des Kaisers güldenen Löffel eingesteckt und die Gabel, so beide hier lagen – hei das Messer auch dazu –«
»Fürwahr, es ist alles verschwunden,« sagte der Kaiser, »Wir sahen aber keine Hand hergreifen.«
»Das ist's eben, Kaiserliche Majestät, dieser Herr Seibold hat Euch eine Geschwindigkeit ohnegleichen – nur heraus mit dem Besteck! Wart, ich will Euch da den Mantel festhalten, weg da –!«
In einem Nu hatte Herr Seibold den Mantel des Herrn Pankraz um, ohne daß jener es ahnte, und das güldene Besteck kam auf einen Griff des Gauklers zum Vorschein. Ganz vernichtet stand Herr Seibold. Herr Pankraz von Znaim seinerseits rannte mit Beteuerungen allerart hin und her zu dem und jenem der Fürsten, sooft er aber zu Herrn Seibold zurückkam, rief er stets über neuen Raub und schüttelte Dolche, Ketten, Handschuhe und was sonst aus demselben Mantel. »Heisa, was kommt da?« rief er mit einemmal, »Krebse habt Ihr auch geraubt? Ha, ha, und was da noch alles drin ist! Nur heraus da, da darf nichts verborgen bleiben!« Und schüttelte Krebse, Backwerk, Äpfel, Pomeranzen heraus, das polterte und sprang alles übereinander, Kaiser und Fürsten aber erlustigten sich baß.
»Majestät, das – das ist zuviel!« rief Herr Seibold, »gestattet mir in Gnaden –!«
»Fort möchtet Ihr? Das glaub' ich wohl«, fiel Herr Pankraz ein. »Ihr merkt, daß Eueres Raubes noch mehr zutage kommt. Hei, was ist denn da? Ihr versteht Euch fast gut aufs Verbergen. Heraus da aus Euerer Nase –!«
»Was wollt Ihr denn mit meiner Nase?« jammerte Herr Seibold.
»Was ich will? Die Melone will ich, so Ihr drin verborgen habt. Hei, seht Ihr, da ist sie schon, schnupft der Herr eine Melone! Und drei Zitronen hat er auch noch darin. Heraus damit – so, da sind sie schon! Daß Euch der Geier! Was ist denn da? Das ist ja, als wär' ein ganzes Schatzkästlein drin? Was, hab' ich nicht ehvor mein Geld eingesteckt? Nun hab' ich's nicht mehr, das habt Ihr mir auch wieder in die Nase hinaufgeschnupft! Seht Ihr, daß ich die Wahrheit spreche!« Dazu einen Strich gemacht über Herrn Seibolds ehrsame Nase und darangeklopft, da fuhr schon das Geld heraus und tanzte auf dem Boden umher. »Halt, was habt Ihr da mit Euerer Hand getan! Ihr wollt was verbergen?«
»Ich – ich – ich will nichts verbergen!«
»Ja, dennoch, drauf wollen wir Euch wohl kommen!« Und sogleich wieder in den Mantel hinein. »Ha, ha, also Tauben stehlt Ihr auch, da haben wir schon zwei, die sind ja ganz wohlbeleibt und gut gebraten – halt, und herüben, auf da den Mantel! Da sind gar drei lebendige! Huß, huß, hinaus da!« Und die drei Tauben flatterten Kaiser und Fürsten über den Köpfen hinweg. »Halt, sag' ich – was hab' ich da gesehen, da habt Ihr ein Zettelein im Mund!«
»Ich hab' nichts im Mund!!«
»Ja, sag' ich!«
»Nein, das werd' ich doch wissen!«
»Nichts da, da hilft kein Leugnen!« Und Herr Pankraz begann zu ziehen und zu ziehen und zog und wickelte einen unglaublich langen Streifen Papier aus Herrn Seibolds Mund, daß weitaus rings lautes Lachen aufschlug, und mitunter griff der andere da und dorthin an Herrn Seibold und holte noch die verschiedensten Dinge hervor, zuletzt, wie wieder aus dessen Nase, einen Ball um den anderen und einer war größer als der andere. Hui verschwanden die wieder bis auf einen, den riß er in zwei Hälften. »Halt, da steht etwas geschrieben!« Richtig war ein Zettelein herabgefallen. Herr Pankraz hob es auf und las: ›Ich, Seibold von Hochstetten, vermesse mich weiter keines Dings, durchlauchtigster Herr Pfalzgraf Philipp, denn selb Euerem Narren und Gaukleren hochberühmt Pankrazio von Znaim allerorten den Sieg abzulaufen und mich an seine Stelle zu setzen – da ich mich dann um ein billiges finden lan und mehr Gehaltes nicht verlange denn des Jahres zweitausend Goldgulden.‹ – Seid Ihr nun überwiesen, Herr Seibold, da lest selbst!«
»Was soll ich denn da lesen?« stotterte Herr Seibold. »Da habt Ihr mir ja ein Königshäslein in die Hand gegeben!«
»So, habt Ihr den Zettel verzaubert?« rief Herr Pankraz. »Dafür zaubere ich Euch einen anderen heraus, der beweist, was zauberisches Gemüt Ihr habt. Kennt Ihr das? Weg da, Häslein!«
Das Häslein war im Augenblick verschwunden, Herr Seibold aber hatte ein zerrissenes Papier in der Hand.
»Das ist ja das Stück vom Küchenzettel, den ich eroberte!«
»Den Ihr geraubt habt!« rief Herr Pankraz. »Glaub's gern, daß Ihr nach soviel Wissen gedürstet habt! Heisa, da steh'n Speisen – Air in Schmalz, Picket Vogel, Mandelmus, Oblatt ausgefüllt, Hühner in weiß Brüh', Haysvisch, Oerprat, weiß Gemues, praun's Gemues, sweinewilprät, Sulzein, Hühner in Rosyn, frisch laxn in ein Ziseindlein, sweinskopf, pachn schiffl, siedfleisch, hoch weiße Milch, lebersulzein von Spensaw, haysa Krebsen, Gretschet sweinskopf in einer Golradt, hoch arbaissement –« undsofort rollt' und quirlte Namen um Namen von des Herrn Pankraz Lippen. »Seht Ihr nun, was für räuberischer Mann Ihr seid?! Jetzt aber habt Ihr noch was – heraus da mit der Herzogin Braut ihrem Blumenstrauß – da ist er schon! Hoch leb' die Frau Herzogin!« Dabei schwang er den Strauß, eilte auf die Hedwig von Polen zu und überreichte ihr kniend den Strauß.
Historische Anmerkung
So froh und glänzend Hedwigs Vermählungsfeier war, soviel Düsteres wurde der Fürstin in späterer Zeit zuteil. Nahe ein Wunder der Schönheit und makellos tugendhaft, verlor sie gleichwohl die Geneigtheit Georgs des Reichen dergestalt, daß er sie von sich entfernte, nach Burghausen in das Schloß bannte und nur äußerst selten besuchte. Er hütete sie, heißt es, wie einen »zweiten« Schatz, den er im Turme bewahrte. Der gemeinte »andere« Schatz enthielt eine ungeheuere Summe baren Geldes, zwölf Apostelfiguren in Lebensgröße von Silber, ganze Stöße Silberplatten, eine Menge Golderz, Kleinodien mit Juwelen, lose Edelsteine usf. Hedwig endete ihr düsteres Dasein am 18. Februar 1502 und wurde inmitten der Kirche des Klosters » Raitenhaslach« begraben. Über ihre Ruhestätte ward ein plastisch großartiges Steindenkmal errichtet, von welchem sich nur die riesige obere Steinplatte mit Inschrift erhalten hat. – Man glaubte nun immer, unter der Steinplatte des Denkmalrestes sei die » Gesamtgruft« mehrerer zu »Raitenhaslach« begrabenen Fürstenpersonen von Niederbayern. Bei näheren Untersuchungen jedoch, welche Anno 1858 vom Vorstand des bayrischen Nationalmuseums, C. M. Freiherr von Aretin und mir angestellt wurden, zeigte sich, daß die früheren Fürsten in der Kreuzung vor dem Auftritt zum Chor der (seinerzeit verlängerten) Kirche einzeln und rein in die »kalte« Erde bestattet worden seien, Hedwig aber auch in einem Einzelngrab, über welches dann das Steindenkmal kam. Dieses Einzelngrab befindet sich in ziemlicher Tiefe unter dem alten Kirchenpflaster, im Verhältnis zu welchem das jetzige etwa fünf Fuß höher liegt, was sich von der zugleich mit der Verlängerung eingetretenen Erhöhung des Gottesgebäudes herschreibt. Bevor man jenes alte Kirchenpflaster mit Schutt bedeckte, scheint man jedoch das Grab noch geöffnet und irgendwelche Nachsuchung noch gepflogen zu haben. Denn die zarten Gebeine der edlen Herzogin Hedwig fanden wir in »auffallender Unordnung« liegen, wie denn auch die Metallgegenstände, etwa Armbänder, von welchen sich Oxydabfärbungen gebildet haben, entfernt waren. –
Vom besagten Grabmal befindet sich ein in Kupfer gestochenes Abbild nebst Fahnen, Wappen usw. in der » Topographia princ. Austriæ« von Gerbert. Archival erübrigt das kindlich gezeichnete Abbild von seiten eines Mönches von Raitenhaslach aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts. Zu Raitenhaslach liegen außer Hedwig von Polen in der Kreuzung begraben: Ludwig der Gebartete von Bayern-Ingolstadt – die nrederbayrischen Fürsten Prinz Johann und dessen Vater Herzog Friedrich – Magdalena, Gemahlin des letzteren und deren Töchter Margareta und Magdalena – und Margareta, Gemahlin Herzog Heinrichs des Reichen.
»Endlich ist er zu Ende!« lallte Herr Seibold.
Der Kaiser winkte ihm auch freundlich, daß er sich entfernen dürfe.
»Halt!« ließ Herr Pankraz erschallen. »Meinen Mantel!«
»Eueren Mantel?!«
»Ja freilich!« Der Mantel ward rasch gewechselt. Tief beugte sich Herr Seibold und wollte dann rasch abtreten. Schon war er an der Tür', als ein zweites »Halt!« ertönte.
»Wa – was wollt Ihr denn noch?«
»Was ich will? Meine Narrenkappe, die habt Ihr ja auf dem Kopf!«
»Ich, Euere Narrenkappe? Meiner Seel'!«
Die Narrenkappe rasch in Herrn Pankrazens Hand, seinen Schlapphut ergriffen und hinaus zum Saal, das war bei Herrn Seibold eins – hinter ihm aber tönte allgemeine Heiterkeit.
* * *
Also trug sich's zu von Anfang bis zu Ende.
Was weiters?
Des Kaisers Wort wurde, wie jeder begreift, aufs gewissenhafteste erfüllt und war Herrn Seibolds Vermessenheit auch nicht in Erfüllung gekommen, wie er zu München ausgesprochen, als ob er keiner Hilfe bedürfe – hinwieder war doch sein anderes Wort nicht minder eingetroffen, als er sagte: »Ficht aus dein Strauß, bringst Ruhm und Ehr' nach Haus!«
Als Herzog Ludwig das Büchlein nach dessen Vollendung zu Gesicht bekam, beschenkte er Herrn Seibold gnädigst und sagte ihm viel freundliche Worte. Herzog Georg, die Hedwig von Polen und Herzog Christoph taten desgleichen.
Der letztere, welcher zu Landshut überaus guten Mutes war, sagte ihm auch noch von Herrn Thomas von Bruckberg anhergesandtem Brief, ergötzte sich an Herrn Seibolds Unglück, hinwieder Ausdauer, indem er sich das und jenes noch näher erzählen ließ, und setzte scherzend bei: »Also hat sich's wieder aufs neue bewährt, gleich an Euch, wie mir, Ehrlichkeit und guter Mut währt am längsten. Ich hab' den polnischen Grafen geworfen und vorgehends all seine List enthüllt – Ihr aber habt auch mit List zu kämpfen gehabt und dennoch den Feind geschlagen, daß er sich hie zu Land nimmer blicken lassen mag. Da Ihr nun gen München zieht und sonst viel hin und wieder an manchen Ort, laßt Euch eins meiner mittleren Rosse geben. Damit reitet gen München und wohin Ihr sonst wollt, es sei Euer eigen und am Futter soll's nie fehlen. Grüßt mir den Thoman von Bruckberg und sagt, etwan in einer Woche Zeit käm' ich selbst – damit Gott befohlen und ich bleib Euch wohlgeneigt!«
Da kann sich jeder des Herrn Seibold Entzücken denken über soviel Huld und Gnade, und daß er da in München zu Fuß von Haus weggegangen, nun aber als berittener Mann wiederkehre. Überdies war er all die Zeit über aufs trefflichste und versöhnlichste von Herrn Konz und Hilkertshofen gespeist und mit den besten Weinen schier überschwemmt worden, zuletzt, als er von Herzog Christoph kam, ward ihm gar auf Herzog Jörgs Befehl noch ein Fäßlein Rheinwein und eine weidliche Kiste kalter Speisen zugestellt. Das gab er beides dem Landshuter Boten, daß er's gen München führe, suchte sich ein frisch gesundes Rößlein aus, dabei ihm Herr Brunner Hilfe leistete, und übereins ritt er zum Tor hinaus.
Nah' dabei sah er die zwo Landsknechte daherkommen, so ihn bei seiner Ankunft verspottet und getäuscht hatten. Sogleich hielt er an und rief: »Wart', ihr kecken Rauscher, ihr! Seht und habt ihr nun vermerkt, was all euere List und Schalkheit gefruchtet! Kreuz, Blitz, Donners, kommt mir noch einmal!«
Damit gab er seinem Rößlein einen Ruck und Schlag, daß es ausschlug, sich bäumte und Herrn Seibold schier abgeworfen hätte. Aber zum Glück ward ihm der Herr, setzte die linke Faust fest auf die Seite, daß sein Ellenbogen ganz ritterlich kühn hinausstand, sah nochmals ganz kühn um und trabte dann seines Weges weiter gen Freising – und von da gen München.
Bedarf's nun keines Wortes, wie höchlich Frau Heierlein erstaunte, als Herr Seibold zu Pferd anlangte und wie begierig sie um der ganzen Unternehmung Verlauf fragte. Er nahm sich aber keine Zeit, sondern ritt sogleich etliche Schritte weiter, hinüber zum Ammertalerhof. Da traf er Herrn Thoman von Bruckberg wohlauf und gesund, gab ihm sein Büchlein und sagte: »Hier nehmt das Opus – Kampf hat's genug gekostet, aber es ist doch zuwege gekommen. Gott sei gedankt und gepriesen, das Büchlein wird der Hochzeit Angedenken erhalten, wenn wir alle nimmer – und etwan alle meine Leiden und Freuden überlängst vergessen sind!«
Die wurden auch gar wohl im Laufe der Zeiten vergessen, sind aber jetzt wieder zutage gekommen und hat nun ein jeder Bericht, was Müh', Sorg', Angst und Zorn zu ertragen war, bis dasselbe fürtreffliche Büchlein geschaffen ward.
