
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Am 26. Januar 1894 war Fürst Bismarck, Generaloberst, in Berlin Gast Wilhelms II.
Aus dem pommerschen Kniephof schrieb der Junker Otto Bismarck an die Schwester Malwine: »Bloß weil Du es bist, will ich von einem meiner wenigen Grundsätze abgehen, indem ich einen Gratulationsbrief purement pour féliciter schreibe. Selbst kommen kann ich zu Deinem Geburtstage nicht, weil mein Vizekönig noch nicht hier ist, um mich abzulösen; ohnehin würde ich riskieren, daß Du nach Deines ungläubigen Bräutigams Vorbild überzeugt sein würdest, ich käme in Geschäften zu Euch und nicht um Deinetwillen.« Im Laufe eines an Abwechselungen nicht gerade armen Lebens mußte Junker Otto recht oft, purement pour féliciter, sogar an erheblich ferner stehende Personen Briefe schreiben und auch daran mußte er, je höher hinauf sein Weg führte und je weiter der kleine Kreis verwandtschaftlichen Verkehrs zurückblieb, immer mehr sich gewöhnen, daß persönliche Freundlichkeit, die er gewährte oder erwiderte, in geschäftliche oder gar gewinnsüchtige Absicht ihm umgedeutet wurde. Er war nie ein Freund des Reisens; am liebsten saß er auf seiner Scholle, daheim in der Altmark oder im Pommernland und später im Lauenburgischen, und immer kehrten, freilich in veränderter Form, vor jeder Übersiedelung die schreckenden Reisebilder und die »gelinde Wut« wieder, die in Schönhausen einst dem jungen Familienvater schlaflose Nächte bereiteten, als er in seines Geistes Auge sich »mit den beiden Brüllaffen auf dem Stettiner Bahnhof« sah. Von Frankfurt sogar, wo es im Parterre des Palais Taxis doch langweilig genug war und »die Stimmung gänzlicher Wurschtigkeit« in ihm vorherrschend wurde, schrieb er, zwölf Jahre später, wieder an die Schwester Malwine: »Ich habe eine Aufforderung, im Herrenhause zu erscheinen, bekommen, nach deren Inhalt ich zweifelhaft bin, ob Seine Majestät in der Tat, wie es darin geschrieben steht, mich in Person oder nur seine untertänigen Herren und Diener en bloc dort zu sehen wünschen. Im letzten Falle würde ich mich nicht für berufen erachten, meine gewichtigen Geschäfte und den Kamin im roten Kabinett verwaisen zu lassen, um bei Halle im Schnee sitzen zu bleiben und demnächst unter der Rubrik von ›Volk, Edelleute, Häscher und Priester‹ den Effekt des großen Ensemble im Weißen Saal mit einer Kostümnuance zu beleben. Ich erwarte noch eine Antwort von Berlin darüber, ob ich als Dekoration oder als Mitspieler verlangt werde.« Diese Stimmungen sind nicht unbekannt geblieben; man weiß, welchen Entschluß die Hochzeitfahrt nach Wien den Brautvater kostete und wie es von Jahr zu Jahr mehr des Zuredens bedarf, bis der Fürst sich nach Kissingen mobil machen läßt. Deshalb ist es auch nicht wunderbar, daß in der vorigen Woche, als Bismarck den Kaiser in Berlin besuchte, die Gegner und auch viele Freunde des alten Kanzlers die Köpfe zusammensteckten und ganz ernstlich glaubten, was der Junker vom Kniephof dem Schwager nur scherzhaft insinuiert hatte, und daß man aus Zeitungsartikeln und Gesprächen, hoffend hier und bangend dort, den Verdacht heraushören konnte: »Er kommt in Geschäften zu uns und nicht um seinetwillen.«
Diesmal hat er nicht erst gefragt, ob er als Dekoration oder als Mitspieler verlangt werde; auf das Mitspielen hat er wohl lange verzichtet und gerade jetzt, wo der Gang der Handlung so vielfach in falsche Bahnen gedrängt ist, kann einen feinen, aber doch schon etwas ermüdeten Spieler die schwere Aufgabe des verantwortlichen Protagonisten kaum verlocken. Einem Gebot der Höflichkeit aber, der germanischen Mannentreue und des patriotischen Empfindens hat Otto Bismarck sich niemals versagt. Die Teilnahme, die der Kaiser von Güns aus dem Leidenden gezeigt, die Grüße, die er von Bremen aus durch den Grafen Wilhelm Bismarck dem Genesenden gesandt hatte, verpflichteten den preußischen Edelmann und den alten Soldaten, persönlich als Dankender vor dem Souverain zu erscheinen, sobald die physische Verhinderung gewichen war. Und nun sandte nicht nur der Monarch eine Stärkung, nun lud auch, in freundlich drängenden Ausdrücken, der oberste Kriegsherr zweimal in zwei Tagen zu seinem militärischen Jubelfest: und nun gab es für den Generalobersten kein Säumen mehr. Der untrüglich sichere Takt, der ihn stets auszeichnete, hat den Fürsten dann bestimmt, Dank und Glückwunsch schon einen Tag früher dem Kriegsherrn darzubringen; wie er einst den ersten Reisen des jungen Kaisers fern blieb, um nicht auf sich einen Teil der Huldigungen abzulenken, so hat er auch jetzt für unanständig gehalten, die massige Größe einer bei Lebzeiten schon mythischen Gestalt in den Vordergrund des Festtagsjubels zu drängen. Er hat wieder einmal die größte und seltenste Kunst hoch gestellter Menschen geübt, die Kunst, rechtzeitig zu verschwinden; die Berliner haben ihn kaum gesehen, und während er mit seiner gewohnten Umgebung gemütlich rauchend beim Kaffee saß, konnte der Kaiser durch die Linden reiten und in jubelnden Zurufen lächelnd den Dank der Bevölkerung entgegennehmen.
Der stürmische Überschwang dieses Jubels mag den Monarchen überrascht haben. Er hatte zu seinem Militärjubiläum den Mann geladen, der dem preußischen Heer von allen Lebenden die wertvollsten Dienste geleistet, der früh in ihm das allein taugliche Mittel zum Zweck der deutschen Einheit erkannt und es durch schlimme Anfechtung zur Größe geführt hat: und nun sah er sich gefeiert, als hätte er eine undenkbare, eine zuvor kaum erträumte Großtat vollbracht. In diesem Überschwang verbarg sich wohl ein Mißverständnis und ein Keim neuer Enttäuschungen. Als er den Fürsten Bismarck aus seinen Ämtern als Kanzler und Minister entließ, schien der Kaiser doch zugleich darauf bedacht, ihn der Armee zu erhalten. An demselben Tage, wo der große Staatsmann einem General den Platz räumen mußte, wurde er im militärischen Rang erhöht; und wie die Ordre, die diese Auszeichnung bekannt machte, so trug auch jetzt die Einladung zu einem militärischen Fest die Unterschrift des Königs von Preußen, der damit unzweideutig ausgedrückt hat, daß er an seinem Ehrentag auf das Erscheinen des Generalobersten besonderen Wert lege (wenn er auch den politischen Rat des Fürsten Bismarck entbehren zu können glaubt).
Für so subtile Unterscheidungen, die in der sorgfältig gegliederten Hierarchie eines Beamtenstaates nicht auffallen können, hat das Volk, hat der rasch erweckte und rasch auch wieder eingelullte Enthusiasmus der Massen kein Verständnis und deshalb entstand eine seit den traurigen Märztagen von 1888 und 1890 nicht mehr gespürte Aufregung, als zuerst ein vages Gerücht meldete: Bismarck kommt nach Berlin, Bismarck wird als Gast des Kaisers im Schloß wohnen. Schnell bildeten sich in den Parlamenten Gruppen, in denen das große Ereignis besprochen wurde; man wies mit Fingern auf die Trefflichen, die sich jetzt gar so begeistert gebärdeten, nachdem sie vor vier Jahren geduldet hatten, daß im Reichstag die Entlassung Bismarcks totgeschwiegen wurde. Die einen sagten: Bismarck kommt nur, wenn er Garantien hat und sicher ist, daß er mitspielen soll; die anderen höhnten: Bismarck hat ein so starkes Gunstbedürfnis, daß er, um einen gnädigen Sonnenstrahl zu erhaschen, mit den Herren sogar, die er früher den Troupier und den Staatsanwalt genannt hat, die feinsten diplomatischen Artigkeiten austauschen wird; und wieder andere meinten: Er kommt überhaupt nicht, er schützt im letzten Augenblick Krankheit vor; und wenn er wirklich kommt, dann tut er's, um für seinen Sohn eine Stellung als Botschafter zu erbitten.
Und dann kam er wirklich. Es war ein schöner Tag, der schönste, den wir seit lange erleben durften. Nicht die gewöhnlichen Hurrabrüller hatten sich aufgemacht; in der Menge, die von früh an die Straßen besetzt hielt, sah man, wie an dem Nachmittag des 29. März 1890, die besten Vertreter deutschen Geistes, deutscher Wissenschaft und Kunst deutschen Gewerbefleißes. Man sah auf die Uhr und berechnete, wann »er« seine Hand in die des Kaisers legen würde, und fromme Frauen flehten für diese Minute, die Vieles vielleicht entscheiden sollte, des Himmels Segen herab. An den äußeren Anlaß zur Festesfreude dachte kein Mensch. Da oder dort jubelte wohl ein Binsengemüt besonders laut, weil es hoffte, nun komme die Zeit endlich wieder, die eine bange und bedenkliche Wahl ihm erspart. Vereinzelt freute wohl auch Einer sich, daß in der Stadt, der kein augustisch Alter blühte, einmal doch mit königlichen Ehren dem Genius gehuldigt wurde. Im ganzen aber überwog die Empfindung, daß hier eine Epoche zum Abschluß kam, die dem Vaterland kein Heil und dem Ansehen des deutschen Namens schweren Schaden gebracht hatte. Und als der Galakutsche brausende Rufe nachgesandt wurden und die unübersehbare Menschenflut sich dann vors Schloß wälzte und schob, da war es, als würde ein Fest der Heimkehr gefeiert und als sollte im Rat des jungen Kaisers der alte Fürst bis zum letzten Wank nun wieder den ersten Platz einnehmen. Es war wirklich schön. Auch für den, der im Lärm der Gassen das Feierkleid seiner Begeisterung nicht gern beschmutzen läßt und der nur in schlechten Theaterstücken ungläubig lächelnd, mit angesehen hat, wie mit einem Zauberschlage plötzlich die Charaktere sich ändern.
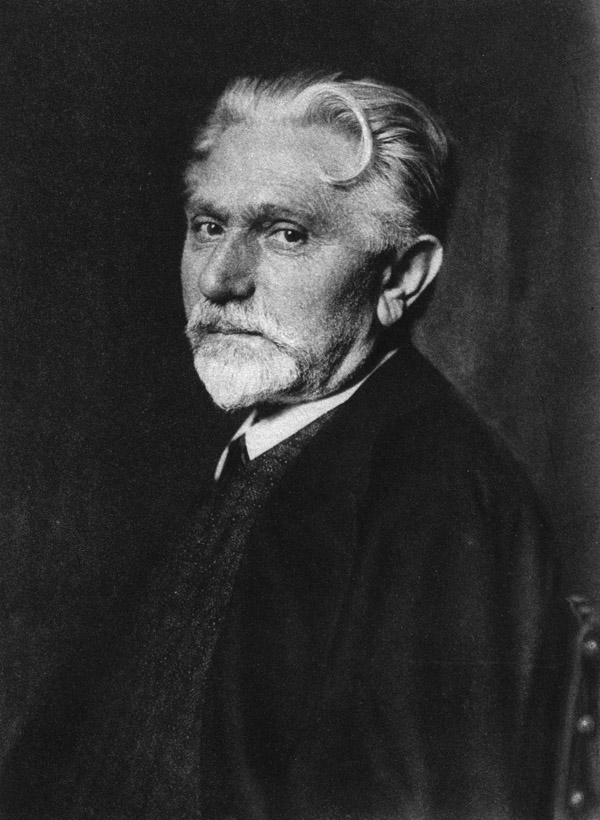
Bebel
Das Berliner Tageblatt hat die offiziöse und diesmal dennoch buchstäblich wahre Nachricht verbreitet, daß in den Gesprächen des Kaisers mit dem Fürsten (die Herren waren nur während der kurzen Fahrt nach dem Bahnhof miteinander allein) die Politik nicht mit einem Worte berührt worden ist. Man spürt in diesem offiziösen Stoßseufzer die überstandene Angst; für den unbefangenen Betrachter aber bringt auch diese Meldung nur Selbstverständliches.
An den für die Zeitungen maßgebenden Stellen mag das so laut verkündete Gefühl der Zufriedenheit wohl aus dem Glauben stammen, der Kluge sei diesmal klug genug gewesen, nicht klug zu sein. Auch sonst hat man Stimmen gehört, die beklagen, daß Bismarck nun unter Girlanden begraben sei. Die Hoffenden und die Fürchtenden werden sich täuschen. Solange Bismarck lebt, kann von einem natürlichen und befriedigenden Zustand der Dinge dann erst wieder die Rede sein, wenn in den entscheidenden Fragen wenigstens sein Rat erbeten und erwogen wird. Der freien Entschließung des Kaisers bleibt es vorbehalten, diesen Zustand herbeizuführen; einstweilen spricht kein Anzeichen dafür, daß der Kaiser die bisher von ihm eingeschlagenen Wege zu verlassen und die bisher von ihm gewählten Berater zu verabschieden wünscht. Graf Caprivi hat sich, wohl nicht leichten Herzens, dazu verstanden, bei dem Manne eine Karte abzugeben, den er im Juni des Jahres 1892 des Verkehrs mit dem Personal der Deutschen Botschaft in Wien für unwürdig hielt; aber er würde sicher nicht im Amt bleiben, wenn »die öffentliche Meinung das Recht zur Annahme erhielte, Fürst Bismarck hätte wieder auf die Leitung der Geschäfte irgendwelchen Einfluß gewonnen«. Der Kaiser, so muß man annehmen, beharrt auf seinem Weg und in dem festen Vertrauen auf seine Berater.
Der Enthusiasmus ist, wie der Haß, ein schlechter Ratgeber. Die jubelnden Massen dachten nicht daran, daß in gewissen Lebensaltern die Charaktere sich nicht mehr ändern und daß weder der Kaiser noch sein Gast eine Haupt- und Staatsaktion aufzuführen beabsichtigten. Im Deutschen Reich ist alles unverändert geblieben; nur der gefährliche Schein einer persönlichen Verstimmung ist beseitigt und die Bahn ist frei für den Ratsuchenden wie für den, der Rat zu erteilen für nötig hält. Darin liegt der wichtigste Wert der festlichen Stunden. Es hieße den Kaiser beleidigen, wenn man ihm die Absicht zutrauen wollte, mit den höchsten Ehren, die er zu vergeben hat, einen unbequemen Mahner zur Ruhe zu bringen. Und der Fürst wird den sachlich begründeten Widerspruch gegen Maßregeln, die er für verhängnisvoll hält, nicht aufgeben, solange er nicht den festen Willen sieht, allmählich wieder in Bahnen einzulenken, die seiner Überzeugung genügen. Persönlich hat er auch früher nichts erstrebt und bekämpft und eine persönliche Genugtuung kann jetzt seine Ansichten nicht erschüttern. Dem obersten Kriegsherrn, der ihm den Stoff zu einem grauen Militärmantel geschenkt hat, wird er in Dankbarkeit verpflichtet bleiben; ebenso sicher aber wird er dem Versuch sich versagen, auf seine alten Tage noch die ragende Reckengestalt in die knappe Uniform des neuen Kurses zu kleiden.