
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
»Meine Fersen bäumten sich, meine Zehen horchten,
dich zu verstehen: trägt doch der Tänzer sein Ohr
in seinen Zehen.«
Nietzsche, Zarathustra.
Als Hans von Bülow, aus dem schüchternen Liszt-Schüler längst der große Dirigent geworden – der größte seiner Zeit –, Strauß 1872 in Baden-Baden wiedersieht, wird er der eifrigste Besucher seiner Konzerte. Er vergißt seine Verbitterungen, sein Humor verliert die Krallen, sein kühler Geist bricht in Flammen aus und Bewunderung reißt ihn zu dem preisenden Geständnis: »Ein scharmanter Zauberer, dessen Kompositionen von ihm selbst dirigiert, mir einen der erquickendsten Musikgenüsse gewährt haben, dessen ich mich seit langer Zeit entsinne ... das ist einer meiner wenigen Kollegen (ja), vor dem ich ungeschmälerte Hochachtung haben kann ... von dem kann Unsereiner was lernen!« Sein Enthusiasmus nimmt kein Ende, das Echte und Eigene fasziniert ihn: »Das ist ein Dirigentengenie in seinem kleinen Genre, wie Wagner im Sublimen! Ich bin noch ganz erfüllt davon, Herz und Kopf tanzen in mir weiter, wie berauschte Derwisch-Fragmente.« Und er beschließt das Erlebnis mit dem Bekenntnis: »Aus Strauß' Vortragsweise ist für die Neunte Symphonie wie für die Pathétique zu lernen!« Worte, die man vielleicht als Worte überliest, die aber Gewicht bekommen, wenn man in der Gegenwart denjenigen Tanzkomponisten suchte, dem Furtwängler oder Richard Strauß Gleiches nachsagten ...
Die Bülowsche Einstellung bezeichnet auch die der anderen Neuromantiker. Liszt, der, zwischen dem Vater und Sohn Strauß geboren, aus der gleichen Zeitkultur kommt, umfaßt beide mit der gleichen Wertschätzung. Bei einer festlichen Gelegenheit nötigt er seine Tochter Cosima aufs liebenswürdigste, mit ihm vierhändig die »Nachtfalter« zu spielen; er hört 1883 (bei Tarnoczy in Pest) von Strauß mit besonderem Vergnügen die eben entstandenen Frühlingsstimmen auf dem Klavier. Leider hat er selbst keinen Walzer des Sohns transkribiert; seinen Geist atmen immerhin die dankbaren und einmal sehr beliebten Bearbeitungen von Karl Tausig (Nachtfalter, Man lebt nur einmal, Wahlstimmen), in denen das Gliederverrenken und Halsumdrehen der Thematik mit chromatischem Witz betrieben wird.
Mit Vater Strauß war Liszt schon 1840 in Wien in Berührung getreten. Nach einem Konzert im Redoutensaal verlangten die erregten Zuhörer noch »ein Improvisato«. Das Publikum schlug Themen vor, ein Wahlkomitee entschied darüber und von den drei gewählten Themen (Haydns Volkshymne, einer Kantilene von Thalberg und einer Walzermelodie von Strauß) suchte Liszt die Walzermelodie »Das Leben ein Tanz« hervor. Die Schiedsrichter hatten sie verworfen; Liszt überrumpelte damit das Publikum, ja, das Publikum lernte sie durch ihn erst kennen: »Wie koste die Tanzweise auf dem Spiegel des Parketts, in einem Kerzenmeer unbeschreiblich vornehm und kokett mit der Kaisermelodie! ... Der verachtete Walzer erhob sich am Schluß der Improvisation zu einem elektrisierenden Dithyrambus der Freude!« Später (1846) besuchte Liszt oft mit Balfe und Wallace den Volksgarten, um Straußische Weisen zu hören, die ihm nächst Schuberts Walzern die liebsten waren. Seine Schätzung wurde zur Tat, als er am 20. Juli bei einem Straußischen Gartenkonzert in der Brühl mitspielte, umringt von einem Kranz schimmernder Damen. (L. Ramann, Franz Liszt, S. 272).
Johann Strauß sah Richard Wagner bloß einmal: Herbst 1875 in Wien, als Wagner ihm seinen Kaisermarsch vorspielte. Aber Strauß diente der Sache des Meisters aus einem musikalischen Instinkt heraus und pflegte sein Werk, während Wien sich gegen Wagner aufrichtete, der – im Geist Kaiser Josefs! – das Hofoperntheater umgestalten wollte »zur Veredelung der Sitten und des Geschmacks der Nation«. Und als Wagner vergebens bemüht ist, seinen Tristan 1861 in Wien persönlich einzustudieren, und Hanslick in Erfüllung einer echten Heroldsaufgabe die Unaufführbarkeit des Werks verkündete, das darauf wirklich abgesetzt wird, – da ist es Johann Strauß, der den Besuchern der Volksgartenkonzerte die verrufene, unspielbare Tristanmusik vorführt, Szenen aus allen drei Akten, wozu Strauß überdies von E. Kulka genaue Texterklärungen schreiben läßt.
Strauß, der Wagners 50. Geburtstag in Wien durch die Holländer-Ouvertüre feierte, fährt als alter Mann (1892) zu den Bayreuther Festspielen (Meistersinger, Parsifal) und hört den Blumenmädchen-Walzer mit einer leisen Genugtuung, als habe bei diesem Dreivierteltakt »der große Richard« doch in seine Partituren geguckt ... Sein Wagner-Erlebnis ist wie das Anton Bruckners rein musikalisch.
Umgekehrt durchspielt ein Strauß-Ton das Leben Wagners. An seinem 63. Geburtstag läßt Wagner sich von einem Liebhaber-Orchester, das Anton Seidl dirigiert, Straußische Walzer vorspielen und dirigiert darauf selbst »Wein, Weib und Gesang«. Er erwirbt in Bayreuth die berühmte Parzelle mit dem Komposthaufen zu einem Grundstück, indem er dem ungeneigten Verkäufer als versöhnende Zugabe einen Straußischen Walzer vorspielt. Er läßt in einem Trinkspruch »unsre Klassiker von Mozart bis Strauß« leben und nennt den Wiener Meister »den musikalischesten Schädel, der ihm je untergekommen sei«.
Und ebenso schätzte ihn die »Gegenseite«, Johannes Brahms; eines der wenigen Geschmacksurteile, worin er sich mit Wagner traf. Dabei ist das Verhältnis, in dem Strauß zu Brahms stand, von köstlich naiver Einseitigkeit. Johannes Brahms schrieb einmal den Anfang des Donau-Walzers auf den Holzfächer der Frau Adele Strauß und darunter: »Leider nicht von Johannes Brahms!«, eine halb verbindliche, halb selbstironische Geste, hinter der doch echtes Bedauern steckt. Brahms fühlt sich von Strauß angezogen und beobachtet ihn, fasziniert von seinem heiteren Dämon. Es rührt geradezu, den versperrten Norddeutschen, der sich immer zur klassischen Haltung bändigt, mit Straußischen Walzern beschäftigt zu sehen. Wie gern spielte er »Wein, Weib und Gesang« und wie gern wollte er die Tänze aus dem Orchestralen, sich und anderen zur Freude, für Klavier übertragen. Seine Fersen bäumten sich, seine Zehen horchten, Strauß zu verstehen ...
»Wie groß die Vorliebe war, die Brahms für den Menschen und Musiker Strauß hegte, geht daraus hervor, daß er, der sonst jedem Kollegen seinen Denkzettel anzuheften und gerade die Wiener Schule mit schonungslosen Sarkasmen zu regalieren pflegte, ihm auch im Scherz niemals ein verletzendes Wort gesagt hat – –« (Max Kalbeck). Ja, aus Thun grüßt Johannes den »Meister Johann« (26. Juni 1888): er habe im Schänzlitheater zu Bern die Fledermaus gehört, den hübschen Professorsfrauen sein Evangelium gepredigt und lebhaft empfunden, daß er doch der einzige Musiker und Komponist heut sei, der zu beneiden ist, zu denen auch er selbst, Brahms, zu zählen sei ...
Strauß betrachtete Brahms mit scheuer Ehrerbietung, »als eine große, schwerverständliche, aber allgemein beglaubigte Autorität«, als gelehrtes Haus und Schöpfer unheimlich ernster Dinge, von denen ihm nur das Deutsche Requiem eingänglich erschien. Obwohl selbst im Umgang mit dem musikalischen Patriziertum, machte er die Wiener Brahmsmanie nicht mit, bezeugte seine Ehrerbietung durch Widmung eines Walzers (»Seid umschlungen, Millionen«, eines seiner schönsten Alterswerke), – aber im Grund wußte Johann mit Johannes nicht viel anzufangen. Nach einigen Pflichtgesprächen verstummte er.
Auf ein Tamburin, das bei einem Fest der Frau Adele Strauß versteigert wurde, setzten beide Künstler ihre Namen: Brahms schrieb: »Hofdienst bei
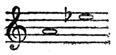 (Anfangsbuchstaben der Hausfrau). Für Fugen: J. Brahms«. Worunter Johann setzte: »Für Walzer: Johann Strauß.«
(Anfangsbuchstaben der Hausfrau). Für Fugen: J. Brahms«. Worunter Johann setzte: »Für Walzer: Johann Strauß.«
Mehr fühlte er sich zu seinem weiteren Landsmann Anton Bruckner hingezogen, was schon die gleiche Mundart erleichterte. Es kam zwar nur einmal zu persönlicher Berührung – Frau Adele Strauß lud Bruckner zu einem Backhendelabendessen ins Palais der Igelgasse, wo sich alle über Bruckners Bayreuther Erlebnisse krank lachten – und von einem Verhältnis kann nicht die Rede sein. Aber Anton Bruckner lauschte wohl eine Stunde hinter der geschlossenen Tür, als Johann Strauß, der sich allein glaubte, im großen Musikvereinssaal am Klavier phantasierte; offenbar hörte Antonius bei Johann die verwandte geistige Mundart. Und nach der Aufführung der Siebenten Symphonie, die das Gelächter und Entsetzen der Hanslick-Leute bildete, fand Bruckner, spät nachts heimkehrend, auf seinem Tisch ein Huldigungstelegramm von seinem begeisterten Zuhörer Strauß.
Nicht als ob Strauß sich als Anhänger oder Sachverständiger gefühlt hätte; aber er fühlte die Verwandtschaft mit einem Geist, der wie er Musik aus der Heimaterde machte, der das Volkhafte in edlere Formen und den Ländler, den Vater des Walzers, symphonisch verarbeitete.
Strauß selbst schrieb keine Walzersymphonien und Symphoniewalzer, es lag ihm fern, gleich Berlioz in der Phantastischen Symphonie dem Walzer deskriptive Aufgaben anzuweisen, ihn Prunk und Glanz eines Ballfestes schildern zu lassen: Strauß blieb Tanzmusiker. Das einzige, was seine Musik absichtlos schildert, ist er selbst: der Diesseitskünstler, dessen unausgesprochenes Motto lautet: »Man lebt nur einmal!«, der Dionysiker, der von Tod und Grab und Jenseits nichts hören mochte; hierin das Gegenbild zum Kreuzfahrer Bruckner, der immer die Wege zu Gott sucht, dem himmlischen Jerusalem zuwandelt und der seine mühselige Erdenpilgerschaft mit dem Worte tröstet: »Non confundar in aeternum!« Beide Künstler bezeichnen das österreichische Wesen. Tänzer und Beter reichen einander die Hände.
Johann Strauß war ein Wiener Gebieter geworden. Vom einstigen Kapellmeister der »Dekreter«, jener soldatenspielenden vormärzlichen Handwerker, aufgestiegen zum Hofballmusikdirektor; vom zaghaften Debütanten mit vier Kompositionen zum Weltmeister auf seinem Gebiet. Kunstpolitische Kurzsichtigkeit verhinderte Wien, Männer wie Liszt und Wagner heranzuziehen und ihnen Weimar und Bayreuth zu sein; kritische Erlebnisunlust, die ihre Quelle in dem gleichen Konservativismus hat, mißhandelte Hugo Wolf, Anton Bruckner und Gustav Mahler. Nichts wurde getan, das Erbe großer Musikkulturen durch neue Temperamente zu verwalten. Der einzig Wohlgelittene und Geliebte blieb Johann Strauß, weil er das einzige Genie war, das der Mittelmensch wie der Hochmensch verstand, weil er im guten Sinn »Musik für alle« schrieb.