
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

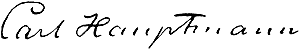
Der Begriff eines preußischen Volks ist uns Kindern des neuen Reichs so gut wie verloren gegangen; wir wundern uns geradezu, wenn wir die Bezeichnung bei älteren Politikern oder Geschichtsschreibern lesen, während der Bayer oder selbst der Badener, dessen Heimatstaat in seiner heutigen Gestalt doch erst sehr junger Herkunft ist, sich in starkem Maß immer als Angehörige ihrer Einzelstaaten fühlen. Und dabei sind doch auch diese keineswegs Stammeseinheiten. Wie wir Preußen uns fast überall gewöhnt haben, immer vom Kaiser und nicht vom König zu sprechen, wie wir mit Wilhelm dem Ersten doch irgendwie das Reich nur als das »verlängerte Preußen« empfinden, so verwischen wir und deshalb auch andre allmählich, und ganz besonders in literarischer und künstlerischer Hinsicht, die Grenzen, die doch keineswegs nur willkürliche und zufällige sind. Nicht nur die alten, sondern auch schon die durch vierzigjährige Gemeinsamkeit mit ihnen verbundnen neuen Provinzen des Königreichs stellen in ihrer Bevölkerung bestimmte preußische Züge dar, die sich scharf abgrenzen und selten völlig verleugnen, so stark auch alles ins allgemein Deutsche hineinwächst, und so groß die Unterschiede im einzelnen sein mögen. Es war doch kein Zufall, daß die kräftigsten literarischen Anregungen der neuern und neusten Literatur preußischer Herkunft waren, daß sie von märkischen Dichtern, wie Fontane, Wildenbruch, Dehmel, schleswig-holsteinischen wie Liliencron, ostpreußischen wie Holz und Sudermann, ausgingen, so daß nach dem politischen Siege Preußen gewissermaßen nun auch den ästhetischen erstritten hat. Und so große Gegensätze zwischen 137 Ostpreußen und Rheinpreußen, Niedersachsen und Märkern vorhanden sind – die Knappheit dieses Landes, das sich groß gehungert hat, können schließlich selbst die Talente vom Rheinstrom her nicht verleugnen, wenn sie natürlich auch bei andern, den Kindern kargerer Heimatstriche, sehr viel deutlicher wird. Und wenn vielleicht den Jüngern das besondre preußische Staatsgefühl zugunsten des großen deutschen Gemeingefühls abgeht, so tragen sie doch unbewußt genug von dem alten preußischen Wesen mit sich, und wenn es nicht bei jedem so durchschlägt wie bei dem alten Fontane, so wird es dem feinern Ohre doch hier und da immer wieder spürbar. Und um so mannigfaltiger kommen dann innerhalb dieses norddeutschen Landes die charakteristischen Töne der einzelnen Landschaft empor.
Wenn man unter ihnen die eigentlich schlesischen Laute erkennen will, so muß man sich die Eigenart dieser nun seit über einundeinhalb Jahrhunderten mit dem Staate verbundnen Provinz vergegenwärtigen. Auf der einen Seite umschließt sie Flachland und flaches Stromuferland, wie Pommern oder Altpreußen, mit vornehmlich ländlicher Bevölkerung, birgt aber dann Bergwerks- und Industrie-Bezirke von großer Ausdehnung mit dichten Volksmengen und Verhältnissen, wie sie sonst nur rheinisch-westfälische Gebiete zeigen, und endlich umschließt die Provinz das großartigste Mittelgebirge Deutschlands, großartig durch den langgestreckten, von ansehnlichen Höhen überragten Kamm, die Felsbildung seiner Schneegruben, die weiten Täler, viel nackte Steinarten, lauter Dinge, die auch dem im Verhältnis zum Hochgebirge niedern Zug des Riesengebirges eine Majestät verleihn, die über den Harz oder gar die grünen Berge Thüringens weit hinausragt. Dazu innerhalb der Bevölkerung die starke slavische Mischung, auf der einen Seite die flache Grenze gegen Rußland, auf der andern der Gebirgsrand mit der österreichischen Nachbarschaft, Magnatenherrschaften von in Preußen unvergleichlicher Ausdehnung und Webernot, deren furchtbare Geschichte immer noch unvergessen 138 lebt. All diese Elemente vereinen sich auch in den Dichtern des Landes. Und wenn unter den letzten und einflußreichsten Gustav Freytag recht als ein Sohn der flachern Landstriche erscheint, dem es nach eignem Geständnis nie wohler ward als bei weitem Ausblick in freie Ebene und der zugleich in des Landes Hauptstadt mit ihrem Handel und ihrer Adelsgesellschaft ganz daheim war, so ist das nun herrschende jüngere Geschlecht von der Gebirgsseite hergekommen und mächtig, laut und leise, beeinflußt und bestimmt durch diese Herkunft, darin oft bis zur intimen Heimatkunst gediehen, die Freytag fern lag, immer aber auch wieder in die große Kunst hineingegangen, ohne sich ganz aus der Heimat zu verlieren.
Hierher gehört Carl Hauptmann, der am 11. Mai 1858 in Salzbrunn geboren wurde. Erst als er sechsunddreißig Jahre alt war, erschien seine erste Dichtung, das Schauspiel »Marianne« »Marianne« und »Sonnenwanderer« sind bei S. Fischer in Berlin, »Waldleute« bei Cotta, »Einhart der Lächler« bei Marquardt & Co. in Berlin, alle andern Schriften Hauptmanns bei Georg D. W. Callwey in München erschienen.. Eine Frauengestalt steht im Mittelpunkt dieses Stücks, fein und zart gegen die Umgebung, die Pflegemutter, den Oheim, den ungeliebten Gatten und den Geliebten abgehoben, aber zu fein für dramatisches Gebilde. Es ist verräterisch für die innre Schwäche des Stücks, daß die grundstürzende Abwendung von den Anschauungen der durch schwere Schicksalsschläge tieffromm gewordnen Mutter und des etwas äußerlich frommen Gatten im Zwischenakt geschieht und uns hernach ohne rechten Eindruck erzählt wird. So schließen die drei Akte sich nicht zum vollen dramatischen Spiel zusammen – es müßten ihrer mehr, es könnten ihrer weniger sein, es ist ein Roman in dramatischer Form, wie ihn etwa der geborene Erzähler Wilhelm von Polenz auch in jungen Schriftstellerjahren geschrieben hat, aber ein Roman freilich, dessen Bewegungen immer aus wirklichen Herzenstiefen bestimmt erscheinen, wenn auch auf dem 139 Wege bis zum geschriebenen Wort manches verloren gegangen ist, manches noch tastend herauskommt.
Sehr viel gegenständlicher wirkte Hauptmanns zweites Drama, »Waldleute« (1895). Bestimmter als in dem ersten trat hier die Landschaft, die Heimat heraus. Etwas von dem Waldhauch, der den größten Förster unsrer dramatischen Literatur, Otto Ludwigs Erbförster, umwittert, webt auch um die Gestalt dieses Waldmenschen, der seine Bäume und den ihm anvertrauten Grund mit leidenschaftlicher Liebe umfaßt und dem die Menschen erst die zweite Welt gegenüber dieser ersten sind. Er ist von dem Geliebten der Tochter, dem er den wildernden Vater erschossen hat, zu Tode getroffen worden – und dennoch legt er die Hände der beiden ineinander und reinigt mit seiner Selbstüberwindung Rache und Leidenschaft des jungen Mannes zur freien, sieghaften Menschlichkeit, die Ephraim Breite in dem dritten, nach ihr benannten Stück (1898) auf anderm Wege erreicht. Sie, die Tochter des Bauern Ephraim, hat sich an den zigeunerhaften Großknecht gehängt, ganz in sinnlicher Flamme, und da er ihr Mann geworden ist und sie doch betrügt mit einer seines wandernden Volks, da kommt ihr endlich in einer qualvollen Nacht der große innre Sieg über das heiße Blut: sie will sich nicht mehr fortwerfen, sie wird neben ihm, aber nicht mehr mit ihm leben, wird rein bleiben neben dem Unreinen, er hat keine Gewalt mehr über sie. »O jemersch«, sagt die alte Mattern in diesem Schauspiel, »mir nahme nee – alles nimmt ins. Nee, nee! Alles nimmt ins, de Menscha tun sek a wing gruß, als wenn se wullta und kinnta.« Das leuchtet auch Breite ein, aber es führt doch nicht zur Resignation, sondern zu einer stillen, tief einsamen Bezwingung des Lebensdrucks in gefestigter Seele.
Ein viertes Drama »Die Bergschmiede« (1901), schloß diese erste, spät begonnene dramatische Entwicklung Carl Hauptmanns ab. Selbst in dem dritten der bisherigen Wirklichkeitsdramen, das ganz naturalistisch gezeichnet war, hatte jedoch die Kraft nur gereicht, 140 wenige Menschen ganz herausstellen zu können; der Bauer Ephraim und seine Tochter lebten und waren ganz gesehn, die zigeunernden Gegenspieler nicht viel mehr als das, was man in der Bühnensprache Chargen nennt, ausgestattet mit ein paar typischen Zügen und ohne tiefer glaubhafte Individualisierung. In dieser Beziehung bedeutete die »Bergschmiede« noch einen Rückschritt. Hier zerfloß Carl Hauptmann alles sehr viel mehr ins Wesenlose, als es die märchenhafte Anlage der Dichtung verlangte; denn er wollte doch in das Phantastische und Übersinnliche des Stoffes handelnde Personen von glaubhafter Persönlichkeit hineinstellen. Aber er geriet aus der Exposition nicht heraus, wiederholte sich von Aufzug zu Aufzug und wußte weder dem hünenhaften Schmied noch seiner jungen Gefährtin, noch dem andern Volk mehr als huschende Züge zu geben. Selbst die Bergstimmung war nicht stark herausgekommen, und dabei war doch die Kunst der Stimmung das stärkste, was Carl Hauptmann bisher erreicht hatte. Denn neben und zwischen diesen Dramen schuf er eine ganze Reihe von Skizzen, kurzen Novellen und Bildern, oft nur wie Übungsblätter leicht hingestrichen, oft aber auch mit einer starken Vergegenständlichung der Landschaft und der Menschen.
Mein Gott! Auf Bergeshöhn! Auf Bergeshöhn,
Wenn längst im Dämmern milchigen Opals
Die Täler schlafen . . . Wenn um stille Felsen
Die Raben einsam krächzen . . . Hinter weiten,
Blauveilchenfarben Erdenwogen langsam
Die Sonne sinken sehn! – Und lautlos schweigen.
Bis nur ein tief tiefreiner, goldner Himmel,
Verlassen von der Sonne Strahlenauge,
Sich über dunklen Erdenhügeln wölbt,
Nur noch ein bronznes Wölkchen träumend weht . . .
Der bleiche Abendstern sein Blinken zündet . . .
Und schauerlich aus öden Felsenklüften
Die letzte Sonnenwärme frierend aufflieht,
Dem Lichte nach in seine Strahlenreiche . . .
141
Und wer es einmal sah, vergißt es nimmer
Und gäb ein Leben, wenn er's lang entbehrt.
Was so in den stärksten und feinsten Versen der »Bergschmiede« wie Sehnsucht in lichtere, von der Heimat gesehene Bezirke wirkte, das sprach sich auch in diesen Skizzen voll aus. »Sonnenwanderer« (1896) nannte sich das eine Buch, und wie ein Grundthema heißt es darin einmal: »Der Mensch liebt im Menschen nur den Gott«. Also das Göttliche im Menschen herauszuholen, nicht nur sein Drum und Dran zu zeichnen, war hier, in diesen, sich der Einzelanalyse fast entziehenden Bildern Hauptmanns Wunsch. Auf allen liegt etwas Verträumtes, Versonnenes unter der Decke des Wirklichen, das dabei mit sichern Linien dargestellt ist. Und in allen ist ein lyrischer Klang, der sich auch schon zu weichen Versen zusammenschloß (»Aus meinem Tagebuche« 1900). Es läßt sich über die »Sonnenwanderer« ihrer ganzen Stimmung nach kaum Feineres sagen, als was Georg Reicke bei ihrem Erscheinen schrieb: »Es ist nur Seele in dem Buch – vielleicht zu viel Seele. Aber dies Buch ist geschaut von Anfang bis zu Ende. Es enthält die Kunst, das Tägliche zum Gegensatz des Alltäglichen heraufzuheben.«
Diese Kunst der Miniatur, wie der Dichter selbst sie bezeichnet, (»Miniaturen« 1905) gewann, je reifer Hauptmann wurde, etwas von der feinen Intimität altmeisterlicher Holzschnitte. So etwa, wenn »der alte Händler« gezeichnet wird, wie er im Ghetto seine Auslage geschlossen hat, erst im Halbdunkel die alten Stiefel und den ganzen Trödel sortiert und dann Weib und Kind zum Abendessen empfängt, die junge Frau, die unter der Windlampe das Tuch vom Kopfe zieht und nun, während der Mann das mitgebrachte Abendessen verzehrt, ihr Kind nährt.
»In der Moderhöhle war es kühl und dunkel wie in einem Grabe. Nur aus der Jungen mit dem Kinde, das Nelkens Kind war, schien Licht wie von innen stumm zu strahlen.
Nelken schlürfte gierig weiter und blickte immer wieder zu dem lichten Wunder, das in seinem Dunkel brannte.« Wie geschlossen 142 das Bild in sich war, bewies das Mißglücken des Versuchs seiner Dramatisierung mit Hilfe neuer Motive (»Der Antiquar« in den »Panspielen« 1910).
Ohne ein deutendes Wort wird der große innre Gegensatz von stillem Frieden und stummem Verbrechen klar in einer Erzählung wie »Die Bradlerkinder« (»Aus Hütten am Hange« 1902). Sturm treibt den Schnee gegen die halbverfallne Hütte im Gebirge, die Lampe wird gelöscht und die warmen Räume umfangen in ihrem Frieden das schuldlos ruhende Elternpaar, das nichtsahnend den Schlaf des wirklich Tiefgerechten schläft, und die gierigen Kinder, den Sohn, der eben von Diebstahl und Verbrechen kommt, die Tochter, die sich in Sinnenbrunst dem ersten Besten hingibt.
Etwas breiter malt Hauptmann solch ganz wirkliche Zustände, immer aber mit einem Licht von innen, in den »Einfältigen« (1905 jetzt in »Judas«). Da steht ein schlichter, frommer Mann im Mittelpunkt, dem keine Lüge und keine Gewalt innerlich etwas anhaben können, und dessen stille, feste Seele es schließlich doch den Liederlichen und Unreinen abgewinnt, wenn sie auch seiner spotten und lachen. Stilles Heldentum – eine Entwickelung, die immer wieder aus einem sichern Punkt gespeist wird – um es noch einmal zu sagen: Licht von innen strahlt von all diesen Hauptmannschen Gestalten aus, um so reicher und um so dauerhafter, je älter und reifer er ward. Vollendet hat sich diese Entwicklung in dem Roman »Mathilde« (1902). »Zeichnungen aus dem Leben einer armen Frau« hat Hauptmann unter den Titel dieses Buches geschrieben, und seine Gegenständlichkeit im Kleinen rechtfertigt diesen Titel doppelt, seine Kunst, Stimmungen und Gebärden fein und ohne Übertreibung mit der Deutlichkeit des Dichters auszumalen, die mehr ist als die gemeine Deutlichkeit der Dinge. Es gehn da Fäden zwischen seiner Art und der der Worpsweder Maler und Zeichner hin und her. Hier aber, in der »Mathilde«, fügen sich die Zeichnungen doch ganz zum einheitlichen Bilde. Die Vorgänge, die erzählt werden, sind so einfach, ja so durchschnittsmäßig, wie sie 143 sich im Leben der allermeisten Fabrikmädchen abspielen – und doch hat dieser Roman wenig zu tun mit all den naturalistischen Erzählungen aus gleichem Umkreis. Es kommt Hauptmann nicht auf spannende Handlung, sondern am Ende nur darauf an: die Seele herauszubringen. So tief will er in den Kern dieser Frauennatur eindringen, daß wir bei ihrem Weg durch Druck und Drang, durch Schmutz und Jammer, durch Lust und Liebe immer das eine richtige Empfinden für den Takt ihres Herzens behalten. Und es gelingt dem Poeten durchaus. Die Sieghaftigkeit einer reinen Natur, die mit lauterem Licht leuchtende Zartheit eines starken, sich nie ganz verlierenden Menschen wird uns klar und lieb. »Freude und Leiden«, heißt es da einmal, »sind aus einem Grund und kommen beide aus Tiefen, die uns Kraft geben und unsre Wege mit lebendigem Sinn bedecken wie der Frühling mit Blumen. Nicht jedem ist geschenkt, in Gründe zu tauchen. Nicht jeder ist gewürdigt, aus der Tiefe zu schöpfen, nicht in Freuden, nicht im Leiden. Aber Mathilde war Eine«. Und dadurch, daß diese feine und eigentümliche Gestalt durch ihres Dichters reife und reiche Seelenkunde ganz die unsre wird, bekommen auch wir selbst etwas ab von dieser Fähigkeit, auf die leisen Töne zu lauschen, die unter der Oberfläche leben und beben. Wie in Wilhelm Specks »Zwei Seelen« die stillen Wasser rinnen, Tropfen auf Tropfen, so rieseln sie auch in »Mathilde«. Hauptmanns Stil ist freilich weit preziöser als Specks, aber diese oft seltsam gesteigerte Sprache hat ihren nicht geringen Reiz und gleitet oft wie von selbst ins rein Lyrische hinüber. So erscheint denn der wundervolle Ostergesang, der das Buch schmückt, wie aus ihm heraus geboren:
Blüten! Blüten! Die kaum geöffneten, zagen –
Ewige Wunder blühen und klingen und sagen:
»Ja, der Lebendige wacht.«
Bäche tosen in schäumenden Ufern zu Tale.
Tausend Stimmen jauchzen!
»Mit einem Male
Schwanden Tod und Nacht!«
144
Wieder, wie wenn heilige Feuer lohten
Über Gräbern Männer in glänzenden Kleidern –:
»Engel!«
Und ein Ewiger spricht:
»Weinet nicht!
Suchet nimmer den Lebendigen
Unter Toten!«
Mit solchen, tief innerlich errungnen Versen führte Carl Hauptmann dies Werk auf die Höhe, eine Höhe, auf der es leider viel zu wenig gewürdigt, viel zu oft übersehn worden ist. Er hatte in der »Mathilde« gezeigt, wie weit seine epischen Gaben, die er so oft miniaturhaft verwendet hatte, zusammengehn konnten zum breitern Bilde, ohne daß dabei der lyrische Gehalt seines Wesens zu kurz kam. Er erwies das nun auch im Drama. Noch nicht in den beiden nächsten. In »Des Königs Harfe« (1903) war noch das Meiste flächenhaft geblieben, undramatisch im Wesen, freilich nicht, wie in der »Marianne«, mit verborgenem epischen, sondern mit offenbar lyrischem Klang. Dies Bühnenspiel war geradezu die lyrische Auseinandersetzung mit dem Königs-Problem, das in den letzten Jahrzehnten so viele unsrer Dramatiker vom spielerischen Thesenstück bis zum tragischen Katastrophen-Drama beschäftigt hat. Die Stimmung ist dieser sehr musikalischen Dichtung Bestes, und mehr als ein Stimmungsreiz ist auch das Harfenmotiv nicht, das in das Stück hineingeworfen wird und das doch nie einen dramatischen Werdegang wirklich wegweisend bestimmt. Die Harfe erscheint nicht, wie man nach dem ersten Akt, da der junge König sie von der grauen Mutter empfängt, meinen sollte, als lösendes und erlösendes Element seines Lebens, sondern nur als eine persönliche Gabe mit persönlicher Auswirkung ohne Klang ins Weite.
Aber auch hier und schließlich selbst in der wiederum episch zu breit geratnen »Austreibung« (1905), in der die Konflikte nie ganz herauskommen, lebte der Sieg fester Herzen, einer innern Frömmigkeit über die Unrast und den Hochmut. Das alles wies 145 Carl Hauptmann, wie es seine Lyrik und die ganze Stimmung fast all seiner Werke zeigte, ins religiöse Gebiet hinein. Und so fand auch er mit der Folgerichtigkeit, die wir nun schon bei einer fast hundert Jahre füllenden Reihe unsrer dramatischen Begabungen erleben, den Weg ins alte Testament. Er schuf seine Bühnendichtung in fünf Akten, »Moses« (1906). Bezeichnend genug löst auch hier der höchste Augenblick immer wieder, wie in der »Mathilde«, ein lyrisches Bekenntnis von großer Stärke aus. Immer wieder, wenn die allgemeine Empfindung nach einem erschütternden Ausdruck verlangt, ertönt aus unbekanntem Munde der Rhythmus, den die Menge aufnimmt, am tiefsten sie und uns bewegend in den hohen Stunden des Auszugs aus Ägypten und der Einkehr ins gelobte Land.
Im Feuerbusche bist Du Mose erschienen,
Jahwe! Großer Jahwe!
Die Heimat hast Du verheißen.
Wir ziehen aus der Knechtschaft.
Wo ist ein Tal,
Das dem Tale des Jordans gliche ?
Wo ist ein zweites Sichem?
Wir tragen des Joseph Gebeine
Heim zu dem Lande der Väter,
Das Du uns verheißen,
Jahwe! Großer Jahwe!
Mächtig setzt das Drama mit einem allgemach sich emportürmenden ersten Akt ein. Arons Weib in Gosen bereitet das befohlene Mahl vor dem Auszug, und in ihr Haus dringen, während draußen drohend schon der Sturm anhebt, Juden jeden Alters. Sie wollen sich aufrichten lassen, einander in der Gewißheit bestärken, daß Moses und Aron heute nicht vergeblich beim Pharao seien, daß sie diesmal endlich die Erlaubnis zur Auswanderung mitbringen. Die alte Jochebed, Mosis Mutter, spricht ihnen in Ekstase Zuversicht ein. Hier schon beginnt jene feine Gegenüberstellung verschiedener Frauencharaktere, die das ganze Drama durchzieht, 146 ohne je die Handlung zu beherrschen. Jochebed, die selige Mutter des Volksfürsten, seiner Sendung gewiß, Mirjam, die aristokratische Schwester, mehr dem erst allgemach an des Bruders Größe erstarkenden Aron als Moses ähnlich, Arons Frau Eliseba mit ihrer stillen, unbeirrten, gehorsamen Zuversicht auf die Männer. Und dann treten Aron und Moses in den Kreis, enttäuscht, vom König weggeschickt ohne Gewährung. Moses, auf den alles starrt, weint krampfhaft; aber als auf eine langsame Frage eines der Alten alle in den Hoffnungsruf »Jahwe! Jahwe!« ausbrechen, hat Moses den Tiefpunkt überwunden. Und er gibt mit der ganze Ruhe und der Gehorsamsgewißheit des geborenen Führers seine Befehle für den nächtlichen Auszug. Die Hütte wird der Fremden leer. Die Familie verzehrt das Lamm, alle sind, wie sie geheißen wurden, gegürtet, halten schon die Stäbe in der Hand. Noch einmal malt Moses das Land der Verheißung und kann doch nicht ganz die Dumpfheit der Stunde überwinden. Da schlagen, zuerst wie junge Flutwellen leckend, dann das ganze Haus erfüllend, die furchtbaren Geschehnisse der Sturmnacht herein; die Erstgeburt der Ägypter liegt getötet, und den mit Blut gekennzeichneten Schwellen der Kinder Israel ist der Würgeengel vorübergegangen, wie es verkündet war. Moses bricht auf, und nachdem jeder zum letzten Mal an der alten Herdstätte die Fackel entzündet hat, verläßt der Zug das Haus, während wogend der Hymnus, von draußen hallend, eines ganzen Volkes Sehnsucht ertönen läßt.
War Moses bisher nur der Führer des Volkes, so tritt er vom zweiten Akt ab als Gegenspieler ihm gegenüber, der Held wider die Masse. Unablässig wird gegen ihn gewühlt. Verwahrlost, hungrig, schlaff sieht sich nach kurzer Zeit das Volk in der Wüste, die jeder Verheißung bar ist. Dazu hetzen die Ägypter, die mitgezogen sind (Hauptmann fand sie in Luthers Übersetzung als »Pöbelvolk« verzeichnet), und die ehernen Midianiter, deren Fürst des Moses Schwiegervater ist, erregen Verdacht und Zorn. Die feinste Frau des Dramas, die schöne Zipora, steht fast allein mit 147 ihrer glühenden Gewißheit, daß ihr Moses nicht fruchtleer vom Sinaiberge zurückkommen, daß er Gottes Stimme dort vernehmen und Segen und Hoffnung herabbringen wird. Aber schon tönt es laut und lauter:
Leer ist des Moses Wort . . . und leer ist seine Verheißung!
Vierzig Tage ließ er uns schmachten!
Vierzig Tage in der brennenden Glut der Wüste!
Vierzig Tage im heulenden, reißenden, eisigen Nachtwind!
Ohne Wasser! . . .
Einer steigert sich am andern in die Sehnsucht nach Ägyptens Fleischtöpfen hinein, hinweg von Jahwe. Aron bringt das goldne Kalb, und während Ziporas Verwandte angegriffen werden, schlingt sich um das Götzenbild der Reigen. Da tritt schweigend Moses mit Josua unter sie, die Tafeln im Arm, in die Jahwe »mit dem starken Finger seiner Hand« sein lauteres Wort gegraben hat. Entsetzt verläßt das Volk den Platz und das Kalb, um das, beschämt, Aron und die Seinen stehn. Moses aber bricht nun aus, und er, der gegangen war, um seinem Volk »Jahwes ewiges Gesetz in Aug und Sinn und Blut zu bringen«, zerschmettert die Tafeln. Er fleht zu Gott, ihm die furchtbar zwängende Last der Führung dieses Volkes abzunehmen, und erst als Zipora, die Stammesfremde, doch Glaubensstarke, ihn an ihre unerschütterliche Nacheiferung erinnert, ermannt er sich, findet Strafe und Sühne für die Frevler, Trost für die Hungernden.
Aber noch hat er nicht gesiegt. Erst der dritte Akt bringt den Höhepunkt des Kampfes und den Ausgang. Die im zweiten etwas gelockerten Fäden werden wieder straff angezogen. Die Wandernden halten in einer Oase, von der aus man Kundschafter nach Kanaan gesandt, des Landes Beschaffenheit zu ergründen. Das Volk scheint ganz zu Jahwes Dienst bezwungen. Überreiche Geschenke bringen sie der Stiftshütte, vor der nun Moses die Ausgesandten erwartet. Er ist noch nicht so voll von Zuversicht in des Volkes Treue wie die Andern. Und siehe: als die Kundschafter 148 zwar köstliche Früchte bringen, lockenden Bericht von des Gelobten Landes Schönheit, aber auch die Gewißheit, daß man Kanaan in Kämpfen werde erobern müssen, da bricht Feigheit, neue Enttäuschung, lange verhehlter Haß alle Schranken nieder. Moses wird von der Revolte umheult, der Chor, in dem ein Ägypter die Unterstimme abgibt, fordert die Rückkehr nach Gosen. Nun wird Moses, wie jedes Genie im kritischen Augenblick schwerer Entscheidung einmal, zum Tyrannen, zum Ankläger und nur zu gerechten Richter in einer Person:
Verflucht sei dies Gesindel! . . . Keiner soll
Das Vaterland je schauen! . . . Solche Knechte
Und Feige sollen in der Wüste fürder
Umwandern . . . vierzig Jahre! . . . Bis die Leiber
Verfallen . . . und man dann im Wüstensande
Die Leichen einscharrt . . . und die ekle Feigheit!
Alle Getreuen, außer Josua und Kaleb, den neben ihm gebliebenen Getreusten, hat der gewaltige Führer in das Heiligtum gerettet, das im Augenblick des wildesten Aufruhrs in Wolken entrückt wird. Und während unter Donner und Blitz des Herrn die Tobenden auseinanderstieben, sieht man im Schwinden der Wolke Moses betend vor Jahwe auf dem Angesicht liegen.
Von da ab klingt das Drama leiser und schwingt mit milderem Glockenschlag aus. Der vierte (schwächste) Akt bringt es nicht recht vorwärts, so wundervoll auch die letzte Szene, Arons Tod, mit lyrischen Reizen übergossen ist. Echt dramatisch aber löst Hauptmann im fünften Aufzug das Problem, den Helden, wie die Geschichte es will, vor dem Ziel sterben zu lassen. Der Schrecken fliehender Heiden zeigt die Gewalt des nun nach vollen vierzig Jahren der väterlichen Stätte endlich nahen Volkes. Und wo eben noch flüchtige Feinde sich bargen, wo selbst die Zunge des aramäischen Zauberers für Jahwe zeugen mußte, verhaucht jetzt der greise Fürst den letzten Odem. Noch einmal, während am Fuß des Berges Nebo der Heerbann durch den Paß zieht, ruft er dem 149 Volk das Gesetz in die Ohren. Und dann, im Schauen des Gelobten Landes, sinkt Moses lächelnd, neben dem von Gott erkorenen Nachfolger, tot zusammen. Das Volk singt die alte Weise, mit der die Väter einst Ägypten verließen.
Mit einer gewissen Bangigkeit durfte man fragen: wie wird der Dichter, der in »Mathilde«, in den »Miniaturen« und sonst so gern mit leisen, kleinen Strichen zeichnete, die großen Gestalten und Bewegungen meistern, deren Darstellung sein »Moses« bringen sollte? Die Antwort lautet: mit souveräner Künstlerkraft hat er stilsicher diesem Bilde gewaltiger Zeiten und Menschen gegeben, was nottat. Und es macht sein Werk nur lebensvoller und farbenreicher, daß er dabei zugleich Szene vor Szene die Gabe der Beobachtung zarter Züge, kleiner psychologischer Offenbarungen bewähren konnte. Carl Hauptmann verfügt über keinen großen Reichtum von Worten, aber über viele Töne, die ihm Nuancierungen erlauben. So erwächst auch von dieser Seite her neben der starken Handlung starke Stimmung in dem Moses-Drama. Das bunte Gewimmel von Menschen, Juden dreier Geschlechter, Ägypter, Midianiter, Moabiter, Amoriter, fällt nicht auseinander, sondern bewegt sich ganz realistisch durcheinander, wie die einzeln handelnden Menschen auch. Freilich konzentriert sich das Interesse auf Moses; auch wenn er nicht auftritt, ist er gegenwärtig, alles steht immer in Beziehung zu ihm; sicher ein echter Zug des Heroendramas, wie wir es so gern wieder auf unsern Bühnen grüßen, auf denen leider dies starke Werk noch nicht erschienen ist.
Was Carl Hauptmann nach dem »Moses« gegeben hat, der Roman »Einhart der Lächler« (1907) zeigt ihn als Menschendarsteller auf der nun erreichten Höhe, freilich nicht als Meister der Komposition. Nirgends verleugnet sich das Streben nach innerer Beseelung, nur daß dem einstigen Zeichner knapper Miniaturen hier der Stoff etwas ins Breite geraten ist und nicht mehr überall so ganz vereinheitlicht erscheint wie sonst, wie vor allem 150 in »Mathilde«. Es scheint so, als ob Carl Hauptmann, obwohl heute zweiundfünfzig Jahre alt, noch in immer neuer Entwickelung steht – hat er doch erst verhältnismäßig spät dichterisch zu schaffen begonnen. Dabei läßt er, wie die lyrisch-dramatische Skizze »Im goldenen Tempelbuche« (»Panspiele« 1910) erweist, alte Fäden niemals ganz fallen.
Mit voller Absicht habe ich es bisher vermieden, davon zu sprechen, daß Carl Hauptmann der ältere Bruder Gerhart Hauptmanns ist; in übler Weise ist es bei uns zum Klischee geworden, seinem Namen stets diese Bezeichnung zu geben, als ob er nicht für sich allein bestehn und gelten könne. Nun, da ich dies gezeigt habe, muß ich freilich hervorheben, wie nahe Verwandtschaft die Kunst dieser beiden Dichter zeigt. Die gemeinsame starke innere Verbundenheit mit der gemeinsamen Heimat durchklingt ihre Werke, sie sind beide Kinder des schlesischen Gebirges, und wenn Peter Hille Gerhart Hauptmann mit den Worten »Rübezahl im Armenhause« charakterisieren wollte, so paßt das zu einem guten Teil auch auf Carl. Beide haben, der eine immer wieder, der andre leider nur einmal, starke Stimmungskunst in der Form novellistischer Kleinarbeit gegeben, beide haben das tiefste Mitempfinden mit den kleinen und bedrückten Menschen, das freilich bei Carl von Anfang an mehr individuell gerichtet gewesen und erst im »Moses« zur Darstellung einer ganzen Volksnot aufgewachsen ist, während bei Gerhart Hauptmann die Entwicklung rasch zum breiten sozialen Gemälde fortschritt und dann erst ins Individuelle mündete. Die stärkste Verbindungslinie scheint mir freilich, neben der Anklammerung an der Heimat Breiten und Stimmungen, in dem Suchen nach einer Verbindung mit Gott durch schlichte Herzen zu liegen. Was Michael Kramer an seines Sohnes Leiche ausspricht und was im Grunde schlichte Ehrfurcht einer fromm gebliebenen feinen Seele vor dem Höchsten über uns ist, das lebt deutlich auch bei Carl Hauptmann, läßt ihn nirgends und nie und stellt in seiner immer wiederholten Betonung seine Werke auf 151 einen einsamen Posten, obwohl er doch auch schon vielfach wirksam geworden ist – mir wenigstens erscheint Hermann Stehr, sein schlesischer Landsmann, mindestens so stark von Carl wie von Gerhart Hauptmann beeinflußt.
Carl Hauptmann war Naturforscher und Philosoph, bei Haeckel und Richard Avenarius in die Schule gegangen und hatte schon selbständige wissenschaftliche Werke veröffentlicht, ehe seine erste Dichtung erschien. Dabei aber ist er den alten Mächten treu geblieben, die fortwirkend aus unerschöpften Quellen sein Talent speisten, wie sie noch auf unbegrenzte Zeit Geschlechter nähren werden. Er ist nach Art und Anlage keine Führernatur, und doch zeigen seine Werke und seine Persönlichkeit weit in die Zukunft hinein, denn in ihnen lebt viel von moderner Nervosität, impressionistischer Ausdrucksweise, neuer intimer Beobachtungskunst; aber mit all dem verband sich – seine größten Werke, »Mathilde« und »Moses« lehren es vor allen – jenes uralte Herzenswissen, das Goethe im letzten Gespräch an Eckermann weitergab, da er sagte: »Gott hat sich nach den bekannten imaginierten sechs Schöpfungstagen keineswegs zur Ruhe begeben; vielmehr ist er noch fortwährend wirksam wie am ersten. So ist er nun fortwährend in höheren Naturen wirksam, um die geringeren heranzuziehn.« 152