
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

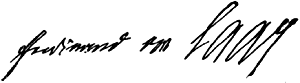
»Es ist noch weniger als Versgeklingel. Ich rate Ihnen, Ihre Zeit mit etwas andrem zu verbringen.« Mit diesem Schulmeisterurteil sandte im Jahre 1861 ein angesehener Leipziger Verleger Ferdinand von Saar ein Heftchen Zeitgedichte zurück. Die Welt hat dies Urteil nicht in Worten, aber durch die Tat immer wiederholt, denn sie ist an Ferdinand von Saar jahrzehntelang völlig vorbeigegangen, und noch heute ist dieser große österreichische Poet diesseits der reichsdeutschen Grenze im Grunde unbekannt. Und wo man diese oder jene seiner Novellen kennt, wird doch kein fester Begriff mit Ferdinand von Saars Künstlergestalt verbunden. Der stille Charakter seiner Kunst, die Zurückgezogenheit seiner ganzen Art hat wohl das Ihre dazu getan; aber sei dies wie auch immer, wir haben um so mehr Anlaß, heute nachdrücklich diesen Dichter in seiner Eigenart zu erfassen und seinen besten Schöpfungen nachzugehn. Haben sie doch noch den besondern Wert, das Österreich seiner Zeit immer wieder fein und unaufdringlich zu charakterisieren.
Ferdinand von Saar wurde am 30. September 1833 in Wien als Sprößling einer geadelten Beamtenfamilie geboren, ward jung Offizier und fand, in seinen Existenzmitteln sehr knapp gestellt, wenig Freude an dem Soldatenleben, obwohl es ihn durch viele Kronländer der Monarchie bis in das damals noch österreichische Venetien verschlug. Mit dem vollen Bewußtsein seiner dichterischen Begabung trat er im Jahre 1860 aus dem Heere und begann ein äußerlich ziemlich einförmiges, von bitterster Not verfolgtes Schriftstellerdasein. Er wäre wohl doch im Kampfe 2 erlegen, wenn nicht zwei hochherzige Frauen sich seiner angenommen hätten; die eine war die Fürstin Elisabeth Salm, eine geborene Prinzessin Liechtenstein, auf deren Schloß Blansko Saar eine Zuflucht und später in der Gesellschafterin der Fürstin, Melanie Lederer, die Gattin einer rasch durch den Tod getrennten Ehe fand; die andre, Josephine von Wertheimstein, eine Schwester des berühmten hellenistischen Forschers Theodor Gomperz, die Gattin eines Prokuristen des Hauses Rothschild. Man ist versucht, an Schiller zu denken, den auch ein Fürst von Geblüt und ein Adelsmann aus der jüdischen Finanz vor dem materiellen Untergang bewahrten. Vornehmlich durch die Huld dieser Frauen, die Gunst ihrer weitverzweigten Verbindungen, war Saar seit seinem sechzigsten Geburtstag ein sorgenfreier Mann, und nun stieg ihm auch in Österreich, das er selten und dann nur zu kurzen Reisen verließ, ein stiller Ruhm empor, dessen höchster Ausdruck die Berufung in das Herrenhaus war, eine Ehre, die seit Grillparzer noch keinem Dichter als solchem widerfahren war. Neben Schloß Blansko und einem stillen Landsitz seines alten Kameraden, des Dichters Stephan Milow, war immer wieder der Wiener Vorort Döbling sein Lieblingsaufenthalt, eine historisch geweihte Stätte, denn hier war manches Lied Mozarts und Schuberts zuerst erklungen, hier war Grillparzer häufig durch das damals noch ländliche Grün geschlendert, hier hatte Lenau manchen glücklichen und dann die schwer umnachteten Tage seiner Vollendung verbracht. Und Saar ist denn auch in seinen novellistischen Schöpfungen immer wieder von Döbling ausgegangen, und wir erleben bei ihm das Wachsen und die Umwandlung des Dorfes in einen Teil des neuen Wien vollkommen mit. Die letzten Jahre des Dichters verdüsterte ein Krebsleiden, dessen Qual ihm am 23. Juli 1906 die Pistole in die Hand drückte. Die Stadt Wien gewährte ihm, der nicht auf dem Zentralfriedhof sondern in Döbling bestattet sein wollte, ein Ehrengrab in dieser ihm so lieben Gemarkung, und die Schillerstiftung, der er letztwillig sein gesamtes 3 literarisches Eigentum vermachte, hat sich beeilt, seine gesammelten Werke in einer musterhaften, von Jakob Minor besorgten, von Anton Bettelheim mit einer Lebensbeschreibung einbegleiteten Ausgabe (bei Max Hesse in Leipzig) darzubieten.
Am Anfang von Ferdinand von Saars Lyrik steht ein Gedicht »Vorgesang«
Jahre sind dahingegangen,
Reich an Kämpfen, reich an Mühn,
Während andre fröhlich sangen,
Ließ ich still mein Herz erglühn.
Großen Zielen zugewendet,
Hab ich Größres nur bedacht –
Ach, wie wenig ward vollendet,
Ach, wie wenig ward vollbracht.
Jetzt doch bei des Lebens Neige
Kehr ich in mich selbst zurück –
Und so blüht ihr Liederzweige
Als ein letztes Dichterglück.
Man kann sagen, daß in dieser Selbstcharakteristik der ganze Saar umschlossen ist. Fröhlich hat auch der junge Leutnant kaum je gesungen, aber was er sang, kam immer aus einem wirklich von innerer Wärme durchglühten Herzen. Nicht ein Ton in seinen Werken ist etwa künstlich angezüchtetes Pathos, das dem langsam und schwer Schaffenden nicht eigen war. Und nie völlig mit dem Gewordnen zufrieden, sah er jede erstiegne Stufe nur als die vorletzte an, über das Große hinweg stets das Größere im Auge. So ist seine Lyrik wirklich quellende, ob auch nicht sprudelnde Poesie. Die stille Landschaft eines Herbsttages wußte Saar immer wieder darzustellen.
Über kahle, fahle Hügel
Streicht der Dämmrung kühler Flügel;
Dunkel wie erstarrte Träume
Stehn im Tal entlaubt die Bäume.
4
Und Blumen und Schmetterlinge, alles, was still aufgeht und still dahingeht, das war sein Element. Die hochstenglige Malve erscheint als seine Lieblingsblume:
Hochaufragende Malven,
Ihr des Gartens ernsteste Zier,
Gern hinwandl ich an euren Reihn,
Wenn der goldene Mittag
Eure sanften Farben verklärt.
Er empfindet in den regungslosen Blüten eine Sehnsucht, Kunde zu geben vom Urquell der Dinge,
Der geheimnisvoll eure Wurzeln tränkt,
Und dem ihr näher steht als der Mensch,
Der, losgelöst vom kettenden Boden,
In Freiheit schreitet.
Und der Trauermantel wird ihm zum Gleichnis der eignen Seele:
Ausgebreitet die ernste Flügelpracht,
Nahst du, schwermütig schöner Falter,
Wie im Traum den Blumen,
Die, aufleuchtend in duftiger Farbenglut,
Des Sommers letzte Tage schmücken
Und des Gartens schwindendes Grün.
Langsam wiegst du dich
In sonniger Luft
Von Kelch zu Kelch –
Aber auf keinen
Senkst du dich nieder.
Ist es doch,
Als scheutest du die buntern Genossen,
Die hier und dort sich festgesogen
Und, versunken in des Genießens Wonne,
Deiner nicht achten.
Einmal noch
Umkreisest du das weite Beet –
5
Dann, hohen Schwungs,
Entflatterst du ins nahe Dickicht,
Wo Fichtenzweige
Hellstämmige Birken umdüstern.
Sinnend blick ich dir nach,
Du dunkel Geflügelter!
Ach, wie so ganz
Gleicht meine Seele dir,
Die in sanfter Schwermut,
Tief verlangend und doch entsagungsvoll,
Über des Lebens
Holder Verheißung schwebt –
Um immer wieder
Zurückzuflüchten
In einsame Schatten.
Diese Verse sind vielleicht die schönsten Saars, und sie gehören überhaupt zum Schönsten, was wir besitzen, sind ein unvergängliches lyrisches Erlebnis. Er besaß den Rhythmus der lastenden Stunde, wie ihn seit Lenau kein österreichischer Lyriker mehr gehabt hat. Er gedenkt in musikalisch durchkomponierten Versen der Ungenannten, Ungeliebten, Gräberlosen, die fernab vom Herzen der Mitwelt unbetrauert dahingegangen sind. Und auch seine Liebeslieder haben diesen schweren Schritt, und höchst bezeichnend ist es, wie mit später Wärme sein Herz da eine Gestalt umfängt, der »der ernste Gang der Jahre das Antlitz leise schon gekerbt hat«,
Doch hold und schlank sind noch die Glieder,
Die du so leicht im Gange regst,
Und reich hängt deine Flechte nieder,
Wenn du sie tief im Nacken trägst.
Die Stunde, in der dann, zurückgedrängt, die Jugend noch einmal mit scheuem Glanz hervorbricht, vergleicht er des Herbstes letzter Traube, 6
Vergessen von des Winzers Hand,
Mit letzter Glut im fahlen Laube,
Wenn sie ein später Wandrer fand.
Soziale Ausdeutung fehlt seinen Versen nicht. Da wird dem absprechenden Hohn des fronenden Metallarbeiters über den scheinbar müßigen Dichter der ganze Schmerz des unablässig hämmernden und feilenden, sich verblutenden Geistesarbeiters entgegengesetzt. Da sieht der Führer der Lokomotive prophetisch in die Zukunft, der er, der Proletarier, die ahnungslos ruhenden Fahrgäste zulenkt. In tiefer Dankbarkeit neigt sich Saars Dichtung denen, die er liebt, den Frauen, die seine Not linderten, dem Vaterlande, dem geliebten Österreich, und unter den Dichtern und Denkern, vor denen er sich beugt, niemandem mit größerer Ehrfurcht als Arthur Schopenhauer, zu dem er das Leid der Edlen flüchten läßt, und dessen Name, wie Saar hofft, wie Erlösung auf allen Lippen zittern soll, wenn die Menschheit »endlich zurückgebracht vom letzten Irrwahn, schaudernd am Abgrund steht«.
Ferdinand von Saar hat sich oft und gern den alten Wiener Poeten genannt; er fühlte sich ganz mit seiner Vaterstadt verwachsen und hat ihre und Österreichs Trauer, wie ihren Aufschwung in einem tief empfänglichen Herzen mitempfunden und gestaltet. In einem Festgesang, der über die Gelegenheit hinaus bleiben wird, hat er die Vereinigung Wiens mit den Vororten verklärt und der Stadt zugerufen, sie möge im Streben nach den neuen, großen Zielen nur getrost die tiefsten Wurzeln im alten Grunde ruhn lassen. Wie er, der leider zu früh dahinging, die neue Bewährung des so oft für verfallen gehaltenen österreichischen Vaterlandes sicher voraussagte, so hat er in fünfzehn in ihrer Art zu neuerer Zeit unvergleichlichen Elegien (1893) Wien gefeiert. Die Elegie war so recht das Versmaß, in dem Saars spröde Kunst sich ausleben konnte. Als ein Sechzigjähriger wandert er nun durch die Stadt seiner Jugend, vergleicht das enge Alte dem weiten Neuen; schwer fällts ihm auf die Seele, daß die weithin gebreitete Stadt 7 nicht mehr so zum Herzen spricht, wie einst die wallumgürtete alte. Tröstlich findet er, daß sich immer noch Altes inmitten des Neuen behauptet,
Und Vergangenheit träumt still in die Zukunft hinein;
aber je weiter er schreitet, um so mehr erwärmt er sich auch an der neuen Stadt. Wohl empfindet er, wie in den rasch emporgeschossenen Arbeitervierteln mit ihrer armen Bevölkerung sich für den Reichtum der Paläste Wiens wie der Welt ein neues Schicksal webt. Aber dann geht die Wandrung in das alte, freundliche Döbling; putzige Villen haben sich freilich zwischen die bekannteren Häuser gedrängt. Aber doch gewahrt er noch der alten Kirche taubenumflattertes Dach, und weiterschreitend ins Rebengelände der Donau findet er das alte, muntre Wiener Volk. Und da der Herbst mit seiner Weinlust vorübergeschritten, kommt der Winter und gibt der Ringstraße neue, bunte Bilder, kommt der Fasching, der durch Saars Verse Straußsche Walzerweisen ertönen läßt. Der Alternde fühlt sich wieder jung, und da der Frühling den Winter verdrängt und der ewige Kreislauf der Natur das neue Wien wie das alte in Blüten und Grün einbettet, da empfindet der Dichter, vom nahen Gebirg der Stadt zugewandt, voll, daß er immer noch im Herzen der alten herrlichen Ostmark ist. Wohl ist Österreich vom Reich getrennt, aber Saar weiß, daß es auch für sich allein stark bleibt; wohl – und das schmerzt ihn mehr – wüten des vielsprachigen Reiches Glieder gegen das eigne Haupt –
Doch du bist noch, o Wien! Noch ragt zum Himmel dein Turm auf,
Uralt mächtiges Lied rauscht ihm die Donau hinan.
Und so wirst du bestehn, was auch die Zukunft dir bringe –
Dir und der heimischen Flur, die dich umgrünt und umblüht.
Sieh, es dämmert der Abend, doch morgen flammt wieder das Frührot –
Und bei fernem Geläut segnet dich jetzt dein Poet.
Es sind Elegien, vor denen den Berliner oder den Hamburger etwas wie Neid überkommen kann, daß ihren Städten solche ganz und gar künstlerische, aus einem tief anhänglichen Herzen stammende 8 Darstellung nicht geworden ist. Die Deutschen im Kampf mit den Slaven hat dann das freundliche und, wie alle Saarschen Schöpfungen, sorgsam durchgefeilte, aber nicht eben bedeutende Idyll »Hermann und Dorothea« (1901) in einem Ausschnitt dargestellt. Lustige Soldatenstreiche tauchen in dem komischen Epos »Die Pincelliade« (1897) auf, wo Saar uns auch einmal behaglich kommt, nicht ohne soldatische Derbheit, aber doch nicht mit voller handelnder Schlagkraft.
Und Schlagkraft vermissen wir auch an Saars Dramen, die lebenslang die Schmerzenskinder seiner Künstlerschaft waren. Es sind vier Trauerspiele, »Kaiser Heinrich der Vierte« (1865 und 1867), »Die beiden de Witt« (1874), »Tempesta« (1860 begonnen, 1881 erschienen), »Thassilo« (1886) und ein Volksdrama »Eine Wohltat« (1861 verfertigt, 1887 erschienen). Das bedeutendste dieser Stücke ist der »Heinrich«. Das Drama besteht aus zwei Trauerspielen: »Hildebrand« und »Heinrichs Tod«; die Bühne hat sich ihnen immer wieder versagt, nicht nur die Österreichs, die keinen Papst auftreten lassen darf, sondern auch die Reichsdeutschlands. Und wenn auch gewiß aus tausend Gründen manches unendlich viel schwächere und schlechtere Drama ans Rampenlicht gekommen ist, so wird man doch sagen müssen, daß die Bühnenleiter recht hatten, wenn sie Saar schließlich nicht herausstellten. Der »Thassilo«, »Tempesta« sind ohnehin schwache Werke, innerlich nur ganz lose verbunden, der »Thassilo« ohne eigentlich tragischen Reiz, »Tempesta«, eine Eifersuchtstragödie, wie auseinandergezogen aus dem Rahmen einer knappen Novelle. »Die beiden de Witt« haben wenigstens an einigen Stellen gegeneinanderspringendes Leben, aber die Fabel baut sich doch zu ausschließlich auf einer Intrige auf, die eine Tragödie nicht tragen kann. Das Volksdrama »Eine Wohltat« ist außerordentlich bezeichnend für Saars Pessimismus, denn es zeigt, wie eine von edlem Willen beseelte Tat dem Beschenkten zum unentrinnbarem Verhängnis wird; aber auch hier haben wir wieder nur eine auseinandergezogene Novelle, 9 etwas, was Anzengruber, der ja stofflich mit diesem Bauerndrama verwandt erscheint, sicherlich innerhalb seiner »Dorfgänge« und nicht in vier Akten dargestellt hätte. Weit über all diesen Schöpfungen steht der »Heinrich«, ein Stück mit einer Fülle poetischer Schönheiten, feiner Beobachtungen und Worte, auch im Vers das am meisten ausgeglichene unter Saars Dramen, und dennoch keine Dichtung, die auf der Bühne je wirklich lebendig werden würde. Denn hier, wo es nicht ausmalen, sondern in freier Luft darstellen heißt, versagen Saar die letzten Töne. Ihm fehlt jede Spur von Theatralik, ohne die noch niemals jemand ein lebendiger Dramatiker geworden ist. Es ist alles aus der Tiefe geschöpft, keine oberflächliche Kunst, aber es fehlt der wirkliche Aufeinanderprall der Charaktere, es bleibt vieles nur Referat in dramatischer Form und wird nicht dramatische Handlung. Wenn man Wildenbruchs erfolgreiche Heinrich-Tragödie dagegen hält, so muß man ohne weiteres sagen, daß der Erfolg dieser jüngern Schöpfung gegenüber der ältern durchaus berechtigt war. Gewiß übernimmt sich Wildenbruch gelegentlich in dem, was Saar fehlt; und etwa, wenn bei Wildenbruch Gregor die Füße auf die Heinrich vorenthaltene Krone stellt, so empfinden wir genau, daß hier einmal nur Theater vorhanden ist. Aber das vergißt sich, weil durch das ganze Stück Leben rauscht, weil ununterbrochen die Charaktere kämpfen, die bei Saar mehr von ihren Kämpfen sprechen. Bei Wildenbruch sehn wir den Gegensatz zwischen Hildebrand und Heinrich schon in der Kindheit des Königs vorbereitet, wo Kind und junger Mann einander mit dem instinktiven Gefühl in die Augen blicken, innerhalb der Umgebung für sich und, wie sie glauben, miteinander allein zu stehn. Bei Saar erzählt bezeichnenderweise Hildebrand in einem langen Bekenntnis vor seinem Tode der Gräfin Mathilde von Canossa, woher sein Haß gegen Heinrich stammt, erzählt von seiner Liebe und seiner Eifersucht und verwischt damit das Bild des tragischen Konflikts, der an uns vorbeigezogen ist. Und Heinrich der Fünfte, der bei Wildenbruch von Anfang an hin- und hergerissen 10 zwischen Liebe zum Vater, Kränkung über unkaiserliche Friedseligkeit und dämonischem Ehrgeiz erscheint, wird bei Saar überhaupt nicht lebendig. Auch er macht am Schluß des zweiten Teils einen Versuch, mit eignen Worten knapp sein Wesen auszudrücken, – der Dichter empfand wohl, daß er es uns nicht hatte schauen lassen. Das Urteil Alfred von Bergers, der lange mit Saar eng befreundet war, ist durchaus berechtigt: »Saar war kein Dramatiker! Die Gabe objektiven Gestaltens war dieser wie eine im wallenden Grün durchsichtiger Flut webende Wasserpflanze im Äther lyrischer Stimmung aufgehenden und lebenden Dichterseele versagt, sowie Darstellung und Ausdruck leidenschaftlichen Wollens diesem kontemplativen Geist nicht natürlich war, der die Außenwelt nur im dunklen Spiegel seines Innern erblickte. Er konnte aus der Sphäre seiner Subjektivität nicht heraus, und das muß der Dramatiker können.« So bleiben freilich in seinen Dramen noch feine Stimmungen genug, die sie immer lesenswert erscheinen lassen, und die dann, wie zum Beispiel zwei wundervoll angedeutete Gartenszenen in »Tempesta«, immer wieder den Novellisten Saar ins Gedächtnis rufen.
Als Novellist war Saar am größten, und wenn wir das festhalten wollen, was von seinen Novellen in der Erinnrung immer wieder sofort mitschwingt, so können wir sagen: es war die Stimmung. Die neuere Literatur hat fünf große Stimmungskünstler der Prosa gekannt: Theodor Storm, Iwan Turgenjew, Ferdinand von Saar, Jens Peter Jacobsen und Guy de Maupassant. Diese fünf, der Russe, der Deutsche, der Deutschösterreicher, der Däne und der Franzose, stellen jeder einen höchsten Typus ihrer nationalen Kunst und ihres Volkstums dar. Sie saugen mit allen Nerven die Reize der umgebenden Welt ein und spiegeln sie in ihren Schöpfungen wieder. Sie wirken weniger durch das Gegeneinander der handelnden Personen als durch leise, feine, tragisch aushauchende Reaktionen leicht verwundbarer, eindrucksfähiger Seelen gegen die Natur, das Leben, die Menschen um sie her. Man kann ihnen 11 ohne weiteres andre Künstler von gleich nationaler Ausprägung gegenüberstellen und hat dann ein noch besseres Bild: zu Storm Hebbel, zu Turgenjew Tolstoi, zu Saar Anzengruber, zu Jacobsen unter Überschreitung der dänisch-norwegischen Grenze Ibsen, zu Maupassant Zola. Jene sind die Maler, die nicht naturalistisch, sondern mit durchaus eignem Glanz, aber treu das Leben reflektieren, absolut subjektiv und ohne den Drang, reformatorisch in Kunst und Leben einzugreifen; diese sind die Bildhauer, die sich am spröden Stein am liebsten versuchen, die manches Stück halbbehauen stehn lassen und, ob auch an Größe untereinander verschiedener als die ersten fünf, allesamt ihrem Volk oder der Kunst neue Ideale einhämmern wollen. Jene geben nur, diese fordern, um jene wird kaum gekämpft, sie setzen sich je nach Zeit und Umwelt langsamer oder rascher durch, diese müssen von ihrem Volk und der Welt erst erobert werden. Beide Gruppen ergänzen sich immer wieder, geben zwei Seiten des Charakters ihrer Nation und zwei Seiten des dichterischen Charakters überhaupt in der Vollendung wieder, und wenn zwei solche Gestalten auch zeitlich zusammentreffen, so braucht man häufig nur die beiden innerhalb eines Volkes nebeneinander zu halten, um das ganze Leben der Nation zu erfassen.
Zwischen jenen fünf Stimmungskünstlern gehn mannigfache Fäden hin und her. Wir wissen, daß Turgenjew Maupassant beeinflußt hat, mit Storm erwuchs er ja gleichzeitig, aber es gibt sicherlich manche innere Berührung zwischen den Männern, die äußerlich durch die gemeinsame enge Freundschaft mit Ludwig Pietsch verbunden waren. Ich möchte auch annehmen, daß Storm auf den stammverwandten Jacobsen gewirkt hat, und jedenfalls ist ein leiser Einfluß Maupassants auf den ältern Saar nicht abzuweisen. Er kommt freilich kaum in Betracht neben der Beeinflussung, die Ferdinand von Saar durch Turgenjew empfing. Dies Hinüber und Herüber nimmt dem Einzelnen nichts von seiner nationalen Eigenheit und Bedeutung, selbst wenn der Einfluß so 12 stark war wie der des Russen auf den Österreicher, dessen Familie nach ihrer Tradition kroatischer Herkunft war. Ist doch etwa Alexis ein typischer preußischer Dichter von großer nationaler Bedeutung geworden, obwohl er aufs stärkste von Walter Scott beeinflußt, ja, anfangs abhängig war. Abhängig ist nun Saar niemals gewesen; aber jene Art der Stimmungskunst, die Turgenjew wieder unter den andern Genossen heraushebt, hat er wohl zum guten Teil wieder von ihm überkommen. Denn wenn bei Storm die Stimmung der Natur das Stärkste ist, bei Jacobsen die Stimmung der Stunde, bei Maupassant die Stimmung der flatternden Seele, die um eine andre Seele kreist, so geht bei Turgenjew immer wieder die Stimmung der Zeit mit, die er nicht im Sinn andrer großer Russen an sich gestaltete, sondern aus der heraus seine Menschen vor uns treten, und deren Licht und Schatten sie überallhin mitnehmen. Wie in Turgenjews Schöpfungen oft der Kampf zweier Generationen die tiefern Hintergründe für die Erlebnisse seiner Geschöpfe gibt, so nun auch bei Saar, der mit voller Betonung einen seiner Helden Turgenjew nachdrücklich in Schutz nehmen läßt gegen die angeblich überragende Größe der neuen Russen und der die wundervolle Novelle »Frühlingswogen« sicherlich nicht ohne Bedeutung hervorhebt.
»Novellen aus Österreich« hat Saar diese sein ganzes Leben begleitenden, durchweg nicht umfangreichen Schöpfungen genannt und damit schon im Titel den Hintergrund des Lebens angedeutet, aus dem seine Gestalten hervorgehn. Und da kann ich nun Alfred von Bergers Urteil freilich nicht unterschreiben, wenn er sagt: »unter seinen Novellen sind jene die schwächsten, die nicht ein Stück Saar, sondern ein Stück Österreich, wie es ist, darstellen wollen.« Das hat ja Saar nie gewollt, aber er war so durchaus selbst ein Stück Österreich, daß er, indem er sich gab, immer wieder Österreich gab, genau so wie Theodor Storm mit dem eignen Erlebnis immer ein Stück seiner meerumschlungnen Heimat herausbringen mußte. Und der große Reiz all dieser Saarschen 13 Novellen, von dem nur die letzten kaum mehr etwas mitbekommen haben, liegt eben darin, daß der subjektive Gestalter, weil er eine freie und reiche, ganz nationale Persönlichkeit ist, immer wieder völlig echte Bilder seiner Heimat mit emporbringt.
Die meisten Novellen Saars sind bezeichnenderweise Ich-Novellen. Der Dichter trifft in einer Gesellschaft einen einst schon gesehenen Menschen, dessen Schicksale ihm nun wieder auftauchen, und er erzählt sie oder läßt sie sich erzählen. Er schließt Bekanntschaften mit Priestern und Landleuten, Offizieren und ausgedienten Beamten, und immer wieder vernimmt er ihre Geschichte. Oder er gibt ein Tagebuch wieder, das ihm zu Händen gekommen ist. Gleich seine erste Novelle »Innocens« (1866) läßt einen Priester sein im Grunde einfaches Schicksal erzählen, das mit Entsagung doch ein stilles, resigniertes Glück geworden ist. Der Hintergrund ist hier eine Zitadelle auf einem Felsenhügel über Prag. »Marianne« (1873) gibt ein tragisch ausklingendes Liebesidyll aus Döbling, in dem es kaum zu mehr kommt als zu einem kurzen Geständnis und einem Kuß, und das dann doch mit dem Tode der rasch Geliebten und eigentlich nie Gewonnenen schließt. »Die Steinklopfer« (1873) bringt wieder jene aus der Lyrik emportönende Liebe zu den letzten Volksklassen, das erste Stück äußerlich objektiver Darstellung, schwächer als die beiden ersten; es erzählt das Geschick zweier armer Seelen beim Bau der Semmeringbahn, »Die Geigerin« (1874) ein Mädchenschicksal von der Grenze, wo die Gesellschaft und ihr Untergrund aufeinanderstoßen. In »Haus Reichegg« (1876) haben wir dann den Typus, der später so oft auftaucht: der Dichter trifft in einem Krankenhaus die Oberin, eine Tochter eines gewesenen Staatsrats, und nun zieht in lebendigster Erinnrung ein Erlebnis vorbei, das den als Manövergast einquartierten jungen Offizier den Anfang einer Tragödie in dem Hause des Staatsrats und später nach Jahren ihr Ende erblicken ließ. Die volle Meisterschaft erreichte Saar mit der im Jahre 1878 geschriebenen Novelle »Vae victis«. Hier ist das ganz persönliche Schicksal dreier Menschen 14 völlig hineinverwoben in das Werden Österreichs nach den italienischen Niederlagen. Der nach dem Frieden von Villafranca nicht ohne leisen innern Bruch in die Hauptstadt zurückgekehrte, bis dahin nur an Erfolg gewöhnte, vortreffliche General sieht seine viel jüngere, kühle Frau an das neue Österreich, an einen liberalen Kammerredner hinübergleiten, er belauscht (das geschieht bei Saar häufig) unabsichtlich ein Gespräch der Frau mit dem jungen Politiker, er muß hören, wie aus dem Munde der Frau das Urteil fällt »es ist aus mit ihm«, und er entzieht sich allem, der Verabschiedung und der Ehescheidung, durch den Selbstmord. Und nun das Schönste in dieser tragischen Novelle: der junge Politiker heiratet die Witwe, er wird Minister und findet sich nach vielen Fehlschlägen eines Tages enttäuscht wieder als Privatmann. »Es erweckte eigentümliche Gedanken und Empfindungen, wenn man dem zwar noch immer aufrechten, aber doch sichtlich im Innern geschädigten Mann während der letzten Jahre im Straßengewühl begegnete. Auffallend sorglos gekleidet, ging er meistens allein, blickte mit seinen scharfen Augen unruhig umher und stieß dabei mit einem starken Rohre gegen das Pflaster, als wollte er neue Verhältnisse aus dem Boden stampfen, die ihn wieder ans Ruder bringen könnten.« In zwei Sätzen die tragische Vollendung eines als stolzer Höhenflug begonnenen Lebens. Auch der ungefähr gleichzeitige »Exzellenzherr« ist in die Stimmung des Vergehns aller Träume getaucht. Wieder erzählt ein greiser Einsamer von einem jungen, nie zum Vollgenuß gelangten Liebesglück, und wieder sind Staatsverhältnisse Österreichs der Hintergrund, wieder lenken Fäden der Politik ein wenig hinüber in das Schicksal des Einzelnen. Und wenn die greise Exzellenz aus dem Studium der Geschichte »die unabwendbare Notwendigkeit alles Geschehenen und Geschehenden und andrerseits die Nichtigkeit und das Traumartige des menschlichen Lebens« immer neu erfährt, spricht er ganz aus der Seele des Dichters, der sein pessimistisches Bekenntnis schon in der »Geigerin« deutlich aussprach. »Dann aber, wenn man erkennen wird, 15 daß der Mensch nichts andres ist als eine Mischung geheimnisvoll wirkender Atome, die ihm schon im Keim sein Schicksal vorausbestimmen: dann wird man, glaube ich, auch dahinter gekommen sein, daß es trotz aller geistigen Errungenschaften besser ist, nicht zu leben!«
Daß es besser ist, nicht zu leben, klingt auch durch die Novelle »Tambi«, die vier Jahre jünger ist als der »Exzellenzherr«; sie zeigt einen Dichter, dem in der Treibhausluft des Wiener Literatenlebens nach dem ersten Buch nichts mehr gelang, der nun Schreiber in einem Nest ist und, nachdem ihm mit seinem Hunde Tambi das letzte geliebte und liebende Geschöpf verloren gegangen ist, seinem Leben ein Ende macht. »Leutnant Burda« (1888) schildert die tragische Verstrickung eines in halbem Größenwahn lebenden bürgerlichen Offiziers, der an adlige Abkunft und an die Liebe einer Prinzessin zu sich glaubt und schließlich in einem Duell fällt, das der leicht Verletzte halb provoziert hat. »Seligmann Hirsch«, wieder eine vollkommne Meisterleistung, gibt den kulturlosen, nach Wien eingewanderten Ghetto-Juden, der in dem Hause seines reich gewordnen Sohnes keine Statt mehr findet und, verbannt, durch Selbstmord endet; die Enkelin aber von weiland Seligmann Hirsch tanzt als Baronesse in den Salons der Wiener Gesellschaft. »Die Troglodytin« und die wiederum vier Jahre nach diesen drei Stücken, 1892 herausgegebene »Ginevra« sind wieder zwei Liebesgeschichten. In der ersten, deren Hintergrund das mährische Gutsleben ist, wird mit schwerer Waldstimmung die wilde Liebe eines zigeunerhaften Geschöpfes zu einem jungen Forstadjunkten gegeben, in »Ginevra«, der schönsten Liebesnovelle Saars, die reine, zarte Hingebung eines wundervollen, jungen Geschöpfes an einen Offizier, der ihr in den Armen einer Kokotte untreu wird, und als er die einst Geliebte wiedersieht, zu tiefst empfindet, daß er sein Glück verscherzt und verdorben hat. Frühlingsstimmung einer kleinen Stadt in Böhmen, eines kleinen Häuschens mit kleinem Garten, Frühlingsstimmung zweier junger Herzen und dann bittre 16 Resignation eines Altgewordnen, der sein bestes Glück haltlos verspielt hat. Es ist Saars eigentliches Seitenstück zu jener Turgenjewschen Novelle »Frühlingswogen«. Die gleichzeitige »Geschichte eines Wiener Kindes« klingt ganz wie ein Kapitel aus den Memoiren des Schriftstellers Saar. Eine Frau, die nach rasch und unbesorgt genossenen Mädchentagen in eine ehrenhafte Ehe tritt, dieser mit einem Liebhaber entflieht und nun im Elend ein merkwürdiges, wenn auch nicht vollendetes Buch schreibt. Da der Dichter ihr, die wieder reich geworden ist, begegnet, ist sie körperlich trotz ihrer Schönheit völlig gebrochen, eine vom Leben tief enttäuschte Frau in den Händen eines rohen Mannes (mich erinnert die Situation immer ein wenig an die Wiener Szenen von Raabes »Schüdderump«), und Morphium macht ihrem Leben ein Ende. »Schloß Kostenitz« (1893) steht in Verwandtschaft zu »Haus Reichegg«, wieder ein Adelssitz, nur nicht von einem erfolgreichen, sondern von einem verabschiedeten Staatsmann bewohnt, und eine Frau, die nicht wie Frau von Reichegg in Untreue verfällt, sondern an dem bloßen Ansturm einer frechen Begierde zu Grunde geht – es ist das völlige Gegenstück zu jenem, seine ebenbürtige Ergänzung.
Wenn wir diese vierzehn Novellen aus Österreich noch einmal zurückblickend betrachten, so finden wir als gemeinsame Züge in ihnen allen tragische Erlebnisse, die mit Ausnahme der »Steinklopfer« auch in trübe Schickung enden, finden in allen eine spröde, ihrer Mittel ganz gewisse, niemals plauderhafte Erzählerkunst. Und alles ist durchaus gebunden an Luft und Licht, an Berg und Flur, an Häuser und Städte Österreichs, dessen Leben Ferdinand von Saar ganz mitlebte. Nirgends bewegt ihn ein heißer Reformdrang. Von dem Aufschwung, den seine Lyrik gelegentlich dem Vaterlande wünscht und voraussagt, ist hier nicht die Rede. Freilich stammen alle diese Novellen aus den Jahrzehnten, da Österreich Schlag auf Schlag erlitt, da Saar noch die Gründung des deutschen Reichs als ein furchtbares Geschick für sein Vaterland empfand, 17 derselbe Saar, der dann später, alldeutsch gestimmt, Bismarcks Tod mit feierlichen Trauerworten begleitete. In all den Stücken lebt die Natur des Wiener Waldes, der mährischen Gebreite, leben böhmische Fluß- und Gebirgsstädte, vor allem die Stadt Wien mit ihren engen Stiegenhäusern und ihren ländlichen Vororten, ihrer hohen und niedern Gesellschaft, ihren Donauufern und ihren Ausflugszielen aufs deutlichste. All das wird kaum beschrieben, nie langatmig dargelegt, aber immer stimmungsmäßig hineingezogen und herumgelegt um die Menschen. Immer wieder empfinden wir über dem subjektiv dargestellten Schicksal des Einzelnen die Fäden, die sein Volk mit ihm überspannen und in schwere Schickungen verstricken. Kein heller Ton aus der von andern so oft besungnen lustigen Leutnantszeit, wie sie etwa Saars Landsmann und Standesgenosse Karl von Torresani schilderte, klingt hier auf. Wir sehn einen Menschen, der das Leben früh sehr ernst nahm, den es hart angepackt hat, und der doch im Druck und Drang des Tages jede Minute einer vollen Stimmung ganz in sich aufzunehmen und zu bewahren wußte.
Was Saar seit dem Jahre 1893, also in den letzten dreizehn Jahren seines Lebens, noch an Novellen geschaffen hat, steht weder auf der Höhe der alten, noch ist es für ihn und Österreich in gleichem Maß charakteristisch, bezeichnend vielleicht nur, daß der »Herbstreigen«, zu dem er 1897 drei Novellen zusammenstellte, wiederum mit einem Worte Schopenhauers beginnt. Hier begegnet es uns schon dann und wann, daß ein Schicksal, wie etwa das des Dieners Fridolin in »Herr Fridolin und sein Glück«, uns kalt läßt, ja, daß, wie in »Ninon«, wo immerhin eine literarische Bohêmewelt fein angedeutet ist, oder in »Conte Gasparo« (1899), uns manches abstößt, weil es nicht stark genug dichterisch durchempfunden ist. In solchen Novellen, etwa auch im »Sündenfall«, hat Saar es mehr mit dem »interessanten Fall« zu tun. Den liebt er ja nun immer, aber er konstruierte ihn nie, sondern er wuchs ihm, wie ich vorhin gezeigt habe, aus Erinnrung und stiller 18 Beobachtung heraus, während er in den späten Werken manchmal etwas künstlich gestellt erscheint. Das geht zum Beispiel in der Geschichte »Sappho« (1906), die eine nie zu vollem Liebesglück gelangte, mit wenig körperlichen Reizen begabte Schriftstellerin zeigt, bis über die Grenze des Peinlichen. Hier wird unbedingt ein Einfluß Maupassants festzustellen sein, der Saar nicht zum Heile ausschlug, denn die Grazie, mit der der französische Meister solche Vorwürfe zu gestalten wußte, besaß der österreichische nicht, dessen Stimmungswerte wo anders lagen.
Wir blicken zurück. Ein Lyriker, der nie hinausjubelt, aber schwere und zugleich feine Verse von höchstem Reiz findet, Gedichte, wie sie keinem andern gelingen konnten als ihm, ganz unkonventionell, ganz persönlich. Ein Novellist, dem zum Dramatiker die Gestaltungskraft fehlt, die sich ganz aus der eignen Person heraus den Schöpfungen der Phantasie gegenüberstellen kann, der dann aber auf seinem eigensten Gebiet, eben in der Novelle, erreicht, was in seiner engern Heimat keinem, im ganzen Umkreis unsrer Dichtung wenigen gelungen ist: die immer neue Bezwingung eines Stückes Leben, hineingebannt in eine voll ausgekostete Stimmung, hineingestellt vor einen vollendet gezeichneten Hintergrund nationalen Lebens, durchzogen von dem echten Herzschlag wirklich lebendiger Menschen. Einfache und verschlungne Schicksale, aber alle ganz wahrhaftig und freilich alle in schwere, trübe Wandlungen endend. Paul Heyse hat an der »Marianne« die sichere Kunst gerühmt, »mit der die verschiedensten Charaktere gleichsam mit einem Silberstift deutlich umschrieben und die seelischen Vorgänge bei aller Mäßigung klar und ergreifend geschildert sind«. Und diese Mäßigung möchte ich Saar noch als einen besondern Ruhmestitel anrechnen; er hielt sich für einen Dramatiker, der er nicht war, aber er kannte in der Novelle sein Feld bis an die letzte Grenze, er war ein Künstler von starker Selbstzucht, der in seinen Meisterjahren unermüdlich aus jedem Stoff, der ihm ja immer Erlebnis war, das Letzte 19 herausholte. Kein Naturalist, so wenig wie Turgenjew, aber ein Wirklichkeitsdarsteller im Sinne Storms, echt in jeder Bewegung und in jedem Wort. Nicht zufällig wohl hat Paul Heyse in seinem Novellenschatz Saar mit Rudolf Lindau, dem auch fast unbekannten Meister, zusammengestellt, denn beide stehn in naher Verwandtschaft, beide haben keine leichtherzige Ansicht vom Leben, beiden ward jener niemals spielerische Ernst, der allein den Künstler groß macht, beide bewahren in ihrer Dichtung jene etwas zugeknöpfte Haltung des ältern Offiziers und des hohen Beamten, beide versagten sich jeder Koterie, und beide verflechten in ihrem spröden Stil, ohne je zu schielen, gern den Ereignissen der Umwelt den interessanten Fall einer menschlichen Schickung, die sie selbst erlebt haben. Beide erscheinen als gute, fein lauschende Zuhörer, die Erfahrenes festzuhalten wissen. Freilich ist Lindau mit seinem spröden norddeutschen Realismus doch in der ganzen Welt zu Hause, während Saar in dem Bezirk Österreichs bleibt, Lindau überwindet den Pessimismus in tapferer Bezwingung, während Saar ihn unterstreicht, und Lindau ist nicht zugleich der lyrische Novellist, gibt nicht diese Atmosphäre von Stimmung (man muß das Wort immer wieder brauchen), in die bei Saar alles getaucht ist. Aber das fast gleiche Verhalten des Publikums gegenüber den fast gleichaltrigen Dichtern hat auch, wie ich zeigen wollte, vielfach verwandte Gründe.
Ferdinand von Saar lebt, er hat sich dauerhaft erwiesen, während Zeitgenossen seiner engern Heimat, die ihn an Ruhm weit überstrahlten, wie Hamerling, längst zurückgetreten sind. Er soll mit seiner echten und feinen Kunst weiterleben, und seine »Novellen aus Österreich« werden, wie ich meine, auf lange hinaus unvergängliche Dokumente eines Schaffens sein, das, in nationale Kämpfe gestellt, die Werte, die still und unabhängig von der Mode und der Zeitströmung emporwachsen, durchhält und weiterträgt. Der Pessimist hat doch sein Österreich und sein Leben, ohne je seinen Standpunkt zu verschieben, wirklich gestaltet. 20