
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

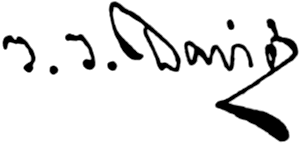
Aus dem Bilde, das der von Ernst Heilborn und Erich Schmidt besorgten Gesamtausgabe von J. J. Davids Werken (München und Leipzig, R. Piper & Co.) vorgeheftet ist, blickt uns der Kopf eines von Schmerzen und Leiden gerüttelten und gequälten, aber, wie wir deutlich fühlen, nicht bezwungnen Mannes entgegen. Die eingesunkenen Schläfen, der von Sorgenfalten umzogne Mund, die eingefallenen Wangen deuten auf körperliche Leiden und Entbehrungen, die schön gewölbte Stirn und der bewußte, klare, ernste Blick der großen Augen auf innerliche Überwindung irdischer Anfechtung. Und auf sie weist auch hin, was der Dichter selbst als sein Testament dem ältern der beiden Herausgeber zuruft; von seinem letzten Krankenbett schreibt er da: »Noch hatten die Ärzte Hoffnung oder taten so. Ein schlimmer Sommer zerstörte auch den Rest davon, und ich habe eben nur schwerer sterben müssen, wie mir das Leben nicht leicht geworden ist. Das muß man eben nehmen, wie es verhängt ist und kommt, und wenn ich die Gesamtheit überblicke, die ja eine ganz hübsche Spanne Zeit umfaßt, so darf ich mir das Zeugnis nicht versagen: wie es mich nicht weich gewiegt hat, so bin ich nicht weich geworden und habe die Dinge genommen und getragen, wie sie gefallen sind.« Und nachher mit tief ergreifenden Tönen aus dem Quellpunkt von Herzensempfindungen, die sich erst vor dem Tode nach außen ergießen: »Zu essen haben Weib und Kind zur Not; sie haben sich an meiner Seite bescheiden gelernt, aber sie sollen die Gewähr haben, daß der Mann, den sie dulden, immer von neuem seine Kraft aufraffen, den sie siechen und Schritt vor Schritt sterben sahn, kein 96 Phantast war, daß er mehr der Ungunst der Sterne als der Unkraft der Arme erlegen ist.« Die Freunde, die sich solchem Anruf nicht entziehn konnten, haben recht getan, daß sie uns so bald nach des Dichters Tode in einer schönen Ausgabe die Gesammelten Werke vorlegten. Es ist für ein noch nicht fünfzig Jahre währendes, kämpfevolles Leben eine sehr stattliche Ernte, sechs Bände Erzählungen, Gedichte und Dramen, ein Band Essays, denen noch die Arbeiten über Anzengruber und Mitterwurzer (aus den Sammlungen »Die Dichtung« und »Das Theater« bei Schuster & Löffler in Berlin) beizugesellen sind.
Jakob Julius David stammte aus Mähren, in Mährisch-Weißkirchen war er am 6. Februar 1859 geboren worden, hat aber seine Kindheit in dem Kuhländchen verlebt, unter Hanaken, in einer Landschaft, deren Erinnerungen von Hussitenschrecken durchklungen sind. Aus dürftigen Verhältnissen zu Hause in dürftige auf der Universität Wien hineingekommen, hat er trotz unermüdlichem Fleiß immer am Rande schwerer materieller Not, oft mitten in ihr, als Journalist und Schriftsteller gearbeitet, bis er am 20. November 1906 am Krebs gestorben ist. Dankbar hat er – davon redet vor allem seine Lyrik – alles empfunden, was ihm von den wenigen, seiner Begabung gewissen Freunden an Lebenserleichterung und aufmunterndem Zuspruch gespendet wurde. In knappen, klaren, feinen Versen spricht sich das aus. Und um so herber klingt die Klage, wenn doch wieder fast jeder Wunsch versagt wird, wenn ihm nicht einmal wird, der Mutter die Augen zudrücken zu dürfen.
Ich bin allein seit vielen Jahren
Und trag es klaglos, wie ich muß;
Nur hätt ich gerne doch erfahren,
Wie lind auf früh ergrauten Haaren
Liegt einer Mutter Abschiedskuß.
Das Kreuz an der Dorfgrenze mahnt ihn immer wieder und nicht vergebens, 97
Daß das Leiden dieses Lebens
Zweck und Maß und Richte sei.
Trübe Bilder, der Zug des Todes, die Erscheinung El Schadais, dessen Blick die ganze Welt zerrinnen läßt, gehn durch Davids gehaltne Verse, und mit letztem, lang nachhallendem Klang hat er etwa Theodor Körners Wesen und Erscheinung aufgefangen:
Ein Eichwald. Drüber Morgenrot;
Aus tiefem Grund ein Ruf der Hörner.
Ein Jünglingssein, ein Mannestod,
Umschreibs in einem Namen: Körner!
Und dabei immer wieder jene tiefe Dankbarkeit für jede gute Stunde, für jeden Lichtblick, den das Leben einem läßt, der es immer schwer nahm und dazu allen Grund hatte. Es sind hier und da Klänge, wie sie ältere Österreicher, vor allem der von David sehr geliebte und früh in seiner Bedeutung erkannte Ferdinand von Saar, auch besitzen.
Freilich an Ferdinands von Saar Erzählungskunst denkt man bei Jakob Julius Davids Prosawerken nicht, denn den lyrischen Hauch und Ton, den jede Saarsche Novelle hat, besitzt David dann keineswegs. Die Trübe und Schwere beider Männer ist die gleiche; aber dennoch erscheint David ganz anders als der ältere Landsmann: Saars Pessimismus, seine feine Resignation ist weit subjektiver als Davids Darstellung schmerzlicher und schwerer Dinge. Ja, vielleicht genügt es, zu sagen, daß Saar ein starkes musikalisches Element hat, während David unmusikalisch, sehr viel mehr plastisch ist.
Davids älteste und bekannteste Erzählung »Das Höferecht« (1890) führt gleich mitten in seine mährische Heimat hinein. Es lebt in ihr nur das von Gestalten und Wohnungen, was der Dichter für seinen Konflikt braucht: das Bauernhaus der Familie Lohner, in der als Stolz und Last der Erbrichter des Dorfes das Höferecht gilt, und dann die Hütte des Dorfjuden. Aus jenem gehn die 98 beiden Söhne, aus dieser die Tochter hervor, die die Handlung tragen und die sie dann weitertragen nach Wien und wieder ins Dorf zurück. Der Dichter ist hier bereits sehr sparsam mit seinen Mitteln, aber noch nicht spürsam genug für die Stimmungen und Wandlungen in den Seelen der Menschen, auch noch nicht ganz vollgesogen mit der Atmosphäre ihrer Umgebung. Es fehlt nicht an schroffen Übergängen, an Brüchen in der Charakteristik, aber es fehlt schon hier völlig jedes Schielen nach populären Stimmungen innerhalb und außerhalb der Kunst, es fehlt jede Art von Stimmungsmache, und es fehlt das sonst so charakteristische Anfängermerkmal überflüssiger Breite. Man fühlt: in dieser tüchtigen, aber noch nicht bedeutenden Heimaterzählung ist David der Stoff nicht zugeströmt, sondern langsam gequollen, und er verschmäht es, durch Putz und Zutat das Gewordne zu dehnen und zu zerren. Ein Mensch, der sich gibt, wie er ist.
Aber schon die kleineren Stücke, die dann die Sammlung »Die Wiedergeborenen« (1890) enthielt, zeigen David freier, zugleich feiner in der Charakteristik. Es sind alles historische Novellen, Dichtungen, die zumeist in der Vergangenheit Mährens spielen, und unter denen »Der neue Glaube« die beste ist, die Geschichte eines Ketzerrichters, der zum Ketzer wird, sich langsam, langsam von allem, was ihn umgibt, loslöst, alle zarten Beziehungen seines Lebens zerreißt und schließlich dem Hussitenheer zustößt. Dies selbe Thema wird dann in einer meisterhaften Erzählung der spätren Reihe »Frühschein« (1896) noch einmal abgewandelt, nun ganz reif, und fein ist es, wie da der Hexenrichter selbst in das Grauenhafte hineingerissen wird, allmählich Menschliches menschlich verstehn lernt und dem Frühschein eines neuen Tages nach dem großen Kriege entgegenflieht. David schildert überhaupt gern verstörte Zeit, wie sie eben nach dem dreißigjährigen Krieg über Deutschland lag, seltsame, aber doch nicht gesuchte Verhältnisse und Menschen mit einem leisen Hauch von Geheimnis wie die Gräfin Andriana Oudenwerde auf Schloß Ripan, über der es 99 schwebt wie halbverschuldete Schickung düsterer Kämpfe, die ein Herz wohl brechen können.
David gibt gern Menschen, die ein empfindliches Herz besitzen, das durch Ungerechtigkeit und Druck hineingehetzt wird in schwere Taten und Gedanken, wie denn in »Ruzena Capek« die Heldin schließlich in ihrer unerträglichen Not den Gatten erschlägt. In dieser Geschichte, wie gemeinhin in seinen späten Werken, hat er auch die Natur Mährens, wo seine Seele immer daheim blieb, in ihrer düstern Schwere am reinsten gestaltet. Wie ein fein gemalter, echter Hintergrund liegt sie in der »Mühle von Wranowitz« um die Liebe des Barons Friedrich Branicky zu der Müllerstochter Hanka Dworzak, ein Verhältnis, das gegeben ist ohne eine Spur von unechter Süßlichkeit und zugleich ohne die leiseste Spekulation auf unkünstlerische Triebe.
Und das ist ein Zeichen von Davids Kunst, daß er, wie schon im »Höferecht«, so auch in seinen spätern, reifern und wirkungsvollern Dichtungen nicht rechts und nicht links blickt und jedes billige Hindeuten auf effektvolle Situationen, jedes Spielen unterläßt. Wie nah hätte solche Gefahr in seinen Wiener Geschichten gelegen, und wie ist er ihr immer wieder aus dem Wege gegangen. Da ist eine kurze und in ihrer Schlichtheit ergreifende Erzählung: »Ein Poet?« Ein armer Journalist, der es zu nichts gebracht hat und nun seinem Leben ein Ende macht, um der Witwe, für die als Lebender zu sorgen ihm nicht gelingen will, durch den Tod eine Versorgung zu bieten. Und etwas Ähnliches in der Geschichte »Digitalis«, wo ein Arzt, der infolge eines Kunstfehlers seine Praxis nicht mehr ausüben darf, in stillem Heldentum langsam aus der Welt geht, um Frau und Kind die Möglichkeit einer Existenz zu sichern. Ganz apart und durch und durch echt ist die Charakteristik des berufsmäßigen Schachmeisters in der Skizze »Das königliche Spiel« oder in der »Troika« die des großen Schauspielers, dem sein Dreigespann von Wille, Temperament und Gedächtnis langsam versagt, und der dies allmähliche Nachlassen empfindet 100 wie den Strom, der zu Winters Ende leise gegen die Eisdecke klopft, bis der Läufer dann vor der Gewalt des hereinbrechenden, alles zerschellenden Flusses untergeht.
Jakob Julius David war durchaus der Meister der Erzählung in kleinerem Umfang. Seine zwei Dramen, die in den Gesammelten Werken enthalten sind, sind nichts als auseinandergezogene Erzählungen, denen das echte Gegeneinanderspielen dramatischer Gestalten abgeht. Ihnen fehlt der langsam getönte Hintergrund der Novelle, der sich nicht aktweise verschiebt, sondern in regelmäßiger Entwicklung aufgebaut wird. Und die Leidenschaften springen nicht gegeneinander an, sondern erwachen langsam, entfalten sich in feinen, kleinen Zügen hier und da, und ihre Darstellung läßt im Schauspiel, wo Personen und ihre Worte in freier Luft stehn, immer wieder die Anlehnung und Einbettung an das von der Erzählung zu gebende Milieu vermissen.
Ja, David war so ausschließlich der Mann der kurzen Erzählung, daß auch im Roman das Letzte fehlt, was diese vielen Novellen und Geschichten uns geben. Dem »Höferecht«, das 1890 erschienen war, folgte ein Jahr später »Das Blut«. Wieder ein Werk vom Lande, die Geschichte eines Brauhauses, dessen ehrbare, puritanische, kinderlose Bewohner das uneheliche Kind der fortgelaufenen Schwester der Hausfrau aufnehmen. Das Blut aber schlägt in ihm durch, und das Mädchen verläuft sich zu einer Kunstreitergesellschaft wie einst die Mutter. Es ist, als ob David, wenn er einen zu breit gewordnen Stoff meistern will, sich zu viel tut und gerade deshalb das Letzte an seinen Personen nicht herausbringen kann; denn das junge Mädchen dieses Romans erwärmt uns kaum je, erscheint, besonders kurz vor seinem gewaltsamen Ende, so uninteressant und durchschnittsmäßig, daß wir uns zu ihm kein Herz fassen können und deshalb den Roman aus der Hand legen, ohne tiefer erschüttert zu sein. »Am Wege sterben«, 1899 erschienen, ist dann ein Wiener Roman, in den die österreichische Landschaft nur ein paar Abgesandte hineinschickt. Wir sehn das Werden, 101 Empor- und Hinabsteigen einer Reihe junger Kommilitonen der Universität, aber wieder niemanden darunter, dem wir mit dem letzten Anteil folgen, den etwa der Dichter im »Frühschein« zu erzwingen weiß, und nur der feine Ton gehaltner Resignation am Schluß, die Stimmung eines Einsamen mitten im Arbeitervorort der Weltstadt gibt eine wärmere Note.
Als Darstellung des Lebens sehr viel bedeutender ist Davids letzter Roman »Der Übergang«, drei Jahre vor seinem Tode herausgekommen. Was auch Ferdinand von Saar so zu schildern liebte: die Entwicklung eines Wiener Stadtteils aus der alten in die neue Zeit hinüber, das gibt David hier, indem er das Geschick der Adam-Mayer-Gasse verflicht mit dem Niedergang der Familie, der sie ihren Namen dankt. Und wie dieser Name vom Straßenschild gelöscht und ein andrer hingesetzt wird, so gehn Vater, Sohn und eine Tochter der Mayerschen Familie zugrunde in Schuld und Haltlosigkeit, um einem neuen, anders benannten Geschlechte Platz zu machen. Es besteht aber freilich nur diese äußere Parallele mit Saars Werk, denn wir leben sonst hier ganz und gar in einer Welt, verwandt der harten Wirklichkeit von Ludwig Anzengrubers »Viertem Gebot«, wie denn Ludwig Anzengruber wohl Davids Herzensdichter gewesen ist. Der Roman ist ohne Zweifel Davids bester, aber er erreicht in der furchtbaren Härte seiner durchaus wahrhaftigen Zeichnung noch nicht die Feinheit und Treue von Davids Erzählungen. Der Dichter ist zu starr in seinem Willen, mit starken sittlichen Akzenten die Fäulnis dieses Hauses bis zum Letzten darzustellen, und selbst die Größe der endlich heraufgezogenen Auseinandersetzung zwischen Mann und Frau an der Leiche des erstochenen Sohnes trägt über die allzu schroffe Starrheit des Ganzen nicht hinweg. »Eine Sehnsucht nach Wahrheit war in ihm«, diese Worte, die David über Zola schrieb, passen ganz auf ihn selbst. Aber dieser Drang war in Schöpfungen wie »Der Übergang« zu sehr gesteigert, ohne von jenem Hauch der Romantik umflossen zu sein, den David Zola als tief empfundnen 102 Schmerz seiner ganzen Persönlichkeit wohl mit Recht nachsagt, der aber auch oft gerade Zolas Romane erst in die Sphäre der Kunst erhob.
Aber freilich hatte diese Härte in David auch ihre eigne Bedeutung, und da, wo sie sich in kleineren Rahmen zu meisterhaften Schöpfungen seiner erzählenden Kunst erhebt, sichert gerade sie dem immer von Schmerzen Überschatteten seine Stellung. Denn David steht als ein Fremder unter dem wenig jüngern Wiener Geschlecht, das sich artistisch gebärdet, das zum großen Schmerz vieler Österreicher, etwa Alfreds von Berger, mehr als irgendein früheres Wien in den Ruf der Phäakenstadt gebracht hat. David, dessen Bild nicht einen jüdischen Zug aufweist, steht weltenfern sowohl jenen weichen Dramatikern und Erzählern von der Art Arthur Schnitzlers, wie den nervösen Neuromantikern vom Schlage Felix Dörmanns, wie der dem Leben abgewandten Kunst Hugos von Hofmannsthal. Und da wird man denn die Namen Ferdinand von Saar und Ludwig Anzengruber wieder aussprechen müssen, wird Marie von Ebner-Eschenbach und Ferdinand Kürnberger nennen können, alle jene ernsten und schließlich allein fruchtbaren deutsch-österreichischen Geister, die uns heute doppelt wertvoll erscheinen, da dies so oft für verfallen gehaltne Reich in neuen Kämpfen unerschöpfte Kräfte zeigt.
Wie fein und sicher Jakob Julius David diese zu deuten wußte, lehren seine Essays, eine der schönsten Sammlungen dieser Art aus den letzten Jahrzehnten. Es ist wohl niemals etwas Feineres und Besseres über Karl Lueger geschrieben worden, als der Aufsatz »Der Bürgermeister«. Es ist geradezu vorbildlich und für den Leser ein künstlerischer Genuß, wie hier langsam das Bild dieses Volksführers aufgebaut wird, wie ruhig zugegeben wird, daß er manchem als ein Erzbanause erscheinen mag, und wie dann doch das Urteil fällt und wohl begründet wird: »Ein ganzer und genialer Kerl«. Auch in diesen Arbeiten, in denen er insbesondere den Künstlern seiner Heimat, auch ihren Schauspielern, 103 unverschönerte Denkmäler setzt, erweist sich Jakob Julius David als der am Echten sich emporarbeitende, dabei durchaus selbständige Kopf, als der Künstler mit reichen Gaben und einer spröden Natur, die über den Alltag hinausdenkt, die, unter Schatten einhergehend, kaum jemals schwärmt und darum auch kaum jemals getäuscht wird. Ein männlicher Schriftsteller, ein Erzähler voll kräftiger, gern der Vergangenheit und seiner Heimat zugewandter Phantasie, ein unablässig an sich arbeitender, sich langsam, aber sicher entwickelnder Dichter – so steht er vor uns da.
Die Halluzinationen, die ihn auf dem Krankenbette umfingen, hat er mit der Ruhe eines Menschen geschildert, der sich zu beobachten weiß, ohne in sich verliebt zu sein. Und wer wollte, wenn er Davids prunkloses, aber dauerhaftes Werk durchschritten hat, ohne Wehmut diese letzten Bekenntnisse aus der Hand legen, in denen es heißt: »Was ich in gekrampften Händen, wie sie ein Ertrinkender ballt, aus jenen Tiefen emporgebracht, das habe ich hier mitgeteilt, das entfällt mir, nun sich der Krampf zu lösen beginnt. Mag sein, daß es Tang ist, wie ihn jede Welle an das Ufer wirft, sonder allen Wert, den man so wenig als den Salzschaum am Dünensand auch nur eines Blickes für wert hält. Es ist aber immerhin doch auch möglich, daß sich unter so geringem Angeschwemmten auch eine Muschel berge, wert des Augenmerks dessen, der sich, aus welchen Gründen immer, aus Sammellust oder müßiger Neugierde, um derlei Gut der See zu kümmern gewöhnt ist. Wie immer dem sei, ich mußte mich dieses unwillig genug Mitgebrachten entledigen, will ich meine Hände annoch zu den Werken nutzen, die meiner etwa noch harren mögen, und die nicht gar zu umfänglich, noch allzu schwierig sein dürfen, sollen sie in dem Endchen Tages vollendet sein, das mir neuerdings vergönnt oder verhängt scheint.« Das ist die Sprache eines durch und durch vornehmen Menschen, und es sind Abschiedsworte eines aufrechten und in seinem Wesen und Schaffen ganz echten Dichters, den wir nicht vergessen wollen. 104