
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
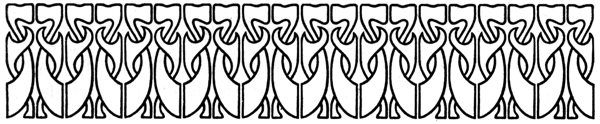
 Tag für Tag trabte nun der Schimmel nach Gersdorf, und sein Herr bildete auf Wochen das Tagesgespräch der Gersdorfer »Kreise«.
Tag für Tag trabte nun der Schimmel nach Gersdorf, und sein Herr bildete auf Wochen das Tagesgespräch der Gersdorfer »Kreise«.
Es wurde Lohmann nicht schwer, alle für sich einzunehmen, an denen ihm etwas lag, und die er für geeignet hielt, in seinem Sinne auf das Volk einzuwirken.
Nur bei seinen medizinischen Kollegen begegnete er süßsauren Gesichtern. Doch verschwand der saure Zusatz bald, als er offen erklärte, er denke nicht mehr ans Praktizieren. Wenn man allerdings hie und da einmal in Laubnitz in besonderer Not nach ihm verlangen solle, werde er sich selbstredend nicht versagen und »gratis und franko« helfen.
Das erregte bei den noch sehr erwerbsfrohen Kollegen nur ein verlegen-ironisches Lächeln, aber keine Besorgnis; denn sie hatten den Laubnitzer Boden auch in dieser Beziehung als ziemlich steril erkannt.
»Da traut sich nicht mal 'ne anständige Epidemie hin!« witzelte der »Kassenarzt«. »Und wenn die Brüder mal im Busche 'ne Pfote oder so was brechen, gehen sie doch zum Riembacher Weibe. A propos, Herr Kollege, ad vocem ›Riembacher Renkfrau‹! Wie ich höre, liegen Sie bereits im sozialen Schlepptau unseres Allgewaltigen Lanz! Das wäre nu so was! Könnten Sie uns nicht mal das Weib ans Messer liefern? Jetzt ging's am Ende noch, so lange Sie leidlich unbekannt in der Gegend sind. Für uns ist's fast unmöglich. Selber hingehn kann man nicht, und verraten wird die hier von keinem, und wenn sie den Leuten auch Arme und Beine vom Leibe doktert.«
Lohmann überlegte.
Die Spitzen gegen Lanz hatten ihn geärgert, desgleichen die Art, wie er selbst und seine Absichten von dem erheblich jüngeren Manne eingeschätzt wurden. Andrerseits erinnerte er sich daran, daß auch die Direktorin Ähnliches gewünscht hatte. Und weil er sich fest vorgenommen hatte, auf dem nun einmal eingeschlagenen Wege sich nicht durch jeden Tümpel und Prellstein aufhalten zu lassen, so schritt er auch lächelnd über diese erste, grünlich schillernde Lache hinweg und versprach, die erste Gelegenheit zum Einschreiten gegen die »Riembacherin« benutzen zu wollen. – –
Zu Hause aber betrieb er mit Eifer das Studium solcher Bücher, die ihm vom Sekretär einer Gesellschaft für Volksbildung als treffliche Volksschriften bezeichnet worden waren. Für ihre Anschaffung sorgte er zumteil selbst. Aber auch der Kommerzienrat stellte ihm zu diesem Zwecke einen »unbegrenzten Kredit« zur Verfügung, als er ihm bei seinem zweiten Besuche seine Pläne entwickelte.
Klaar wurde ihm auch bei den sichtenden Vorarbeiten der beste Ratgeber und die beiden Männer erlebten gemeinsam eine köstliche Überraschung, als sie in der neueren und neusten volkstümlichen Literatur soviel Kerngesundes und Bodenständiges entdeckten.
»Wieviel ist da, trotz allen Geschreis über die Schamlosigkeit der heutigen Literatur, gesünder und besser geworden, seit wir jung waren und Zeit zum Schmökern fanden!« rief eines Tages Klaar erstaunt nach der Lektüre eines Bandes von Roseggers »Dorfsünden.« »Welcher Abstand zwischen diesem Schrift- und dem Geschäftsgeiste unseres Volkes!«
»Freuen wir uns dessen, Herr Kommerzienrat!« sagte Lohmann. »Es liegt in unserm guten Schrifttum, finde ich, eine höchst gesunde Reaktion gegen das moderne Schein- und Erwerbsfieber. Und es ist ja auch erklärlich! Die Großstädter fliehen aus ihren Steingräbern auf jede nur mögliche Weise. Wenn's nicht tatsächlich geschehen kann, laben sie sich wenigstens am Erdgeruch, der einem gesunden Buche dieser Art entströmt, die man die ›heimatkünstlerische‹ nennt.«
»Natürlich!« entrüstete sich der Kommerzienrat, »eine Etikette muß auch der schönsten und zartesten Sache gleich um den Hals gehängt werden!« –
So schlang sich um die beiden Männer bald das feste Band gleicher Interessen, und im gemeinsamen Betrachten der reichen Kunstschätze, die jeder in seinen Mappen hegte, verlebten sie manche wunschlose Weihestunde.
Und weil sie sich bewußt waren, daß das Schöne gewiß und wahrhaftig auch veredelnd wirkt, wenn's überhaupt erst Herrschaft im Menschen gewinnt, sannen sie hin und her, wie für die Menge auch ›zu dieser Stadt der goldnen Gassen‹ der Pfad zu bahnen sei.
Und siehe da: als sie sich verlangend umblickten, fanden sie auch hierin ein nutzbares und verdienstliches Ins-Breitegehen der Kunst. Wertvolle Reproduktionen alter Meistergemälde, aber auch neuartige, bunte, lebensfrische Steinzeichnungen lebender Meister, packende Holzschnitte und Radierungen wurden ihnen in Fülle angeboten, das meiste für wenige Mark, vieles sogar für Pfennige käuflich. Der Arbeitssaal Klaars verwandelte sich zeitweilig, wenn die Sendungen der Kunsthändler ankamen, zum Museum, und in einem wahren Freudenrausche kaufte der Kommerzienrat hunderte solcher Blätter.
Heimlich und unauffällig streuten dann der Sanitätsrat und seine Helfer diesen unverwüstlichen Schönheitssamen über Laubnitz und Gersdorf aus. –
Und er hatte es wohl nötig, unverwüstlich zu sein; denn er fiel auf unkrautüberwuchertes Erdreich.
In zu vielen Arbeiterwohnungen protzten bereits im »echt imitierten Gold-Barock-Rahmen« die Scheusäligkeiten, die der kleine Wendehals-Kolporteur zugleich mit seinen Romanen als »Prämie« an den Mann gebracht hatte.
Wie häufig erlebten in der Folgezeit Lohmann, Marianne und Elisabeth ein Apostelschicksal, wenn sie kamen und den Leuten das Echte für den Abklatsch, das warme Leben für verblaßte und entstellte Puppen boten. Ein wahrer Schreck erfaßte nicht nur die »Ungebildeten«, wenn sie auf dem Papier Farben sahen, die ihnen die Natur, freilich nur in ihren Feiertagslaunen, hundertmal vor Augen gezaubert hatte, und ein naiv geschautes Stück Naturleben, ein lebenswahr hingemaltes Stückchen Wiese, Feld oder Wald sich an die Wand hängen zu sollen, kam den Arbeitern oft wie eine verächtliche Zumutung vor.
»A, su woas, doas kinn mer ju olle Tage sahn!« hörte sich Lohmann oftmals entgegnen. »Do braucht ma ju bloßig die Noase zum Fauster naus recka!«
Lohmann wußte in solchen Fällen häufig nicht, ob er sich über die in unserm Volke so tief hinuntergehende Verbildung ärgern, oder sich nicht lieber in die Seele des Künstlers hinein freuen solle; denn dem konnte ja eigentlich kein besseres Lob gespendet werden, als diese unwilligen Ablehnungen seiner Schöpfung.
Von immer neuen Bemühungen, geschmackbildend zu wirken, hielten ihn solche Zwischenfälle ebenso wenig ab, wie vom Ausstreuen einer Fülle guter Bücher über das ganze Tal. Er tat das so vorsichtig, als treibe er Ähnliches wie jener Botaniker, von dem er einmal gelesen hatte: Stechapfel-, Bilsenkraut-, Schierling- und Nachtschattensamen trug der Brave in holder Mischung stets in seinen Taschen herum, um sie auf allen Spaziergängen heimlich an Wegen und Rändern auszustreuen, damit es im kommenden Jahre nicht an Anschauungsmaterial fehle zur Betrachtung »dieser gefährlichen Feinde der Menschheit.«
»Möchte doch unsere Saat auch so üppig aufgehen wie all das Gift umher, um wenigstens einige von den Stechäpfeln und Nachtschatten zu ersticken, die so üppig in den Gemütern wuchern, auch hier in den Weltwinkeln!« seufzte Lohmann während einer der »Lesestunden«, die seit einigen Wochen regelmäßig in der Villa abgehalten wurden.
Ihre Einrichtung hatte sich ungezwungen ergeben, nachdem Lohmann Marianne und die Direktorin in eine tätige Mithilfe an seinen Bestrebungen verstrickt hatte. Schneller nämlich, als er's zu hoffen gewagt hätte, sah er seinen Wunsch erfüllt, »daß Marianne sein Wirken mit ihren warmherzigen Augen bestrahlen möge.« Als sie merkte, wieviel Lanz und seiner Frau daran lag, Lohmanns jungen Enthusiasmus zu erhalten, beteiligte sie sich mit Feuereifer an der Prüfung der neuerworbenen Volksschriften und deren Einschmuggelung in die Weberhäuser. Und als Frau Elisabeth von ihrer Reise zurückkehrte (einige Wochen später, als man's geplant hatte), fand sie ihre Tochter und den Mann, der einst den Inhalt ihres eigenen Jugendlebens gebildet hatte, in einem so regen geistigen Austausche, daß das etwas Beängstigendes für sie hatte.
Weil aber die gute Schwägerin Malwine mit leuchtenden Augen dabei saß, wenn sich die beiden die Köpfe rot disputierten über den Wert oder Unwert eines Bildes oder Buches für die Geschmacks- und Charakterbildung der Massen, zwang sie sich selbst immer wieder zum Beruhigtsein.
»Malwine ist klug und gut,« dachte sie bei sich, »und würde eine wirkliche Gefahr für Mariannen bald erkennen und beseitigen. Ich aber bin nicht unparteiisch und sehe wohl zu schwarz.«
Was sie aber unter »Gefahr« verstand, das dachte sie nicht einmal vor sich selbst zu Ende. –
So stimmte sie denn auch fast erfreut zu, als die Direktorin vorschlug, man solle sich doch alle Wochen einmal zu Lesestunden bald in der »Villa«, bald im Waisenhause zusammenfinden, um so gleich gemeinsam das »Material« prüfen zu können. Wenn sie der Sanitätsrat mit dem Schimmel holen und wieder heimbringen lasse, werde sie selbst so oft als möglich teilnehmen.
»Nicht holen lassen, verehrteste Frau Direktorin«, rief Lohmann, über diesen Plan in einer Weise jugendlich erfreut, die ihm selber rätselhaft erschien, »selber holen! Es soll mir eine besondere Freude sein, das stets selbst zu besorgen!«
So geschah's denn auch, und auf diesen Fahrten strickte die klugherzige alte Frau emsig weiter an dem Netze, mit dem sie ihn umgarnt zu haben meinte zu Nutz und Frommen fürs allgemeine Wohl.
»Er soll uns nun nicht mehr entschlüpfen!« dachte sie schelmisch bei sich und ahnte nicht, daß auch sie nur ein Schifflein war, mit dem die höhere, dunkel wirkende Macht, von ihr ungesehen, dem Leben Lohmanns ein so wunderlich buntes Salende anwob! –
* * *
Auf einer dieser Fahrten – es war ein lauer Frühlingsabend im März, wo die Menschenherzen aufbrechen wie die Knospen am Gestäude – brachte Frau Malwine die Rede auf Reginen.
»Absichtlich habe ich bisher noch nicht mit Ihnen von der Beklagenswerten gesprochen, lieber Freund«, sagte sie weich und legte ihre Hand leise auf den Arm, mit dem er die Zügel hielt. »Ich hoffte immer, Sie sollten selbst einmal von ihr beginnen.«
Lohmann biß sich schweigend auf die Lippen.
Reginas Bild war ihm in diesen letzten Wochen immer mehr verblaßt im Eifer der jungen Volksbeglücker-Tätigkeit. Das dies geschehen konnte, stand jetzt wie ein Vorwurf vor ihm.
Die Direktorin ahnte wohl etwas Ähnliches; denn sie fuhr fort: »Wir sahen stillvergnügt zu, wie Sie in Ihrem gemeinnützigen Wirken auflebten. Ich denke mir auch, daß Sie ein gut Teil Ihrer früheren Frische schon wieder gewonnen haben. Ja, ja: ›Arbeiten und nicht verzagen‹! da ist schon viel Wahres dran. Darin liegen Klammern für alles, was aus den Fugen gehen will. Arbeit und Vertrauen auch für andere! So verstehe ich's. Soll's Ihr eigen Kind vergeblich von Ihnen erhoffen, lieber Freund?«
Er merkte wohl die Absichtlichkeit, mit der sie ihn in kurzem Zwischenraume zweimal so nannte. Und das tat ihm so wohl, als trage ihm ein linder Hauch aus weiten Fernen ein leises Kosewort der Mutter zu. Es wurde ihm weich ums Herz im Strahl dieser reinen Güte und im Wehen des Frühlingsodems, der in den Bergwäldern ringsum die letzten Winterfesseln kosend löste.
»Ich habe gearbeitet an ihr!« versuchte er eine schwache Gegenwehr.
»Auch genug? Und unverdrossen?«
»Sie schnitt mir's selber ab!«
»Jetzt wäre Gelegenheit, die Fäden wieder anzuspinnen und zwar so dauerhaft, daß sie nichts mehr durchreißen könnte.«
Er schüttelte stumm ablehnend den Kopf.
»Warum nicht?« fragte sie weich, als gelte es, ein trotziges Kind durch unentrinnbare Güte zu leiten.
»Weil ich ihr auch vertraut habe, felsenfest, und sie hat mein Vertrauen getäuscht, schmählich, schändlich – unverzeihlich!« antwortete er erbittert.
»Lieber Freund!« sagte da die Alte mit festem Tone, durch den aber eine tiefe, tiefe Traurigkeit ging. »Dies Wort sollten wir ganz aus unserm Lexikon streichen! Woher sollen wir armen Schächer den Mut nehmen, etwas ›unverzeihlich‹ zu finden? Richtet nicht, auf daß Ihr nicht gerichtet werdet!«
Der Bibelspruch verdroß ihn.
»Ach nein, liebste Frau Direktor,« rief er nervös, »lassen wir die biblischen Sentenzen lieber mal beiseite! Sie haben für mich etwas Befremdendes!«
»Gut!« antwortete sie mild. »Lassen wir sie! Fassen wir's rein menschlich! Was ist uns ›unverzeihlich‹? In erster Linie das Unbegreifliche. Und warum bleibt uns so vieles unbegreiflich? Selbst an unsern nächsten Angehörigen? Wir stecken zu fest und zu phantasielos, zu arm an Gefühls-Tastsinn und Herzensregsamkeit in unserer eigenen, dicken, selbstgerechten Haut. Oder wir sind zu arm an beschämenden Erfahrungen über uns selbst. Wir wanderten auf zu glatter Straße oder zu blind gegen uns selbst auf holpriger, und wenn wir auf ihr strauchelten, so gestanden wir's uns nicht ein, daß wir über unsere eigenen Beine fielen, sondern schoben's auf fremde Heimtücke. Wissen Sie was? Ich wünschte jedem, der sich aufs hohe Pferd der ›Unverzeihlichkeit‹ setzt, schleunigst einen jähen Sturz in den ›Sumpf‹, in dem nach seiner Meinung der andere bis um den Hals drin sitzt. Sicher hülfen sie sich dann öfter gegenseitig heraus.«
Sie hatte sich die Wangen rot geredet in einem Eifer, den er nur schön finden konnte.
»Sie vergessen, liebe Freundin,« entgegnete er befangen, »daß es auch Gegensätze des Charakters und der Anlage gibt, die das Verzeihen erschweren, neue Verbindung aber schier unmöglich machen. Daß Regina diesen Gewaltmenschen liebte, kann ich schließlich noch verstehen. Aber daß ihre Leidenschaft so blind über uns alle hinwegrasen konnte, ganz ohne Besinnen, wer unter den Rädern liegen bleibe, und daß sie sich mit solcher Feigheit wegstahl –«
»Das eben ist schief!« fiel hastig die Direktorin ein. »Sie stahl sich nicht feig hinweg; sie wurde von einem Wirbelsturm weggerissen. Und der hat sie nun zu Boden geschmettert. Die Ärmste! Sie lebte in dem Wahne, er werde sie immer durch den blauen Äther dahintragen. Ist das nicht eine Sache, mehr zum Beweinen als zum Verdammen? Müßten wir da nicht unten stehen und die Arme weit ausbreiten, um sie im Sturze aufzuhalten und nicht zerschmettern zu lassen?«
Da dachte er an das diebische Waisenmädchen, das diese Frau »zu sich in die Küche« genommen hatte, trotzdem ihr »eigentlich vor jeder Gemeinheit gruselte«, und er sagte: » Sie bekämen das wohl fertig, liebe Freundin! Aber ich kann's nicht! Noch nicht! Vielleicht – wenn die Jahre alles weiter von uns fortgerückt haben – wenn man nicht mehr all die Kanten sieht, die da so schmerzhaft gestoßen haben, und wenn die Grasnarbe über dem Grabe draußen dicker geworden ist! Regina müßte sich ja auch jetzt am frischen Gestein die Stirn zerschlagen!« setzte er leiser hinzu.
»›Wundschlagen?‹ sagen Sie lieber. Und das, gerade das sollten Sie ihr gönnen. Sie wird nach nichts mehr verlangen, als darnach.«
»Ich zweifle, daß Sie hier das Richtige fühlen!« sagte Lohmann bedrückt und sah im Geiste die stolze Gestalt, als die er seine Tochter kannte, in das überbescheidene Laubnitzer Haus einziehen und mit gekräuselter Lippe seine junge Tätigkeit unter den Webern und Holzschlägern ironisch belächeln und auf seine neuen Freunde mit den kalten Augen des Unverständnisses herabblicken, die schon oft ihre Mutter so schmerzlich erregt hatten, und er hörte vor allem, wie sie Mariannen als »gutgeartete Minderwertigkeit« einschätzen werde. Die aber würde sich in stummer Scheu von der Besudelten fern halten und schließlich auch von ihm. Und gerade dies letzte Gesicht hatte etwas entschieden Qualvolles für ihn, so daß er gepreßt hervorstieß: »Nein, ich kann nicht, kann noch nicht!«
»So gönnen Sie sich Zeit, lieber Freund!« entgegnete die Direktorin mild. »Die wundertätige Luft um uns her sprengt ja jetzt auch die Knospen an allen Zweigen, und doch werden wir erst nach Monaten Blätter und Blüten sehen.«
Und in stummem Sinnen fuhren sie weiter durch die laue Nacht.
