
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
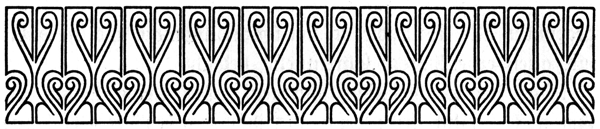
 Es war am Morgen nach dem großen Feste. Die Sanitätsrätin saß in später Morgenstunde am Frühstückstisch, gar nicht die blühende Frau, als die sie die Gesellschaft kannte, sondern ein Häuflein rührenden Migräne-Unglücks.
Es war am Morgen nach dem großen Feste. Die Sanitätsrätin saß in später Morgenstunde am Frühstückstisch, gar nicht die blühende Frau, als die sie die Gesellschaft kannte, sondern ein Häuflein rührenden Migräne-Unglücks.
Regina bediente sie und antwortete dabei mühselig auf all die befriedigten Erinnerungen, mit denen die leidende Mutter den vergangenen Abend testierte und dieses Fest in die lange Reihe der andern ihres dreißigjährigen Gesellschaftslebens einrangierte.
»Es ist ja, Gott sei Dank, auch darin immer aufwärts gegangen!« stellte sie seufzend, aber mit Genugtuung fest.
»Ja, sag' mal, Mama,« fuhr Regina wie erschreckt empor, »ist denn darauf so viel Wert zu legen?«
Die Mutter sah verwundert auf.
»Wie meinst Du denn das?« fragte sie angestrengt.
»Nun, sind's denn die Menschen, die sich da so in Haufen einfinden, wert, daß man sich so um sie müht?«
»Ich verstehe Dich nicht recht, Regina. Ihr gebt doch auch Gesellschaften, Du und Adalbert.«
»Na freilich! Man muß ja! Aber hat's denn Wert, all das Beisammenhocken und Sich-Belauern?«
Die Mutter sah mit plötzlicher Besorgnis zur Tochter hin, gespannt, trotzdem ihr das arge physische Schmerzen verursachte.
»So pflegen die zu sprechen, die in Gefahr sind, daß ihnen die Gesellschaft den Rücken kehrt.«
»Muß es denn immer die Gesellschaft sein, die den Rücken kehrt?« fuhr da die Tochter jäh auf, und über ihren gefalteten Brauen saß der düstre Zorn. »Kann nicht auch mal ihr der Rücken gekehrt werden?«
»Ja, ich weiß nicht, Regina –«
Miene und Stimme der Mutter waren ängstlich wie bei einem Kinde.
»Hoffentlich sind das nur theoretische Erörterungen,« sagte sie weinerlich und sank ganz in sich zusammen. Nach einiger Zeit aber sah sie wieder forschend-argwöhnisch zur Tochter hinüber, die eine Stickerei zur Hand genommen hatte.
»Ich weiß nicht,« stöhnte sie, »man kennt sich bei Dir gar nicht aus, Regina. Das war leider immer so! Du bist dem Vater sonst in allem so ähnlich, sogar die Nase hast Du nach ihm, aber im Gemüt – da fehlt Dir ganz seine glückliche Heiterkeit.«
Sie hielt erschöpft inne, aber als die Tochter aufreizend still blieb, fuhr sie lamentabel fort: »Mit Deiner Ehe ist's auch so! Man wird nicht klug aus Euch! Es ist eben schlimm, daß Ihr keine Kinder habt.«
»Nein, Mama, sage das nicht!«
Regina hatte sich mit einem Ruck von ihrer Arbeit emporgerichtet und saß nun in trotziger Abwehr hintenübergebeugt da.
»Wenn ich Gott für etwas dankbar bin, dann für das!«
Die Mutter schüttelte den Kopf in Verdruß und Schmerz.
»Adalbert, glaube ich, wünscht sie sich sehr.«
»Möglich.«
Das klang eisig.
»Ja, mein Gott, warum hast Du ihn denn aber geheiratet?« rief da die Mutter in hellem Entsetzen. »Es hat Dich doch niemand dazu gezwungen. Du kannst doch nicht mal sagen, daß wir Dich dazu gedrängt hätten.«
»Nein, Mama, das kann ich nicht sagen!«
Der Mutter schnitten Wort und Ton der Tochter wie Messer in Ohr und Schläfe.
»Tu mir den einen Gefallen, Regina,« bat sie, »und sage das dem Vater nicht. Du ahnst nicht, wie Du ihn betrüben würdest. Ja, wenn Adalbert nicht obendrein Scheurigs Sohn wäre! Scheurigs große und angesehene Familie ist doch auch Vaters treuster und dankbarster Patientenkreis.«
»Was hat das mit meiner Ehe zu tun?« fragte Regina hastig und wegwerfend.
»Sage das nicht so! Wir sind in diesen Kreis eingewurzelt, mein Kind. Und gestern hat Scheurig erst den schönen Toast ausgebracht! Mein Gott, ich wüßte gar nicht, wie ich ohne diese guten Menschen auskommen sollte, und neue Freunde suchen, dazu sind wir doch nun schon zu alt. Und ich, Regina, ich bin viel zu schwach und hinfällig dazu.«
In Regina stieg ein heißes Bedauern auf.
»Die Ärmste!« dachte sie und zwang sich zur blinden Abkehr von dem drohenden Abgrunde, dem sie alle, alle hier zutreiben sah.
»Sag nur dem Vater nichts!« kam die angstgequälte Frau wieder auf ihre Hauptfrage zurück. »Er braucht seinen Frohsinn so nötig. Und wenn er nun Scheurigs und den andern mit den Gedanken entgegentreten sollte, daß Ihr unglücklich lebt! Und wenn's die andern erführen, welch ärgerliches Gerede! Und wer weiß, was dann noch Schrecklicheres kommt!«
Regina klammerte sich an die Platte des Büffets. Ihre Lippen waren zu zwei scharfen, roten Strichen zusammengepreßt; ihre drohenden Brauen stießen über der charaktervollen Lohmann-Nase zusammen, und in ihren fast männlich-stattlichen Körper kam ein Dehnen und Straffen, als wolle sie sich auch physisch dem weichen Grunde des Mitleids entwinden, in den sie sich tiefer und tiefer hineingezogen fühlte.
Es war wohl schwer, übermenschlich schwer, der gütigen, schwachen, gebrochenen Frau gegenüber, die ihre Mutter war, »das starke Recht des auflebenden Ichs zu behaupten!« Wer weiß – vielleicht hielt die da den Zusammenprall mit diesem ersten »Nein,« den das Leben ihrem selbstverständlichen Egoismus entgegensetzte, gar nicht aus! Es gibt ja Gläser, die die erste Dissonanz zersprengt, und das sind nicht einmal die kostbarsten.
Was konnte geschehen?
Regina durchschauerte es.
In jedem Falle wohl ein Entsetzliches.
Denn wenn sie schwieg, begann das Lavieren zwischen den tückischen Schären der Lüge. Sie aber hatte vor, hindurchzusteuern mit kühner Stirn durch all den Wattenschlick aufs hohe Meer, und wenn's auch nur sei, um draußen zu versinken. Die aber am Gestade ihr nachblickten, sollten nur Zorniges ihr nachrufen, nichts Verächtliches. Und auch eine schiffbrüchige Heimkehr zu diesem Gestade würde sie nie versuchen. Das stand bei ihr fest.
»Nur hinaus können, nur hinaus!« schrie es laut in ihr auf, und die Mutter, die gerade jetzt einen zagen Blick zu der Stummen und Starren herüberwarf, sah, wie sich die Sturmwand türmte, aus der die Unwetter hervorbrechen mußten über das schöngepflegte Blumenbeet ihres farbenschmucken Gartenlebens.
Sie hatte fast jeden ihrer Freunde und Bekannten einmal im Leben über stürmische Blachfelder stemmen sehen. Mit mehr Interesse als wahrhafter Teilnahme hatte sie zugeschaut und doch auch mit ihrem Bedauern nicht gekargt.
Und nun sollte sie selbst hinaus in die zausende Nacht! Denn nicht weniger als das bedeutete ihr »gesellschaftlich Schiffbruch leiden.«
Das Grausen des Kraftlosen und Ungeschulten befiel sie; sie schlich mit leisem Weinen hinaus.
Regina, der dies Weinen wie das Winseln eines verschütteten Kindes geklungen hatte, stand wie mit Erz umpanzert da. Und in dieser seelischen Lähmung blieb sie auch, als draußen hastiges Laufen anhob und erstickte krampfhafte Aufschreie durch Türen und Portieren wie auf geisterhaften Nachtfalterflügeln zu ihr hereinschwirrten. Sie wußte, was diese Töne bedeuteten, und das Mitleid zerrte mit hundert Händen an ihr. Aber die Füße versagten ihr den Dienst, und in ihrem Hirn stieg und fiel rastlos wie die Kugel im Fontänenstrahl der eine Gedanke: »Es muß sein! Es muß sein!« Dann hörte sie den eiligen Schritt des Vaters auf dem Flur, und als es drüben ganz still geworden war, verwandelte sich ihr ganzes Wesen in die Spannung, wann er nun hier eintreten werde, und was dann geschehen solle. Denn daß er bald kommen werde, das wußte sie. – – – –
Und plötzlich stand er vor ihr.
Sie sah erst scheu zu ihm hinüber, zwang sich aber bald zu einem festen Blicke auf das »schöne« Männergesicht, in dem jetzt Zorn, Unverständnis, Trauer und Besorgnis in irrer Folge aufleuchteten.
»Regina,« sagte er endlich, nach Festigkeit ringend, »willst Du mir nichts sagen?«
»Ja, Papa!« entgegnete sie schnell, und aufatmend löste sie sich von dem Büffet los, dessen Platte sie noch immer umklammert gehalten hatte. »Es ist besser, Du weißt gleich alles: ich kann nicht mehr Adalberts Frau bleiben.«
Die letzten Worte schrie sie fast heraus, sodaß er sich scheu umwandte und nach der Tür blickte.
»Also doch!« stieß er hastig hervor. Dann ging er gedankenabwesend ans Fenster und starrte, still mit sich ringend, hinaus, während er die Hände auf dem Rücken ineinandergrub.
Und auch ihm war's, als stünde er im Wetter, geradeso wie vorhin der schwachen Frau, mit der er ein Leben lang so angenehm auf glatter Bahn dahingerollt war.
Sie hatten so weich und behaglich im Fonds gesessen und sich der Wandelbilder gefreut, die rechts und links vorüberhuschten, immer so ziemlich einander gleich, etwas eintönig wohl auf die Länge der Zeit, aber doch alle so heiter und blumig und so voll Duft und voll Farbe, daß man's kaum spürte, wie sie allmählich in den langen Jahren matter und fahler geworden waren.
Und nun dieser Schauer, der das alles prasselnd zu zerschlagen drohte.
Und gerade jetzt! Heute! Nach diesem reizenden Gestern!
Gewiß, er kannte sie, die Ironie des Lebens, vom Hörensagen aber nur. Jetzt sah er ihr (– spaßhaft, daß man darüber sechzig Jahre werden kann! –) zum ersten Male selbst in ihre grinsende Fratze. – – –
»Und warum?«
Mit dieser Frage riß sich Lohmann selbst gewaltsam aus seinem Brüten und wandte sich wieder zu seiner Tochter, die immer noch starr zu ihm hinsah.
»Weil ich ihn nicht liebe!« antwortete sie mit fester Stimme.
»Nicht mehr, meinst Du! – Nicht wahr?«
»Nein! Ich habe ihn niemals geliebt. Ich – (sie senkte den Kopf) – wußte das nur nicht.«
»Und wie lange weißt Du's nun schon?«
»Schon lange! Seit Jahr und Tag!«
Ein heißes Feuer der Scham lohte in ihren Augen auf.
»O Papa,« rief sie durchschüttert, »es war eine Qual und – Schmach, immer noch sein Weib sein zu müssen.«
Er suchte hinter sich nach dem Fensterbrett, um sich daran stützen zu können.
»Ich glaube Dir's, mein Kind!« sagte er weich. »Und Du tust mir leid.«
»Papa!«
Es war ein schreckhafter Jubel in dem Laute, mit dem sie das rief, ein Jubel, noch halb umflort von Zweifel, ob es möglich sei, soviel Verständnis bei einem Vater finden zu können.
»Komm doch mal her, Regina!« fuhr er in demselben weichen Tone fort. »Komm her, und stehe nicht so feindlich von ferne. Wie auf dem Sprunge stehst Du ja! Wir müssen doch trachten, uns zu verstehen!«
Er ließ sich in einen der hohen Sessel am Fenster fallen. Regina aber eilte rasch über die ganze trennende Breite des Zimmers zu ihm hin, und ehe er sich's versah, kniete sie neben ihm und barg ihr Gesicht schluchzend an seiner Brust. Er aber strich ihr leise über das Haar, aus dessen dunkler Fülle es wie ein starkes Fluidum in seine feinfühlenden Fingerspitzen strömte.
»Beruhige Dich, mein Kind,« sagte er nach langer Pause, mit Rührung ringend, »beruhige Dich und sprich Dich aus!«
Ein paar Mal noch ging ein krampfhaftes Zucken durch die prachtvolle Gestalt des jungen Weibes; dann aber erhob sie sich mit der Fassung, die nur die Starken besitzen, und setzte sich dem Vater gegenüber in einen andern hochlehnigen Sessel.
»Welche Rasse ist in ihr!« dachte Lohmann, sie betrachtend. »Welche Beherrschung! Und wie weit ist das alles von jeder Schauspielerei entfernt! Adalbert ist ein guter Kerl, aber viel zu wenig Rassenmensch für sie. Auf die Dauer wenigstens! Man konnte sich's denken! Aber sie hat ihn ja selbst gewollt.«
Und laut fuhr er fort: »Also war Deine Neigung zu Adalbert nur eine Täuschung, mein Kind?«
»Ach, Papa, ich glaube, ich habe nie eine Neigung für ihn gehabt!« sagte sie, zu Boden schauend. »Ich nahm ihn, weil ich keine besondere Abneigung gegen ihn verspürte. Und dann wußte ich ja auch, daß ich niemals einem andern mehr Neigung schenken würde.«
»Das wußtest Du?«
»Ja, Papa! Deine Fragen quälen! Ich will's lieber gleich sagen: weil ich liebte, hoffnungslos liebte!«
Seine Züge strafften sich in qualvoller Spannung.
»Vetter Heinz!«
Lohmann erblaßte in jähem Verstehen.
»Ich weiß –« stieß er hervor, »ich weiß nun alles! Und nun – was wollt Ihr nun!«
»Ich will ihm angehören!« brach's vulkanisch aus ihr hervor. »Und ich muß! Nichts kann mich hindern, seit ich's weiß, daß er mich liebt, immer geliebt hat. Wie ein Paar blinde Toren liefen wir aneinander vorüber: er nach Afrika und ich – in die Arme des andern.«
»Es ist die alte Geschichte!« zitierte Lohmann. Er hatte so oft zitiert, daß er's jetzt gewohnheitsmäßig tat. »Und er – Heinz – ist also expreß vom Kongo herübergekommen, um Dich so post festum aufzuklären?«
Bittre Ironie zuckte jetzt um seinen Mund.
»Das wohl nicht!« antwortete Regina zögernd. »Wir haben uns ja ganz zufällig getroffen – auf meiner Reise hierher!«
»Ein liebenswürdiger Zufall!«
Lohmann konnte den ironischen Ton nicht loswerden.
»Und die paar Stunden auf der Fahrt und dann gestern die paar Feststunden haben genügt, Dich zu solchen Entschlüssen zu bringen? Regina – (er wurde wieder weicher und ernster) – Entschlüsse fürs Leben! Bedenke doch!«
»Ich ringe schon seit drei Jahren mit ihnen, Papa. Es fehlte mir nur immer der äußere Anlaß. Adalbert ist ja immer so korrekt! Und dann – wo sollte ich auch hin?«
»Regina!« rief da der Vater in aufrichtig-schmerzlicher Erregung. »Was sprichst Du? Hast Du kein Vaterhaus?«
»Nein, Papa!« antwortete sie fest und ruhig. »Das habe ich nie gehabt! Und daran lag's, daß ich ging, zu ihm ging, den ich nicht liebte. Es machen's ja wohl tausende von viel beneideten Haustöchtern so!«
Lohmann sah sie mit völligem Nichtverstehen an.
»Ich weiß nicht –« sagte er stockend.
»Nun ja, Papa, Du magst verwundert sein. Du meinst, Ihr hättet mir nie was in den Weg gelegt.«
Er nickte stumm.
»Das wohl, Papa! Aber – Ihr – Ihr habt mich eben einfach links liegen lassen – das war's!«
Sie schluchzte es förmlich heraus, so daß er beruhigend seine Hand gegen ihr Gesicht hob, das sie in ihr Taschentuch verborgen hatte.
»Nicht doch!« wehrte er ab. »Nicht doch!«
»Es war so!« entgegnete sie, die Augen trocknend, wieder gefaßter. »Du hattest niemals Zeit für mich. Du warst immer unterwegs, in der Praxis oder in Vereinen und Gesellschaften. Und daheim warst Du nur für Mama da. Sie gehörte ja auch immer zu Deiner Praxis. Für mich, die körperlich Gesunde, hattest Du nur flüchtige Blicke, nie aber auch nur eine Viertelstunde übrig. Ich hätte in einem fremden Hause nicht einsamer dastehen können als zwischen Euch beiden, die Ihr nur Augen und Ohren für einander hattet.«
»Regina,« sagte er bewegt, indem er aufsprang, »das sind harte Anklagen. Aber vielleicht – vielleicht verdienen wir sie! Leiden und Fürsorge machen egoistisch. Und Mama war immer leidend, und ich mußte immer für sie sorgen.«
Er ging langsam in tiefem Nachdenken auf und ab. Dann wie in plötzlichem Entschlusse sagte er: »Höre mal zu, Regina. Vielleicht tut Dir das in Deiner gegenwärtigen Verfassung gute Dienste!«
Er setzte sich wieder in den Lehnstuhl und sah starr auf seine zwischen den gespreizten Knieen gefalteten Hände nieder, als würde es ihm schwer, die Erinnerungen zu sammeln.
»Es ist lange her,« begann er, »da war ich in ähnlicher Lage wie Du, Regina. Ich liebte jung, zu jung vielleicht. Und es war eine andere als Deine Mutter.«
»Nicht möglich!« fuhr Regina auf.
»Doch! Höre nur! – Es war ein reich begabtes Geschöpf mit einer starken Seele, meinte ich. Was ich aber für Stärke hielt, war wohl nur Ehrgeiz, Machtgelüst, wenn nicht noch Niedrigeres. Sie sah mich schon als Leuchte der Wissenschaft. Und so nur wollte sie mich. Vielleicht wär's gelungen, wenn nicht mein Vater so früh gestorben wäre. Ich erzählte Dir schon davon. Nun mußte ich die Hände zum Erwerb regen. Ich ging Hals über Kopf in die Praxis, hierher ›aufs Dorf!‹ wie sie sagte. Und sie stellte mir ein ›Entweder-oder‹ mit Worten nicht nur, auch mit der Tat. Ihretwegen solle ich mich nicht an die Kette legen, schrieb sie, und ging fort in eine lästige Fron. Und zu dieser weiten räumlichen Trennung ist dann allmählich die der Herzen gekommen.«
Er brach ab, aber Regina fragte leise: »Und wenn sich nur Deins von dem ihren getrennt hätte?«
Er winkte abwehrend mit der Hand.
»Wer weiß,« seufzte er, »wie's war! Ich hatte damals, wo ich wie ein Verzweifelter um die Existenz der ganzen Familie rang, nicht Zeit zu Herzensanalysen. Die Arbeit verschlang mich ganz. Und der junge, schnelle Erfolg berauschte mich wohl auch. Dann lernte ich Deine Mutter kennen – als Patientin, als die rührendste und lieblichste, die ich je gehabt. Und die Dankbarkeit der Genesenden war so herzerquickend und alles, was sie umgab, so gewinnend, wie sie selber. So kamen wir zusammen! Und sie hat meine Neigung zu ihr mit ständiger Sorge um ihre zarte Gesundheit in Atem erhalten, und so ist die Neigung allmählich zur herzlichsten Liebe gereift.«
»Und ihre Liebe zur Anbetung.«
»Ich hoffe, Regina, du verbindest mit diesem Urteil keine Geringschätzung gegen sie und mich.«
»Nein, gewiß nicht, Papa! Aber die Bitterkeit kann ich nicht los werden, so sehr ich Dir auch für Dein Vertrauen danke. Ich weiß wohl, was es kostet, so was seinem Kinde zu erzählen. Aber Dein Fall findet auch keine Anwendung auf mich. Adalbert und ich kamen uns nicht näher; wir glitten immer weiter von einander fort.«
»Und was erwartest Du von dem andern, dem – Stürmer – dem Gewaltmenschen? Daß er das ist, wirst Du mir zugeben.«
Sie nickte bejahend. Es tat ihr wohl, daß er den nicht schmähte, der seine Ruhe und sein Behagen gefährdete.
»Ich will Dir sagen,« fuhr Lohmann weich fort, »was Dein Los an seiner Seite ist: er verzehrt Dich, wie das Feuer ein reifes Ährenfeld. Denn er ist kochende Glut durch und durch.«
»Möglich!« flüsterte sie, und es ging wie ein Lächeln des Erwarmens über ihr Gesicht.
»Sie stand zu lange im Kühlen!« dachte Lohmann mit wehem Bedauern. »Nun verzehrt Sie die Sehnsucht nach der Glut.« Und im heißesten Drange, halten zu wollen, was er nicht ohne Schuldgefühl sich entgleiten sah, warb er mit Blick und Wort und Gebärde um seines großen Kindes Liebe, die er so lange achtlos zur Seite schmachten ließ. Und voll verzehrender Angst um die Ruhe seines Weibes und Hauses und erfüllt von Besorgnis um das langgewohnte Behagen, das in geordneten Verhältnissen und im ungetrübten Verkehr mit einem großen Freundeskreise liegt, drang er in Regina, ihnen allen den »Schmutz« und die »Schande«, den »Aufruhr« und die »Verunglimpfung« zu ersparen, den ein solcher »Eklat« mit sich bringe. Nicht für einen kurzen »Fiebertraum« solle sie die ruhige Stetigkeit ihres gesicherten Lebens dransetzen, nicht einem »unberechenbaren Charakter« ihre »kristallklaren Verhältnisse« opfern und sich und ihre Eltern dazu.
»Denn,« schloß er, nahezu erschöpft, »das mußt Du Dir klarmachen, Regina: wir fallen allesamt Deiner Leidenschaft mit unserm Lebensglück zum Opfer, und die, die nicht ganz intakt sind, vielleicht mit dem Leben dazu.«
Sie wußte wohl, wen er meinte, und sah's an der unterdrückten Träne in seinem Auge, wie ihn der bloße Gedanke schon fassungslos mache.
Und ihm gegenüber fand sie den Mut nicht, wie gestern Abend diese Opfer als notwendig für ihr »wohlverdientes Eigenglück« zu bezeichnen. –
Stumpf und schwach geredet, zermürbt und in ihrem Entschlusse zum Schwanken gebracht, versprach sie dem Vater, Heinz aus dem Wege gehen und »auf die bescheidene Flamme stillen Glückes harren zu wollen, die sich gewiß auch auf dem Herde, dem sie sich nun einmal gelobt habe, noch entzünden werde.« –
Am meisten hatte sie entmutigt, daß auch ihr »schöner«, liebenswürdiger und milddenkender Vater, der so herzbewegend auf sie einsprach, im Grunde genommen nichts von dem verstand, was in ihr nach Befreiung und »endlicher voller Befriedigung« schrie. Sie fand den Mut nicht, über die beiden »vom Glück verhärteten Seelen« ihrer Eltern hinwegzuschreiten zu dem, was sie als ihr eigenes Glück erträumte.
Und so gab sie jenes Versprechen. – – –
Der Sanitätsrat aber eilte erfreut zu seiner »einsam leidenden« Gattin, um sie zu beruhigen. –
Als er über den Flur ging, trug er in seiner Brust ein Zwittergefühl: ein lästig Unbehagen über die vielen schönen Worte, die er hatte verbrauchen müssen, um seine Tochter von diesem »Spektakel« abzuhalten, und auch wieder einen Stolz, daß es ihm, dem Sanitätsrat Lohmann, nun einmal gegeben sei, allen »schwierigen Leutchen« den Kopf zurecht zu bringen, selbst seiner eigenen Tochter Regina. – – –
Die aber saß bald darauf fassungslos schluchzend auf ihrem Zimmer. Sie verwünschte ihren eigenen Mund, »daß er voreilig Verrat am höchsten und heiligsten Rechte ihres eigenen Ichs« geübt habe. – – – –
Hätte ihr Vater gewußt, daß sie nach langem Kampfe mit sich selbst zu dem Entschlusse kam, Heinz mündlich und ausführlich auseinandersetzen zu wollen, warum sie auf seine Liebe verzichten müsse: er würde wohl besser über sie gewacht und die Begegnung vereitelt haben, die sie zum Zweck einer »letzten Aufklärung« herbeiführte. – – –
Von dieser Besprechung kehrte Regina Lohmann nicht heim: sie war des Löwenjägers Beute geworden.
* * *
Sie erfuhr's am Kongo nicht, wie richtig sie an jenem Geburtstagsabende alles vorweg verkündigt hatte.
Ihres Vaters Optimismus kam ernstlich ins Schwanken. Zunächst durch das, was er selbst als ihre eigene »empörende Wortbrüchigkeit« bezeichnete, mehr noch aber durch all das, was sie im Gefolge hatte.
Seine »brillante gesellschaftliche Stellung« und seine »Bomben-Praxis« erwiesen sich als Kartenhäuser, was alle menschlichen Errungenschaften werden, wenn die richtigen Winde dahinterkommen. Hier aber blies verwandtschaftliche Rachsucht aus einem Dutzend gewichtiger Scheurig-Backen, und Leute vom Schlage der Rätin Scharfenberg unterstützten diese Stürme durch eine nachtschwarze unterirdische Maulwurfsarbeit. Nicht lange, so bröckelte es an dem, was Lohmann so feststehend dünkte wie ein Bollwerk, bald oben, bald unten, und es begann zu wackeln und zu wanken, und wenn er sich nicht bald freiwillig draus flüchtete, fiel's ihm wohl über dem Kopfe zusammen.
Schneller, als das Lohmann »bei dem ersten besten« für möglich gehalten hätte, sah er sich von der Gesellschaft »vergessen« und in der Praxis von dem frisch hergeschneiten Kollegen Jonas »ersetzt«, dem ob dieser jähen Erbschaft fast bange wurde.
Was aber der Sanitätsrat bei allem verbissenen Zähneknirschen noch still und äußerlich gefaßt ertrug, das wurde für Frau Lillis Schultern, die nie eine Last getragen hatten (– nicht einmal die der eigenen Kränklichkeit –) zu viel. Sie brach nach kurzem wort- und tränenreichen Kampfe zusammen.
Noch ehe am Kongo das schnellfüßig schleichende Fieber Regina zum ersten Male meuchlings in einen andersartigen Taumel versetzte, als sie ihn aus der ungestümen Glut des Afrikaners sog, goß ihre Mutter in einem langen, heißen Blicke zum letzten Male alle ihre Liebe und Bewunderung über einen gebrochenen Mann aus. – – –
