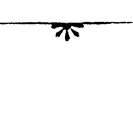|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++


 Das Leben jedes echten Thüringers ist gleichsam mit einer Perlenschnur von Kartoffelklößen durchflochten, und seine Augen leuchten, wenn er nur den Namen dieses für ihn so köstlichen Gerichts aussprechen hört.
Das Leben jedes echten Thüringers ist gleichsam mit einer Perlenschnur von Kartoffelklößen durchflochten, und seine Augen leuchten, wenn er nur den Namen dieses für ihn so köstlichen Gerichts aussprechen hört.
Ganz besonders in der Fremde nimmt der Kartoffelkloß für ihn einen geradezu symbolischen Charakter an, er bedeutet ihm die Heimat mit all dem Lieblichen, Holden und Trauten, das für den trotzdem so wanderlustigen Deutschen mit diesem Worte verknüpft ist, und haben sich irgendwo in der weiten Welt Thüringer um dies köstliche Gericht zusammengefunden, so verzehren sie es mit lyrischen Empfindungen, und den weicheren unter ihnen werden die Augen feucht. Angehörige des kräftigen und ausdauernden Volksstammes der Thüringer sind über die ganze Welt verbreitet, und überall, wohin sie gelangen, vermögen sie zu gedeihen, sofern das Land Kartoffeln hervorbringt. Denn die grünen Berge, die rauschenden Wälder, die lieblichen Thäler, die rieselnden Bäche seines Heimatlandes vermag der Thüringer zu entbehren, nicht aber das köstliche Gericht, an dem die holdesten Erinnerungen seiner Jugend haften. Davon hat mein Freund, der Afrikareisende Doktor Elgersburg, selbst ein geborner Thüringer, ein höchst sonderbares Beispiel berichtet. Als dieser vor einigen Jahren den Kongo hinauffuhr, gelangte er an eine Station, wo man ihn mit Freuden begrüßte, als man hörte, daß er ein Arzt sei, denn einer der dort angestellten Europäer, der, wie sich bald zeigte, ebenfalls von Geburt ein Thüringer war, lag schwer krank danieder, und keines der in der Stationsapotheke vorhandenen Mittel wollte ihm helfen. Man führte den Doktor Elgersburg zu dem Kranken, und dieser erfahrene Arzt wußte auf den ersten Blick, was seinem Landsmann fehle. Als die wohlbekannten Laute des heimischen Dialektes an das Ohr des Patienten schlugen, ging ein schwaches Lächeln über seine schlaffen Züge, und in seinen Augen leuchtete etwas wie Hoffnung auf. Doch dies matte Licht erlosch bald wieder, und mit müder Stimme sprach er dann: »Sie können mir doch nicht helfen, Herr Doktor, es geht zu Ende. O, wär' ich doch nie in dies infame Land gekommen!«
»Nur Mut, lieber Landsmann!« sagte der Arzt, »so schlimm steht die Sache denn doch nicht. Passen Sie nur auf, die Geschichte wollen wir bald haben.«
Dann ging er hinaus zum Chef der Station und sprach zu dem: »Ganz einfache Diagnose. Der Mann hat Heimweh. Der Mann ist Thüringer. Sind Kartoffeln am Ort?«
Es zeigte sich, daß von der letzten europäischen Proviantsendung noch deren 50 Liter vorhanden gewesen waren, allein diese hatte man zur Aussaat bestimmt, und gerade am Tage vorher waren sie in die Erde gekommen.
»Hier handelt es sich um ein Menschenleben!« rief der Arzt, »da müssen unbedingt ein paar Liter wieder ausgekratzt werden! Anders kann ich den Mann nicht retten.«
Kopfschüttelnd schickte der Stationschef auf das energische Drängen des Doktors ein Negerweib hin, und binnen kurzem kam dieses mit einem Korbe voll Kartoffeln zurück. Als nun diese geschält wurden und solch wohlbekanntes Geräusch, sowie das taktmäßige Plumbsen der fertig geschälten Knollenfrüchte in den Kücheneimer hörbar ward, da war es merkwürdig zu sehen, wie eine sanfte Röte über das Gesicht des Kranken im Nebenzimmer zog, und wie sich seine Ohren spitzten gleich denen eines Schlachtrosses, das den Klang der Kriegstrompete vernimmt. Und als nun gar eine Reibe herbeigeschafft und die Kartoffeln gerieben wurden, da richtete er sich ein wenig auf einem Arm empor und strich sich wie träumend mit der Hand über die Stirn. »Nun, wie ist Ihnen?« fragte der Arzt, der soeben in die Thür getreten war.
»Sonderbar, höchst sonderbar!« sprach der Kranke. »Mir ist, als träumte ich. Als wär's Sonntagvormittag, und ich zu Hause bei meiner Mutter in Ilmenau ›unter den Linden‹, wo der Brunnen vor der Thüre steht.«
»Ja, ja,« rief der Arzt, »es kommt noch besser, warten Sie nur!«
Da sonst ein geeignetes Instrument am Orte nicht vorhanden war, so hatte doch der Arzt eine Kartenpresse entdeckt und diese sogleich für seine Zwecke in Anspruch genommen. Er schlug die Masse der geriebenen Kartoffeln in eine Serviette, spannte sie ein und hieß das Negerweib die Schrauben anziehen. Als der Kranke das Knarren der Schrauben vernahm und das girrende Rieseln des ausgepreßten Saftes, da richtete er sich ganz auf von seinem Lager und sah mit glänzenden Augen vor sich hin: »Ich weiß nicht, wie mir ist,« flüsterte er vor sich hin, »mir wird so wohl; ich glaube, ich kann noch wieder gesund werden.«
Ein wenig Weißbrot war vorhanden; es ward nach der Anweisung des Arztes in Würfelchen geschnitten und geröstet. Dann formte er selber kunstgerecht aus der vorbereiteten Masse die stattlichen Klöße und verteilte die Semmelbrocken sachgemäß. Während das Gericht nun kochte, kehrte der Doktor zu seinem Kranken zurück und saß in fröhlicher Erwartung zukünftiger Ereignisse an dessen Lager. Doch dieser war wieder ganz in sich zusammengesunken, der Glanz seiner Augen ausgelöscht und jeder Hoffnungsschimmer von seinen Wangen verschwunden. »Nur Mut, nur Mut!« sagte der Arzt, »die Medizin ist bald fertig.«
Nach einer Weile entstand draußen ein Geräusch, der Doktor eilte hinaus und kam mit einer mächtigen Schüssel dampfender Kartoffelklöße wieder zurück. Der Kranke lag abgewendet und rührte sich nicht. Doch plötzlich stieg ihm der liebliche Duft in die Nase. Das riß ihn empor. Er saß aufrecht, starrte mit wirren Blicken, wie wenn er einen Geist schaue, auf die Schüssel hin und ward rot und bleich innerhalb einer Sekunde. Dann schien ihn ein Gefühl unsäglichen Glückes zu überkommen. »O, du mein Herrgott!« sagte er.
Die Schüssel ward vor ihn hingesetzt, man stopfte ein Kissen hinter seinen Rücken, und nun begann der Kranke fast zaghaft und seinem Glücke noch nicht recht trauend einen der Klöße kunstgerecht auseinander zu reißen. Nun sah er wohl, es war kein Traum. Dann probierte er den Kloß, und alsbald liefen ihm die Thränen über die eingefallenen Wangen. »Alles richtig,« murmelte er, »gerade so wie meine Mutter sie macht in Ilmenau ›unter den Linden‹, wo der Brunnen vor der Thüre steht.« Alsdann verzehrte er im Schweiße seines Angesichts elf Kartoffelklöße wie eine Faust groß, sank darauf mit paradiesischen Empfindungen zurück in die Kissen und schlief vierundzwanzig Stunden hintereinander weg. Er wachte auf mit einem Gefühle, als wenn seine Glieder von Stahl und seine Gelenke Sprungfedern wären, stand auf, kleidete sich an und ging noch desselbigen Tages auf die Elefantenjagd.
Als ich dieses merkwürdige Erlebnis meines Freundes, des Afrikareisenden Doktors Elgersburg, eines Sonntagvormittags am runden Tische der Weinhandlung von Knoop in der Potsdamerstraße erzählte, fand ich statt des ironischen Zweifels, den ich eigentlich erwartet hatte, einen Beifall, der mich überraschte, besonders von zwei Zuhörern, die mit strahlender Aufmerksamkeit der Geschichte gefolgt waren. Von diesen beiden Männern, die ebenfalls Thüringer waren, hatte sich besonders der eine meiner Freunde, Doktor Wendebach, durch die große Lebhaftigkeit seiner Teilnahme ausgezeichnet. Dieser Doktor Wendebach, der ein ungeheuer gelehrtes Werk kulturhistorischen Inhaltes herausgab, war in seiner Art ein merkwürdiger Mensch, denn er verband den emsigen Fleiß mühseliger Forschung mit der heitersten Lebenslust des Weltmannes, er verstand es, wenn man so sagen darf, Biene und Schmetterling in einer Person zu sein. Dazu besaß er die Gabe, die wunderlichsten Einfälle und paradoxesten Ideen mit dem größten Aufwand von Scharfsinn und Lebendigkeit vorzutragen, ihnen die glänzendsten Mäntelchen umzuhängen und sie durch blitzartige Einfälle auf eine geistvolle Art zu beleuchten. In diesen dialektischen Fechterkünsten war er so gewandt, daß jemand, der sich mit ihm in dergleichen scherzhaften Streit einließ, fast immer den kürzeren zog.
Doktor Wendebach hatte also diese Geschichte mit großer Aufmerksamkeit und Teilnahme angehört und sagte nun mit Befriedigung: »Sehr gut! Die Geschichte glaub' ich! Sie ist mir wieder ein Beweis für die ungeheure Bedeutung der Kartoffel in unserm Kulturleben.«
Einige in der Gesellschaft wagten zu lachen über diese Bemerkung. Da geriet er aber sofort in Feuer. »Ja, meine Herren, Sie lachen!« rief er. »Es gab auch Leute, die über Kopernikus lachten, als er behauptete, die Erde drehe sich um die Sonne. Die Leute haben längst ausgelacht. Für mich, meine Herren, beginnt die neuere Geschichte überhaupt erst mit der Einführung der Kartoffel. Eine ältere Kultur war hingesiecht, der Dreißigjährige Krieg bedeutete ihren letzten fürchterlichen Todeskampf, dann japste sie noch ein paarmal und war hin. Der Rest war Schweigen. Aber jedermann ist bekannt, daß sich in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges der Anbau der Kartoffel überallhin verbreitete. Die Zeit trug ihr Heilmittel in sich; wie ein Phönix aus der Asche sollte eine neue mächtige Kultur emporsteigen und zwar aus jener Asche, in der die erste Kartoffel in Deutschland gebraten wurde. Der Siegeszug der Kartoffel ist der Siegeszug Deutschlands zur neuen Macht und Größe. Die folgenreichste That Friedrichs des Großen ist nicht, daß er Schlesien eroberte, sondern daß er Tausende von neuen Ansiedlern ins Land rief und den Anbau der Kartoffel zwangsweise beförderte. Und so ward später die sandige verachtete Mark und ein großer Teil Preußens zu dem reichsten Kartoffellande der Welt. Meine Herren, es ist kein Zufall, daß aus diesem Boden das neue Deutschland emporwuchs und daß ein Kartoffelbauer im großen, unser mächtiger Bismarck, die vielen deutschen Vaterländer zu langersehnter Einigkeit zusammenschweißte.
»Ich bemerke schon wieder, daß einige lachen. Meine Herren, die Sache ist gar nicht lächerlich. Hören Sie nur weiter! In einer anderen Gegend Deutschlands, in dem gesegneten Thüringen, war man schon im vorigen Jahrhundert bemüht, den Kartoffelgenuß zu veredeln, zu erhöhen, ihm eine vornehmere Form zu geben, und dies Bestreben führte zu der epochemachenden Erfindung des Kartoffelkloßes. Dieser ist gewissermaßen die Kartoffel mit sich selbst multipliziert, die vergeistigte Kartoffel. Er ist kugelförmig, weil die Kugel die Form der Vollendung bedeutet, kugelförmig wie der Tautropfen, der den Diamanten an Glanz überstrahlt, wie das Geschoß, das den Tod, und die Pille, die Genesung bringt, kugelförmig wie der Reichsapfel, das Symbol der höchsten Macht, kugelförmig wie Sonne, Mond und alle Sterne. Und nun frage ich wieder, war es ein Zufall, daß die unmittelbare Folge dieser merkwürdigen Erfindung in dem kleinen Weimar eine Blüte der Litteratur war, wie sie die Welt nicht glanzvoller zum zweitenmal gesehen hat, daß wie Sonne und Mond Goethe und Schiller dort aufstrahlten, umgeben von anderen Sternen unvergänglichen Glanzes? Was?«
Ich muß gestehen, daß trotz aller Verwarnung die Tafelrunde wieder unbeschreiblich lachte. Es saß aber ein Württemberger am Tisch, der diese Pause benutzte, um einzufügen: »Sie waren doch beide Süddeutsche, Schiller war ein Schwabe und Goethe ein Frankfurter.«
Großartig war der Ausdruck erhabener Ueberlegenheit, mit dem Doktor Wendebach jetzt auf den unglücklichen Schwaben hinblickte. Noch höher zogen sich seine Augenbrauen, und noch mehr als gewöhnlich krauste sich seine Stirn, und seine dichten, kurz geschnittenen Haare starrten gen Himmel wie die Mähne eines gereizten Löwen. Sein Gefühl für die Schwäche dieses Einwandes war so stark, daß er sich zuvor in einem kleinen hysterischen Gelächter Luft machen mußte. Dann schleuderte er einen vernichtenden Blick auf seinen Gegner und begann in ganz hoher Stimmlage, allmählich jedoch, je mehr er in Feuer geriet, zu einem tieferen Tone herabsinkend: »Sehr gut, sehr gut! Schiller war ein Schwabe, das läßt sich nicht leugnen. Jetzt sind natürlich alle Schwaben stolz auf ihn, nachdem er bei uns im Weimarschen was geworden ist. Natürlich! Aber wie war es damals? Bei Nacht und Nebel mußte er fliehen aus seinem Vaterlande, weil man seinen Pegasus ins Joch spannen wollte, weil man ihm das Dichten verbot. Natürlich lief er davon und irrte lange in Deutschland herum, bis er endlich ins Weimarsche kam und nun wußte, wo er hingehörte, da könnt' er die Schwingen seines Genies entfalten! Da schrieb er den Wallenstein, die Maria Stuart, die Jungfrau von Orleans, den Tell, und was er sonst mochte. Na, und Goethe! Er war 'n kleiner Advokat in Frankfurt mit wenig Praxis und eben im Begriff, in 'ne Bankiersfamilie hineinzuheiraten. Da kam unser Fürst, unser Karl August, und holte ihn sich und rettete diesen ungeheuren Genius, der gerade daran war, ein kleiner Reichsstadtphilister zu werden. Bei uns ist er Minister geworden, ja, und bei uns hat er seinen Faust, Egmont, Tasso und andere unsterbliche Werke geschrieben. Natürlich jetzt, wenn mal was von Goethe in Frankfurt gegeben wird und der Donner des Beifalls durch das Haus braust, da sitzt der richtige Eingeborene ganz geschwollen da und sagt: »Ja, die Kumedi is scheen, se is awer aach von eme Hiesige.« Als wenn die Frankfurter etwas dafür könnten, daß Goethe der größte Dichter der Neuzeit geworden ist. Ich für mein Teil glaube mehr an den Kartoffelkloß.«
Der zweite Thüringer in unsrer Gesellschaft, Herr Doktor Dammann, der im Gegenteile zu seinem hitzköpfigen Landsmanne stets eine etwas phlegmatische Ruhe zu bewahren pflegte, sagte nun in behäbigem Tone: »Lassen wir das dahingestellt, was mein phantasiereicher Freund über die politische Bedeutung der Kartoffel und die litterarische des Kartoffelkloßes mit großem Feuer entwickelt hat, so viel steht fest, daß unsere heimischen Kartoffelklöße eines der wunderbarsten Gerichte vorstellen, das die Welt kennt, und daß jeder zu bedauern ist, der diesen Genuß entbehren muß oder gar am Ende nicht achtet. Denn auch solche Banausen gibt es. Natürlich müssen die Klöße richtig zubereitet werden. Gegen das Rezept des Afrikareisenden Doktor Elgersburg habe ich nichts einzuwenden, nur ein Punkt blieb mir zweifelhaft. Es hieß, er verteilte die gerösteten Semmelbrocken sachgemäß. Was ist sachgemäß? Darüber gibt es bei uns in Thüringen zwei Auffassungen. Die eine davon ist unbeschreiblich thöricht …« »Kolossal thöricht!« fügte Doktor Wendebach hier ein, und der andre fuhr in ruhig dozierendem Tone fort: »Ich will sie deshalb hier weiter gar nicht erwähnen, sondern Ihnen nur die einzig richtige Methode angeben, die darin besteht …« »Achtung, sehr wichtig,« fügte Wendebach hier ein, »… die darin besteht, daß um einen Kern von gerösteten Semmelbrocken herum die lockere Kartoffelmasse angeordnet wird, gleichsam wie sich ein Ei um den Dotter herum aufbaut. Dies ist die einzig richtige Methode, und alles andre ist falsch!«
Dieser Ausspruch wirkte scheinbar wie ein Blitzschlag auf Doktor Wendebach, und er schnappte sichtlich nach Luft.
»Zunächst bin ich sprachlos!« rief er dann. »Entarteter Sohn deiner Heimat, bekennst du dich zu dieser geistlosen Theorie. O was nützen die ganzen Errungenschaften von 1870, was nützt es, daß wir wieder ein einiges und großes Volk geworden sind, wenn im Innern das Zerwürfnis lauert und das Dilemma um sich frißt. Wir sind die beiden einzigen Thüringer hier am Tisch und haben über das herrlichste und großartigste Produkt unsres Landes verschiedene Meinung. Was sage ich: Meinung, wo in dem einen Falle Ketzerei die einzig richtige Bezeichnung ist. Unglücklicher, im Finstern tappender Mensch, dir ist niemals die Idee des Kartoffelkloßes aufgegangen! Man sieht, du bist aus Blankenhain. In Blankenhain hat man nie etwas von Klößen verstanden. Kenner zucken die Achseln, wenn von Blankenhainer Klößen die Rede ist. Denn jeder Verständige weiß es, daß die gerösteten Semmelbrocken zur Auflockerung dienen, daß man sie nicht in öder mechanischer Weise in die Mitte kleckst – das Herz im Leibe dreht sich mir um über die Roheit dieser Anschauung –, sondern sie sorgfältig und gleichmäßig verteilt, also, daß der Querschnitt des Kloßes ein liebliches Ansehen bekommt, gleich hellem Porphyr, der von eingesprengten bräunlichen Krystallen durchsetzt ist.«
»Auf welcher Seite die Roheit der Anschauung liegt, möchte unschwer zu entscheiden sein,« sagte Doktor Dammann nun, »denn dein Kloß gleicht einer Kugel, geformt aus einer regellosen Masse, während der meine gewissermaßen nach krystallinischen Gesetzen gebildet ist, und dadurch ein jeder für sich ein geschlossenes Individuum darstellt. Dein Kloß ist die Anarchie, die Willkür, meiner die Ordnung, das Gesetz, deiner ein Plebejer, meiner ein Aristokrat. Der meinige ist zu vergleichen jenen Achatkugeln von anmutiger und regelmäßiger Form, die im Innern eine köstliche Krystalldruse tragen und jegliches Auge erfreuen durch sinnvolle und gesetzmäßige Bildung.«
Nun aber brauste Wendebach wieder empor wie ein Sprühteufel, und auch Dammann geriet bei dem fortdauernden Streite immer mehr ins Feuer, während die Tafelrunde sich über diese komische Kloßfehde vor Lachen ausschütten wollte. Die beiden Leute gingen wie die Kampfhähne gegeneinander. Sie zogen Plato, Kant und Schopenhauer zur Unterstützung ihrer Meinungen herbei, citierten Schiller, Goethe und Shakespeare zu ihren Gunsten und gerieten zuletzt in eine solche Kampfeswut, daß die Stöße von beiden Seiten hageldicht fielen und sich schließlich sogar zu Beleidigungen zuspitzten. Denn Wendebach rief zuletzt, erbittert durch die zähe Hartnäckigkeit seines Gegners, indem er sich an die belustigten Zuhörer dieses Kampfes wandte: »Sie müssen sich nicht wundern, meine Herren, wenn man in Blankenhain so unglaubliche Ansichten über Klöße hegt. An diesem Orte befindet sich nämlich das Landesirrenhaus. Wenn die Mauern solcher Anstalt auch noch so dick sind, etwas sickert doch immer durch. Da erklärt sich vieles!« schloß er triumphierend. Sein Gegner aber antwortete mit ruhiger Schlagfertigkeit: »Bei uns sperrt man die Unglücklichen doch ein, damit sie keinen Schaden thun können, bei euch in Neustadt aber, da laufen sie frei herum, das ist der Unterschied.«
»Unglaublich!« murmelte Wendebach und verstummte plötzlich. Das Gespräch wandte sich nun auf andre Dinge; zwischen den beiden Thüringern aber herrschte Mißstimmung, und sie gingen bald grollend und getrennt ihres Weges.
Am nächsten Sonntag vermißte man sie am runden Tische. Das fiel weiter nicht auf, denn sie konnten beide durch Zufall verhindert sein. Jedoch, als sich auch am nächsten Sonntag keiner von beiden einfand, wunderte man sich darüber und stellte Mutmaßungen an, die der Wahrheit ziemlich nahe kamen, wie sich bald zeigen wird. Denn ich begegnete in der nächsten Woche dem Doktor Wendebach auf der Straße und als ich ihn fragte, warum er sich nicht sehen ließe, machte er ein mißmutiges Gesicht und sagte: »Ja, wenn der andre nicht dorthin käme. Mit einem Menschen an einem Tische zu sitzen, der so blödsinnige Ansichten über Klöße hat und dabei vernünftigen Gründen durchaus unzugänglich ist, das alteriert mich, das macht mich nervös, das halte ich nicht aus.«
Zufällig traf ich bald darauf auch den Doktor Dammann, und ich stellte an ihn dieselbe Frage. »Das dürfen Sie nicht verlangen,« sagte er. »Mit einem Menschen, der, wenn man seine irrige Meinung über Klöße durch vernünftige Gründe bekämpft, gleich mit dem Irrenhause kommt, kann ich nicht verkehren. Das sehen Sie wohl ein.«
Auf meinen Bericht am nächsten Sonntag faßte der runde Tisch einen Beschluß, der den beiden Gegnern unterbreitet ward und glücklicherweise deren Zustimmung fand. Jeder von ihnen sollte bei sich zu Hause ein Kloßessen veranstalten, bei dem das berühmte Gericht nach der von jedem verfochtenen Art zubereitet werden sollte. Die Tafelrunde sollte daran teilnehmen und schließlich durch Abstimmung entscheiden, welcher Methode der Vorzug zu geben sei. Besonders Wendebach, bei dem die erste Sitzung stattfinden sollte, faßte den Plan mit besonderem Feuer auf und war äußerst siegesgewiß. Das ist eine herrliche Idee,« sagte er, »das bedeutet die Zerschmetterung meines Gegners. Denn die Wahrheit behält doch immer den Sieg!«
Der erste dieser entscheidenden Abende kam heran, und wir fanden uns vollzählig bei unserm Freunde ein. Wendebach ging siegesgewiß zwischen uns herum, rieb sich in der Vorfreude seines vermeintlichen Triumphes die Hände und schoß halb mitleidige Blicke auf seinen Gegner. »Seht doch nur, wie blaß er ist,« sagte er. »Aeußerlich benimmt er sich zwar gefaßt, aber innerlich zittert er wie Espenlaub!«
Dann wurden die Flügelthüren geöffnet und wir begaben uns erwartungsvoll an die wohl geschmückte Tafel. Als nun nach der Suppe eine gewaltige Schüssel der mächtigen Klöße nebst einem stattlichen Sauerbraten erschien, verbreitete sich die feierliche Stille der Erwartung. Die Gerichte wurden herumgereicht, und der erste, der in verzeihlicher Neugier und Spannung einen der Klöße zerlegte, war Doktor Dammann. Doch kaum hatte er einen Blick auf das Innere dieses Nationalgerichtes geworfen, als er, auf seinen Teller schauend, in ein stilles, schlitterndes Lachen ausbrach.
»Was hat denn der Kerl?« fragte Wendebach halblaut. »Sollte sich ein Ausbruch bei ihm vorbereiten?«
Allein jeder, der dem ersten Beispiele Dammanns gefolgt war, folgte auch dem zweiten, und zuletzt saßen alle Mitglieder der Tafelrunde da und starrten mit demselben innerlichen schütternden Lachen auf ihre halbierten Klöße.
Wendebach sah ratlos von einem zum andern. Dann, von einer dunkeln Ahnung ergriffen, zerriß auch er schnell und kunstreich eine der grauweißlichen Kugeln in zwei Hälften und ward in demselben Augenblicke purpurrot bis unter die Spitzen seines buschigen emporstrebenden Haares. Er richtete sich hoch auf und warf einen Blick voll erhabenen Zornes auf seine Gattin. So denke ich mir etwa Jupiter an der Göttertafel, wenn er bemerkte, daß die Ambrosia angebrannt und der Nektar sauer war. »Weib!« rief er mit donnernder Stimme, »Schlange, die ich an meinem Busen genährt habe, was ist das!?«
Die arme Frau, die schon mit blasser Miene und ängstlichem Ausdruck das ihr unerklärliche Gebühren der Tischgesellschaft beobachtet hatte, sagte nun ganz verschüchtert: »Aber ich bitte dich, Karl, was hast du denn? Was ist geschehen?«
»Was geschehen ist?« rief Wendebach. »Unerhörtes ist geschehen! Ich bin zerschmettert! Ich bin vernichtet! Ich bin dem Hohne der Menschheit ausgeliefert! Bei diesen Klößen sind die Semmeln in der Mitte angeordnet! Das ist mehr als entsetzlich, das ist Verrat!«
»Aber ich bitte dich, teuerster Karl,« sagte die Frau. »Wir essen dieses dein Lieblingsgericht sehr oft und schon seit Jahren, und niemals war es anders zubereitet. Du warst doch sonst immer zufrieden. Und wenigstens sechsmal hast du es mir wiederholt, wir sollten es genau so machen wie immer, denn das wäre wichtig.«
Der Donner des Gelächters, der sich nun erhob, war unbeschreiblich, und inmitten dieser wogenden Lustigkeit saß Doktor Wendebach bleich und ratlos und murmelte unverständliche Worte. Doch die Wellen der allgemeinen Fröhlichkeit stiegen höher und höher, und in ihren schäumenden Fluten ward der berühmte Streit um die Struktur des thüringischen Kartoffelkloßes für immer begraben.