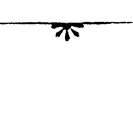|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++


 Als Bräsig »von wegen dem zackermentschen Podagra« in die »Wasserkunst« gehen mußte, da erregte es sein höchstes Mißfallen, daß er gezwungen war, fortwährend an Orten spazieren zu gehen, wo er Gott in der Welt nichts zu thun hatte. Denn ein Landmann, wenn er auf seinem Gute das betreibt, was er Spazierengehen nennt, hat fortwährend etwas zu thun und immer Unterhaltung, und wenn es auch manchmal nur Aerger ist. Denn überall auf jedem Flecke des Landes, das er bebaut, gibt die Gegenwart ihm etwas zu betrachten, zu sinnen und zu denken, gibt es für ihn Erinnerung an die Vergangenheit und Pläne für die Zukunft. So geht denn eine solche Unternehmung meist recht langsam von statten, und der richtige Landmann »steht sich spazieren«, wie man von meinem Vetter sagt, der zu einer Strecke von einem Kilometer drei Stunden braucht, an Unterhaltung dabei aber keinen Mangel leidet.
Als Bräsig »von wegen dem zackermentschen Podagra« in die »Wasserkunst« gehen mußte, da erregte es sein höchstes Mißfallen, daß er gezwungen war, fortwährend an Orten spazieren zu gehen, wo er Gott in der Welt nichts zu thun hatte. Denn ein Landmann, wenn er auf seinem Gute das betreibt, was er Spazierengehen nennt, hat fortwährend etwas zu thun und immer Unterhaltung, und wenn es auch manchmal nur Aerger ist. Denn überall auf jedem Flecke des Landes, das er bebaut, gibt die Gegenwart ihm etwas zu betrachten, zu sinnen und zu denken, gibt es für ihn Erinnerung an die Vergangenheit und Pläne für die Zukunft. So geht denn eine solche Unternehmung meist recht langsam von statten, und der richtige Landmann »steht sich spazieren«, wie man von meinem Vetter sagt, der zu einer Strecke von einem Kilometer drei Stunden braucht, an Unterhaltung dabei aber keinen Mangel leidet.
Darin hatte der alte Bräsig also ganz recht, daß er meinte, an Orten spazieren zu gehen, wo man Gott in der Welt nichts zu thun habe, sei langweilig, und ebenso gewiß ist es, daß der, der sich allerorts etwas zu thun machen kann, vom Leben den doppelten Genuß hat. Da gibt es nun richtige Genußmenschen, die zu ihrer Unterhaltung beim Spazierengehen auf Dinge verfallen, die von den sogenannten verständigen Menschen wohl nur als nutzlos und thöricht erachtet werden können und geeignet sind, deren heftiges Kopfschütteln zu erregen. Zu dieser Spezies gehört eine Sorte von sonderbaren Käuzen, mit denen ich mich besonders beschäftigen will, das sind die sogenannten »Florafälscher« oder »Ansalber«, das heißt Leute, die bestrebt sind, die Flora des Gebiets, in dem sie sich aufhalten, durch Aussaat oder Anpflanzung um neue Arten zu vermehren. Ich muß nun bekennen, daß auch ich mich seit einigen Jahren dieser den Botanikern verhaßten Gilde angeschlossen habe, und daß der Ausdruck »Florafälscher« auf mich selbst von einem berühmten Berliner Professor der Botanik angewandt worden ist. Dem Laien mag es sonderbar erscheinen, daß ein Bestreben, das auf die Bereicherung der einheimischen Flora gerichtet ist, nicht den begeisterten Beifall der Botaniker hervorruft, aber das hat auch seine guten Gründe. Denn ebensowenig wie jeder andre Sterbliche, liebt es der brave Pflanzengelehrte, »hineinzufallen«. Und dieses Schicksal ist ihm in neuerer Zeit durch das Ueberhandnehmen verruchter Florafälscher oft genug bereitet worden. Man denke, bei einem Ausfluge entdeckt Herr Doktor X. die Dingsda soundsoja in einer Menge von Exemplaren. Ein unerhörter Fund. In keiner Provinzflora ist diese Pflanze aufgezählt, ja selbst im ganzen Lande ist sie noch niemals gefunden worden. Diese Entdeckung war dem glücklichen Doktor X. vorbehalten. Er gerät in einen kleinen Rausch, sucht sich die besten Exemplare für sein Herbarium aus und hält die Stelle vorläufig geheim. In der nächsten Sitzung seines botanischen Vereins aber kommt er mit männlich verhaltenem Stolze damit zum Vorschein. Allgemeines Erstaunen und große Bewunderung, bis es sich plötzlich irgendwie unzweifelhaft herausstellt, daß ein infamer Florafälscher die Pflanze dort vor kurzem »angesalbt« hat, wodurch natürlich der eben noch so stolze und glückliche Entdecker dem spöttischen Lächeln seiner Kollegen preisgegeben wird. Ich weiß davon eine kleine wahre Geschichte, die sich in Leipzig ereignet hat. Dort gibt es in der Nähe eine botanisch berühmte Gegend, die als Fundort mancher Pflanzen, die sonst im Lande nicht vorkommen, einen gewissen Ruf besitzt. Dort an einer geeigneten Stelle säete ein lasterhafter Mann, der leider mein Freund ist, eine Alpenpflanze aus, deren Samen er sich von der Reise mitgebracht hatte. Im nächsten Jahre stand sie dort in schönen großen Polstern und in voller Blüte, woran er sich sehr erfreute. Kaum war dies so weit, so erschien eine Notiz in einer Leipziger Zeitung etwa des Inhalts, daß der berühmte Bienitz noch immer seinen alten Ruf bewahre, denn, man denke nur, die Linaria alpina stände dort jetzt in voller Blüte, eine ganz ungewöhnliche Seltenheit. Auf diese Nachricht hin wallfahrteten sofort alle Botanisierkapseln Leipzigs an diesen geheiligten Ort, und am nächsten Tage schon war die schöne Pflanze bis auf die letzte Spur wegbotanisiert. Als mein Freund hinauskam, um sich seine Schöpfung nach der Anerkennung, die sie gefunden hatte, auch einmal wieder anzusehen, war dort kein Stengelchen mehr vorhanden. Da ward in ihm die Rachsucht Herr über seine besseren Gefühle, und er veröffentlichte in derselben Zeitung die Art und Weise, wie dieser berühmte Berg zu seiner neuen Seltenheit gekommen war, was natürlich zur Folge hatte, daß die getäuschten Botaniker das vorher so hoch geschätzte Exemplar in ihrem Herbarium nur noch mit bitteren Empfindungen zu betrachten vermochten, denn »angesalbte« Pflanzen sind für sie ohne jeden sittlichen Wert.
Hieraus geht nun zur Genüge hervor, daß Botaniker und Ansalber sich als Feinde zu betrachten gewohnt sind, die einen, weil sie von den andern schon so manchesmal getäuscht worden sind, und die andern, weil ihnen von den einen oft in kurzer Zeit die seit Jahren gehegten Anpflanzungen ohne Gnade wegbotanisiert werden. Darum möge man es mir nicht verübeln, wenn ich als passionierter Ansalber mich über die Standorte der Pflanze, von der jetzt die Rede sein soll, in tiefstes Schweigen hülle.
Es war, wenn ich nicht irre, im Jahre 1873, als mir bei einem Aufenthalt in Dresden ein zierliches Pflänzchen auffiel, das hier mit zarten Ranken aus den Spalten und Ritzen der Sandsteinfelsen hervorhing, oder dort an geeigneten Orten, zum Beispiel den Vorsprüngen und Pfeilern der alten berühmten Elbbrücke, dichte blühende Polster bildete. Die niedliche Pflanze gefiel mir, und ich behielt sie im Gedächtnis, denn das bescheidene zierliche Gewächs, das mit seinen epheuartigen Blättern und seinen hellvioletten, feinen Blümchen, die mit einem blaßgelben Gaumenfleck geziert sind, aus öden Felsenritzen und altem verwittertem Mauerwerk hervorgrünte, erschien nur wie ein Stückchen Poesie. Das Pflänzchen ist unscheinbar und kann leicht übersehen werden; hat man es aber entdeckt und seine feinen Reize kennen gelernt, so wird man es vielen seiner prangenden und ins Auge fallenden Schwestern vorziehen, wie es ja auch schöne stille Mädchen gibt in Kattunkleidchen, die, wer sie kennt, bei weitem höher schätzt als jene, die in Sammet und Seide rauschen und hinter köstlich gemalten Fächern hervor berechnete Blicke schießen.
Ich erfuhr bald den Namen dieser meiner jungen Liebe. Sie hieß Linaria cymbalaria oder Cymbelkraut und war eine Cousine jenes schönen hochgelben Leinkrautes, das fälschlich so oft Löwenmaul genannt wird und auf Wiesen, Feldrainen und in Wäldern bei uns überall häufig blüht. Das Cymbelkraut ist ursprünglich in den Mittelmeerländern heimisch und langsam und allmählich nach Norden gewandert. Wie weit Ansalber dabei beteiligt gewesen sind, weiß ich nicht; jedenfalls ist das kleine Mauerblümchen oft in Gärten angepflanzt worden und dann, wo es günstige Bedingungen fand, allmählich verwildert. So heißt es auch zum Beispiel in der »Flora des Riesen- und Isergebirges« von W. Winkler von ihm: »Angepflanzt und verwildert.«
Als ich später meinen Freund Johannes Trojan kennen lernte, fand ich in ihm ebenfalls einen Verehrer dieses zierlichen Pflänzchens. Er hatte sich einst aus Hameln an der Weser Samen davon mitgebracht und zog es seitdem alljährlich in Töpfen. Im Hinblick auf die vielen sandsteinernen Ufermauern und Kanalböschungen, die in Berlin vorhanden sind, hatte ich nun unterdes den Gedanken gefaßt, ob es nicht möglich sein würde, diese Blume in Berlin einzubürgern, und mit etwas Samen, den ich von Trojan erhielt, machte ich den ersten Versuch, der aber mißglückte. Ich sagte mir, diese Sache muß im großen angefaßt werden, und da ich unterdes in Erfahrung gebracht hatte, woher dieser Same zu beziehen sei, ließ ich mir im nächsten Frühjahr einen tüchtigen Posten kommen. Dies war im Jahre 1890, und seit dieser Zeit ergießt sich unablässig den ganzen Frühling und Sommer hindurch ein feiner Regen von Linariasamen über Berlin und Umgegend, wie sich mein Freund Trojan gelegentlich einmal ausdrückte. Die Folgen sind nicht ausgeblieben, und ich kann wohl sagen, daß die kleine Pflanze jetzt an manchen Stellen in und bei Berlin heimisch ist. An einigen Orten ist sie schon zum drittenmale wiedergekommen. Denn so zart das Pflänzchen ist, so hat es doch eine große Zähigkeit, sich an den Stellen zu behaupten, wo es einmal steht, und dazu tragen drei Eigenschaften bei. Erstens ist es fast bedürfnislos, begnügt sich mit der kümmerlichsten Mauerritze und nährt sich hauptsächlich aus der Luft. Zweitens schlügt es in jedem Jahre aus der Wurzel wieder aus, und drittens hat es die Gewohnheit, seinen ungemein reichlichen Samen an günstigen Orten zu verstecken. Die niedliche Blume sitzt an einem kurzen Stiele, ist sie aber abgeblüht, so wird dieser Stiel mächtig lang und dreht und wendet sich und sucht für die Samenkapsel an seinem Ende nach einer geeigneten Mauer- oder Felsenritze. Ja, manche Ranke, an der oft eine stattliche Reihe solcher langgestielten Samenkapseln hängt, kriecht mit der ganzen Gesellschaft in solche Ritze und hütet sie dort wie eine Henne ihre Kücken. So kommt es, daß möglichst wenig Samen dieser klugen Pflanze unnütz verloren gehen.
Ja, das pfiffige Cymbelkraut sorgt schon für sich und seine Zukunft, aber ich habe in Berlin mit einem andern Feinde zu kämpfen, der für meinen Liebling der Schrecken aller Schrecken ist. Das ist nämlich die hochnotpeinliche Ordnung, die in dieser vortrefflich verwalteten Stadt herrscht. Unser fürchterlichster Feind ist der Ritzenausschmierer. Ueberall, wo ich nur in Berlin diese Pflanzen zum Wachsen gebracht habe, darf ich annehmen, daß der Ritzenausschmierer bereits wie eine drohende Wolke am Horizonte schwebt. An einigen schrägen Mauerböschungen des Humboldthafens blühten im vorigen Jahre Pflanzen, die den Winter durchgemacht hatten, und grünten unzählige neugesäete. Da waren eines Tages schreckliche Maurer da, mit Kalkkasten und Kratzinstrumenten und anderen Marterwerkzeugen, und hielten grausames Gericht, erneuerten zerbröckelte Steine und schmierten alle die grünenden Ritzen barbarisch mit Kalk aus. Aber wir, ich und mein Pflänzchen, sind zäh, an anderen Stellen in der Nähe des Humboldthafens blüht es jetzt wieder reichlich und munter
An den Orten, wo man den Samen mit dem Finger in die Ritzen drücken oder mit etwas Lehm hineinschmieren kann, kommt die Pflanze mit fast absoluter Sicherheit, solche zugängliche Stellen aber sind selten, und in vielen Fällen kann ich nur von oben die runden Körnchen auf die Steinböschungen streuen und muß es dem Zufall überlassen, daß er sie beim Hinabrollen in eine geeignete Ritze führt. Solche Stellen kosten viel Samen, und man kann von Glück sagen, wenn von Tausenden einer Wurzel schlägt. Diese sind mir dann natürlich ganz besonders lieb – dem Ritzenausschmierer aber ist nichts heilig. In der Nähe der früheren chinesischen Gesandtschaft hatte ich auf diese Art eine kleine Kolonie an der Kanalufermauer zu stande gebracht, die einzige Stelle im weiten Umkreis, wo ich diesen Erfolg erzielt hatte. Da sah ich eines Tages auf derselben Uferseite sich ein plumpes kahnartiges Fahrzeug an der Böschungsmauer entlang bewegen. Darauf befanden sich einige Böcke und Bretter, ein Kalkkasten und zwei Männer, die ich mit Henkersknechten zu vergleichen nicht umhin konnte. Der eine von ihnen trug eine Hornbrille mit großen Gläsern, durch die er in alle Ritzen stierte mit schrecklichem Mörderblick. Dann kratzte er sie aus mit fühllosem Eisen – o, wie mir dieser Ton in die Seele schnitt – und dann schmierte er. Nicht lieblich wie Werthers Lotte das Butterbrot für ihre Geschwister – nein, brutal und mit Vernichtungsfreude, wie es mir schien. Die Männer befanden sich bei der Potsdamer Brücke, also noch weit von dem Standorte meiner geliebten Pflanze, aber ihr Los war besiegelt, das war nicht mehr zu bezweifeln.
Langsam, aber sicher, wie das unerbittliche Schicksal, krochen sie alle Tage weiter an der Mauer, überall weiße Streifen und Striche zwischen dem grauen Steinwerk zurücklassend; sie verfuhren mit jener widrigen Gelassenheit und Gemütsruhe, mit der die Schlange ein gefangenes Tier hinunterschlingt. Ich vermied fortan diese Gegend. Erst in späterer Zeit, als alles längst vorüber sein mußte, richtete ich meinen Spaziergang wieder nach dem Umkreis der ehemaligen chinesischen Gesandtschaft, um trauervoll das Grab meiner kleinen Freundin, einen breiten, öden Kalkstreifen, zu betrachten. Seitdem kann ich mir das unerbittliche Schicksal nicht mehr anders vorstellen, als in Gestalt eines alten, verschrumpelten Maurers mit einer Hornbrille und einem Kratzeisen.
Von solchen kleinen Enttäuschungen wimmelt die Geschichte meiner Ansiedelung der Linaria cymbalaria in und bei Berlin, und ich kann sie nicht alle aufzählen. Nur eine will ich noch mitteilen. Auf dem Moospolster eines Brückenpfeilers meiner Nachbarschaft stand das Pflänzchen sehr üppig schon im zweiten Jahre, das Resultat von gewiß mehr als fünftausend darüber gestreuten Samen, denn ich kam täglich dort vorbei, und jedesmal regnete eine kleine Prise hinab, bis es endlich dastand. Ich betrachtete diese Blümchen stets mit liebevollem Blick, und wenn sich ihre Ranken im Winde regten, bildete ich mir ein, sie nickten mir zu. Doch eines Tages war dort alles verschwunden.
Das war keine Folge der hochnotpeinlichen Ordnung, sondern dieser Raub hatte der Pflanze selbst gegolten, denn nur genau die Stelle, wo sie gestanden hatte, war aus dem Moospolster ausgeschnitten. Wie jemand dies möglich gemacht hat, an der unzugänglichen Stelle, ist mir ein Rätsel. Seitdem ist mir die Ansiedelung dort noch nicht wieder geglückt, aber stehen soll die Pflanze dort doch wieder, so wahr ich Heinrich Friedrich Wilhelm Karl Philipp Georg Eduard heiße.
Für alle solche kleinen Enttäuschungen aber werde ich reichlich entschädigt, wenn ich auf einem gewissen Kirchhofe in Berlin stehe und an einer gewissen Stelle über das Geländer blicke auf eine alte, verwitterte Sandsteinmauer, die dem mörderischen Ritzenausschmierer schon seit vielen gesegneten Jahren entgangen ist und ihn, wie ich hoffe, niemals kennen lernen soll, oder wenn ich, wie im letzten Juni, in ein schön gelegenes Dorf der Berliner Umgegend wandere, wo ich vor zwei Jahren gesäet habe und nun die breite Kalksteinmauer über und über mit blühenden Ranken bedeckt finde, oder wenn ich jetzt hier in Kolbergermünde, wo ich dieses schreibe, meine Aussaat vom vorigen Jahre an allerlei alten Festungsmauern lieblich blühen sehe. Herr Johann Nebendahl aus Groß-Pampow in Mecklenburg, der den besten Weizen in der ganzen Gegend baut, hat auch keine größere Freude, wenn er seine üppigen Felder betrachtet, als ich in solchem Augenblick.
Und nun zum Schluß noch eine Bitte an die verehrten Herren Botaniker, die dies lesen: wenn ihr diesem zierlichen Pflänzchen in und bei Berlin zufällig einmal in die hellen, freundlichen Augen schaut – laßt es stehen! Ihr wißt es nun, es ist ja doch nur angesalbt. Und der, der seinen Samen streute, möchte gern eine kleine grüne Spur hinterlassen auf dieser Erde. Zwar hat er auch allerlei Lieder und Geschichten ans Licht gestellt, allein diese entstanden aus der Zeit für die Zeit und werden schwinden mit der Zeit. Sie werden einst vergessen sein, und nur auf den höchsten Borten zurückgebliebener Leihbibliotheken in weit abgelegenen Landstädten werden einige Bände noch stehen, aber niemand mehr wird nach ihnen fragen. Dann aber wird vielleicht noch ein kleines, zierliches Pflänzchen, das aus dürren Mauerritzen lieblich hervorgrünt, lebendige Kunde geben davon, daß der Verfasser jener vergessenen Geschichten einst über diese Erde gegangen ist, wie wir alle gehen, und wie es in Konrad Ferdinand Meyers schönem Gedichte heißt: »Als ein Pilgrim und ein Wandersmann.«