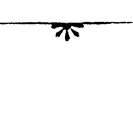|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++


 Der gute alte Onkel bin ich. Wenn man mich fragen wollte, wie es gekommen ist, so kann ich nur sagen, daß die gütige Vorsehung mich wohl dazu bestimmt hat, denn es ist ein Beruf, der mir ausnehmend gefällt. Wer es nicht erlebt hat, der glaubt es gar nicht, wie schön es ist, ein alter Onkel zu sein. Aber das muß man sagen, es gehören auch solche Brüder und Schwestern dazu, wie ich sie besitze, vier Brüder, die alle verheiratet sind, und drei Schwestern, die auch alle verheiratet sind. Alle haben sie Kinder, und von den Kindern haben manche schon wieder Kinder; da lohnt es sich denn doch, Onkel zu sein.
Der gute alte Onkel bin ich. Wenn man mich fragen wollte, wie es gekommen ist, so kann ich nur sagen, daß die gütige Vorsehung mich wohl dazu bestimmt hat, denn es ist ein Beruf, der mir ausnehmend gefällt. Wer es nicht erlebt hat, der glaubt es gar nicht, wie schön es ist, ein alter Onkel zu sein. Aber das muß man sagen, es gehören auch solche Brüder und Schwestern dazu, wie ich sie besitze, vier Brüder, die alle verheiratet sind, und drei Schwestern, die auch alle verheiratet sind. Alle haben sie Kinder, und von den Kindern haben manche schon wieder Kinder; da lohnt es sich denn doch, Onkel zu sein.
Ich habe mich nun eben nicht verheiratet, denn es ist mir nicht gelungen. Es war eine Zeit, da dachte ich oft daran und ich malte mir so schön aus, wie es sein würde. Da war in meiner Phantasie ein kleines Haus in der Vorstadt, das lag in einem Garten ganz heimlich und schön, wie ein Nest im Grünen. Und in dem Hause war alles so vorzüglich und anmutig eingerichtet, wie es eigentlich nur in idealen Häusern vorkommt, die es gar nicht gibt. Ich hatte dort in meiner Phantasie ein wunderbares Studierzimmer mit einem Erkervorbau, in dem Blumen waren, und mit einem geräumigen dunkelbraunen Schreibtisch, der mit allem bedeckt war, das man nur irgend zum Schreiben nötig hat. Mächtige, schön verzierte Bücherschränke standen an den Wänden, und sie waren alle gefüllt mit sauber gebundenen Büchern, deren Inhalt das Beste war, was die Menschheit gedichtet und erdacht hatte. Mit dem Studierzimmer stand ein zweites kleineres in Verbindung, in dem sich meine Sammlungen und Instrumente befanden. Dort waren schimmernde Krystallbildungen und glänzende Erzstufen, Versteinerungen aller Arten, die Ueberbleibsel urweltlicher, untergegangener Bildungen und Schmetterlinge und Käfer, die Zeugen des neuesten und jüngsten Lebens, alles in sauberen Kästen sorgfältig geordnet. Neben dem Studierzimmer sollte dann ein Anbau sein, in dem sich ein Vogelhaus befand. Die Thür konnte geöffnet werden, und durch das leichte Drahtgitter sah ich dann von meinem Schreibtisch aus in den grünen sonnigen Raum, in dem ein Springbrunnen plätscherte und die kleinen Vögel flatterten und sangen. Wenn ich nun genug gearbeitet hätte und über den Flur ginge und die Thür öffnete, da würde ich wieder in andre Zimmer kommen, in denen man gleich das Walten einer Frauenhand bemerkt, denn alles ist zierlicher und schöner eingerichtet, und ein Hauch des Friedens und der Anmut schwebt über den Dingen. Und da würde meine Frau mir entgegenkommen, sehr schön, aber sehr einfach gekleidet, mit etwas zierlichem Weißen um den Hals, und sie würde ihren gelben Gartenstrohhut mit dem blauen Bande auf das helle Haar setzen und an meinem Arme in den Garten gehen. Dort würden wir die herrlichen und seltenen Blumen betrachten, die wir beide pflegen, und allerlei schöne Pläne für die Zukunft spinnen und würden sehr glücklich sein.
Ja, so war es alles in meiner Phantasie. Wie meine zukünftige Frau nun beschaffen sein sollte, das war ganz genau bestimmt. Sehr schön sollte sie sein, aber nicht eine sonnenhafte Schönheit, der sich alles beugt, sondern eine sanfte, milde, deren Antlitz der Spiegel von Güte des Herzens und Innigkeit des Gemütes ist. Sie sollte mittelgroß und von einer sanften Rundung aller Formen sein, ihre Stimme wohllautend und ihr Sinn gemäßigt heiter. Sie sollte sein wie die Sonne, wenn ich komme, und wie der Mond, wenn ich gehe.
Aber es ist ein eigenes Ding um die Phantasiegestalten. Da war nun in Wirklichkeit ein kleines Mädchen, die hatte von alledem sehr wenig, aber sie war ein fröhlicher Schmetterling und sang und trällerte den ganzen Tag. Sie hatte zwei lachende braune Augen und dunkles lockiges Haar, das sie gern um das Köpfchen schüttelte, und wenn sie ins Zimmer trat, so war mir gerade, als wenn die Sonne plötzlich hinter den Wolken hervorglänzt. Ihretwegen hatte ich bald die ganze Phantasiegestalt vergessen, aber als ich dachte, der schöne Schmetterling sei mein, da flatterte er fröhlich zu einem andern. Das war eine recht betrübte Geschichte und mir wird noch jetzt oft ganz wehmütig, wenn ich daran denke. Doch das sind Träume und Dinge, die vergangen sind; genug, es ist mir nicht gelungen, mich zu verheiraten, und mich dünkt, in dieser schwierigen Welt da ist es so leicht auch nicht, wie es wohl manchmal den Anschein hat.
Ich habe nun tapfer mein liebebedürftiges Herz an fremdes Glück anranken lassen. Und Gott sei Dank, dazu ist mir ausbündigste Gelegenheit gegeben. Ich habe sieben Erstgeborene erlebt, die alle ausnehmende unbegreifliche Wunderkinder vor Gott und den Menschen waren. Und dann noch viele, viele Nachgeborene von nicht ganz so wunderbarer Natur, indem die Vorgänger schon zu viel davon vorweggenommen hatten, allein sie waren doch auch höchst merkwürdige Kinder, die durch ihre ungewöhnliche Vollendung in den Augen ihrer Mütter als seltene Erscheinungen dastanden. Allen diesen Kindern war ich der gute Onkel, und da nun die älteren schon erwachsen sind und einige schon selber Kinder haben, so bin ich nun allmählich der gute »alte« Onkel geworden.
Da sind nun die Mädchen, braune und blonde, kleine, die sich schmeichelnd an mein Knie drücken, größere, die mir lustig entgegenspringen, und erwachsene, die mich sittig begrüßen; da sind die Jungen vom krabbelnden Knirps bis zum ernsten Mann, alle mit dem Familienzug und doch alle verschieden, wie man es nur denken kann. Und das alles wächst vor mir auf, mich kennend und liebend, mir angehörig, meine Freude, meine Sorge und mein Stolz, – und da soll man nicht glücklich sein?
Ei, und da hatte ich auch genug zu thun. Wie viele Beratungen habe ich nicht mitgemacht über die ersten kurzen Kleider und über die ersten Höschen und über die ersten Bilderbücher. Dann, wenn sie größer wurden, über die Schule und dergleichen. Ja, ich bin mit der Zeit eine Autorität in solchen Dingen geworden und mein Wort ist allen Müttern gewichtig. »Onkel Ludwig hat's gesagt,« ist ein nicht gering anzuschlagendes Argument und gibt oft den Ausschlag, wenn Papa nicht einwilligen will.
Ich danke ferner dem Schöpfer, der mir ein gutes Gedächtnis für die Spiele meiner Kindheit gegeben hat. Kann wohl irgend jemand so exemplarische Drachen, Wind-, Wasser- und Sandmühlen bauen, als ich; weiß wohl jemand so viele lustige Spiele anzugeben, so viele Kinderspäße und Scherze, so viele Märchen und Geschichten zu erzählen? »Onkel,« sagte neulich mein Großneffe Friedrich, genannt Fidde, zum Unterschiede von Friede und Fritz, die seine Vettern sind und eigentlich auch Friedrich heißen, »Onkel,« sagte er mit ernster Miene, »ich glaube, es gibt gar nichts, was du nicht kannst!« Ja, so berühmt bin ich! –
Da ich gerade sieben verheiratete Geschwister habe, so brauchte ich nie in Verlegenheit zu sein, meine Abende zuzubringen, denn ich dürfte nur alle Abende zu einem andern gehen und Sonntags zum ältesten, der das Haupt der Familie ist. Allein das thue ich nun doch nicht, denn das würde Tante Veronica übel nehmen, wenn ich so wenig häuslich wäre. Man darf aber nicht schließen, daß Tante Veronica wirklich meine Tante ist, sie ist sogar nicht einmal mit mir verwandt, sondern nur eine alte, prächtige Dame, die mir die Wirtschaft führt. Darin zeigt sich eigentlich recht mein Glück, daß ich Tante Veronica zu meiner Haushälterin erworben habe. Sie ist eine saubere, etwas rundliche Dame und hat ein rosiges Gesicht mit vielen freundlichen Fältchen und zwei Löckchen, die unter einer schneeweißen Haube hervorschauen. Sie trägt stets eine mattgraue Kleidung und hat immer ein sonntägliches Wesen, wenn sie auch alle Hände voll zu thun hat. In ihrem Zimmer sind Blumen, ein Kanarienvogel, urgroßväterliche Möbel, schimmernde Sauberkeit und ein schneeweißes Bett mit weißen Vorhängen. Wenn die Sonne in das Zimmer hineinscheint, ist es eine Sehenswürdigkeit.
Tante Veronica weiß ebenso gut in meiner Familie Bescheid als ich. Alle die Neffen und Nichten jederlei Größe, die zu mir auf die Treppen heraufgestiegen kommen mit einem Anliegen, einer Bitte, oder auch mit einem: »Ich will dich nur besuchen, lieber Onkel,« vermag sie zu klassifizieren, nur mit den vielen Vornamen liegt sie im Zwiespalt und tappt gern in dem Urwald der verschiedenen Namen umher, ehe sie den richtigen trifft. Da kommt ein leichter zwölfjähriger Schritt die Treppe hinauf, es klingelt, und Tante Veronica geht, um zu öffnen. »Na Luise … Minchen … Frieda … Klara … na! Hedwig, was willst du denn?« höre ich sie auf dem Vorplatz fragen. »Tante,« antwortet eine lustige Kinderstimme, »weißt du denn nicht, in der vorigen Woche bin ich ja zwölf Jahre alt geworden, und heute wird die ›Zauberflöte‹ gegeben!« Und herein kommt Nichte Hedwig gehüpft, ganz Erwartung und freudige Aufregung, denn sie wird heute zum erstenmale mit mir ins Theater gehen. Es besteht nämlich ein geheiligtes Herkommen in unsrer Familie, daß kein Kind vor seinem zwölften Jahre ins Theater gehen darf, und da das erste Stück, das der Großvater und das der Vater gesehen haben, die »Zauberflöte« gewesen ist, so ist auch dies ehrwürdiger Gebrauch geworden. Ich habe es mir nun ein für allemal vorbehalten, mitzugehen und das Kind in die neue Wunderwelt einzuführen. Eine Quelle stets neuen Genusses gewährt es mir, die jungen unerfahrenen Gemüter zu beobachten, wie sie sich dem ersten Eindrucke gegenüber verhalten. Und alle sind sie verschieden. Da ist Adolf, der sich nie wundert, der praktische, der alles als selbstverständlich hinnimmt und bei Schlange, Feuer und Wasser nur fragt, wie es gemacht wird; Ludwig, der stumm und starr ist vor staunendem Entzücken und noch tagelang wie im Traum einhergeht; Hermann, der Naturforscher, der die Bemerkung macht: so was thäten die Schlangen gar nicht und in Afrika hätten manche Häuptlinge auch zahme Löwen; Klara, die mit zitternder Furcht und jubelnder Freude das ganze Stück begleitet, und Minchen, die sich hauptsächlich über die schönen Anzüge freut u. s. w.
Ich habe demgemäß die »Zauberflöte« siebenunddreißigmal gesehen und kann sie auswendig. In der Kinderstube ist die »Zauberflöte« ein Lieblingsgespräch, es spielt fast eine Rolle wie Weihnachten. Ja, da bin ich nun bei Weihnachten. Das ist gar eine wunderbare Zeit, und um alles in der Welt möchte ich sie nicht missen. Im Oktober fängt es schon an, und alle die süßen Reize genieße ich, alle die holden Kinderphantasien erlebe ich von neuem. Das ist dann ein Sinnen und Denken und Spintisieren und die Läden Durchmustern! Alle meine Mal-, Papp-, Tischler- und Kleisterkünste werden wieder hervorgesucht und es wird immer geheimnisvoller bei mir, so daß meine kleinen Besucher nur mit Vorsicht eingelassen werden können. Und dann nachher ist Bescherung der Reihe herum. Bei allen Familien baue ich auf in den letzten Tagen des alten Jahres, und siebenmal kehrt dieser herrliche Tag für mich wieder, der mir stets neue Genüsse bringt. Und auch mir wird beschert, an jedem Abend, in jeder Familie. Ich habe dreiundzwanzig Rückenkissen, die mir eigentlich ein Greuel sind, über die ich mich aber stets unbeschreiblich freue. Darunter sind sieben mit Katzen und vier mit Hunden und drei mit »Ruhe sanft!« Sanft ruhen sie auch, denn ich habe eine Kiste dazu, die schon halb voll ist. In dieser Kiste befinden sich auch so viele Antimacassars oder Antibaumöle, wie ich sie nenne, daß man einen ganzen Tanzsaal damit belegen könnte, und wenn ich meine Zimmer mit den Zeichnungen tapezieren wollte, die mir zu Weihnachten gemacht worden sind, so könnte ich noch Bedürftigen davon abgeben. Unter diesen Zeichnungen sind auch viele Landschaften mit Bäumen, auf denen, wie Stifter sagt, Handschuhe wachsen. Ich habe einundzwanzig Zigarrentaschen und rauche fast gar nicht, und siebzehn Kammfutterale, obgleich mein Kopf so glatt wie eine Tenne ist. Hausschlüsseltaschen kann ich jeden Tag in der Woche eine neue nehmen, und von den gekratzten und gemalten Tassen mit »Zur Erinnerung« und »Dem guten Onkel« und den sonstigen Trinkdingen will ich gar nicht reden, denn ihre Zahl ist Legion.
Von meinen Träumen über die ideale Wohnung ist doch ein wenig in Erfüllung gegangen. Sie liegt zwar hoch in einem Hinterhause, allein sie schaut doch auf schöne grüne Gärten herab. Zwei freundliche Zimmer und eine Schlafkammer nenne ich mein, und auch manch schönes Gerät, darauf mein Auge mit Freude ruht, ist darin zu finden. Manche gute Bücher sind meine stillen Freunde, – laute hab' ich ja genug, – auch mit den geträumten Sammlungen sind einige saubere Kistchen gefüllt. Ein Vogelbauer mit zierlichen ausländischen Finken steht unter Blumen und schönen Blattgewächsen bei meinem Schreibtisch, der zwar nicht prächtig geschnitzt, doch sehr bequem und traulich ist. Der Mensch muß auch nicht zu viel verlangen. So lebe ich denn vergnügt und heiter und danke meinem Schöpfer, der es so gut mit mir gefügt hat.
Zuweilen frage ich mich wohl, wie es nun fortgehen und wie es einmal enden wird?
Nun, ich hoffe, so Gott will, soll es noch eine ganze Weile so sein und bleiben wie es ist. Aber ich werde immer älter und mein Bart wird ganz weiß werden, und dann wird endlich der Tag kommen, wo ich nicht mehr bin. – Und sie werden mich feierlich zu Grabe bringen an jene Stelle auf dem alten Kirchhofe, die ich mir schon auserwählt habe, an jene Stelle, wo es so einsam und friedlich ist und wo ich so gerne saß, um auf die Stadt hinzusehen, die trotz Gewühl und Gewirr und Getreide, das in ihr ist, so friedlich in blauem Dämmer daliegt. – Und sie werden viele Kränze auf mein Grab legen und Rosen darauf pflanzen, weil ich die Rosen so sehr geliebt habe. – Dann werden die Kränze verwelken und das Grab wird grün werden und die Rosen in die Höhe wachsen und in jedem Frühling voll Blüten sein. – Zuweilen werden noch einige kommen und frische Kränze auf mein Grab legen, aber die Jahre vergehen und es werden immer weniger sein. – Und zuletzt wird niemand mehr kommen. – Dann werden die Rosen mächtig herangewachsen sein und breit hinranken über das Grab, daß es im Frühling wie ein blühender Rosenhügel daliegt. – Und eines Abends wird ein kleiner Vogel kommen und sich auf einen blühenden Zweig setzen und im stillen Schein des Abendrots sein Liedchen singen. – Und dann wird er vergessen sein: »der gute alte Onkel.«