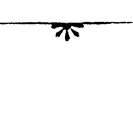|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++


 Ich glaube, es war von Kind auf an nicht ganz richtig mit ihm. In den Augen seiner Eltern, deren einziger Sohn er war, galt er für ein Genie, und seine Mutter hatte um ihn von Anfang an ein Netz wunderbarer Sagen über seine frühzeitige und unheimliche Intelligenz gesponnen. Ich schweige von den Thaten seiner ersten Kindheit, die in den Augen seiner Eltern mit einer Fülle von geheimnisvollen Genieblitzen durchwoben war, sondern fange dort an, wo meine eigene Kenntnis beginnt. Er war in meinem Alter, und als ich ihn zuerst sah, zählten wir beide zwölf Jahre. Mir ist noch genau in Erinnerung die sonderbare Art, mit der er sich seitwärts an mich heranschob, indem er dabei eifrig nach meinem Kopfe schielte. Er war es nämlich gewohnt, mit gleichalterigen Knaben fortwährend gemessen und verglichen zu werden, und so erklärt sich das merkwürdige Verfahren. Wir wurden zusammen in den Garten geschickt, allein ich vermochte nicht viel mit ihm anzufangen, da er von den Dingen, die nach meiner Ansicht für Knaben meines Alters einzig und allein würdig und angemessen waren, gar keine Ahnung
zu haben schien. Wenn ich mich stehend schaukelte, daß ich hoch in die Aeste des Lindenbaumes flog, so sah er mir mit offenem Munde und sichtlichem Entsetzen zu; wenn ich in einen allerdings noch sehr grünen Apfel biß, so schauderte seine wohlerzogene Seele; als ich am Teich in einen Baum kletterte und mich auf einem schwanken Aste über dem Wasser wiegte, da war ihm dies wiederum ein grausiges Unternehmen, und als ich nun gar auf einem schmalen Baumstamm über den Bach balancierte, da las ich kreideweißes Entsetzen in seinen Zügen. Dies alles war mir natürlich sehr schmeichelhaft und spornte mich zu ferneren Thaten an, allein sehr mißfiel es mir doch, daß er auf alle meine Aufforderungen zur Nacheiferung immer nur antwortete: »Das darf ich nicht.« Dies erschien mir äußerst kläglich und unmännlich und zudem unpraktisch, denn wenn man immer nur that, was man durfte, war doch am Ende das Leben seines schönsten Reizes beraubt. Schließlich empfand ich ein kaum abzuweisendes Bedürfnis, ihn durchzuprügeln, unterdrückte jedoch diesen Trieb mehr aus Klugheit als aus Rücksichten der Tugend, denn ich fürchtete eine allzu kräftige Verzinsung des ausgegebenen Kapitals von der starken Hand meines Vaters. Daher begnügte ich mich damit, ihn gelegentlich bloß in das Gras zu schubsen, so daß er zwei wunderschöne, grüne Knieflecke in seinen schneeweißen Hosen davontrug und sich über diese Entstellung heulend in die sicheren Arme seiner Mutter flüchtete. Ich kam dafür mit einer
Maulschelle davon und Emilchen kriegte neue Hosen an. Nun aber drehte sich der Spieß um, und als wir uns beide im Zimmer bei den Eltern der Sittsamkeit befleißigen mußten, was ihm sehr leicht wurde, mir aber mit Aufbietung meiner ganzen Verstellungskunst nur mäßig gelang, da kam er auf den Gebieten zur Geltung, die ihm geläufig waren, und es stellte sich heraus, daß er besonders in den Künsten glänzte. Vor kurzem war die Familie in Schwerin gewesen, und da hatte das wunderbare, soeben vollendete Schloß einen solchen Eindruck auf den begabten Emil gemacht, daß er seitdem bestrebt war, es immer und immer wieder zu zeichnen, so daß die glückliche Mutter schon eine ganze Reihe solcher Entwürfe hatte sammeln können. Es war immer ein mächtiger Salat von Türmen, Giebeln und ungezählten Fenstern, und obwohl keine dieser Zeichnungen eine wirkliche Aehnlichkeit mit ihrem Vorbilde aufwies, so sahen die beseligten Eltern dennoch die Spuren des Genius darin und in ihrem Söhnlein einen zukünftigen Oberbaurat. Ich dachte im stillen, ob wohl der künstlerische Emil einen solchen Kaninchenstall bauen könne, wie ich mir zu Hause einen gemacht hatte, ordentlich aus Steinen und Holz, mit einer Thür und einem kleinen Glasfenster, regendicht und windgeschützt. Oder eine solche Hütte aus Brettern und Weidengeflecht, wie ich sie mir in einem verborgenen Winkel des Gartens errichtet hatte, inwendig mit alten Bastmatten ausgeschlagen und mit einem ordentlichen Herde aus Steinen, auf dem ein wirkliches
Feuer brannte, während ich, der große Indianer »Fliegender Büffel«, heimgekehrt von gewaltigen Jagd- und Kriegszügen, auf der Bärenhaut ruhte und mit meinem Stammesgenossen, dem Inspektorssohne, der den Indianernamen »Toller Hund« führte, eine Friedenspfeife Kartoffelkraut rauchte. Ich fürchtete, er würde alles dieses nicht können.
Ich glaube, es war von Kind auf an nicht ganz richtig mit ihm. In den Augen seiner Eltern, deren einziger Sohn er war, galt er für ein Genie, und seine Mutter hatte um ihn von Anfang an ein Netz wunderbarer Sagen über seine frühzeitige und unheimliche Intelligenz gesponnen. Ich schweige von den Thaten seiner ersten Kindheit, die in den Augen seiner Eltern mit einer Fülle von geheimnisvollen Genieblitzen durchwoben war, sondern fange dort an, wo meine eigene Kenntnis beginnt. Er war in meinem Alter, und als ich ihn zuerst sah, zählten wir beide zwölf Jahre. Mir ist noch genau in Erinnerung die sonderbare Art, mit der er sich seitwärts an mich heranschob, indem er dabei eifrig nach meinem Kopfe schielte. Er war es nämlich gewohnt, mit gleichalterigen Knaben fortwährend gemessen und verglichen zu werden, und so erklärt sich das merkwürdige Verfahren. Wir wurden zusammen in den Garten geschickt, allein ich vermochte nicht viel mit ihm anzufangen, da er von den Dingen, die nach meiner Ansicht für Knaben meines Alters einzig und allein würdig und angemessen waren, gar keine Ahnung
zu haben schien. Wenn ich mich stehend schaukelte, daß ich hoch in die Aeste des Lindenbaumes flog, so sah er mir mit offenem Munde und sichtlichem Entsetzen zu; wenn ich in einen allerdings noch sehr grünen Apfel biß, so schauderte seine wohlerzogene Seele; als ich am Teich in einen Baum kletterte und mich auf einem schwanken Aste über dem Wasser wiegte, da war ihm dies wiederum ein grausiges Unternehmen, und als ich nun gar auf einem schmalen Baumstamm über den Bach balancierte, da las ich kreideweißes Entsetzen in seinen Zügen. Dies alles war mir natürlich sehr schmeichelhaft und spornte mich zu ferneren Thaten an, allein sehr mißfiel es mir doch, daß er auf alle meine Aufforderungen zur Nacheiferung immer nur antwortete: »Das darf ich nicht.« Dies erschien mir äußerst kläglich und unmännlich und zudem unpraktisch, denn wenn man immer nur that, was man durfte, war doch am Ende das Leben seines schönsten Reizes beraubt. Schließlich empfand ich ein kaum abzuweisendes Bedürfnis, ihn durchzuprügeln, unterdrückte jedoch diesen Trieb mehr aus Klugheit als aus Rücksichten der Tugend, denn ich fürchtete eine allzu kräftige Verzinsung des ausgegebenen Kapitals von der starken Hand meines Vaters. Daher begnügte ich mich damit, ihn gelegentlich bloß in das Gras zu schubsen, so daß er zwei wunderschöne, grüne Knieflecke in seinen schneeweißen Hosen davontrug und sich über diese Entstellung heulend in die sicheren Arme seiner Mutter flüchtete. Ich kam dafür mit einer
Maulschelle davon und Emilchen kriegte neue Hosen an. Nun aber drehte sich der Spieß um, und als wir uns beide im Zimmer bei den Eltern der Sittsamkeit befleißigen mußten, was ihm sehr leicht wurde, mir aber mit Aufbietung meiner ganzen Verstellungskunst nur mäßig gelang, da kam er auf den Gebieten zur Geltung, die ihm geläufig waren, und es stellte sich heraus, daß er besonders in den Künsten glänzte. Vor kurzem war die Familie in Schwerin gewesen, und da hatte das wunderbare, soeben vollendete Schloß einen solchen Eindruck auf den begabten Emil gemacht, daß er seitdem bestrebt war, es immer und immer wieder zu zeichnen, so daß die glückliche Mutter schon eine ganze Reihe solcher Entwürfe hatte sammeln können. Es war immer ein mächtiger Salat von Türmen, Giebeln und ungezählten Fenstern, und obwohl keine dieser Zeichnungen eine wirkliche Aehnlichkeit mit ihrem Vorbilde aufwies, so sahen die beseligten Eltern dennoch die Spuren des Genius darin und in ihrem Söhnlein einen zukünftigen Oberbaurat. Ich dachte im stillen, ob wohl der künstlerische Emil einen solchen Kaninchenstall bauen könne, wie ich mir zu Hause einen gemacht hatte, ordentlich aus Steinen und Holz, mit einer Thür und einem kleinen Glasfenster, regendicht und windgeschützt. Oder eine solche Hütte aus Brettern und Weidengeflecht, wie ich sie mir in einem verborgenen Winkel des Gartens errichtet hatte, inwendig mit alten Bastmatten ausgeschlagen und mit einem ordentlichen Herde aus Steinen, auf dem ein wirkliches
Feuer brannte, während ich, der große Indianer »Fliegender Büffel«, heimgekehrt von gewaltigen Jagd- und Kriegszügen, auf der Bärenhaut ruhte und mit meinem Stammesgenossen, dem Inspektorssohne, der den Indianernamen »Toller Hund« führte, eine Friedenspfeife Kartoffelkraut rauchte. Ich fürchtete, er würde alles dieses nicht können.
Aber auch der Dichtkunst frönte er und hatte schon in seinem sechsten Jahre folgendes Epigramm angefertigt:
»Unsere Scheune hat ein Dach,
Hinterm Garten fließt der Bach«,
durch welche Leistung den beglückten Eltern klar ward, daß auch der Kuß der Muse die Stirne ihres Emil berührt hatte. Seitdem war von ihm bereits ein ganzes Heft vollpoetisiert worden, das die Aufschrift trug: »Gedichte von Emil Rautenkranz, erster Band«, und der beglückte Vater konnte nicht umhin, einige Perlen aus dieser Sammlung zum besten zu geben, während der jugendliche Autor ziemlich geschwollen daneben saß. Ich ward davon nicht sehr ergriffen, denn dichten konnte ich auch, hütete mich jedoch sehr, damit heraus zu kommen, weil sich meine Verse vorzugsweise im satirischen Genre bewegten und ich mich vor dem wohlverdienten Honorar fürchtete, das mir sicher war, wenn zum Beispiel folgende, halb lateinischen, halb plattdeutschen Verse auf meinen Klassenlehrer, Herrn Hamann, der aus Hessen stammte und eine ziemlich gelbe Gesichtsfarbe zur Schau trug, ans Licht gedrungen wären:
»
Unus, duo, tres,
Herr Hamann is'n Heß!
Semel, bis, ter, quater,
Gäl is he as'n Tater!«
Im ernsthaften Genre war ich allerdings nicht
über einen Anfang hinausgekommen, der lautete:
»Gefolgt von zweien Mohrenknaben
Begab sich Omar auf die Jagd …
Weiter gedieh das Gedicht niemals, da mir durchaus nichts mehr einfallen wollte.
Die größte Prüfung stand mir aber noch bevor, denn Emil war auch musikalisch, und zwar war dies seine Glanzseite. Er wurde demnach ans Klavier beordert und fingerte eine Sonate von Clementi mit einer mir unbegreiflichen Fixigkeit herunter, während die glücklichen Eltern dabei saßen und strahlten wie Alpengipfel beim Sonnenaufgang. Dies war nun etwas, das ich wirklich anerkennen mußte, obwohl es mir ganz ungewöhnlich sauer wurde, denn wenn auch schon Lateinisch nicht schön und Griechisch gar ein Greuel war, so war das allergrößte Schrecknis doch die Klavierstunde und das dazu gehörige Ueben. Meine Mutter ergriff natürlich die Gelegenheit, mir den talentvollen, fleißigen Emil als ein glänzendes Muster vorzuhalten, wodurch sich meine Abneigung gegen diesen nur noch vermehrte, indem ich weiter nichts empfand als eine nagende Reue, ihn vorhin, als die Gelegenheit so günstig war, nicht doch durchgeprügelt zu haben. Dies Musterbeispiel hat auch bei mir keine Früchte getragen und trotz achtjährigem Klavierunterricht bin ich musikalisch rein geblieben. Mein einziger Ersatz für diese langjährige Qual ist das erhebende Bewußtsein, drei Klavierlehrer bis an den Rand des Grabes geärgert zu haben, indem es mir gelang, in jeglicher Stunde bei jedem den brennenden Wunsch zu erwecken, an den Wänden in die Höhe zu laufen, und solche Stimmung bei ihm zu erzeugen, daß er den Tag verfluchte, an dem er geboren war. Wer will mich darum schelten? Das Recht des Angegriffenen ist die Notwehr, und ich habe mich dieses Rechtes bedient, so gut ich konnte.
Meine musikalischen Neigungen gingen vorzugsweise auf den Instrumentenbau, und da war ich fest überzeugt, daß ich mehr leistete als der brave Emil. Ob er wohl Flöten machen konnte aus Weiden oder Rohr, und Schalmeien aus spiralförmig gewickelter Baumrinde, Blasinstrumente aus Kälberkropf und Quietschen aus Kalmus? Ob er wohl auf Kuhhörnern und Gießkannen und Pustrohren blasen konnte wie ich und auf den Fingern pfeifen, daß man es durchs ganze Dorf hörte? Das war es, was ich sehr bezweifelte.
Solcher Art war meine erste Begegnung mit Emil Rautenkranz und seitdem bin ich in der Lage gewesen, seinen Lebensgang zu verfolgen. Ich kann wohl sagen, daß er mir jetzt Mitleid einflößt, wenn ich bedenke, wie seine Eltern trotz ihrer Affenliebe mit ihm umkamen. Der Vater, der auf einer wohldotierten Landpfarre nicht viel zu thun hatte und zu allerlei Versuchen und spitzfindigen Unternehmungen hinneigte, hatte an seinem einzigen Sohne von frühester Kindheit an alle pädagogischen Systeme ausgeübt, deren er nur habhaft werden konnte, so daß der unglückliche Emil auf alle möglichen Arten erzogen wurde, nur nicht auf eine richtige. Er wurde überhaupt Tag und Nacht immer in einem fort erzogen und zu jeder Zeit ohne Unterlaß wurden Anlagen in ihm entwickelt. Zudem mußte er alle die gesundheitlichen Schrullen mitmachen, mit denen der an allerlei wirklichen und eingebildeten Krankheiten leidende Vater an sich herumexperimentierte. Einmal ergaben sie sich der naturgemäßen Lebensweise, schliefen auf Stroh, ernährten sich von rohem Fleisch und ungekochten Rüben, wobei sie so herunterkamen, daß sie beide kaum noch einen Schatten werfen konnten, ein andermal verbesserten sie ihre Säfte durch eine fürchterliche Kur, bei der sie sich ausschließlich mit trockenem Weißbrot stopften und ein wenig sauren Moselwein dazu tranken, und wieder ein andermal versuchten sie alle Ungesundheit mit Wasser aus sich herauszuspülen, indem sie ungeheure Mengen dieser reinlichen Flüssigkeit in sich hineinpumpten und jegliche Nacht in einem nassen Umschlage verbrachten. Emil Rautenkranz ist mir überhaupt immer ein glänzendes Beispiel dafür gewesen, was die menschliche Natur alles aushalten kann, denn trotz aller dieser Kuren und trotz der unglaublichen geistigen Ueberfütterung, die ihm zu teil ward, blieb er körperlich doch ganz gesund. Nur sein armer Kopf ist ihm schon auf dem Gymnasium ganz zermürbt worden, denn außer dem Schulunterricht mußte er unablässig von einer Privatstunde in die andere rennen, von der Zeichenstunde in die Klavierstunde, von der italienischen in die spanische. Er lernte Stenographie und Mnemotechnik, und schließlich hatte die Made der Gelehrsamkeit sein bißchen Grips ganz verzehrt, so daß nur noch etwas Wurmmehl in seiner verödeten Hirnschale zu finden war. Deshalb gelang es ihm auch nicht, obwohl er endlich durch zähe Ausdauer die Prima ersessen hatte, die Abgangsprüfung hinter sich zu bringen, trotzdem er den Versuch dazu zweimal anstellte. Nur in der Musik hatte er es zu einigen wirklichen Kenntnissen und im Klavierspiel zu einer erträglichen Fertigkeit gebracht, was weiter nicht zu verwundern ist, denn wie man täglich sehen kann, erfordert die Ausübung dieser Kunst den geringsten Aufwand von Phantasie, Verstand oder geistiger Klarheit, ja selbst ein halber Idiot kann immer noch ein tüchtiger Geiger oder Klavierspieler sein, und so niedere Geschöpfe wie die Zigeuner treffliche Musik machen. Ist sie doch die einzige Kunst, die sogar von Tieren in vollendeter Weise ausgeübt wird. Darum lag es nahe, den jungen Mann diesem Berufe zu widmen, weshalb er denn nach langen elterlichen Verhandlungen und nachdem von allen Seiten Ratschläge in Menge eingeholt worden waren, nach Berlin gesendet wurde, um »sich auszubilden«.
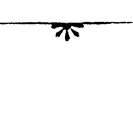
Ich hatte unterdes das Gymnasium bereits in Tertia verlassen, hatte als Maschinenbauer in verschiedenen Fabriken gearbeitet, war eine Weile in Hannover auf dem Polytechnikum und längere Zeit in einer größeren Maschinenbauanstalt als Konstrukteur thätig gewesen, bis ich endlich in meinem vierundzwanzigsten Jahre nach Berlin kam, um auf der Gewerbeakademie noch einige Jahre zu studieren. Ich traf dort meinen alten Freund Abendroth, der sich schon längere Zeit dort aufhielt. Eines Tages fragte mich dieser: »Hast du den Nachbar der Sterne schon besucht?«
»Wer ist das?« fragte ich etwas verwundert über diese Bezeichnung. »Nun, unser musikalischer Emil,« antwortete Abendroth, »er wohnt fünf Treppen hoch in der Kochstraße bei den Sternen, dem Himmel so nahe, daß er die Sphärenmusik vernimmt und in stillen kalten Winternächten den großen Bären brummen hört. Ich bin überzeugt, wenn er zum Schornstein hinausklettert, kann er in der Milchstraße spazieren gehen. Um sein Haupt bewegt sich als eine glänzende Aureole zukünftigen Ruhmes der ganze Tierkreis mit seinen funkelnden Sternbildern, und der Mond, der, wie du weißt, gerne mal raucht, bittet sich zuweilen Feuer von ihm aus. Emil kann von sich sagen wie der Knab' vom Berge:
»Die Sonne strahlt am ersten hier,
Am längsten weilet sie bei mir; …«
denn wenn schon alle Straßen in Dämmerung versunken sind – bei ihm ist noch heller Sonnenschein; ich glaube, um Johannis geht sie dort überhaupt nicht unter.«
Ich sah aus dieser Darstellung, daß mein Freund Abendroth seine alte Freude an humoristischer Uebertreibung noch nicht verloren hatte, und fragte ihn lächelnd, wo man Gelegenheit hätte, Freund Rautenkranz zu treffen.
»Nirgendswo,« sagte Abendroth, »als einmal zufällig auf der Straße, im Konservatorium oder bei sich zu Hause. Sonst geht er an keinen öffentlichen Ort, nur am Sonntag nachmittag sitzt er bei Buchholz und schleckt eine Tasse Schokolade mit Schlagsahne und eine Menge süßen Kuchen. Dies ist aber seine einzige Ausschweifung. In der ersten Zeit habe ich ihn nach langer Bearbeitung in den ›Verein der Löwenbändiger‹ eingeführt – wir trinken dort nämlich Löwenbräu und jeder Schoppen heißt ein ›Löwe‹ – allein für das Löwenbändigen hat er weder Sinn noch Talent, und ich habe ihn nie wieder bewegen können, mitzugehen. Er hat dann stets ›einen höchst wichtigen Brief zu schreiben‹ oder sonst einen anderen miserabelen Vorwand. Aber besuchen thu ich ihn manchmal, teils weil Treppensteigen gesund ist, teils weil es mir Vergnügen macht, und teils, weil die Alte, seine Mutter, eine geniale Hand für mecklenburgische Mettwurst hat. Ich glaube, alle vierzehn Tage fast kommt ein Paket mit Fressabilien für ihn an, so daß er wirklich Hilfe braucht, um alles zu bewältigen. Erst heute morgen, als ich ihm zufällig begegnete, fragte er mich geheimnisvoll, wie lange sich wohl eine gebratene Rehkeule hielte, er hätte heute morgen eine von Hause bekommen. Ich sagte natürlich: Gar nicht, sie müßte auf der Stelle verputzt werden. Da wurde er ganz sentimental und flehte mich an, ich solle ihm doch heute abend dabei helfen. Natürlich kommst du dann mit und erneuerst die alte Bekanntschaft.«
Ich fand Emil Rautenkranz fast unverändert, er sah noch ebenso aus, wie vor zwölf Jahren, nur daß er größer geworden war. Dasselbe unfertige, erdgraue und glatte Gesicht, denn ein Bart wollte durchaus auf dem Boden seines Antlitzes nicht gedeihen, nur um die Kinnbacken herum saßen einige spärliche, gelbgraue Flausen. Ich glaubte sogar zu bemerken, daß er nach der ersten Begrüßung wieder wie damals seitwärts nach meinem Kopfe schielte. Als wir uns von den Strapazen des Aufstiegs erholt hatten, fuhr er seine eßbaren Schätze auf und begann mit einer ganz ungewöhnlichen Ungeschicklichkeit Thee zu kochen. Nachdem eine Überschwemmung von brennendem Spiritus glücklich beseitigt und der Thee endlich fertig war, goß er eine wasserklare Flüssigkeit in unsere Tassen. »Der ist aber verdammt dünn,« sagte Abendroth.
»Ich weiß nicht, ich weiß wahrhaftig nicht, woran es liegt,« erwiderte Rautenkranz, indem er sich verwirrt in die Haare fuhr, »aber er sieht aus wie Wasser.« »Schmeckt auch wie Wasser,« sagte Abendroth, nachdem er einen Theelöffel der verdächtigen Flüssigkeit zum Munde geführt hatte. »Ist auch Wasser!« fiel ich ein, denn einem dunklen Verdachte Raum gebend, hatte ich den Deckel der Kanne abgehoben und gefunden, daß Rautenkranz versäumt hatte, Thee hineinzuthun. Nun, dieser Fehler ließ sich schnell beseitigen, und bald waren wir eifrig beschäftigt, die gute Rehkeule am Verderben zu hindern. Emil erzählte uns derweil von seinen Arbeiten und Bestrebungen. Er war in eins der vielen Konservatorien eingetreten, die unter Leitung irgend eines Mannes, der sich als Musiker oder auch bloß durch Reklame einen Namen gemacht hat, das Bestreben an den Tag legen, so viele Menschen als möglich zur Musik abzurichten und die Zahl überflüssiger Virtuosen, unglücklicher Klavierlehrerinnen und heilloser Dilettanten aufs möglichste zu vermehren. Zuweilen gibt es der Zufall, daß aus solcher Anstalt einmal ein wirklicher Künstler hervorgeht, und dies dient ihr dann zu glänzendem Ruhme und verfehlt nicht, ihr reichlich neue Opfer zuzuführen, denn die große Herde ist immer der Ansicht, es ließe sich in der Kunst alles lernen und es käme nur auf den Lehrer an. In den »neuen Fiedelliedern« Theodor Storms heißt es:
»Am Markte bei der Kirchen
Da steht ein klingend Haus;
Trompet' und Geige tönen
Da mannigfalt heraus.«
Ach, solcher Häuser gibt es viele, viele in Berlin, nur daß statt der Trompete das Donnern der Klaviere vorherrscht und markdurchdringende Solfeggien weiblicher Stimmen. Dort sieht man Tag für Tag große und kleine Mädchen mit Musikmappen aus- und eingehen und nervöse Jünglinge, deren einzige Aehnlichkeit mit ihrem großen Vorbilde Liszt ihre langen Haare bilden. Ich glaube, die jungen Menschen würden sich, um ihrem Idol noch näher zu kommen, Warzen stehen lassen im Gesicht, wenn sie nur wüßten, wie das zu machen wäre. In diesen Häusern werden, wenn man alles zusammenaddiert, täglich viele Pferdekräfte auf die Bewegung von Tasten und Geigenbogen verwendet und ungezählte Kubikmeter Luft verbraucht, um Stimmritzen zum Tönen zu bringen. Nur Stocktaube oder Leute mit Nerven von Gußstahl vermögen es, unter oder über einem solchen Konservatorium zu wohnen, ohne in kurzer Zeit geistig zu Grunde zu gehen.
In ein solches Institut war Emil Rautenkranz eingetreten und trieb dort nach gewohnter Weise alles, was er nur in den Tag hineinpferchen konnte, und übte außerdem zu Hause mindestens vier Stunden täglich schreckliche Etuden. Daneben plagte ihn auch die Lust, etwas zu komponieren. Aber er gestand ehrlich: »Wenn ich abends aus der Oper oder aus dem Konzert heimkomme, da habe ich immer Ideen genug, aber wenn ich zu Hause vor dem Notenpapier sitze, da fällt mir durchaus nichts ein. Ganz besonders will es mir nicht gelingen, hübsche und interessante Motive zu finden – mein Kompositionslehrer lacht immer so schrecklich über sie und ich gebe mir doch so viel Mühe.«
Mein Freund Abendroth, der sehr musikalisch war, jedenfalls mehr als Rautenkranz, saß so, daß er aus dem Fenster sehen konnte. Man blickte dort auf ein ungeheures Meer von Dächern, Giebeln, Türmen und Telephonleitungen, das sich fern in einen graublauen Dämmer verlor. Nicht weit von dem Fenster führte eine Nebenleitung von fünf Drähten vorüber, und auf diesen saßen gerade vier Schwalben, die sich ausruhten. Es zuckte Abendroth etwas um die Mundwinkel, als er jetzt sehr ernsthaft begann: »Lieber Freund, ich begreife nicht, wie du um Motive verlegen sein kannst, sieh doch nur aus dem Fenster, wie die vier Schwalben auf den Telephondrähten sitzen gleich Noten auf ihren Linien, da hast du gleich ein Motiv f, a, d, c sehr niedlich – die Schwalbe ist doch ein musikalischer Vogel.«
Emil sah zuerst ziemlich dumm aus, dann blickte er auf die Schwalben und seine Züge verklärten sich allmählich: »Wahrhaftig, es stimmt,« sagte er, »das ist aber höchst wunderbar.« »Ja, lieber Freund,« sagte Abendroth dann, »das Gute liegt auf der Straße und fliegt in der Luft, nur auf das Finden kommt es an. Du weißt, der ist der Klügste, der andere für sich arbeiten läßt, laß du die Schwalben für dich arbeiten. Ich bin überzeugt, diese so überaus musikalischen Vögel können sich vermöge eines ihnen innewohnenden, geheimnisvollen Gesetzes gar nicht anders auf fünf Drähte setzen, als daß sie irgend eine wohlklingende Tonfolge bilden.«
Aus irgend einem Grunde veränderten jetzt drei der Schwalben aufflatternd ihren Sitz, so daß die Tonfolge e, h, g, e entstand. »Aber das ist doch nicht hübsch,« sagte Rautenkranz nach einer Weile, »das klingt schlecht.« »O bewahre,« sagte Abendroth sehr überlegen, »die Sache geht aus F-dur und somit heißt es c, b, g, e, und das paßt außerordentlich gut zu dem Vorhergehenden; setze es nur zusammen, dann erhältst du: f, a, d, c, c, b, g, e, und das ist doch sehr hübsch. Was willst du denn mehr?«
»Wahrhaftig,« sagte Rautenkranz wieder freudig verblüfft, »nein, das ist aber doch zu merkwürdig.«
»Sieh mal,« fuhr Abendroth nun mit fast verbrecherischer Ernsthaftigkeit fort, »da kannst du dir nun den ganzen Sommer lang von den klugen Schwalben Leitmotive arbeiten lassen, denn ohne diese geht es doch heute nicht mehr, es ist noch immer das Modernste, und wenn du genug zusammen hast, da wollte ich mal den sehen, der dich dran hindern wollte, eine mächtige, große Oper zu komponieren. Oder besser noch, gleich drei bis vier, die alle zusammenhängen. Ich kann dir einen höchst geräumigen und musikalisch noch kaum vernutzten Stoff empfehlen, das ist die Völkerwanderung. Ich glaube kaum, daß sie unter sieben Opern zu bewältigen ist. Ja, eine Heptalogie, das ist das einzig Wahre. Gerade eine Woche muß das Ganze dauern, Sonntags die erste und am Sonnabend die letzte Oper. Von wüstenhafter Ausdehnung muß jetzt alles sein, wenn es bemerkt werden soll. Das Wilmersdorfer Unland achtet keiner, aber vor der Lüneburger Heide hat man Respekt. Gottfried Keller hat ein kleines Büchlein geschrieben, das zu dem Reizvollsten gehört, das je in deutscher Sprache gedichtet wurde, die ›Sieben Legenden‹, aber wie wenige gibt es, die das beachten. Freytags ›Ahnen‹ dagegen in ihrer erhabenen Ausdehnung kennt jeder.«
»Ja, mein Sohn,« fuhr er dann fort, »wenn du dann die sieben Opern fertig hast, wirst du jedenfalls furchtbar berühmt werden und eine riesige Gemeinde um dich sammeln. Man wird in deinem geliebten Vaterlande entweder in Kriewitz oder in Teterow ein ungeheures Rautenkranz-Theater bauen, in dem sich kein mystischer Abgrund, sondern eine mystische Höhe befindet, denn du wirst das Orchester über dem Schnürboden anbringen und damit ungeahnte Wirkungen erzielen. Und alljährlich im Sommer, wenn es am heißesten ist, wird eine Völkerwanderung beginnen nach Kriewitz oder Teterow, um die ›Völkerwanderung‹ zu hören, und alle Bierwirte und Selterswasser-Verkäufer in jener Gegend werden dich anbeten. Dein Name wird unter die Sterne versetzt werden und mit Recht wird man dich, dann im Ernste, wie jetzt im Scherze, nennen: ›Nachbar der Sterne‹.«
Rautenkranz sah ganz ungewöhnlich verblüfft aus, als Abendroth diese lange Rede hinter sich hatte, und glotzte bald ihn, bald mich mit seinen hellgrauen, nichtssagenden Augen verständnislos an. Ich muß nun hier notgedrungen einflechten, daß, obwohl ich meinen Freund Abendroth als einen gutmütigen und wohlwollenden Menschen kannte, es mir doch an diesem Abend beinahe so vorkam, als hielte er Emil Rautenkranz fast ein wenig zum besten. Dieser aber, der von Ironie und Humor oder ähnlichen Zwittergeschöpfen des menschlichen Geistes nicht die geringste Ahnung hatte, grinste endlich doch sehr geschmeichelt und meinte, so weit wäre es doch wohl noch lange nicht.
Dann ging er ans Klavier, um uns etwas vorzuspielen, einige von den modernen, schwierigen Sachen, die in das Gebiet der Jongleur-Kunst gehören. Die turnerische Geschicklichkeit seiner Finger war durch unausgesetzte Uebung nicht unbeträchtlich, jedoch weder Herz noch Gemüt, ja nicht einmal der Verstand waren an seinem Spiel beteiligt; alles war mühsam angelernt, und was er konnte, verdankte er ausschließlich einer ungewöhnlichen Ausdauer seines Sitzfleisches. Abendroth flüsterte mir zu: »Spielt er nicht gerade so, als ob ihn der Akustiker Kaufmann in Dresden mit großer Sorgfalt gearbeitet hätte. Ich weiß, auf welche Art ein Geschäft mit ihm zu machen wäre. Er müßte einen Unternehmer finden, der mit ihm auf Reisen geht. Bei Beginn der Vorstellung würde ein Flügel und ein großer Kasten auf der Bühne stehen. Der Unternehmer tritt auf, hält eine kleine Rede etwa folgenden Inhalts: ›Langjährige Bemühungen … ungeheure Geldopfer … endliches Gelingen … höchst sinnreicher Musik-Automat …‹ etc. etc. Dann macht er den Kasten auf, nimmt Rautenkranz heraus, zieht ihn sorgfältig auf, trägt ihn ans Klavier, legt ihm den Fuß auf das Pedal und die Hände auf die Tasten, drückt scheinbar auf einen Knopf im Genick und dann spielt Rautenkranz los. Natürlich frenetischer Beifall, denn keine Seele wird darauf verfallen, daß da wirklich ein Mensch arbeitet.«
Als wir nun endlich auch musikalisch vollständig gesättigt waren, verabschiedeten wir uns dankend für die gewährten Genüsse, verließen den Nachbar der Sterne und begaben uns wieder auf den Abstieg in das Reich der gewöhnlichen, niederen Sterblichen, wo wir desselbigen Abends noch unterschiedliche Löwen bändigten.
* * *
Ich weiß nicht, ob sich irgend jemand dafür interessiert, zu erfahren, was aus dem Nachbar der Sterne später geworden ist. Sollte es dergleichen Neugierige geben, so diene ihnen zur Nachricht, daß er sich noch mehrere Jahre lang in Berlin immerfort ausbildete und dann in die Stadt zurückkehrte, wo er das Gymnasium besucht hatte. Seine Eltern waren unterdes gestorben und hatten ihm ein angenehmes Vermögen hinterlassen. Er kaufte sich ein kleines Haus mit einem Garten in der Vorstadt und lebt dort mit einer Tante, die mütterlich für ihn sorgt. Er gibt einige Klavierstunden und spielt zuweilen in Wohlthätigkeitskonzerten, bei welchen Gelegenheiten die musikalisch genügsamen unter seinen Mitbürgern seine rapiden Läufe, unfehlbaren Oktaven-Gänge und reinlichen Triller höchlichst bewundern und ihn für ein musikalisches Licht halten, denn er ist ja in Berlin auf dem Konservatorium des berühmten Kullerhahn vier Jahre lang »ausgebildet« worden. Er lebt, wie er es gewohnt ist, immer so öde für sich hin und ist ganz glücklich, denn das Essen schmeckt ihm und seine Verdauung ist normal. Ob es wahr ist, daß er vor den Fenstern seines Arbeitszimmers fünf Drähte hat ziehen lassen und dort den Schwalben noch immer Motive ablauert, sowie, daß er mit den Vorarbeiten zu seiner Heptalogie »die Völkerwanderung« schon drei dicke Bände gefüllt hat, kann ich nicht mit Sicherheit verbürgen. Mein Freund Abendroth behauptete es zwar, allein mein langjähriger Umgang mit ihm hat mich die Vorsicht gelehrt, seinen Versicherungen nicht ohne ernste Prüfung Glauben zu schenken. Sein Respekt vor den Thatsachen ist leider so gering, daß er stets geneigt ist, den Gebilden seiner Phantasie gleiche Rechte einzuräumen mit den Ergebnissen einer wahrheitsgetreuen historischen Forschung. Ich glaube, wollte ich mich kürzer ausdrücken, könnte ich fast sagen: »Er lügt manchmal ein bißchen.« Aber in diesem Sommer werde ich selber hinreisen und Emil Rautenkranz mal besuchen – nun, da werden wir ja sehn!