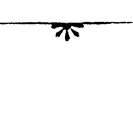|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++


 Ich war etwa eine Stunde lang durch die letzte Kunstausstellung gewandert und hatte genug. Durch die Natur kann ich den ganzen Tag schweifen, ohne satt zu werden, wenn aber einige hundert Maler mit einigen tausend meist mittelmäßigen Bildern über mich herfallen, da haben sie mich bald mürbe. Es ist ja leider ein Zeichen der Zeit, daß heutzutage bei weitem zu viel studiert, gedichtet, gebildhauert und vor allen Dingen auch gemalt wird, weit über den Bedarf hinaus und meist von Unberufenen, so daß sich die Säle unsrer Ausstellungen mit Mittelgut und Ueberflüssigem füllen. Es gibt ja immer noch einige Oasen in dieser Farbenwüste, wie zum Beispiel vor einigen Jahren »Das Spiel der Wellen« von Böcklin, aber was ist sein Schicksal gewesen. Der Kunsthändler, der es kaufte, ist damit sitzen geblieben, und wenn ich mich nicht irre, hat er es noch. Und doch ist es eins der wenigen Kunstwerke, die diesen Namen wirklich verdienen, und ragt selbst unter den Gemälden dieses wirklichen Künstlers besonders hervor. Es ist ein echter rechter Böcklin, ohne jede Nachlässigkeit in der Durchführung und jene unverständliche
Schrullenhaftigkeit, durch die der große Maler seinen Verehrern oft das Leben so sauer macht. Welche köstlichen Verkörperungen der Naturgewalten sind diese Nymphen, Tritonen und andern Fabelwesen, wie sie mit den Wellen steigen, sich überschlagen und hinabsinken, insonderheit der alte vergnügte Seegreis im Vordergrunde. Von Ansehen ein alter richtiger Seekapitän, mit dem man ganz gerne in einer Schifferkneipe im Hamburger Hafen schon mal ein Glas Grog getrunken haben könnte, und doch ein Fabelwesen aus einer Märchenwelt. Das sind nicht die leeren, blutlosen, antikisierenden Schemen, die einem auf andern derartigen Gemälden begegnen, nein, das sind wirkliche, ganz moderne Wesen mit Fleisch und Blut und voll von grausigem Ernst und ungeheurer Lustigkeit. Sie leben. Und wie das alles fließt und rollt und in der natürlichsten Bewegung ist. Nach meiner Meinung hat noch nie einer das Wasser so gemalt wie Böcklin, das wirkliche, lebendige, durchsichtige Wasser, durch dessen überkantende Wellen der Himmel scheint und von denen wirklicher Schaum fliegt. Wer so viele Stunden lang wie ich der Brandung zugeschaut hat, der weiß, welch ein kompliziertes Gebilde die einzelne Welle ist, wie ihre steigende Fläche zusammengesetzt ist aus lauter kleinen Wellen und diese aus noch kleineren und wie es zugleich in ihr rinnt und niederfließt, der weiß, daß jede Welle eine kleine sich in jedem Augenblick verändernde Welt für sich ist. Dieses Innenleben der Welle, wie ich es nennen möchte,
stellt Böcklin mit den einfachsten Mitteln in geradezu bewunderungswürdiger Weise dar, so daß man auch von seinen Wellen sagen darf, sie leben.
Ich war etwa eine Stunde lang durch die letzte Kunstausstellung gewandert und hatte genug. Durch die Natur kann ich den ganzen Tag schweifen, ohne satt zu werden, wenn aber einige hundert Maler mit einigen tausend meist mittelmäßigen Bildern über mich herfallen, da haben sie mich bald mürbe. Es ist ja leider ein Zeichen der Zeit, daß heutzutage bei weitem zu viel studiert, gedichtet, gebildhauert und vor allen Dingen auch gemalt wird, weit über den Bedarf hinaus und meist von Unberufenen, so daß sich die Säle unsrer Ausstellungen mit Mittelgut und Ueberflüssigem füllen. Es gibt ja immer noch einige Oasen in dieser Farbenwüste, wie zum Beispiel vor einigen Jahren »Das Spiel der Wellen« von Böcklin, aber was ist sein Schicksal gewesen. Der Kunsthändler, der es kaufte, ist damit sitzen geblieben, und wenn ich mich nicht irre, hat er es noch. Und doch ist es eins der wenigen Kunstwerke, die diesen Namen wirklich verdienen, und ragt selbst unter den Gemälden dieses wirklichen Künstlers besonders hervor. Es ist ein echter rechter Böcklin, ohne jede Nachlässigkeit in der Durchführung und jene unverständliche
Schrullenhaftigkeit, durch die der große Maler seinen Verehrern oft das Leben so sauer macht. Welche köstlichen Verkörperungen der Naturgewalten sind diese Nymphen, Tritonen und andern Fabelwesen, wie sie mit den Wellen steigen, sich überschlagen und hinabsinken, insonderheit der alte vergnügte Seegreis im Vordergrunde. Von Ansehen ein alter richtiger Seekapitän, mit dem man ganz gerne in einer Schifferkneipe im Hamburger Hafen schon mal ein Glas Grog getrunken haben könnte, und doch ein Fabelwesen aus einer Märchenwelt. Das sind nicht die leeren, blutlosen, antikisierenden Schemen, die einem auf andern derartigen Gemälden begegnen, nein, das sind wirkliche, ganz moderne Wesen mit Fleisch und Blut und voll von grausigem Ernst und ungeheurer Lustigkeit. Sie leben. Und wie das alles fließt und rollt und in der natürlichsten Bewegung ist. Nach meiner Meinung hat noch nie einer das Wasser so gemalt wie Böcklin, das wirkliche, lebendige, durchsichtige Wasser, durch dessen überkantende Wellen der Himmel scheint und von denen wirklicher Schaum fliegt. Wer so viele Stunden lang wie ich der Brandung zugeschaut hat, der weiß, welch ein kompliziertes Gebilde die einzelne Welle ist, wie ihre steigende Fläche zusammengesetzt ist aus lauter kleinen Wellen und diese aus noch kleineren und wie es zugleich in ihr rinnt und niederfließt, der weiß, daß jede Welle eine kleine sich in jedem Augenblick verändernde Welt für sich ist. Dieses Innenleben der Welle, wie ich es nennen möchte,
stellt Böcklin mit den einfachsten Mitteln in geradezu bewunderungswürdiger Weise dar, so daß man auch von seinen Wellen sagen darf, sie leben.
In diesem Jahre hatte ein Franzose, dessen Namen ich vergessen habe, etwas Aehnliches versucht. Er hatte auf einer ungeheuren wandgroßen Tafel durch eine Unmasse von nackt ausgezogenen Salondamen das Wellenspiel eines Waldbaches zu verkörpern gesucht. In allen möglichen Stellungen glitten und stürzten diese Mengen von gleichgültigen Weibern die Fälle hinab, wanden sich durch die Engen, klammerten sich an die Felsen oder riefen die ferneren an und winkten ihnen. Es war ein sehr fleißig und geschickt gemaltes Bild, aber es war ohne jede Spur von wirklichem Naturgefühl. Braust uns aus dem Böcklinschen Bilde die wirkliche Salzluft des Ozeans entgegen, so kam aus diesem nur ein schwaches Patschulidüftchen hervor, und ich fragte mich, wie der Maler es nur angefangen hatte, daß er nicht vor Langerweile gestorben war, als er diese ungeheure Masse von gleichgültigen rosigen Armen und Beinen und sonstigen Gliedmaßen malen mußte.
In solchen Gedanken schlenderte ich dem Ausgange zu in jenen wenig besuchten Seitenräumen an der Stadtbahn, wohin die minder bevorzugten verbannt werden; da sah ich plötzlich meinen Freund, den Schriftsteller Reinhard Flemming, in der Ferne vor einem Bilde stehen, scheinbar in die tiefste Betrachtung versunken. Ich war neugierig, was das wohl für ein Bild sein möge, das auf ihn eine so große Anziehung auszuüben schien, da ich ihn aber nicht stören wollte, schritt ich langsam näher. Mein Freund wühlte, wie immer, wenn ihn etwas besonders ergriff, mit der Hand in seinem blonden Vollbart, trat ein wenig zurück und versank immer tiefer in die Betrachtung des Bildes. Ich sah jetzt, daß ein Lorbeerkranz mit schwarzer Schleife daran hing als ein Zeichen, daß der Maler vor kurzem gestorben sei. In dem Augenblicke, als ich ganz nahe gekommen war, schien mein Freund mit sich über das Bild ins reine gekommen zu sein, nickte einigemal wie zustimmend vor sich hin, sah auf und erblickte mich. Er schien erfreut, mich gerade jetzt zu treffen, winkte mir mit der Hand, deutete stumm auf das Bild und trat zurück, um mir Platz zu machen. Das Bild war mittelgroß und stellte einen Sonnenuntergang an einem See dar. Hinter schwarzen Waldeswipfeln war das Tagesgestirn eben versunken, und leuchtete nur noch mit einem tiefen Purpur hervor, der höher am Himmel in einen sanften rotgoldenen Schein verblaßte, in dem einige Rosenwölkchen friedlich schwammen. Mit dem tiefsten Schwarz spiegelten sich die Schatten des Waldes in dem unbewegten See und hoben sich ab gegen seine leuchtende Purpurflut, durch die ein Kahn mit einigen schwarzen Figürchen dahin zog, einen helleren Streif hinter sich lassend. Das war alles, aber man empfand die sanfte, wehmütige Stimmung dieses Abends, man fühlte den tiefen Frieden, der überall ausgebreitet war, ja man glaubte schließlich das leise Rucksen der Ruder zu hören und den fernen Gesang:
»Ich weiß nicht, was soll es bedeuten,
Daß ich so traurig bin.«
Ich sah nach dem Namen des Malers und wunderte mich. Er war mir wohl bekannt, aber ein derartiges Bild hätte ich von ihm nie erwartet. Als ich das zu meinem Freunde äußerte, sagte dieser: »Also der Meinung bist du auch. Hast du eine Stunde Zeit? Ja? Dann wollen wir in die Klause gehen, eine Flasche Rheinwein trinken, und ich will dir von diesem Bilde eine wunderliche Geschichte erzählen.«
Die kleine Künstlerkneipe in dem Stadtbahnbogen war leer; wir suchten uns eine abgelegene Ecke, setzten uns an einen der weißgescheuerten Tische und bestellten eine Flasche Rüdesheimer. Von draußen durch die geöffnete Thür schallte Konzertmusik und das unablässige Knirschen der auf dem Kies vorüberwandelnden Füße; zuweilen rollte mit dumpfem Donner ein Zug der Stadtbahn über uns hin und ließ die Gläser auf dem Büffett mit leisem Klirren erzittern, und so waren wir mitten in der strömenden hastenden Welt und doch ganz allein mit uns.
»Aus deiner Aeußerung schließe ich,« sagte mein Freund, »daß du die Werke des verstorbenen Friemann kennst. Ich war mit ihm befreundet und habe eine große Anzahl von ihnen entstehen sehen. Sein Atelier war nicht weit von meiner Wohnung in einer stillen Straße im Garten und ich besuchte ihn zuweilen, um mit ihm zu plaudern. Du wirst mit mir darüber einig sein, daß er nicht zu den ersten seines Faches gehörte, aber er war sehr fleißig, lieferte ein reinliches sauberes Stück Arbeit, und so ein Waldweg mit Staffage oder Waldrand mit Durchblick in die Ferne von ihm war immerhin eine sehr erfreuliche Zimmerzierde. Was man so Poesie nennt, fehlte seinen Arbeiten, aber es war stets ein tüchtiges Stück Natur drin, wie er sie eben sah mit klaren, nüchternen Augen. Wenn ich ihn besuchte, gerieten wir gewöhnlich bald in Streit, denn da ich so meine eigenen Ansichten über die Kunst habe, die von den seinen sehr abwichen, so dauerte es nicht lange, bis wir eine sogenannte Frage hin und her zerrten wie zwei Dachshunde, die sich in denselben Knochen verbissen haben. Insbesondere wollte er mir einen Satz nie zugeben, der zu meinen Glaubensartikeln gehört, daß nämlich nur dann die Kunst wirkliches Leben haben könne, wenn sie ganz aus dem Boden der Heimat hervorgewachsen sei. Ging ich so weit, zu behaupten, daß in unserm nordischen Flachlande nur der Ziegelrohbau, als aus dem Materiale und Boden des Landes entstanden, eine künstlerische Zukunft habe und vorzugsweise auszubilden sei, oder vertrat ich die nach seiner Ansicht wahnsinnige Ansicht, daß Berliner, also märkische Maler, ausschließlich märkische Landschaften malen sollten, so geriet er ganz aus dem Häuschen. Umsonst führte ich die alten Holländer für mich an, deren Kunstgröße ganz auf eigenem Boden gewachsen ist, die ihre eignen Bauern und ihre eignen Bettler malten und ihre stattlichen wohlbeleibten Weiber als Göttinnen und Madonnen darstellten, die ganze biblische Geschichte in das Kostüm ihrer Zeit steckten und ihre monotonen Wiesen- und Windmühlenlandschaften durch den Zauber der Beleuchtung und der silbertönigen Luft zu Kunstwerken verklärten.
»Wie wenig kümmern wir uns aber um das, was um uns ist, ja, wenn, wie jetzt gerade, holländische Waisenmädchen in blauen Kleidern mit weißen Hauben Mode sind, so reisen unsre Maler dahin und malen holländische Waisenmädchen, die uns gar nichts angehen, und statt der Berliner Grachten malen sie Amsterdamer, und den ganzen Zauber von Wasser und Wald, Heide und Hügeln, der um Berlin herum ausgebreitet liegt und landschaftlich in seiner Art ersten Ranges ist, lassen sie links liegen und nur wenige sind es, die sich drum kümmern. Charakteristisch ist, daß einer der ersten, der sich ausschließlich den märkischen Landschaften aus der Umgegend von Berlin widmete, ein Ausländer war, ein Däne Namens Söborg, dessen Sonnenuntergangsbilder von einem eigenen träumerischen Reiz sind.
»Bei einer dieser Gelegenheiten führte ich ihm den Maler Malchin, einen unsrer feinsten Landschafter, als ein Beispiel vor. Der bleibt im Lande und nährt sich redlich, sagte ich. Er ist mit seiner mecklenburgischen Heimat eng verwachsen, und seine Bilder gehen aus seiner täglichen Umgebung hervor. Im Winter lebt er in Schwerin, im Sommer verankert er sich in irgend einem schönen Strohdach-gesegneten Dorfe. Warum machen Sie es als geborener Mecklenburger nicht ebenso? Ich frage nicht umsonst, denn obwohl Sie jedes Jahr nach Oberbayern gehen, so suchen Sie Ihre Motive doch so aus, wahrscheinlich ohne daß Sie es wissen, daß Ihre Bilder ebenso gut aus Mecklenburg stammen könnten. Mit großer Kunst vermeiden Sie alles, was an das Gebirge erinnern könnte, und wollten Sie unter das Bild da auf Ihrer Staffelei schreiben statt ›Waldweg bei Tölz‹, wie Sie es jetzt nennen, ›Waldweg bei Neubrandenburg‹, so wird Ihnen das jeder aufs Wort glauben.
»Friemann sah etwas verwundert vor sich hin; meine letzten Bemerkungen hatten offenbar Eindruck auf ihn gemacht.
»›Sie haben recht,‹ sagte er, ›und mit dem Gedanken, den Sommer über in meine Heimat zu gehen, habe ich mich oft genug getragen, aber Sie wissen ja, daß ich leidend bin. Es ist für mich nicht möglich, dort so zu leben, wie ich leben muß. In Oberbayern ist man an Maler und Sommerfrischler gewöhnt und darauf eingerichtet. Ich finde dort unzählige Dörfer in günstiger Lage, wo es eine angemessene Verpflegung und gutes Quartier gibt; in mecklenburgischen Dörfern aber ist das nicht der Fall. Strapazen zu ertragen, ist mein Körper nicht mehr eingerichtet.‹
»Das leuchtete mir nun allerdings ein, denn er war lungenkrank, und die Aerzte gaben ihm keine lange Lebenszeit mehr.
»Bei dieser selben Gelegenheit kam es heraus daß er die Umgebung von Berlin überhaupt noch gar nicht kannte. In Wannsee war er einmal gewesen und in Potsdam hatte er einmal einen Fremdenbesuch herumgeführt und es bei dieser Gelegenheit selber zum erstenmal oberflächlich kennen gelernt. Er kannte weder die Oberspree, noch die wundervollen Havellandschaften zwischen Spandau und Heiligensee, er wußte nichts von Woltersdorfer Schleuse und Rüdersdorf, ja selbst in Tegel war er nie gewesen. Es gelang mir, ihn zu bewegen, mit mir einen Ausflug nach Tegel zu machen. Wir nahmen uns, seines leidenden Zustandes wegen, einen Wagen, und bei dieser Fahrt hatten wir das Glück, jenen Sonnenuntergang zu erleben, dessen getreues Bild Sie soeben gesehen haben. Mein Freund war von diesem Schauspiel geradezu hingerissen, doch hinderte das ihn nicht, sein Skizzenbuch hervorzunehmen und dieses wundervolle Spiel von Licht und Farbe, so gut es ging, zu notieren. Er ist später, statt nach Oberbayern zu reisen, sechs Wochen in Tegel gewesen und hat dort Studien gemacht und keinen Sonnenuntergang versäumt, allerdings ohne je wieder einen zu erleben, der diesem gleich gekommen wäre. Aber der Gedanke, diesen ihm unvergeßlichen Eindruck im Bilde festzuhalten, verließ ihn nicht wieder, und den ganzen nächsten Winter hat er mit diesem Bilde unablässig gekämpft und gerungen, so viel es ihm bei seinen stets geringer werdenden Kräften nur möglich war. Dieser Kampf im Verein mit der tückischen Krankheit rieb seine Lebenskraft schneller auf, als es sonst wohl der Fall gewesen sein würde. Ich besuchte ihn öfter und fand ihn stets in einer Art Verzweiflung über dieses Bild. Zuweilen stellte er es zurück, weil er sich tot daran gesehen hatte, wie der Malerausdruck lautet, und fing etwas andres an, aber immer holte er es wieder hervor. ›Noch nie,‹ sagte er einmal, ›ist ein Bild so fest in mein Gedächtnis eingegraben gewesen wie dieses, noch nie habe ich so genau gewußt, wie es sein muß, aber auch noch nie hat meine Hand so sehr versagt wie diesmal. Es ist, als ob der Teufel sein Spiel dabei hätte. Und ich weiß: könnte ich diese Glut, diese Tiefe herausbringen, wie sie mir vorschwebt, so würde es ein Bild werden, wie ich noch nie eins gemalt habe, mein letzter, mein eigener Sonnenuntergang, denn lange mach' ich's nicht mehr. Ich würde dann einen guten Abgang haben, wie die Schauspieler sagen.‹
»Im Frühling kam ich von einer Reise, die mich längere Zeit von Berlin ferngehalten hatte, wieder zu ihm. Ich traf ihn in seinem Atelier, und als er mir langsamen Schrittes und in gebeugter Haltung entgegen kam, sah ich sogleich, daß ich einen Sterbenden vor mir hatte. Aber dennoch leuchtete mir, als er mich begrüßte, etwas wie gehobene Stimmung aus ihm entgegen, und um seine eingefallenen Mundwinkel spielte ein eigentümliches Lächeln. Er führte mich sogleich vor sein Bild und weidete sich an meinem Erstaunen, als ich es in der Vollendung vor mir sah, wie wir beide es heute gesehen haben. Die Farben waren noch nicht ganz trocken, es konnte erst vor kurzem fertiggestellt worden sein.
»›Triumph!‹ sagte ich. ›Sie haben gesiegt!‹
»›Aber fragt mich nur nicht, wie!‹ antwortete er und ein seltsam starrer Ausdruck erschien auf seinem Gesicht. ›Ich habe Ihnen eine sehr wunderliche Geschichte zu erzählen, eine Geschichte, die Sie, wie ich fürchte, nicht glauben werden. Es wird mich etwas angreifen und es ist, glaube ich, besser, ich stärke mich ein wenig dazu. Auch wollen wir zugleich unser Wiedersehen feiern und die Vollendung des Bildes. Das sind drei Gründe, die schon für einen sehr edlen Wein ausreichend sind.‹ Er drückte auf einen Knopf und nach einer Weile erschien sein Diener auf einem Balkon in der Höhe der ersten Etage, von dem eine Treppe hinabführte, so daß man von der dort gelegenen Wohnung aus direkt in das zu ebener Erde gelegene Atelier gelangen konnte.
»›Bringen Sie die Flasche la Tour blanche, die auf dem Büffett steht, und zwei Gläser!‹ rief Friemann hinauf. Als der Wein gebracht und eingeschenkt worden war, hoben wir die Gläser, richteten die Augen auf das Bild und stießen klingend miteinander an. Friemann leerte sein Glas in einem Zuge. Dann lehnte er sich zurück und erzählte mir mit leiser, heiserer Stimme und zuweilen von pfeifenden Atemzügen und Hustenanfällen unterbrochen, folgendes:
»›Sie wissen, das Bild hat mich lange sehr gequält und aufgeregt, es peinigte mich sogar nachts im Traum. Doch in der vorgestrigen Nacht war es anders. Mir träumte, es sei Morgen, und ich stünde schnell auf, um an die Arbeit zu gehen. Dabei war ich in einer seltsam freudigen Stimmung und konnte kaum erwarten, bis ich vor meinem Bilde stände. Wenn ich sonst vom Anziehen träume, kann ich nie etwas finden, und alles geht verkehrt, diesmal flog aber alles von selber an seine rechte Stelle, und als ich hinunter gehen wollte, fühlte ich mich so federleicht, daß ich die Treppe mit großer Geschwindigkeit hinabtrillerte, wobei ich mit den Fußspitzen nur leicht die Kanten der Stufen anschlug. Dann stand ich vor meinem Bilde und hatte mit großer Geschwindigkeit meine Palette in Ordnung, die richtigen Farben aufgesetzt, und nun sah ich ganz hell und deutlich, wie es sein mußte. Eine magische Gewalt war in mir, die die Farben mischte und den Pinsel führte, und zum erstenmal in meinem Leben fühlte ich in diesem Traume die sogenannte Lust des Schaffens; ich wurde ganz übermütig. So malt man in Venedig und andern großen Bädern, sagte ich vor mich hin. Ja können muß man's, von Können kommt die Kunst. Das macht man so, und das macht man so! Und wunderbar, jeder Strich saß, und in unglaublich kurzer Zeit stand das Bild in jener Tiefe und Leuchtkraft da, wie es mir immer vorgeschwebt, und wonach ich so lange vergeblich gerungen hatte. Deswegen überkam mich ein unendliches Wohlgefühl, wie man es nur in den allerschönsten Fliegeträumen hat, so daß ich vor lauter Wonne die Augen aufschlug und erwachte. Es war um die Zeit, wo ich gewöhnlich aufzustehen pflegte, und erheitert und ermuntert durch diesen Traum begann ich mich so schnell wie möglich anzukleiden, um an die Arbeit zu gehen und zu versuchen, ob es mir gelingen würde, dieses Spiel der Phantasie zur Wahrheit zu machen. Als ich nun ahnungslos auf den Balkon trat, um die Treppe hinabzugehen, da sah ich plötzlich, daß unten im Atelier an der Staffelei jemand stand und malte. Ich geriet in maßloses Erstaunen und einigen Zorn, denn wer durfte sich das wohl herausnehmen. Als ich aber genauer hinblickte, packte mich plötzlich das eiskalte Entsetzen, denn der da unten stand und malte, war kein andrer als ich selber. Ein Kribbeln ging über meine Kopfhaut, und meine Kinnbacken fingen an zu zittern. Ich aber ermannte mich, fuhr mir mit der Hand über die Augen und sah wieder hin. Es bot sich ganz dasselbe Bild; der Mann da unten war ich oder doch wenigstens mein Spiegelbild, ein Schemen, eine Hallucination oder was weiß ich. Wie es die Palette und den Pinsel handhabte, wie es die Farben mischte und aufsetzte, wie es zurücktrat und mit schiefgeneigtem Kopfe das Bild betrachtete, das war ich, wie ich leibte und lebte. Ich stand in einer Art von Erstarrung und wagte mich nicht zu rühren, weder zu fliehen, noch hinunter zu gehen. Da merkte ich, daß der da unten sich mit seiner Arbeit dem Ende näherte, und nun durchfuhr mich ein neuer Schreck. Wenn er nun aufblickt, sagte ich mir, und dich ansieht, bist du verloren, das erträgst du nicht. In diesem Augenblick mischte das Phantom auf seiner Palette einen Ton, wobei es schnell zwischen diesem und dem Bilde hin und her sah, genau in der Weise, wie ich das zu thun pflege, trat auf die Leinwand zu und that, wie ich genau wußte, den letzten Strich. Dann nickte es zurücktretend ein paarmal befriedigt vor sich hin, sah plötzlich zu mir auf und winkte mir dreimal mit dem Pinselstiel. Was weiter geschah, weiß ich nicht, denn in demselben Augenblick verlor ich die Besinnung.
»›Als ich wieder zu mir kam, nach wie langer Zeit, weiß ich nicht, saß ich merkwürdigerweise auf dem Lehnstuhle vor meinem Bilde, der dort immer steht, damit ich mich von Zeit zu Zeit ausruhen kann, und vor mir stand mein Bild fertig, so wie ich es geträumt hatte, und wie Sie es vor sich sehen. Ich habe nicht das Kleinste mehr daran geändert und werde es auch nicht thun, denn ich habe das Gefühl, ich könnte nur was verderben, wenn ich es noch einmal anrühre.‹
»Die letzten Sätze hatte mein Freund Friemann nur mit großer Anstrengung und unter vielen Pausen zusammengebracht, jetzt brach er, durch das viele Sprechen erschöpft, fast zusammen und mußte sich durch ein zweites Glas des köstlichen Bordeauxweines wieder aufrichten.
»Ich versuchte mich in allerlei natürlichen Erklärungen für diese wunderlichen Vorgänge, allein er lächelte nur dazu. ›So hat es sich für mich ereignet,‹ sagte er, ›und so soll es für mich auch bleiben. Sagen Sie selbst, aber sagen Sie ganz ehrlich: hätten Sie es für möglich gehalten, daß ich ein solches Bild malen könnte? Würden Sie darauf verfallen sein, daß es von mir wäre, wenn Sie es irgendwo ohne Namensunterschrift gesehen hätten?‹
»Ich mußte allerdings ehrlich gestehen, daß ich, wäre mir dies Bild auf irgend einer Ausstellung begegnet, nie auf ihn als den Autor verfallen wäre.
»›Nun also!‹ sagte er. ›Darum, wenn es nun auch eine natürliche Erklärung für diese Vorgänge geben sollte, so möchte ich sie doch gar nicht wissen, denn offen gesagt, es thut mir wohl, daß mir nach einem nüchternen und bedeutungslosen Leben auf meine alten Tage doch noch so etwas wie ein Wunder begegnet ist. Und in diesem Glauben will ich sterben.‹
»Er hat nicht mehr lange darauf zu warten brauchen. Nach vierzehn Tagen haben wir ihn auf dem Matthäikirchhofe begraben.«
* * *
Mein Freund Reinhard Flemming schenkte den Rest aus der Flasche in die Gläser, wir erhoben sie und stießen stumm miteinander an. Draußen knirschten noch immer die Schritte vorüber, die Musik spielte einen Walzer von Strauß, und mit dumpfem Donner rollte ein Stadtbahnzug über das Gewölbe zu unsern Häupten.
Als wir diesen Ort verließen, gingen wir wie auf Verabredung noch einmal gemeinsam zu jenem Bilde und standen noch eine Weile in tiefem Schweigen davor, ehe wir uns trennten.