
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Meine Patientin schlief in dieser Nacht den Schlaf der Gerechten. Ich konnte kein Auge zutun. Der Schlag, den mir dieser plötzliche Haltruf in dem Augenblicke, wo ich mich anschickte zu handeln, versetzte, die Ungewißheit über seine Ursache und Bedeutung, und meine Zweifel über seine Wirkung auf Herrn Durands Lage, versetzten mich in die größte Unruhe und beschäftigten meine Gedanken vollauf bis zum Morgen.
Ich war sehr erschöpft und muß auch so ausgesehen haben, als bei den ersten Strahlen der blassen Morgensonne Fräulein Grey sanft die Augen aufschlug und mich dabei überraschte, wie ich sie betrachtete. Ihr Lächeln verriet aufrichtiges Mitleid. Sie drückte mir die Hand und sagte:
Sie haben wohl die ganze Nacht an meinem Bett gewacht? Ich habe noch nie jemand gesehen, der so müde aussah, wie Sie – oder so gut, schloß sie mit ihrer weichen Stimme.
Es wäre mir lieber gewesen, sie hätte das letzte Wort nicht ausgesprochen. Es paßte in jenem Augenblick nicht auf mich, hat vielleicht nie auf mich gepaßt. Gut! Ich! Wo doch meine Gedanken nicht bei ihr, sondern bei Herrn Durand geweilt hatten; wo das vorherrschende Gefühl in meinem Busen nicht das der Erleichterung, sondern das eines unbestimmten Bedauerns war, daß es mir nicht vergönnt gewesen, meinen großen Versuch auszuführen und so zu meiner eigenen Befriedigung wenigstens die völlige Unschuld meines Geliebten, selbst auf Kosten der Seelenruhe dieses vertrauensvollen Mädchens, dessen liebenswürdigem Gemüt schon der bloße Gedanke an ein Verbrechen einen tödlichen Streich versetzen würde.
Offenbar errötete ich; sicher ist, daß ich in sichtliche Verlegenheit geriet, denn ihr Auge heiterte sich auf, und mit scheuem Lächeln flüsterte sie:
Es ist Ihnen nicht angenehm, wenn man sie lobt – eine weitere Tugend von Ihnen. Sie besitzen so viele Tugenden. Ich nur eine einzige; ich liebe meine Freunde.–
Das tat sie. Man konnte sehen, daß ihr die Liebe Leben war.
Einen Augenblick zitterte ich. Wie nahe war ich daran gewesen, dieser feinen Seele eine unheilbare Wunde zu schlagen. Befand sie sich schon in Sicherheit? Ich war dessen nicht gewiß. Meine eigenen Zweifel waren noch nicht niedergeschlagen. Ich wartete mit fieberhafter Ungeduld auf die Zeitungen. Sie würden sicher Neuigkeiten enthalten. Neuigkeiten von welcher Art? Das war die Frage.
Sie werden mich heute morgen meine Briefe sehen lassen, nicht wahr? bat sie, während ich in ihrer Nähe beschäftigt war.
Das hängt vom Doktor, nicht von mir ab, sagte ich lächelnd. Aber heute befinden Sie sich viel besser!
Es ist so schmerzlich für mich, meine Briefe nicht lesen zu können, murmelte sie, oder ein Wort zu schreiben, um ihn zu beruhigen. –
So erzählte sie mir ihr Herzensgeheimnis und fügte unbewußt noch eine weitere Bürde zu der schweren Last, die mich bereits niederdrückte. Darauf ließ ich sie allein.
Ich war eben im Begriff, einige Vorbereitungen für das Frühstück meiner Kranken zu treffen, da betrat Herr Grey das Zimmer und begegnete meinem Blick. Er hielt eine Zeitung in der Hand. Mein Herz drohte still zu stehen, als ich bemerkte, wie aufgeregt sein Benehmen und unruhig seine Blicke waren. Lag der Grund dazu in diesen Spalten? Nur mit Mühe gelang es mir, meine Augen von der Zeitung abzuwenden, die er derart in der Hand hielt, daß ich die fettgedruckten Ueberschriften hätte lesen können. Dies wagte ich nicht zu tun, so lange er seinen Blick auf mich richtete.
Wie geht es Fräulein Grey? fragte er in großer Hast und Verlegenheit. Geht es ihr besser heute morgen oder schlechter?
Besser, beruhigte ich ihn; trotzdem war ich erstaunt zu sehen, wie sich sein Gesicht augenblicklich aufhellte.
Wirklich? fragte er. Finden Sie ihren Zustand wirklich gebessert? Die Aerzte sagen dasselbe, aber ich habe nicht viel Vertrauen zu den Aerzten in derartigen Fällen, fügte er hinzu.
Ich sehe keinen Grund ein, Ihnen nicht zu trauen, entgegnete ich. Die Krankheit Ihrer Tochter ist zwar ernst, aber allem Anschein nach nicht besorgniserregend. Ich muß indes gestehen, daß ich außerhalb des Spitals nur wenig Erfahrungen gesammelt habe. Ich bin noch jung, Herr Grey –
Er sah mich an, als sei er ganz einverstanden mit mir über diese Bemerkung. Dann betrat er das Zimmer seiner Tochter, ohne die Zeitung wegzulegen. Bevor ich mich ihm anschloß, holte ich mir eine Zeitung, die ich rasch überflog.
Da ich Großes erwartet hatte, war ich überrascht und enttäuscht, als ich nur eine kleine Mitteilung über den Fall Fairbrother vorfand. Darnach hofften die Behörden, in das Geheimnis Klarheit zu bringen, sobald es ihnen gelänge, eines gewissen Zeugen habhaft zu werden, dessen Verbindung mit dem Verbrechen eben aufgedeckt worden sei. Es stand somit nicht mehr und nicht weniger in der Zeitung, als mich Herr Gryce in seinem Briefe hatte wissen lassen. Wie konnte ich das aushalten – den Aufschub und den Zweifel – und dabei meine Pflichten der Kranken gegenüber erfüllen! Glücklicherweise blieb mir keine Wahl übrig. Ich hatte diese Pflicht auf mich genommen und mußte sie nun auch erfüllen. Vielleicht würde mein Mut sich wieder beleben, wenn ich mein Frühstück zu mir genommen hätte. Vielleicht würde ich dann in der Lage sein, mir meine Meinung über die Person des neuen Zeugen zu bilden, wozu ich mich in diesem Augenblick völlig unfähig fühlte.
Diese Gedanken gingen mir im Kopf herum, als ich wieder an Fräulein Greys Lager zurückkehrte. Als ich ihre Türe erreichte, hatte ich wieder meine Selbstbeherrschung ganz erlangt, wie ihre ersten Worte bekundeten:
So ist's recht! Jetzt lächeln Sie wieder so freundlich! Sie bringen mir Sonnenschein in mein Zimmer. –
Es war gut, daß sie mir nicht ins Herz blicken konnte.
Herr Grey, der an dem Bettpfosten lehnte, warf mir rasch einen Blick zu, der, wie mir vorkam, nicht ganz frei von Argwohn war. Hatte er entdeckt, daß ich eine geheime Rolle spielte, und waren die Zweifel, die in seinem Blicke lagen, einfach nur die Folge seiner eigenen Verlegenheit? Es war mir nicht möglich, das zu entscheiden, und so legte ich die Frage zu den übrigen, die mich bereits quälten.
So mußte ich dem Tag ins Antlitz blicken, dem, wie ich wußte, noch manche andere Tage gleichen Unbehagens, gleicher Unsicherheit und Unbefriedigtheit folgen würden.
Aber die Erlösung war nahe. Noch im Verlauf des Vormittags empfing ich ein Briefchen von meinem Onkel, in dem er mir mitteilte, daß er mich, wenn ich mich für ein paar Stunden frei machen könnte, gerne etwa um drei Uhr zu Hause sprechen würde. Was konnte er mir zu sagen haben? Ich konnte es nicht mutmaßen. Mit großer Unruhe entsprach ich daher, nachdem ich mir von Herrn Grey die Erlaubnis dazu erwirkt hatte, seiner Bitte.
Vor dem Hause meines Onkels stand ein Gefährt, das wir sofort bei meiner Ankunft bestiegen. Ohne die leiseste Ahnung von seiner Absicht, setzte ich mich neben ihn. Ich nahm an, daß er die Ausfahrt geplant hatte, um in aller Ruhe und ohne Zurückhaltung mit mir plaudern zu können, ohne befürchten zu müssen, gestört zu werden. Aber sehr bald erkannte ich, daß er etwas ganz anderes im Sinne hatte. Wir fuhren nämlich nicht den üblichen Weg, den er zu Spazierfahrten gewöhnlich wählte, sondern gerade in entgegengesetzter Richtung. Seine Unterhaltung beschränkte sich auf allgemeine Gegenstände, und er vermied es vorsichtig, auf jenes Gebiet zu geraten, das uns beide vor allen anderen interessierte.
Schließlich konnte ich meine Neugier nicht mehr zügeln.
Wo fahren wir hin? fragte ich. Du führst mich doch unmöglich zu Herrn Durand?
Nein, antwortete er, ohne ein weiteres Wort beizufügen.
Aha, zum Hauptquartier der Polizei, stammelte ich, als das Gefährt abermals in eine andere Straße einbog und vor einem Gebäude hielt, das mir sehr wohl bekannt war. Onkel, was soll ich denn hier?
Einen Freund treffen, antwortete er und half mir aus dem Wagen. Dann flüsterte er mir ins Ohr, als ich einigermaßen bestürzt neben ihm herging: Es ist Herr Gryce, der dich beim Inspektor Dalzell treffen möchte.
Bei diesen Worten fiel mir eine Riesenlast vom Herzen. Ich sollte also erfahren, was der Grund dafür gewesen war, daß ich meine Aufgabe nicht hatte ausführen sollen. Die traurige Nacht des Zweifels und der Unwissenheit sollte sich aufhellen. Da schob ich meinen Arm unter den des Onkels und drückte ihn ganz entzückt, unbekümmert um die erstaunten Blicke der zahlreichen Beamten, an denen wir auf unserm Wege zum Büro des Inspektors vorbeikamen.
Die beiden Herren warteten bereits auf uns, und mich überkam eine solche Freude, als ich des Detektivs freundliches, ernstes Gesicht erblickte, daß ich kaum bemerkte, wie sich mein Onkel leise zurückzog und das Zimmer verließ.
Oh, sagen Sie mir, was sich ereignet hat! rief ich ungestüm aus, als mich die Herren begrüßt hatten. Etwas, das Herrn Durand retten wird, ohne Herrn Grey zu belasten? Haben Sie so gute Nachrichten für mich?
Kaum, antwortete der Inspektor. Er bat mich, Platz zu nehmen und sagte dann zu Herrn Gryce, der mir freundlich zulächelte:
Sie werden vielleicht die Sachlage am besten klarlegen können, Herr Gryce.
Der Detektiv nickte und wandte sich mit den Worten an mich:
Ich habe Ihnen bereits gesagt, Fräulein Van Arsdale, daß der Herr Inspektor und ich nach verschiedenen Richtungen hin arbeiten. Die Verantwortung für meine Nachforschungen trage ich ganz allein. Herr Dalzell hat mich nicht ermuntert –
Ich kann es Ihnen ja nicht verbieten, unterbrach ihn der Inspektor ernst.
Nun ja, entgegnete Herr Gryce. Aber das verhindert nicht, daß wir beide in Berührung miteinander bleiben, damit wir am Ende dann unsere Ergebnisse zusammenzählen können und damit wir auch jetzt schon nicht die gleiche Arbeit doppelt tun. Nun hat Herr Dalzell einen Erfolg zu verzeichnen, der auf meinen Plan einen Einfluß ausüben wird. Er hat von einem Umstand erfahren, der mich veranlaßt, vorderhand – bis sich etwas aufgeklärt hat – meine Nachforschungen zu verschieben.
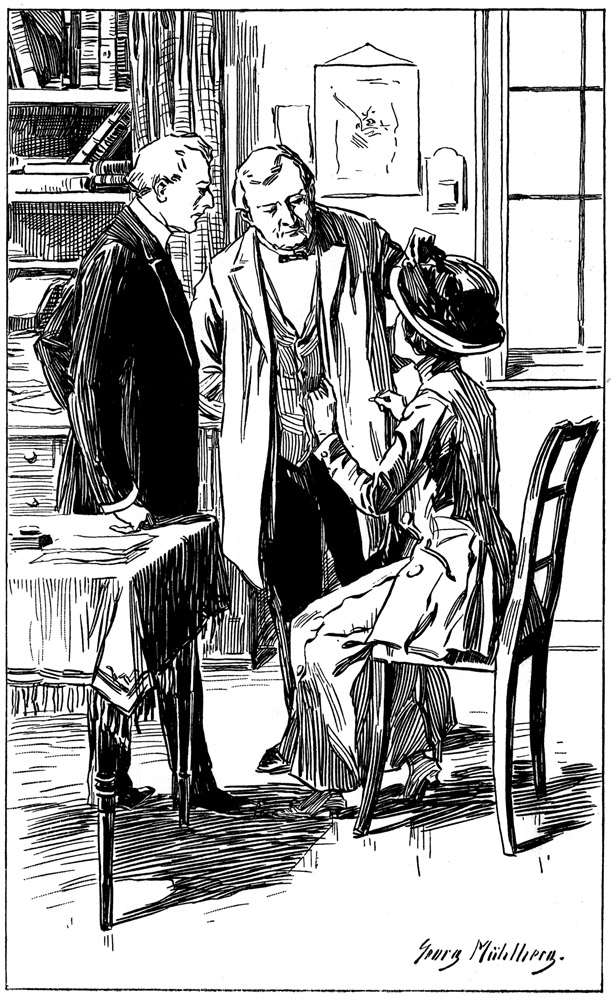
Und – und – Sie können mir nicht sagen, welcher Art dieser Umstand ist? stammelte ich, als Herr Gryce nicht die Absicht verriet, etwas zu dieser sehr wenig befriedigenden Erklärung beizufügen. Herr Gryce blickte zum Inspektor hinüber.
Eigentlich sollte ich es nicht tun, sagte dieser. Aber Sie hatten die Absicht, uns einen so wichtigen Dienst zu leisten, daß ich meine Prinzipien ein wenig beiseite setzen und etwas für Sie tun will. Im Grunde verrate ich Ihnen nur, was die Reporter schon morgen ausposaunen werden. Es handelt sich um folgendes: ein Mann hat sich bei mir gemeldet und erklärt, er habe eine Aussage zu Protokoll zu geben, die möglicherweise mit dem Fall Fairbrother in Beziehung gesetzt werden könne. Ich hatte den Mann schon einmal gesehen und erkannte in ihm auf den ersten Blick einen der Zeugen, der die Verhandlung unnötig in die Länge gezogen hatte. Erinnern Sie sich an den Traiteur Jones, der nur zwei oder drei Kleinigkeiten anzugeben hatte und trotzdem einen ganzen Nachmittag zu seiner Aussage brauchte?
Gewiß, antwortete ich.
Gut. Das war der Mann. Ich muß gestehen, daß ich von seinem Besuche nicht sehr entzückt war. Aber er benahm sich weniger ungeschickt, als ich erwartete, und bald erfuhr ich, was er mir mitzuteilen hatte. Es war das folgende: Einer seiner Leute hatte ihn plötzlich verlassen, einer seiner geschicktesten Leute. Der Mann war in seinem Dienste als Kellner am Ramsdellschen Ball tätig gewesen. Es war ja nun keine Seltenheit, daß diese Leute ihre Stellungen wechselten, aber gewöhnlich kündigten sie ihren Austritt an. Dieser Mann nun benachrichtigte ihn nicht davon, sondern blieb einfach zu der Stunde weg, wo seine Leute gewöhnlich erschienen. Dies war vor ungefähr zwei Wochen geschehen. Jones, der für den Mann, weil er ein vorzüglicher Kellner war, eine gewisse Vorliebe hatte, sandte in sein Logierhaus, um zu fragen, ob er krank sei. So erfuhr er, daß er ebenso unerwartet wie seinen Arbeitgeber auch sein Zimmer verlassen hatte. Unter gewöhnlichen Umständen wäre die Sache damit erledigt gewesen; aber da eine große Festlichkeit in Aussicht stand, wollte Jones den guten Kellner nicht verlieren, ohne den Versuch zu machen, ihn wieder für sich zu gewinnen. Daher zog er Erkundigungen über seinen mutmaßlichen Aufenthalt ein.
Alle derartigen Fälle pflegt er sich in ein besonderes Heft zu notieren. So erwartete er, ohne Schwierigkeit den Namen des Mannes oder den seines früheren Arbeitgebers ausfindig zu machen. Aber als er in dem Hefte nachschlug, fand er zu seinem Erstaunen, daß neben dem Namen des Mannes keine anderen Bemerkungen standen als der Tag seiner Anstellung, der 15. März.
Hatte er ihn ohne Empfehlungen in seine Dienste genommen? Er sollte sich wundern, wenn er das getan hätte, aber sein Notizbuch gab ihm keine Auskunft darüber. Es stand nur der Name und das Datum darin. Aber das Datum! Sie haben gewiß schon bemerkt, daß es kein gewöhnliches Datum ist! Später fiel das auch dem Manne ein. Es war der Tag des Ramsdellschen Balles, der Tag der großen Mordtat! Als er sich wieder an die Vorfälle dieses Tages erinnerte, fiel es ihm ein, warum der Name Wellgood in seinem Heft nicht von den üblichen Randbemerkungen begleitet war. Es war ein außerordentlich mühevoller und unglücklicher Tag gewesen. Der Auftrag war wichtig und das Wetter schlecht. Außerdem war er gerade durch das Zusammentreffen von allerlei unglücklichen Zufällen in großer Bedrängnis und hatte zu wenig Hilfskräfte zur Verfügung. Und als schließlich noch am Tage selbst zwei seiner Leute erkrankten, und dieser geschickt aussehende selbstbewußte Wellgood sich zu sofortiger Anstellung meldete, nahm er ihn sofort in seinen Dienst, ohne auch nur einen Blick auf das Zeugnis zu werfen, das sehr zufriedenstellend zu sein schien. Später hatte er die Absicht gehabt, sich das Zeugnis anzusehen, das er sorgfältig mit andern Papieren in eine Mappe auf seinen Schreibtisch gelegt hatte. Aber in der Aufregung, die die unerwarteten Ereignisse des Abends nach sich zogen, hatte er vergessen, es zu tun, da er außerdem mit der Arbeit und dem Benehmen des Mannes sehr zufrieden war. Aber jetzt standen die Dinge anders. Der Kellner hatte ihn ohne Kündigung verlassen, und er wollte den Mann aufsuchen, von dem jener an ihn empfohlen worden war und sich erkundigen, ob dies das erste Mal sei, daß Wellgood eine gute Behandlung mit schlechter Aufführung vergolten habe.
Daher suchte er in seiner Mappe nach dem betreffenden Papier; aber er fand zu seinem Erstaunen, daß es nicht mehr dort war. Diese Entdeckung kam ihm sehr merkwürdig vor, da er bestimmt wußte, daß er das Papier nicht selber der Mappe entnommen, und daß niemand das Recht dazu hatte. Er faßte Verdacht auf einen jungen Menschen, der gelegentlich Zutritt zu seinem Arbeitszimmer hatte. Aber dieser Bursche befand sich nicht mehr in der Stadt. Er hatte ihn wegen eines kleinen Versehens während der verflossenen Woche entlassen, und er brauchte mehrere Tage, um ihn wieder zu finden. Mittlerweile steigerte sich sein Aerger, und als er schließlich den Burschen fand, beschuldigte er ihn des Diebstahls, und zwar mit solcher Heftigkeit, daß das Unerwartete eintraf, und der Bursche beichtete. Er gab zu, das Empfehlungsschreiben aus der Mappe auf dem Tisch entwendet zu haben, aber nur, um es wieder an Wellgood zurückzugeben, der ihm Geld dafür versprochen hatte. Auf die Frage, wie groß die Summe gewesen sei, gab der Bursche zu, daß es zehn Dollars waren. Dieser Betrag für einen so einfachen Dienst und von seiten eines so unbemittelten Menschen war so ungewöhnlich groß, daß anzunehmen war, daß der Mann sein Empfehlungsschreiben nicht allein zu weiterem Gebrauch für eine neue Anstellung bedurfte. Daher betrieb Jones seine Nachforschungen immer eifriger und gelangte schließlich zu einem Ergebnis, das er zu Beginn nicht erhofft hatte: er ermittelte die genaue Adresse, die in dem gestohlenen Papier angegeben war, und an die sich, aus einem bestimmten Grunde, der Bursche erinnerte. Die angeführte Adresse bezog sich auf einen andern Stadtteil. Sobald Jones Zeit fand, stieg er in die Hochbahn und fuhr in die angegebene Straße.
Dort in dem bezeichneten Hause harrte seiner eine Ueberraschung. Und diese Ueberraschung ist auch uns zuteil geworden, Fräulein Van Arsdale, als er uns das Ergebnis seiner Nachforschung mitteilte. Der Empfehlungsbrief trug die Unterschrift: »Hiram Sears, Verwalter«. Der Name war ihm nicht bekannt – vielleicht kennen Sie ihn? nein? – aber als er das Haus erreichte, dessen Adresse die Empfehlung trug, erkannte er, daß es eines der feinsten Häuser in New York war, trotzdem er sich im Augenblick nicht daran erinnerte, wer dort wohnte. Aber bald machte er es ausfindig. Der erste Passant unterrichtete ihn darüber. Vielleicht kennen Sie es auch, Fräulein Van Arsdale? Es war die achtundachtzigste Straße, Nummer –
Ist es möglich, rief ich ganz entsetzt aus, dort wohnt ja Herr Fairbrother selbst. Der Gatte der –
Stimmt! Und Hiram Sears, dessen Name bei der Verhandlung erwähnt wurde, wie Sie sich vielleicht erinnern, ist, trotzdem er aus guten Gründen nicht in Person anwesend war, sein Verwalter und Faktotum.
Wie? Und er war es, der Wellgood seine Empfehlung verschafft hatte?
Jawohl!
Hat ihn Herr Jones gesehen?
Nein, das Haus ist, wie Sie sich erinnern werden, abgeschlossen. Herr Fairbrother gab, als er die Stadt verließ, seinen Dienern Ferien. Seinen Verwalter nahm er mit, d. h. sie fuhren zusammen ab. Aber in den Telegrammen aus Santa Fé ist er nicht erwähnt. Er scheint Herrn Fairbrother nicht in die Berge gefolgt zu sein.
Sie sagen dies mit so eigenartiger Betonung, bemerkte ich.
Weil uns das eigenartig vorgekommen ist. Wo befindet sich Sears jetzt? Und warum ist er nicht bei Herrn Fairbrother geblieben, wenn er doch beim Verlassen der Stadt die Absicht offenkundig zur Schau trug, ihn in die »Placidamine« zu begleiten? Dieser Umstand gab uns zu denken, Fräulein Van Arsdale, als wir an die einsame Reise des Herrn Fairbrother von dem Punkte, wo er erkrankte, bis zu seiner bei Santa Fé gelegenen Mine dachten; aber wir haben uns in der richtigen Bewertung dieser Tatsache nicht geirrt, wie durch die weiteren Umstände bewiesen wurde.
Jetzt, Fräulein Van Arsdale, fuhr der Inspektor fort, als ich rasch zu ihm aufsah, werde ich Ihnen großes Vertrauen beweisen, indem ich Ihnen verrate, was unsere Leute über diesen Sears in Erfahrung gebracht haben. Wie ich schon sagte, werden es morgen die Zeitungen in aller Welt verkünden. Ich glaube, es wird Ihnen zum Verständnis verhelfen, warum Ihnen Herr Gryce jene dringende Anweisung zugehen ließ, von Ihrem Vorhaben abzustehen, als Ihr ganzes Herz Sie trieb, es auszuführen, um damit Herrn Durand reinzuwaschen. Herr Gryce ist ganz meiner Meinung, daß man es vermeiden muß, eine so vornehme Persönlichkeit zu beunruhigen, wie Sie gegenwärtig eine beobachten, solange noch die geringste Hoffnung vorhanden ist, das Verbrechen auf einen andern Urheber zurückzuleiten. Und eine solche Hoffnung besteht in der Tat. Dieser Mann, dieser Sears ist unter keinen Umständen die harmlose Seele, für die man ihn auf Grund seiner Stellung halten könnte. In Anbetracht der kurzen Zeit, die uns dafür zur Verfügung stand – erst gestern kam Jones zu mir aufs Büro – haben wir, Herr Gryce und ich, in dieser Beziehung sehr interessante Tatsachen zutage gefördert. Dieses Sears' Ergebenheit Herrn Fairbrother gegenüber war mir ein Geheimnis und war uns schon am Tage nach dem Verbrechen so genau bekannt, wie heute. Aber die Gefühle, mit denen er Frau Fairbrother betrachtete – nun, das ist etwas anderes, und erst gestern abend erfuhren wir, daß die Anhänglichkeit, die ihn mit ihr verband, von jener Art war, die weder auf Alter noch Stellung Rücksichten nimmt. Er war kein Adonis und, wie wir erfuhren, alt genug, um ihr Vater sein zu können; aber trotz alledem haben wir bereits mehrere Personen ausfindig gemacht, die merkwürdige Geschichten von der leidenschaftlichen Ausdauer zu erzählen wissen, mit der seine alten Augen ihr zu folgen pflegten, wenn sie zufällig zusammentrafen, solange sie noch unter dem Dach ihres Gatten weilte; und andere berichten, noch lebhafter als die ersteren, wie er nach ihrem Umzug in ihre eigene Wohnung in dem benachbarten Park zu verweilen pflegte, nur um aus der Ferne ihre Gestalt zu erblicken, wenn sie den kleinen Weg von und zu ihrem Wagen zurücklegte. Es kam so weit, daß seine sinnlose, fast greisenhafte Leidenschaft für diese prachtvolle Schönheit bei verschiedenen Leuten beinahe sprichwörtlich wurde, und man hat sie bei der Verhandlung nur aus Rücksicht auf Herrn Fairbrother verschwiegen, der diese Schwäche an seinem Verwalter nie beobachtet hatte. Nichtsdestoweniger haben wir jetzt einen Zeugen – – ist es nicht erstaunlich, wie viele Zeugen man mit geringer Mühe auftreiben kann, die nie daran gedacht hätten, sich selbst zu melden? – einen Zeugen, der bereit ist, zu beschwören, daß er ihn eines Abends beobachtete, wie er seine Faust hinter ihrem Rücken ballte, als sie hochmütig an ihm vorbei in ihr Haus ging. Dieser Zeuge ist überzeugt davon, daß der Mann, den er diese Bewegung vollführen sah, Sears gewesen ist, und ebenso sicher, daß die Dame Frau Fairbrother war. Der einzige Punkt, worüber er nicht ganz so sicher ist, betrifft die Gefühle seiner Frau, wenn sie nämlich erfährt, daß er sich zu jener Stunde in jener Gegend aufhielt, während er offenbar an einem ganz anderen Orte vermutet wurde. Der Inspektor lachte.
Hat der Verwalter denn einen schlechten Charakter, fragte ich, daß dieser Ausdruck seiner Gefühle einen so großen Eindruck auf Sie machte?
Ich weiß nicht, was ich, bis jetzt wenigstens, darüber sagen könnte.
Die Ansichten über diesen Punkt sind geteilt. Seine Freunde bezeichnen ihn als den sanftesten Menschen der Welt, der ohne seine angeborene praktische Geschicklichkeit niemals imstande wäre, das große Haus, das ihm anvertraut ist, zu verwalten. Seine Feinde – und auch von diesen haben wir einige wenige aufgetrieben – sagen im Gegenteil aus, sie hätten nie Vertrauen zu seinem stillen Wesen fassen können; dieses stehe nicht im Einklang mit dem Umstande, daß er anfangs der Fünfziger Jahre Goldgräber in Kalifornien gewesen sei. Sie sehen, ich führe Sie soweit, als wir selbst vorgedrungen sind. Daher will ich auch hinzusetzen, daß die Leidenschaft dieses scheinbar so unterwürfigen, in Wirklichkeit aber heißblütigen Verwalters zu einem Weibe, das ihm gegenüber nie ein anderes Benehmen zeigte, als was er beleidigende Gleichgültigkeit nennen wird, uns einen Anhaltspunkt zu geben schien, dem wir unsere Aufmerksamkeit zuwenden müßten. Darin wurden wir noch durch die Antwort auf ein Telegramm bestärkt, das wir gestern abend an die Wärterin des Herrn Fairbrother absandten.
Bei diesen Worten griff er nach einem kleinen, gelben Papierstreifen, der auf seinem Schreibtisch lag, und übergab ihn mir. Ich las die Worte:
Verwalter verließ Herrn Fairbrother in El Moro. Seither nichts mehr von ihm vernommen.
Annetta La Serra.
Für Abner Fairbrother.
In El Moro? rief ich aus, da reichte ja die Zeit – –
Für ihn, um noch vor dem Mord in New Jork einzutreffen. Gewiß! Er brauchte nur die schnellsten Verbindungen zu benützen!