
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Ich war in die Garderobe geeilt, um meine Sachen zu holen, da mein Onkel darauf bestanden hatte, mich von einem Schauplatz wegzubringen, wo mich meine bloße Gegenwart schon in einem gewissen Sinne kompromittierte.
Ich war schnell zur Abfahrt bereit und eilte eben durch die Halle zu der kleinen Verbindungstüre mit der Seitentreppe, wo mein Onkel auf mich warten wollte, da fühlte ich das Verlangen in mir, noch einen Blick auf den Schauplatz hinunterzuwerfen, ehe ich dieses Haus verließ, in dem sich meine größten Interessen nunmehr konzentrierten.
Ein breiter Absatz, der die Haupttreppe einige Fuß über dem Boden der Halle unterbrach, bot mir einen vorzüglichen Aussichtspunkt dazu. Ohne den möglichen Folgen viel Beachtung zu schenken, ohne auch nur an meinen armen, geduldigen Onkel zu denken, schlüpfte ich zu diesem Absatz hinunter. Die ungewöhnlich hohe Rampe schützte mich vor der Beobachtung. Und so konnte ich meine Blicke auf dem Platze herumwandern lassen, der von nun ab mit meinen ergreifendsten Erinnerungen verbunden bleiben sollte.
Vor mir lag die große, viereckige Haupthalle. Von ihr ging der Korridor aus, der zum Hauptportal und zugleich zur Bibliothek führte. Als mein Blick den Gang entlang glitt, bemerkte ich, daß aus diesem Raum die große Gestalt des Engländers herauskam.
Er hielt inne, als er die Haupttreppe erreichte, und musterte mit scharfem Blicke eine Gruppe von Herren und Damen, die sich in der Nähe des Kamins versammelt hatten; ich richtete meine Blicke erst darauf, als meine Aufmerksamkeit in diese Richtung gelenkt wurde.
Der Inspektor war aus dem Zimmer, wo ich ihn mit Herrn Durand verlassen hatte, herausgekommen und zeigte nun den Leuten den außergewöhnlichen Edelstein, den er eben unter so bemerkenswerten, wenn nicht verdächtigen Umständen wieder entdeckt hatte. Alt und jung drängte sich um ihn, und ich strengte mein Gehör an, um die einzelnen Ausrufe zu vernehmen, die den allgemeinen Lärm übertönten. Da sah ich plötzlich, wie Herr Grey eine rasche Bewegung machte. Als ich meine Aufmerksamkeit ihm zuwandte, bemerkte ich gerade noch einen Ausdruck von Interesse und zugleich von Unsicherheit an ihm, ob er zurücktreten oder vorwärts gehen sollte.
Ohne meine wachsame Beobachtung zu ahnen, zweifellos im Bewußtsein, daß die meisten der Leute in der Gruppe, auf die sein Auge gerichtet war, ihm den Rücken zukehrten, gab er sich keine Mühe, sein großes Interesse an dem Edelstein zu verbergen.
Er folgte ihm mit den Augen, wie er von Hand zu Hand ging; sein Gesicht trug, ohne daß er es vielleicht wußte, einen gierigen Ausdruck, und ich war nicht im geringsten erstaunt, als er, nach einer kurzen Zwischenzeit unsicheren Schwankens, plötzlich entschlossen vorwärts eilte und darum bat, man möchte ihm den Stein geben, damit er ihn besichtigen könne.
Unser Gastgeber, der in der Nähe des Inspektors stand, flüsterte diesem ein paar Worte zu, worauf seiner Bitte entsprochen wurde. Der Edelstein wurde Herrn Grey übergeben, und ich sah, möglicherweise weil mir meine Aufregung den Blick trübte, daß die Hand des großen Mannes zitterte, als der Diamant seine Handfläche berührte. Gewiß, es war so! Seine ganze Gestalt erzitterte, und ich wartete gespannt auf das Ergebnis seiner Untersuchung, da kehrte er sich um, um das Juwel gegen das Licht zu halten. In diesem Augenblick ereignete sich etwas so Ungewöhnliches und Seltsames, daß es keiner von denen vergessen wird, die in jenem Augenblick im Hause anwesend waren.
Es war ein Schrei, dessen Herkunft niemand beschreiben konnte, der durch seine Höhe und seine Macht über die Einbildungskraft überirdisch zu sein schien; er tönte durch das ganze Haus hindurch und erstarb in einem so schwermütigen und ergreifenden Seufzer, daß er nicht nur tief in mein eigenes, schwaches und schwergeprüftes Herz drang, sondern auch die zehn starken Männer einschüchterte, die ich von meinem Standpunkt aus beobachten konnte, Herr Grey ließ vor Schreck den Diamanten fallen, und weder er noch einer der andern schickte sich an, ihn wieder aufzuheben. Erst als wieder Stille herrschte, eine Stille, die beinahe ebenso unausstehlich für ein empfindliches Ohr war, wie der Schrei, der ihr voraufgegangen, erst dann bewegten sich wieder die Leute. Ein Herr beugte sich vor, um nach dem Diamanten zu sehen, ohne daß es ihm gelang, ihn zu entdecken; erst einer der Kellner, der den Stein vielleicht beim Fallen verfolgt hatte oder sein Gefunkel sehen konnte, fand ihn am Rande des Teppichs, wohin er gerollt war. Er eilte hinzu, hob ihn auf und übergab ihn wieder Herrn Grey.
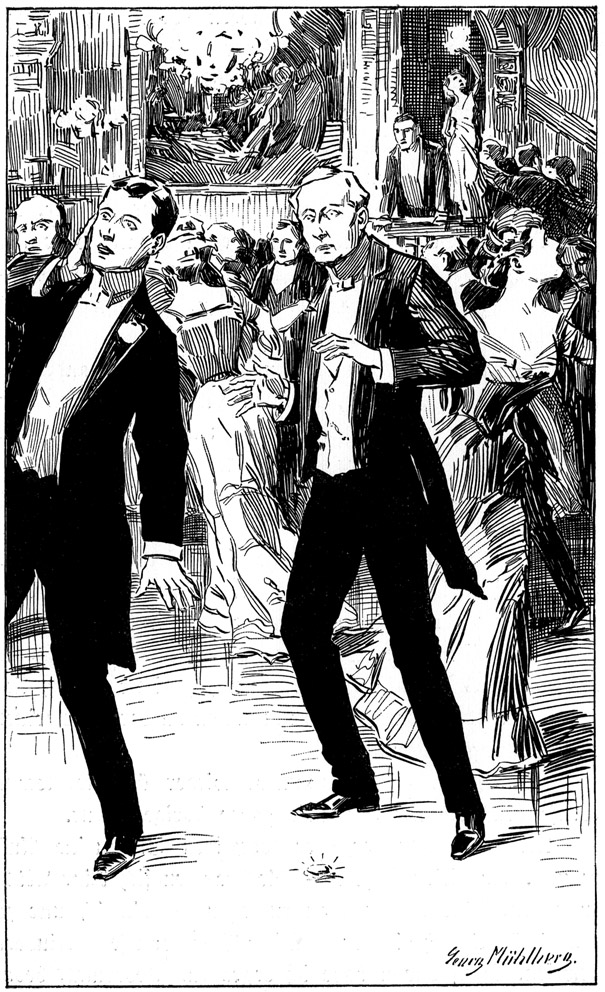
Instinktiv schloß ihn der Engländer in die Hand, aber mir – und wie ich denke, auch den andern – war es klar, daß sein Interesse dafür verschwunden war. Wenn er auch darauf blickte, so hatte er sicher seine Aufmerksamkeit nicht bei der Sache, denn er stand stumm und teilnahmlos da, während unausgesetzt Herren und Damen aufgeregt hinzu- und wegeilten, mit dem Versuche einer Erklärung für den Schrei beschäftigt, der noch in aller Ohren klang. Erst, als all diese verschiedenen Personen sich wieder versammelt hatten, ergriffen vom Schrecken vor einem Geheimnis, an dessen Aufklärung alle Bemühungen gescheitert waren, ließ er seine erhobene Hand sinken und nahm an der allgemeinen Unterhaltung wieder teil.
Die Worte, die er nunmehr wieder äußerte, waren ebenso bemerkenswert, wie die ganze übrige Szene.
Meine Herren, sagte er, verzeihen Sie meine Aufregung. An diesen Schrei – Sie brauchen sich keine Mühe zu geben, seine Herkunft zu entdecken – bin ich nur zu gut gewöhnt. Ich bin der glückliche Vater von sechs Kindern gewesen. Fünf davon habe ich begraben. Jedesmal, bevor eines davon starb, ertönte dieser Schrei vor meinen Ohren. Ich habe nur noch ein einziges Kind, eine Tochter – sie liegt krank im Hotel. Ist es ein Wunder, wenn ich vor diesem Warnungsschrei zusammenzuckte und mich unter seinem Eindruck schwächer zeigte, als es ein Mann tun sollte? Ich gehe nach Hause. Aber erst noch ein Wort über diesen Edelstein. –
Er hob ihn wieder vor das Auge und unterwarf ihn einer sorgfältigen Untersuchung, wozu er seine Augengläser aufsetzte. Sorgfältig betrachtete er ihn von allen Seiten, ehe er ihn wieder dem Inspektor zurückgab.
Dann begann er mit einer Veränderung im Tone seiner Stimme, die jedermann aufgefallen sein muß:
Ich habe gehört, daß dieser Stein sehr bemerkenswert sei und den Ruf völlig rechtfertige, den er hier in Amerika besitzt. Aber ich muß Ihnen mitteilen, daß Sie sich alle in seinem Werte getäuscht haben, am meisten derjenige, der einen Mord beging, um in seinen Besitz zu gelangen. Der Stein, den Sie eben so freundlich waren, mir für meine Prüfung zur Verfügung zu stellen, ist gar kein Diamant, sondern eine, allerdings vorzügliche Imitation, die indes ihre reiche und sorgfältige Fassung gar nicht wert ist. Es tut mir leid, daß ich mit diesem Urteil allein stehe; aber ich bin ein Kenner von Edelsteinen, und es ist mir nicht möglich, diese offenkundige Fälschung durch meine Hand gehen zu lassen, ohne gegen ihre Berühmtheit und ihre angebliche Echtheit zu protestieren. Herr Ramsdell – damit wandte er sich an unsern Gastgeber – ich bitte Sie, meine Entschuldigungen entgegenzunehmen, da ich sofort ins Hotel fahren muß. Der Schrei, den Sie gehört haben, bildet den einzigen Aberglauben in unserer Familie. Wollte Gott, ich fände mein Kind noch am Leben. –
Was konnte darauf erwidert werden? Keiner seiner Zuhörer, nicht einmal ich selber, trotz meiner Neigung zur Romantik, schenkte seiner Erklärung des unverständlichen Schreis, der eben gellend durch das Haus getönt hatte, Glauben. Aber angesichts seiner Behauptung, er nehme den Schrei als Warnung an, angesichts der Tatsache, daß alle Bemühungen, den Ton oder auch nur seine Quelle zu bestimmen, gescheitert waren, schien kein anderer Weg möglich zu sein, als diesen Herrn mit der Schnelligkeit, die seinen abergläubischen Befürchtungen entsprach, abfahren zu lassen.
Daß dies den Absichten des Inspektors widersprach, suchte er gar nicht zu verbergen. Es war auch natürlich, daß er es vorgezogen haben würde, wenn Herr Grey noch dageblieben wäre, schon um seine überraschenden Schlüsse in bezug auf diesen Diamanten klarer zu stellen, der durch die Hand verschiedener der ersten Kenner im Lande gegangen war, ohne daß sich irgend ein Zweifel über dessen Echtheit auch nur geregt hätte.
Sobald Herr Grey weggegangen war, änderte der Inspektor sein Benehmen. Er schaute auf den Stein in seiner Hand und schüttelte langsam das Haupt.
Ich zweifle daran, ob man sich heute nacht auf das Urteil Herrn Greys verlassen kann, meinte er und steckte den Edelstein so sorgfältig ein, als sei sein Glaube an dessen wirklichen Wert durch die Versicherungen dieses berühmten Fremden nicht im geringsten erschüttert worden.
Ich erinnere mich nicht mehr genau, wie ich endlich dazu kam, das Haus zu verlassen, noch was zwischen meinem Onkel und mir auf unserm Heimwege vor sich ging. Ich war von all diesen Schlägen wie betäubt, und sowohl meine Gedanken, als auch meine Gefühle verweigerten mir weiterhin ihre Dienste. Ich kann mich nur noch auf einen Eindruck besinnen, und das war der Eindruck, den unser altes Heim auf mich bei unserer Ankunft machte, als sei es etwas Neues und Fremdartiges; so viel war geschehen und so viele Aenderungen hatten in mir selbst Platz gegriffen, seitdem ich es vor fünf Stunden verlassen. Sonst aber ist mir keine Erinnerung mehr gegenwärtig, bis zu jener frühen Stunde am traurigen Morgen, da ich mit einem Seufzer wieder für diese Welt erwachte, in dem Augenblicke, wo sich meines Onkels liebevolles Antlitz in der Türe zeigte.

Augenblicklich fand ich die Worte wieder, und Frage auf Frage sprudelte von meinen Lippen. Er gab mir keine Antwort darauf, er konnte es nicht tun. Aber als ich mich aufregte und nicht nachließ, zog er die Morgenzeitung hinter dem Rücken hervor und legte sie in meinen Bereich. Sofort fühlte ich mich wieder beruhigt, und als er mich nach ein paar guten treuen Worten allein ließ, griff ich nach dem Blatte und las, was in dieser Stunde so viele andere Menschen in der Stadt lesen mochten.
Die Beschreibung der Ereignisse dieser Nacht stimmte im allgemeinen mit meinen Beobachtungen und Erlebnissen überein. Hier sind nur noch ein paar Einzelheiten, die mir nicht zu Gehör gekommen waren, von Interesse. Das Mordinstrument, das man an dem von Herrn Durand bezeichneten Orte vorfand, war für Sammler von Kunstgegenständen oder Raritäten bemerkenswert. Es war ein Stilett, von der kleinsten Art, lang, scharf und dünn. Kein amerikanisches Erzeugnis war es, auch nicht in diesem Jahrhundert verfertigt, sondern es rührte aus den Zeiten her, wo in den Winkeln und Nebengassen der mittelalterlichen Straßen Mordtaten an der Tagesordnung waren.
Dies bildete das erste unerklärliche Geheimnis.
Das zweite war der bis jetzt ebenso unverständliche Fund von zwei zerbrochenen Kaffeetassen auf dem Fußboden im Alkoven, die kein Kellner noch sonst eine andere Person dorthin getragen haben wollte. Auf dem Servierbrett, das Peter Mooney – der Kellner, der als erster von dem Morde Nachricht gegeben – in den Alkoven trug, standen keine Tassen, sondern nur Schälchen mit Eis. Dieser Umstand war mit Sicherheit bewiesen. Aber es waren außerdem die Griffe von zwei Porzellantassen unter den Trümmern aufgefunden worden und zwar von zwei Tassen, die nach den Kaffeeflecken auf dem Teppiche zu urteilen, gefüllt gewesen waren.
Als ich dies las, fiel mir ein, daß Herr Durand erwähnt hatte, er sei bei seiner Flucht aus dem verhängnisvollen Gemach auf Scherben von Porzellan getreten. Da dieser Umstand eine Theorie zu bestätigen schien, die ich bereits langsam im Geiste zu bilden begann, wandte ich mich brennend vor Spannung dem nächsten Abschnitt zu.
Dort harrte meiner eine Ueberraschung. Andere hatten erfahren – ich nicht –, daß Frau Fairbrother nur wenige Minuten vor ihrem Tode noch eine Mitteilung erhalten hatte. Ein gewisser Herr Fullerton, der vor Herrn Durand sie im Alkoven ausgesucht hatte, gestand, daß er für sie das Fenster geöffnet hatte, als von außen ein Ruf oder Signal ertönt sei. Dann habe er einen Zettel entgegengenommen, der ihm von unten mit Hilfe eines Peitschenstocks heraufgereicht worden sei. Er konnte nicht sehen, wer die Peitsche hielt, aber auf Frau Fairbrothers Bitte hatte er den Zettel losgeknüpft und ihr übergeben. Während sie sich mit der Lektüre abmühte, denn die Schrift war offenbar weit davon entfernt, lesbar zu sein, warf er noch einen Blick heraus. Dieses Mal sah er unten eine Gestalt gegen die Zufahrt zueilen. Er habe die Gestalt nicht erkannt, noch würde er sie wiedererkennen. Was die Natur der Mitteilung selbst anbelangt, so wisse er nichts darüber, außer, daß Frau Fairbrother nicht angenehm berührt davon zu sein schien. Sie runzelte die Stirne und war sehr niedergeschlagen, als er den Alkoven verließ. Die Frage, ob er beim Schließen des Fensters die Vorhänge wieder zusammengezogen habe, verneinte er und erklärte, daß sie ihn auch nicht gebeten habe, es zu tun.
Diese Aussage, die zweifellos eigentümlich klang, war durch den Kutscher bestätigt worden, der seine Peitsche zu dem erwähnten Zwecke hergeliehen hatte. Der Kutscher, der als gutmütiger Mensch bekannt war, hatte nichts Ungewöhnliches daran gefunden, als ihn ein armer Teufel darum bat, um, wie er sagte, eine eilende Nachricht der Dame zu übergeben, die gerade über ihnen an dem beleuchteten Fenster saß. Es herrschte um diese Zeit ziemlich starker Wind und Schneefall. So war es ganz natürlich, daß der Mann sich vor dem Wetter zu schützen suchte. Aber er erinnerte sich deutlich genug an seine Gestalt, um zu erklären, daß er weder sehr unter der Kälte zu leiden, noch ermüdet schien, und daß er den Mantelkragen bis über die Ohren hinaufgeschlagen hatte. Als er mit der Peitsche zurückkam, war er zwar weniger unhöflich, als zuvor, aber er hatte kein »Danke« für die ihm erwiesene Gefälligkeit übrig, oder, wenn er es hatte, verlor es sich im Getöse des Windes.
Der Zettel, dem von der Polizei die größte Wichtigkeit beigemessen wurde, war vom Koroner in der Hand der Ermordeten aufgefunden worden. Er enthielt nur ein paar mit Bleistift niedergekritzelte Worte. Die ersten zwei Linien waren ineinander hineingeschrieben und unleserlich, dagegen die dritte und letzte deutlich lesbar. Sie enthielt nur die Worte: »Mach Dich auf Schlimmes gefaßt, wenn ...« Wenn was? Hunderte fragten sich sicherlich in diesem Augenblick dasselbe. Auch ich wollte darüber nachdenken, aber erst mußte ich versuchen, mir die Sachlage klar zu machen, diese Sachlage, die bis hierher immer noch Herrn Durand als Verdächtigen, und zwar als einzigen Verdächtigen erscheinen ließ.
Mehr als das hatte ich nicht erwartet. Aber da kam mir mit dem Tageslicht, das in mein Zimmer drang, mit einem Male die Erkenntnis; es war ja, wenn man die Sachlage mit gesundem Menschenverstande betrachtete, rein unmöglich, daß ein Mann von so tadellosem Rufe und so ehrenhafter Stellung schuldig sein sollte. Und trotzdem waren die äußeren Umstände so ungünstig für ihn, daß gerade die oberflächliche allgemeine Meinung sich leicht davon umgarnen lassen würde. Und als ich den ganzen Bericht gelesen, mußte ich selber gestehen, daß die scheinbare Anklage, die er gegen Anson enthielt, einen gewissen Eindruck auf mich gemacht hatte. Zwar war mein Glaube an seine Unschuld nicht erschüttert. Ich hatte ja seinen Blick voll Liebe und zärtlicher Dankbarkeit aufgefangen; mein Vertrauen in seine Unschuld war dadurch wieder völlig gefestigt worden. Aber ich erkannte mit der ganzen Klarheit meines durch fortgesetztes Studium geübten Verstandes, wie schwierig es war, dem Vorurteil entgegenzuarbeiten, das seine eigenen, unüberlegten Handlungen verursacht hatten, insbesondere der unglückselige Versuch, Frau Fairbrothers Handschuhe im Täschchen eines andern Weibes verbergen zu wollen, und nicht zuletzt seine eigene Erklärung der Gründe, die ihn dazu bewogen haben sollten. Es unterlag keinem Zweifel, daß diese Erklärungen vielen gekünstelt und unnatürlich erscheinen mußten.
Ich sah eine Aufgabe vor mir, die menschliche Kraft zu übersteigen schien. Aber ich war gewillt, sie trotzdem zu lösen. Ich glaubte an seine Unschuld, und wenn es andern nicht gelingen würde, wollte ich es unternehmen, ihn vom Verdachte zu reinigen – ich, trotz meiner Unscheinbarkeit, trotzdem ich keine Erfahrung in juristischen Fragen, in Gerichtssachen und Verbrechen besaß, einfach kraft meines unbegrenzten Glaubens an den Verdächtigten, auf meine Klugheit vertrauend und bauend. Diese Klugheit hatte mir bereits gute Dienste erwiesen und würde mir noch weit bessere leisten, wenn ich erst einmal die Einzelheiten übersah, deren Kenntnis die Einleitung zu jeder geistigen Arbeit bildet.
Der Bericht in der Morgenzeitung schloß mit den Erklärungen, die Herr Durand zu dem Sachverhalt gegeben, der ihn so schwer zu belasten schien. Infolgedessen stand kein Wort von den Ereignissen in der Zeitung, die hernach einen so gewaltigen Eindruck auf alle Anwesenden gemacht hatten. Herr Grey war wohl erwähnt, aber nur als einer der Gäste aufgeführt. Und keinem der Leser dieser ersten Morgenausgabe konnte ein Zweifel über die Echtheit des Diamanten kommen, der allem Anschein nach den Mittelpunkt in diesem großen Verbrechen und seinen Ursachen bildete.
Die Wirkung dieser Unvollständigkeit des Berichtes auf mich selber war eigenartig. Ich begann mich nachgerade zu fragen, ob der ganze Zwischenfall nicht ein Gebilde meiner erregten Phantasie vorstellte, einen Alpdruck, der sich über mich gelegt, über mich allein, und so keine Tatsache vorstellte, mit der man weiterhin zu rechnen hatte. Aber schon in der nächsten Minute erkannte ich die Wahrheit und verschwanden alle meine Zweifel, und es wurde mir klar, daß die Polizei nur in berechtigter Klugheit handelte, wenn sie die sensationelle Erklärung Herrn Greys noch geheim hielt, bis sie von den Sachverständigen auf ihre Richtigkeit hin geprüft würde.
Der Inhalt der zwei Spalten, die den Familienzwistigkeiten in breiter Geschwätzigkeit gewidmet waren, welche zur Trennung zwischen Herrn und Frau Fairbrother geführt hatten, ist in wenigen Zeilen erzählt. Die beiden hatten sich vor drei Jahren in Baltimore verheiratet. Er war damals schon ein reicher Mann, aber noch nicht der vielfache Millionär, der er nunmehr war. Mit seinem offenen, hübschen Gesicht und seinem Mangel an Umgangsformen paßte er nicht zu dieser lebhaften, glänzenden Kokette, deren Reize hauptsächlich auf künstlichen Ursachen beruhten. Trotzdem ihr Name nie in einen Skandal verwickelt ward, wurde ihr Gemahl ihrer Launen und ihrer Eroberungen überdrüssig, die vor ihm oder vor der Welt im allgemeinen zu verbergen, sie nicht die geringste Anstrengung machte; und an einem schönen Tage im vergangenen Jahre waren sie auf friedlichem Wege übereingekommen, sich zu trennen. So lebten sie denn jedes für sich, jedes auf großem Fuße und mit einer gewissen gegenseitigen Achtung vor einander. So verloren sie keinen ihrer Freunde und erhielten sich einen beneidenswerten Rang in der Gesellschaft. Er wurde selten gleichzeitig mit ihr eingeladen, und sie erschien niemals in Gesellschaften, in denen er erwartet wurde; aber mit Ausnahme dieses Umstandes wurde das Verhältnis der beiden nie berührt; ihr Leben ging seinen ruhigen Gang, und es wurde allgemein mit Zufriedenheit konstatiert, daß keines von beiden jemals über das andere ein unehrerbietiges Wort verlauten ließ. Gegenwärtig befand er sich im Südwesten, wohin er vor etwa drei Wochen verreist war. Er würde indes wahrscheinlich, sobald er das Telegramm erhielte, in die Stadt zurückkehren.
Die Vermutungen über die Person des Mörders waren notwendigerweise übereilt. Zwar sprach man von einem geheimnisvollen Falle, aber man konnte deutlich genug zwischen den Zeilen lesen, daß die Vernehmung Anson Durands als das sichere Vorspiel zu seiner Verhaftung unter Anklage des Mordes galt. –
Nunmehr ist es Zeit, daß ich über mich selbst einige Angaben mache. Ich hatte einen gründlichen Bildungsgang durch gemacht. Trotzdem ich der Liebling meines reichen Onkels war, hatte ich schon frühe sein Anerbieten, seinen Reichtum nach Herzenslust und für immer zu genießen, ausgeschlagen und Verpflichtungen auf mich genommen, die Selbstverleugnung und angestrengte Arbeit erforderten. Ich tat das aus dem Grunde, weil es mir Vergnügen bereitet, Geist und Gemüt zugleich zu beschäftigen. Mich jemand nützlich zu erweisen, wie es eine Krankenpflegerin dem Leidenden gegenüber tut, erschien mir als der beneidenswerteste Beruf, bevor ich Anson Durand zu lieben begann. Dann wurde die lebhafte Sehnsucht aller Frauen nach dem Schicksal, das ihrem Geschlechte beschieden ist, auch die meinige; aber so sehr ich mich anfänglich darnach sehnte, so sehr meine Liebe all mein Sein beherrschte, ich gelangte zu der Einsicht, daß sie nicht erwidert wurde und daher ein Zeichen von Schwäche sei. Ich kämpfte mit dem Gegner, und endlich gelang es mir, wie ich wenigstens glaubte, die Schlacht zu gewinnen; es war gerade zu der Zeit, als ich mein Diplom erhielt. Da aber kam die große Ueberraschung, die mir das Leben zugedacht hatte. Anson Durand erklärte mir seine Liebe, und ich gelangte zu der Einsicht, daß all meine Vorbereitungen nun häuslichen Freuden und dem einzigen wahren Dasein weichen müßten, das dem Weib beschieden ist. Eine Stunde hatte ich im Lichte dieser neuen Hoffnung gejubelt; dann kam das Drama, und ein Chaos brach über mich herein! Gewiß hatte ich gute Schulen durchgemacht. Aber konnten mich meine Kenntnisse auf dem einzigen Wege vorwärts bringen, auf dem ich mich jetzt nützlich erweisen könnte? Ich wußte es nicht, ich hielt mich gar nicht bei dieser Frage auf; ich war entschlossen, den Weg zu gehen, den ich vor mir sah, ob er zum Ziele führte oder nicht. Und erleichtert durch diese Forderung an meine Energie stand ich auf, kleidete mich an und wandte mich den Aufgaben zu, die der Tag an mich stellte.
Eine davon war, zu erfahren, ob Herr Grey bei seiner Rückkunft zum Hotel seine Tochter so krank vorfand, als seine üblen Ahnungen ihm verraten hatten. Ein Gespräch durch das Telephon, dem sich später noch ein zweites anschloß, klärte mich über diesen Punkt auf. Fräulein Grey war zwar schwer krank, aber immerhin konnte ihre Erkrankung nicht als lebensgefährlich bezeichnet werden. Auf jeden Fall hatte sich ihr Zustand gebessert, und wenn nicht von neuem Komplikationen hinzutraten, so war Hoffnung vorhanden, daß sie in vierzehn Tagen wieder ausgehen könnte.
Ich war nicht erstaunt über diese Nachricht. Im Gegenteil entsprach sie meinen Vermutungen. Der Schrei eines Geistes in einem amerikanischen Hause gehörte zum Aberglauben, selbst in einer Umgebung, die mit Furcht und all dem Entsetzen, das ein Verbrechen begleitet, förmlich geladen war. Und in meinen innersten Gedanken fügte ich diesen Umstand als weiteres verdächtiges Moment zu den andern hinzu, die ich gegen einen gewissen Jemand hegte.
Wenn ich die Ereignisse der nächstfolgenden Tage in aller Breite erzählen sollte, müßte ich meinen Bericht mit unnötigen Einzelheiten belasten.
Ich traf mit Herrn Durand in der nächsten Zeit nicht mehr zusammen. So umgänglich mein Onkel in den meisten Dingen war, so unerbittlich bewies er sich in diesem Punkte. Bevor nicht Herrn Durands guter Ruf durch das Verdikt des Koroners wiederhergestellt wäre oder sich ein Beweisgrund zeigen würde, der ihn wieder über allen Verdacht erhöbe, sollte ich mit ihm keinerlei Beziehungen unterhalten; ich erinnere mich noch genau an die Worte, mit denen mein Onkel ein endloses, hitziges Wortgefecht abschloß, das wir über diesen Gegenstand führten. Sie lauteten:
Du hast Herrn Durand deinen vollen Glauben an seine Unschuld in der klarsten Weise ausgesprochen. Das muß ihm fürs nächste genügen. Wenn er der ehrenwerte Gentleman ist, für den du ihn hältst, wird er sich auch damit zufrieden geben.
Da mein Onkel selten von seinen Vorsätzen abgeht, und wenn er einmal im Ernste spricht, er es auch genau damit nimmt, versuchte ich gar nicht mehr, seinen Entschluß zu bekämpfen, insbesondere da ich ihm recht geben mußte, wenn ich mir die Sache klar und nüchtern überlegte. Aber trotzdem ich so verhindert wurde, meinem Bräutigam meine Sympathie mitzuteilen, blieben doch meine Gedanken und Gefühle frei. Und diese galten alle dem Manne, der einem schmählichen Verdacht verfallen war, gegen dessen Erniedrigung und Böswilligkeit er, infolge seiner in gesellschaftlicher wie in geschäftlicher Beziehung von jeher blühenden Stellung, nicht vorbereitet war.
Denn Herr Durand galt immer noch beinahe ganz allgemein als verdächtig, trotz einiger Tatsachen, die nach und nach ans Licht kamen und seine Aussage bestätigten.
Dies kam mir höchst ungerecht vor. Wie sollte es denn gehen, wenn keine neuen Anhaltspunkte sich mehr ergaben, die von der Polizei und vom Publikum auch als solche angesehen wurden? Sollte er nicht alle die Umstände, die seine Schuld in Zweifel stellten, zu seinen Gunsten auslegen dürfen? Zum Beispiel jenen Blutspritzer auf seinem Hemde, den ich gesehen und die Gestalt, von der ich berichtet hatte? Warum wurde die Tatsache, daß der Flecken ganz anders aussah, als wenn er von unten her auf das Hemd gelangt wäre und seiner Form nach nur von oben heruntergefallen sein konnte, warum wurde diese Tatsache nicht höher bewertet von denen, deren Pflicht es war, in das Geheimnis einzudringen, um dem wahren Sachverhalt auf den Grund zu kommen? Mir erzählte dieser Umstand eine so klare Geschichte von seiner Unschuld, daß ich mich verwunderte, wie ein Mann wie der Inspektor sie mit Stillschweigen übergehen konnte. Aber später verstand ich es. Ein einziges Wort klärte mich darüber auf. Meine Berechnung war ja ganz richtig gewesen. Das Blut mußte unbedingt von oben herabgetropft sein. Aber was nicht bewiesen werden konnte, war, daß dieser Tropfen nicht in dem Augenblick herabgefallen war, wo das Stilett in die Lampe hinaufgesteckt wurde, sondern erst, nachdem der Schuldige entkommen war und ein anderer, ein Unschuldiger, das Zimmer betreten hatte.
Aber das Geheimnis der zerbrochenen Kaffeetassen! Dafür schien sich keine Erklärung finden zu lassen.
Und dann das noch immer nicht gelöste Rätsel in der Inschrift auf dem Zettel, den man in der Hand des ermordeten Weibes gefunden hatte, jener Warnung, die, wie man jetzt entziffert hatte, lautete: »Nimm Dich in acht! Er hat die Absicht, zum Ball zu kommen! Mach Dich auf Schlimmes gefaßt, wenn –« Sollte man darin die Belastung eines Mannes sehen, der schon nach der Natur seines beabsichtigten Anschlags niemand in sein Vertrauen ziehen konnte?
Dann das Stilett, von dem eine genaue Abbildung in sämtlichen Zeitungen erschien! War das die Art von Waffe, die ein feiner New Yorker Herr für ein derartiges Verbrechen benutzen würde? Es war ein so eigenartiges Stück, daß man es wohl bis zu seinem Besitzer zurückverfolgen könnte. Wäre es als das Eigentum des Herrn Ramsdell erkannt worden, als ein Stück der reichhaltigen Sammlung von Kunstgegenständen, die in dem höchst elegant eingerichteten Alkoven vorhanden waren, so hätte seine Verwendung als Mordinstrument als Beweis dafür in Betracht kommen können, daß das Verbrechen ohne Vorsatz ausgeführt worden sei, und damit als Grundlage eines Beweises zugunsten der Unschuld Herrn Durands keinen Wert besessen. Aber Herr Ramsdell erklärte von Anfang an, daß er die Waffe nicht kenne, und folglich mußte man sich mit der Frage begnügen, ob ein Mann von Herrn Durands Urteilsvermögen eine ungewöhnliche Waffe zur Ausübung eines so empörenden Verbrechens mitgebracht haben würde, dieses Verbrechens, das sowohl wegen seiner Natur wie wegen der Begleitumstände zweifellos die Aufmerksamkeit der ganzen zivilisierten Welt auf sich lenken würde. Ein anderer Beweisgrund, den er selber vorbrachte, und dem alle seine Freunde beistimmten, war der, daß ein Diamantenhändler sicher der letzte wäre, der versuchen würde, durch irgend welche ungesetzlichen Mittel in den Besitz eines so hervorragenden Juwels zu gelangen. Denn er würde, besser als sonst irgend jemand, wissen, daß es so gut wie unmöglich wäre, einen solchen Stein auf irgend einem Markt, vielleicht mit Ausnahme des Orients, unterzubringen. Darauf wurde ihm erwidert, daß ihm auch niemand eine solche Tollheit zutraue; daß, wenn er sich in den Besitz dieses großen Diamanten habe setzen wollen, es nur deshalb geschehen sei, um seine Konkurrenz mit dem andern, den er für Herrn Smythe sich verschafft habe, aus dem Wege zu räumen. Diese Beweisführung trieb uns freilich wieder auf den einzigen Grund zurück, den wir zu seinen Gunsten anzuführen vermochten, seinen bis jetzt unbefleckten Ruf und das Zutrauen, das alle die zu ihm hegten, die ihn kannten.
Aber der einzige Umstand, der mich beunruhigte, und der für alle – Beamte oder Publikum – unzweifelhaft die Quelle der größten Verwirrung bildete, war die unerwartete Bestätigung von Herrn Greys Ansicht über den Diamanten durch das Urteil der Sachverständigen. Sein Name erschien zwar nicht in den Blättern, die alle mit der größten Uebereinstimmung Schweigen darüber bewahrt hatten. Aber der Wink, den er am Abend des Balles im Ramsdellschen Hause dem Inspektor gegeben, war befolgt worden. Und nachdem Sachverständige den Diamanten genau untersucht hatten, gelangten sie zu dem Ergebnis, daß der Stein, für den, wie viele glaubten, ein Leben verloren, ein anderes aufs Spiel gesetzt worden war, nur eine Fälschung sei; eine gute, ja eine ungewöhnlich hervorragende Imitation ohnegleichen, aber eben doch nur eine Nachbildung des großen und berühmten Edelsteins, der vor zwölf Monaten durch Tiffanys Hand gegangen war: Diese Entscheidung traf wie ein Blitzschlag alle diejenigen, die den Diamanten in unvergleichlichem Feuer eine oder zwei Stunden vor dem Tode der unglücklichen Frau Fairbrother an ihrer Brust hatten glänzen sehen.
Die Wirkung dieser Entdeckung auf mich war so überwältigend, daß ich mehrere Tage lang nur noch in einem Traumzustand dahinlebte. Doch unterließ ich es nicht, aufmerksam die Annahme zu verfolgen, die die Presse darüber verlauten ließ. Diese Vermutungen waren der Stoff so zahlreicher Diskussionen, daß binnen kurzem die meist behandelte Frage nicht mehr den Mörder Frau Fairbrothers betraf (diese Frage schien für viele schon erledigt zu sein), sondern, wer es gewesen, der an Stelle des echten Diamanten die Fälschung untergeschoben habe, und wie und wann und wo dieser Betrug vor sich gegangen sei.
Die Ansichten über diesen Punkt waren, wie ich schon erwähnte, zahlreich und verschieden. Einige bestimmten als Zeit dafür jene sehr kritische und schwer kontrollierbare Zwischenzeit zwischen der Ermordung und dem Augenblick, wo Herr Durand den Schauplatz betrat. Diese Theorie wurde, wie kaum erwähnt zu werden braucht, von denen aufgestellt, die ihn zwar für unschuldig an der Ermordung Frau Fairbrothers hielten, aber doch glaubten, er habe die vorgefundene Sachlage benutzt, um den Leichnam des Steines zu berauben, den er in seinem damaligen Entsetzen und in der Aufregung augenscheinlich für ihren großen Diamanten hielt. Anderen, unter denen sich viele Teilnehmer an dem Balle befanden, schien es außer Frage zu stehen, daß diese Unterschiebung vor dem Ball, und zwar mit dem vollen Einverständnis der Frau Fairbrother geschehen sei. Die auffallende Art und Weise, wie sie ihren Fächer zwischen dem glitzernden Schmuck an ihrer Brust und den neugierigen Blicken, die fortwährend darauf gerichtet waren, bewegte, mochte ihr damals als Koketterie ausgelegt werden, aber jetzt erschien sie ihnen eher als Ausdruck ihrer Befürchtung, die Täuschung, die sie sich hatte zuschulden kommen lassen, möchte entdeckt werden. Keiner von allen setzte die Zeit der Verwechselung auf den gleichen Moment an, wie ich; aber keiner hatte auch, wie ich, den Hergang mit den Augen der Liebe verfolgt; außerdem muß daran erinnert werden, daß die meisten, und darunter muß ich auch die Polizeibeamten rechnen, hauptsächlich ihr Augenmerk darauf richteten, sichere Beweise für die Schuld Herrn Durands zu finden; ich dagegen kannte nur ein Ziel, und das war im Gegenteil, die Erklärungen, die uns Herr Durand gegeben, durch unzweifelhaft bewiesene Tatsachen zu befestigen. Und dazu war es unumgänglich nötig, zu beweisen, daß Frau Fairbrother sich über den hohen Wert des Edelsteins an ihrer Brust wohl bewußt war und infolgedessen bestrebt sein mußte, sich des Juwels zu entledigen, wenn, wie so viele glaubten, der ergänzte Brief tatsächlich folgendermaßen lauten mußte:
»Nimm Dich in acht! Er hat die Absicht, zum Ball zu kommen! Mach Dich auf Schlimmes gefaßt, wenn Du den großen Diamant bei Dir trägst!«
Es war ja möglich, daß sie selbst das Opfer eines Betruges geworden war. Es war ja nicht ausgeschlossen, daß irgend jemand, der sich zu ihren Schmucksachen Zutritt zu verschaffen wußte, schon vor jenem Abend, ohne ihr Vorwissen die Steine ausgetauscht hatte; aber, da bis jetzt noch kein Grund vorlag, dies anzunehmen, da sie keinen öffentlichen und auch, soweit man in Erfahrung bringen konnte, keinen geheimen Liebhaber oder unehrlichen Diener hatte, und da vor allem, so weit sich bestimmen ließ, während des ganzen letzten Jahres weder hier noch auswärts ein Diamant von dieser Bedeutung auf den Markt gekommen war, konnte ich mich nicht entschließen, dieser Vermutung beizutreten; vielleicht aus dem gleichen Grunde, wie ich in meiner Unerfahrenheit auch nicht den Mut hatte, einer andern Annahme volles Vertrauen entgegenzubringen, die völlig verschieden war von den angeführten Hypothesen.
Diese Annahme zwar, die in meinem Geiste immer greifbarere Gestalt anzunehmen begann und mehr und mehr an Deutlichkeit gewann, war es, die meinen Mut während der ganzen schrecklichen Zeit gezwungenen Wartens und Bangens aufrecht erhielt, aber ich war entschlossen, meinen Verdacht, für so wichtig ich ihn auch hielt, erst dann öffentlich auszusprechen, wenn mir alle Hoffnung benommen wäre, daß Herr Durand von seiten derer Recht zuteil würde, die die Einmischung einer so unbedeutenden kleinen Person, wie ich eine war, in das große Getriebe der Rechtsprechung sicher nicht mit freundlicher Nachsicht aufnehmen würden.
Die Verhandlung, von der man die Aufklärung aller dieser zweifelhaften Umstände erwarten durfte, war in Rücksicht auf die Heimkehr Herrn Fairbrothers verschoben worden. Sein Zeugnis war von größtem Werte. Wenn er nicht vielleicht gar in der Lage war, wertvolle Winke in Beziehung auf die Person des Verbrechers zu geben, so konnte er doch wenigstens Auskunft über die leidenschaftlich umstrittene Frage erteilen, ob der Edelstein, den die Ermordete bei ihrem Betreten des Ballsaales getragen, der echte gewesen, derselbe, den ihm Tiffany wieder zurückgegeben hatte oder die wohlbekannte Fälschung, die sich jetzt in den Händen der Polizei befand. Er hielt sich jetzt irgendwo in den Bergen Unterkolorados auf, aber eigentümlicherweise war es nicht gelungen, in direkte Verbindung mit ihm zu treten; noch konnte man in Erfahrung bringen, ob er schon von dem tragischen Tod seiner Frau Kenntnis erlangt hatte. So kam es, daß die Angelegenheit in New York nur langsame Fortschritte machte, und schon hatte es den Anschein, als sei der Fall auf einen toten Punkt gelangt, da wurde plötzlich die öffentliche Meinung wieder in Bewegung gesetzt: aus Santa Fé lief ein Telegramm ein, das der ganzen Angelegenheit eine bestimmte Wendung zu geben schien. Nach dieser Nachricht hatte Abner Fairbrother vor wenigen Tagen auf dem Wege zu einer neuen Goldmine, der »Placida«, die Stadt berührt. Er habe schon damals die Symptome einer Lungenentzündung an sich verspürt, und nach neueren Nachrichten liege er schwer krank darnieder.
Krank! Das erklärte alles! Sein Schweigen, das viele als Gleichgültigkeit betrachtet hatten, war das eines Mannes, dem die physische Möglichkeit abgeht, zu reden oder auf irgend eine Weise sich zu betätigen. Krank! Dieser tragische Umstand rief endlose Auslegungen hervor. War ihm der Tod seiner Frau bekannt oder nicht? War er nach oder vor seiner Abreise von Colorado nach Mexiko erkrankt? Hatte seine Krankheit ihre Ursache in dem Schlag, den ihm die Kunde vom Schicksal seiner Frau versetzt, oder, wie aus den Zeitungsberichten hervorzugehen schien, im allzu raschen Wechsel des Klimas?
Das ganze Land zitterte vor Aufregung, wieviel mehr verzehrte ich armes Ding, an das keiner dachte, mich vor Ungeduld! Das können sich nur die vorstellen, die selbst einmal einem ähnlichen Aufschub standhalten mußten. Würden die Verhandlungen, die so ungeduldig erwartet wurden, noch länger hinausgeschoben werden? Würde Herr Durand auf unbestimmte Zeit im Ungewissen belassen werden, in einer so undurchdringlichen Atmosphäre des Unheils, das ihn zur Verzweiflung bringen mußte? Sollte ich noch länger die Leiden ertragen müssen, die diese Umstände auf mich häuften? Jetzt, wo ich doch glaubte, ich wisse –
Aber das Schicksal zeigte sich weniger verstockt, als ich befürchtete. Am nächsten Morgen wurde auf telegraphischem Wege von Santa Fé wenigstens einer der Punkte dieser großen Streitfrage erledigt. Ich werde diese telegraphische Nachricht in der Form der später wiedergegebenen Mitteilung anführen, die wenige Tage nachher in einer der größten Zeitungen zu lesen war.
Sie kam von ihrem ständigen Berichterstatter für Neumexiko und war, wie der Herausgeber besonders betonte, für ihn selber und nicht für das Publikum abgefaßt worden. Er habe indes in Anbetracht des großen Interesses, das die ganze Angelegenheit in den Augen seiner Leser besitze, es für gut befunden, den Bericht ohne Kürzungen dem Publikum zur Verfügung zu stellen.