
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
»Ich habe heute Nacht so seltsam geträumt,« sagte Seraphine eines Tages zu Rita, die sie im Fahrstuhle wieder nach ihrem Lieblingsplätzchen zum stillen Weiher hingeschoben hatte, und kleine Krumen Weißbrod in's Wasser warf, um die Schwäne damit zu füttern. Es waren zwei stolze Vogelpaare mit feingeschwungenen Hälsen und blendend weißem Gefieder, und man hatte sie erst seit etwa acht Tagen wieder in's Freie gesetzt. Der Weiher war ja ebenfalls gefroren gewesen, und viele lustige Kinder hatten sich in den Wintermonaten darauf getummelt, nun lag er wieder gleich einer tiefblau glänzenden Fläche zwischen den grünen Ufern und spiegelte die herrlichen Bäume in seiner Tiefe, und nachts den Mond und das Heer der Sterne. – Die Schwäne aber stritten sich um das Futter aus Ritas Händen und Seraphine schaute ihnen still sinnend zu. »Nun und was hat meinem Schatz geträumt?« frug die heitere Freundin, die es nicht liebte, wenn die Kranke in die eigenen Gedanken versunken, so schweigend saß.
»Mir träumte, ich säße in unserm großen Saale mit den Ahnenbildern, du standest an meiner Seite Rita, und Lischen hatte uns ein ganzes Körblein voll Erdbeeren gebracht, die sie im Walde für uns gepflückt hatte. Wir kosteten sie, ich fand ihren Geschmack bitter, sagte jedoch nichts, um dem Kinde seine Freude nicht zu verderben. Da sah ich plötzlich unsern Franz eintreten, den Saal zu beleuchten. Er zündete die beiden großen Leuchter an, und steckte auch noch die Kerzen des sechsarmigen Girandolen am Kamine in Brand, so daß es auffällig hell um uns her wurde. Plötzlich öffneten sich die beiden Thürflügel und eine große weiße Gestalt trat herein, sie schien mehr zu schweben als zu gehen, man hörte keinen Tritt, wohl aber das Rauschen ihrer Atlasschleppe. Ihr Antlitz war verschleiert, ich vermochte ihre Züge nicht zu unterscheiden, auch die Stimme schien mir unbekannt. –
Langsam, feierlich schritt sie auf mich zu, reichte mir ihre Hand, sie war eisigkalt, wie die einer Toten und sagte: »Steh' auf von diesem Platze mein Kind, er gebührt dir nicht.«
Ich sprang sofort auf beide Füße, erschrocken, zitternd stammelte ich: »Muß ich wirklich fort von hier?«
»Ja,« sprach die Dame in Weiß und nickte mit dem Haupte, wie zur Bekräftigung. Du aber legtest deinen Arm um meinen Nacken und suchtest mich zu trösten, denn ich weinte – denke nur wie thöricht Rita, ich weinte, und war tief traurig.
»Und müßtest du gehen, mein Lieb, dann ging ich mit dir!« flüstertest du mir zu und darüber bin ich erwacht. –
Aber ich fror, und beide Wangen waren naß von jenen Thränen.«
»Soll ich deine Traumdeuterin machen, Herzensphinchen?« scherzte Rita, »so höre: »Die weiße Dame will mir die Krankheit dünken, die dich bisher an Zimmer und Bett festgehalten hat, sie kommt jetzt mit beginnender Sommerszeit, und möchte dich hinausbefehlen in's Freie, nicht hier ist dein Platz; der Platz beim Kamine gebührt dem Alter, nicht dir, nicht unserer Jugend, deshalb solltest du aufstehen und ihn verlassen. Ist's nicht so?«
Seraphine schüttelte traurig ihr Köpfchen: »Du holst deine Deutung gar weit her, Liebste, und ich kann ihr nicht beipflichten. Weißt du, was ich denke? Die fremde Dame war der Tod, ich sah ihre Züge nicht, aber sie war so eisigkalt, und sie hat mir bedeutet, mich zum Sterben herzurichten.«
»I was nicht gar, das wäre!« lachte Rita, obschon ihr im innersten Herzen ein tiefes Weh zuckte, das sie mühsam zu verbergen suchte, »was thäte ich alsdann dabei? Ich hab' dir ja gesagt, ich ginge auch mit dir, und weißt du Phinchen – sterben mag ich jetzt noch nicht! Du wirst schon sehen, es bedeutet deine baldige Genesung und daß wir beide täglich recht viel und lange im Parke umherschweifen und gar nimmer in dem düstern Zimmer bleiben mögen.«
»Fandest du nicht meinen Vater recht sehr traurig heute, Rita?« frug Seraphine plötzlich, »als er vorhin an uns vorüberging, und uns begrüßte, meinte ich, so schwermütig hätten seine Augen nach mir geblickt, und seine Hand zitterte, als ich mich darauf neigte, sie zu küssen. O Rita, was nur den armen Vater quälen mag? Wie viel gäb' ich darum, könnt' ich's ergründen, denn dann könnte ich ihm vielleicht helfen!«
»Ob du nicht doch zu schwarz siehst Liebste?« versuchte Rita sie zu trösten; »die großen Besitzungen, die vielen Beamten, all' das bringt Verdruß und Unruhe mit sich, ich möchte nicht um alles in der Welt an seiner Stelle sein, bin viel, viel lieber des alten Invaliden dummes Mädel, als der Besitzer von Hohenfeldt. Was sagst du dazu?«
»Ich denke, Gott giebt jedem, was er braucht, und auch zum Amte das Er uns anweist, schenkt Er den nötigen Verstand und die Kraft, es auszuüben.«
»Ich wurde heute durch einen Brief gebeten in das Gasthaus zur goldnen Taube zu kommen,« sagte der Graf bei Tische zu seiner Familie, »und ich bitte dich, liebe Mechtild sei nicht bange, wenn ich etwas länger bleibe, als du mich vielleicht zurück erwartest; ein Sterbender verlangt nach mir, so muß ich hin, das siehst du ein.«
»Kennst du den Kranken, Manuel?«
»O ja, ich kannte ihn sehr wohl; er war lange Jahre durch mein steter Gefährte, mein Reisegenosse, mein Begleiter auf der Jagd – auch du kennst ihn – es ist Ferdinand, der Sohn unsers einstigen Försters.«
Die Gräfin erschrak; Ferdinand! Dieser Name weckte in ihr tausend bittere und schwere Erinnerungen, sie hatte ihm nie Vertrauen schenken können, er war ihr stets so kriechend höflich entgegengetreten – aber nun war er sterbend, ihr frommes Herz kannte nichts von Haß und Groll, sie verzieh, wenn immer er ihr unangenehm gewesen wäre, und betete, daß Gott ihm helfe.
»Kann ich nichts für ihn thun Manuel?« frug sie sanft, »ihm etwas schicken oder irgend welche Erleichterung geben?«
»Er wird nimmer viel bedürfen, Liebe, ich danke dir.«
»Hat ihn der Pfarrer besucht?«
»Ja, man hat mir gesagt, er sei gestern nachts hier eingetroffen und habe vor allem seinen Frieden mit Gott gemacht.«
»O dann ist's gut! Gute Nacht, mein Manuel!« sprach die Gräfin, und bot ihrem Gemahle die Hand zum Abschiede. Er drückte sie fest, und küßte sie auf die Stirne. »Leb' wohl, bete für den Armen, auch du mein Kind;« sprach er zu Seraphine gewendet, und fügte leise, so daß nur sie allein es hören konnte hinzu: »und auch für mich!« – – –
Seraphine nickte und küßte seine Hand. »Ach könnt' ich deinen Kummer von dir nehmen!« dachte sie bei sich.
Der Graf aber begab sich nach dem Gasthofe und wurde von dem Wirte ehrerbietigst in das Zimmer geführt, das der Neuangekommene bewohnte. Obwohl Hohenfeldt seine zweite Heimat und der eigentliche Aufenthalt seiner Kinder- und Jugendjahre gewesen war, hätte ihn doch niemand wieder erkannt. Selbst dem Grafen wurde es schwer, den ehemaligen Freund und Vertrauten wieder zu finden in dem abgezehrten, todbleichen Gesichte, und den gänzlich verfallenen Zügen. Ferdinand erhob sich und bezeigte eine sichtliche Freude, doch aber auch unverkennbares Erschrecken, als Graf Emanuel an sein Bett trat. Auch in ihm hatten Gram und Kummer scharf gemeißelt, auch hier hatte der Schmerz Besitz ergriffen von dem einst so schönen männlichen Gesichte und es grausam zerstört! –
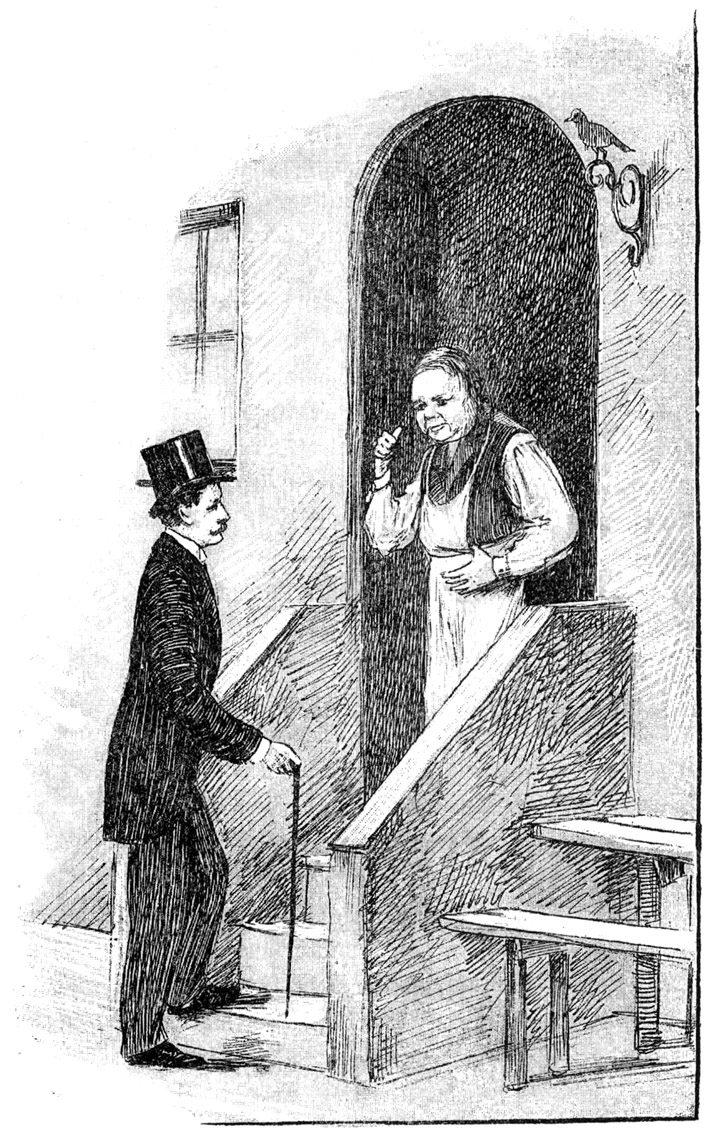
»Sie kommen, gnädiger Herr!« begann der Kranke mit heiserer Stimme, »Sie haben meine Bitte erfüllt, und lassen mich nicht sterben, ohne mir verziehen zu haben. Gott wolle Sie dafür belohnen!« –
Er mußte eine Weile innehalten, ehe er weiterfuhr: »Sie wissen, welch' ein bewegtes Leben hinter mir liegt, Herr Graf, und daß ich jetzt über den Ocean herübergekommen bin, denn ich fand nirgends Rast noch Ruhe. Ich habe schon als Knabe nach dem Glücke gejagt, und kannte kein anderes, kein höheres Glück, als reich zu sein. Mit Geld glaubte ich alles zu besitzen, mit Geld glaubte ich mir alles zu verschaffen – aber den Frieden gab es mir nicht.
Herr Graf wissen, daß mir das Glück zuweilen für lange Zeit lächelte, daß ich mich dann für beneidenswert hielt, und glaubte, ich könnte mir Welt und Menschen unterwerfen. Aber eben diese rasende Gewinnsucht führte mich zum Abgrunde – ich wurde ein Spieler, und verlor oft an einem Abende wieder, was ich in vielen andern Tagen gewonnen hatte. So traten allmählich große Verlegenheiten an mich heran, ich mußte mich in Schulden stürzen, ich deckte eine Schuld und machte, um dies zu ermöglichen, eine neue Anleihe. Ich war damals immer um Sie, Herr Graf, und – jetzt weiß ich es – ich verleitete Sie zu vielem Unrechte, lenkte Sie aber nie zum Guten. Sie halfen mir oft aus der Not, dagegen schwieg ich zu manchem, was Sie nicht bekannt haben mochten, Herr, Sie mögen mich der Gewinnsucht zeihen, ich gestehe es, daß sie mir keineswegs fremd war, im Gegenteil, daß ich eben wieder einmal sehr bedeutend in der Klemme saß und einer ergiebigen Summe bedurfte, um dies letzte Mal der öffentlichen Schande und Strafe zu entgehen. – Ein letztes Mal sollte es auch wirklich sein, ich war in Leidenschaft und Unrecht verstrickt, doch noch nicht so ganz gesunken, daß mir nichts an der Öffentlichkeit gelegen wäre. Eine große Ehrenschuld mußte eingelöst werden – und niemand konnte mir helfen, als Sie! Ich wollte Ihnen hierfür auch einen wirklichen Dienst leisten, einen Gefallen thun, der sich der Mühe lohnte; denn glauben Sie mir, Herr Graf, ich hatte Sie wirklich lieb – niemals in meinem Leben liebte ich nach meiner Mutter noch jemanden so aufrichtig, wie Sie!« – Wieder hielt er inne – das Sprechen schien ihm furchtbar schwer zu werden und oft unterbrach ein heftiger, trockener Husten seine Rede; nach einer Weile fuhr er fort: »Schon mit dem Tode des Grafen Rudolf hatte sich der Wunsch in mir festgesetzt, die vier Augen, die Ihrem Glücke noch im Wege standen, sollten sich schließen für immer. Wie aber gerade ich das angehen könnte, wußte ich freilich noch nicht! Aber jeder Tag befestigte meinen Vorsatz, ich wollte Sie glücklich machen, wollte Ihre ehrgeizigen Wünsche befriedigen um jeden Preis. Dann kam der Tod der beiden Damen Helene und Irene, nur die kleine Tochter blieb noch zu beachten, und als ich vernahm, man beabsichtige eine Übersiedelung nach Hohenfeldt-Rast, war ich entschlossen, dort mein Ziel zu erreichen, koste es, was es wolle. Mir selbst stieg das Wasser bereits an den Hals, ich sah keinen weiteren Ausweg mehr zu meiner Rettung, als durch Sie! Ich bedurfte einer großen Summe, und nur von Ihnen hatte ich sie zu erwarten. Ich wollte sie erzwingen. In den Gemächern, die man für die kleine Gräfin Hedwig zur Wohnung bestimmte, war morsches Holzgetäfel, Schnitzereien, alte Möbel in Menge. Wie schnell würde das in Rauch und Feuer aufgehen! und das arme, kleine Leben, das eigentlich noch gar nicht selbstbewußt begonnen hatte, ein elternloses Kind gegenüber der bösen, gefahrvollen Welt – fast fühlte ich's wie Mitleid mit dem Kinde, und mehr noch fand ich es erbärmlich, daß einer stolzen, männlichen Kraft wie der Ihrigen, dieses schwache Kind entgegen stände; nein, das sollte, das durfte nicht sein! – Alles andere wissen Sie, Herr Graf!
In der zweiten Nacht nach der Ankunft Ihrer Familie auf dem böhmischen Schlosse brannte der rechte Flügel desselben nieder, und mit ihm verunglückte die kleine Erbin von Hohenfeldt, die zweijährige Tochter Ihres seligen Bruders Rudolf.«
Graf Emanuel war bleich geworden, wie der Sterbende vor ihm, als er jetzt das Wort ergriff und erzählte: »So sagtest du, und so bekam es jedermann zu hören. Ich war damals in stürmischer Eile nach Böhmen geritten, denn ein Bote hatte mich von dem schweren Unglücke benachrichtigt. Ich fand alles in gräßlichster Verwirrung, du selbst aber hattest nur die erneute Versicherung deiner hingebendsten Treue für mich – dennoch sagte mir ein einziger Blick in dein Auge alles. Ich war frei von jedem störenden Anhange, war der Erbe kolossaler Reichtümer, und das alles war dein Werk, Ferdinand!«
Der Kranke nickte und sprach, ohne den hervorstürzenden Thränen zu wehren: »Ja, Herr Graf, mein Werk, aber auch mein Fluch! – – Die große Summe, die Sie mir schenkten, brachte mich, um nicht auffällig zu sein, nicht sogleich, aber nach einiger Zeit über das Weltmeer, wo ich eine neue Existenz gründete.
Ich glaubte mich jetzt Ihnen gegenüber quitt.«
»Und ich Unseliger trug den Lohn meines Verbrechens in mir herum!« rief der Graf im klagenden Tone. »Was ich gelitten habe, seitdem meine Habsucht, mein Ehrgeiz Befriedigung fand, seitdem ich erreichte, nach was ich schon als Knabe gestrebt, Macht und Reichtum und Unabhängigkeit, – Gott allein weiß es.
Oft steigt der Schatten eines bleichen Kindes vor mir auf und verfolgt mich bis in meine Träume, er greift mit eiskalter Hand nach meinem Herzen, daß mir der Atem stockt, und meine Sinne sich verwirren. Und doch sind wieder andere Tage, wo ich das Schreckliche nicht glauben kann, ich meine dann, du hättest mich in deiner Gewalt behalten mögen, hättest die kleine Hedwig nur beiseite geschafft, um mir mit ihr zu drohen, oder mit ihrer Zuhilfenahme etwas von mir zu erpressen.
Ach, wäre es so, Ferdinand! Ach hättest du mich damals belogen, dann wäre ich kein Mörder, kein Verbrecher. O sei barmherzig, sprich! Vielleicht in wenigen Stunden schon stehst du vor dem ewigen Richter – sprich die Wahrheit, ist Hedwig tot? lebt sie? O sage nein, niemals befahl ich dir, sie zu töten, niemals! Ich erschrecke nicht, wenn du sagst: verlasse dein Schloß, gieb alles hin, – ich küsse die Hand, die mich zum Bettler macht, nur sprich das einzige Wort!« –
»Ja Herr, ich glaube, daß sie lebt!« kam es langsam über die bläulichen Lippen des Kranken, »ich mußte es Ihnen noch sagen, ehe ich sterbe.«
Graf Emanuel meinte umzusinken, und hielt sich nur mit äußerster Willenskraft aufrecht, um alles zu hören, was jener noch zu sagen hatte.
Sollte es möglich sein? Sollte doch noch ein letztes Mal Friede für ihn werden? Wollte Gott barmherzig sein, und hatte er genug gebüßt?
»Meines Weibes Glück hab' ich vergiftet, meinen Arthur zu den andern Söhnen in's Grab gelegt, und muß täglich bereit sein, auch mein letztes Kind hinscheiden zu sehen – keine Freude – keinen Frieden hat mir dein Rat gebracht, Ferdinand, – und das entsetzliche, das schmutzige Geld! Fluch und Elend! Ach, wie gerne gäbe ich alles zurück in Hedwigs Hände, könnte ich damit gut machen, was ich verbrach, könnt' ich sie wieder einsetzen in ihr Recht! Sprich, lebt sie? und wo, wo kann ich sie finden?« –
»Ich weiß es nicht.«
Der Graf glaubte aus allen Himmeln in den Abgrund der Hölle zu stürzen bei diesen Worten.
»Willst du mich auf's äußerste treiben? Hältst du mir die goldne Schale mit dem Hoffnungstranke an die Lippen, um sie hohnlachend wieder mir zu entreißen?«
»Ach Herr Graf, ich fürchtete, daß es so kommen würde – hier aber bin ich unschuldig; hier hat Gott selbst eingegriffen, und all' unsere menschlichen Berechnungen zu nichte gemacht. Deshalb hab' ich so lange mit mir gekämpft, ob ich hierher kommen, Ihnen alles sagen sollte? Ach, ich wußte es ja selber nicht.
Alles war gut vorgesehen, ein stummer Junge, der mir mit hündischer Treue ergeben war, weil ich ihm einmal eine große Wohlthat erwiesen hatte, war von mir belehrt worden in jener Nacht an der hinteren Schloßpforte, die durch den weitläufigen Park nach dem Walde führt, mich zu erwarten. Ich hatte wohl dafür gesorgt, daß das Feuer in jenem Flügel mit Vehemenz ausbrechen und das Schlafzimmer des Kindes rasch in einen Flammenherd umwandeln mußte. Die Kleine selbst hatte ich schon vorher in meiner Nähe verborgen; daß die Kinderfrau, nachdem sie Hedwig zur Ruhe gebracht und sich in's Bett begeben hatte, nicht mehr nach dem Kinde sehen konnte, sondern fest schlief, war gleichfalls meine Sorge gewesen.
Ich wußte, daß im Städtchen N. wohlhabende Leute wohnten, die gewiß geneigt sein würden, die Kleine aufzunehmen.
Vorerst hatte ich auch noch ihre Kleider und Wäsche mit denen eines einfachen Kindes vertauscht, und beglückwünschte mich ganz besonders zu dem Umstande, daß das Kind noch so viel wie gar nichts und dann nur völlig Unverständliches sprach, so daß jeder Verrat ausgeschlossen war. Und gerade diese Langsamkeit im Sprechen hatte die gräflichen Angehörigen an der kleinen Hedwig so oft beunruhigt.
Mein Stummer hatte keine Ahnung, wer das Kind sei, das ihm übergeben wurde, er hatte unbedingten Glauben an mein Wort und that genau, wie ich befahl.
Ich hatte ihm auch noch den Auftrag erteilt, für die Ernährung der Kleinen Sorge zu tragen, und eine Stunde, ehe er sie irgendwo absetzte, von dem Schlafmittel Gebrauch zu machen.
Mein goldner Lohn, seine Anhänglichkeit an mich, und sein körperliches Unglück, das ihn ohnehin vom Verkehre mit den Menschen abschnitt, verbürgte meinem Unternehmen das Gelingen. Alles ging so gut als möglich. Sie wissen, daß ich selbst mich noch einmal in's brennende Schloß stürzte, um das Kind zu retten, daß man sämtliche Dienerschaft verhörte, daß niemand derselben fehlte, und auch sonst nicht das Geringste vermißt wurde, was auf einen Einbruch oder Brandstiftung hätte schließen lassen! – Mein Stummer war nach einigen Tagen wieder zurückgekehrt. Er berichtete mir in seiner Sprache, die ich wohl verstand, er habe die Kleine nach der Stadt N. getragen, sie dort in einem schönen Hause niedergelegt und von seinem Verstecke aus beobachtet, wie sie dort gefunden und freundlich aufgehoben worden wäre.
Reich belohnt entließ ich ihn. Ja, jetzt, angesichts des Todes gestehe ich es, Herr Graf! ich freute mich damals meiner Schlauheit, ich ließ Sie fest an Hedwigs Tod glauben, während ich mir ein vortreffliches Drohmittel vorbehielt, in der Mitteilung nämlich: Sie lebt.
Diese zwei Worte, das wußte ich, sicherten mir Ihre immer offene Börse, und dazu Ihr absolutes Schweigen. –
Ich habe hiervon keinen Nutzen mehr gezogen. – Sie wissen es.
Seitdem sind mehr denn zwölf Jahre hingezogen; ich glaubte Sie nicht wieder zu sehen – wer erklärt aber die Sehnsucht eines Menschen, dem der Tod im Nacken sitzt, wer das Verlangen nach seiner Heimat? Schon lange trage ich die zehrende Krankheit in mir herum, Tag und Nacht drängte es mich die heimatliche Scholle noch einmal zu küssen, das Grab der Eltern zu sehen – der guten Eltern, denen meine schlechte Aufführung das Herz gebrochen hat, – aber auch Ihre Verzeihung wollte ich erlangen, Herr Graf, um den Preis meines Geständnisses. Hedwigs Aufenthalt zu erfahren, reiste ich selbst nach jener kleinen böhmischen Stadt; mein Stummer, der inzwischen verunglückte, hatte mir das Haus genau bezeichnet, den Namen der Familie aber wußte er nicht; – wer beschreibt meinen Schrecken, als ich erfuhr, jener Besitz sei schon seit vielen Jahren in fremden Händen. –
Nach dem Tode der jungen Frau, so erzählte mir jemand, sei alles verkauft worden, und ihr Gatte mit dem kleinen Mädchen abgereist. Ich aber kam todkrank in Hohenfeldt an. Das ist alles, was ich weiß.«
Der Kranke schien völlig erschöpft; er hatte seine letzte Kraft aufgeboten, den Hergang mitzuteilen, und sein Gewissen von der Last frei zu reden, die es drückte. Jetzt aber war seine Aufgabe vollendet. Er übergab dem Grafen seine Brieftasche, sie enthielt den Namen des böhmischen Städtchens, die nähere Bezeichnung des Hauses und alle anderen mit Hedwigs Aussetzung zusammenhängende Daten.
Schon in der folgenden Nacht fiel der Kranke in heftige Delirien, wobei die Feuersbrunst in Hohenfeldt-Rast eine Hauptrolle spielte. Der Graf wich nicht mehr von seinem Bette, denn er wollte niemanden Einblick gestatten in das seltsame Verhältnis, das sie beide verband. Auch die Furcht, sein ängstlich gehütetes Geheimnis verraten zu sehen, hatte hieran Anteil.
Gegen Morgen war Ferdinand in den Armen Emanuels, der ihm alles verziehen hatte, verschieden. Der Jugendfreund drückte ihm die Augen zu und hielt bei ihm die stille Totenwache, bis der helle Tag die Leute brachte, um sich des Fremden anzunehmen. – Dann erst kehrte er selbst nach Hause zurück.