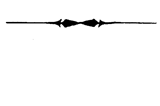|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Marie hatte recht, Heinz war wirklich aus Rand und Band. Die Wissenschaft, wie sie ihm gelehrt wurde, befriedigte ihn nicht, sie wurde ihm von Tag zu Tag mehr zuwider. Er hatte mit der größten Energie gearbeitet, mit dem größten Eifer nach Befriedigung gesucht, sie war ihm nicht zu Theil geworden, sein Fleiß erschien ihm wie verschwendet.
Die völlige Vereinsamung, in der er lebte, war nicht dazu angethan, ihm das Herz leichter, den Sinn frischer zu machen. Er hatte bisher durch unermüdliche Arbeit die innere Unruhe niedergehalten, jetzt, wo er aufhörte zu arbeiten, verlangten seine leidenschaftliche Natur, sein lebhafter Geist stürmisch nach einer Veränderung. Auch sein Verhältniß zu Anna konnte ihm auf die Dauer keine Befriedigung gewähren. Anna's Hingebung an seinen Willen war von vornherein viel zu bedingungslos gewesen, als daß er sich ihren Werth so recht hätte zum Bewußtsein bringen können, ihre Liebe hatte von Anfang an zugleich einen so starken Zug der Resignation gezeigt, daß es ihm selbstverständlich erschien, sie sei keinerlei Ansprüche an ihn zu machen berechtigt. Er hatte sich Anna's Liebe nicht mühsam erobert, sie war ihm wie eine reife Frucht gleichsam von selbst zugefallen, wie sollte er sie als ein hohes Gut schätzen. Er war jung, eitel und hochmüthig, da mußte ihm auch das reichste Maß von Liebe als eine selbstverständliche Huldigung erscheinen. Daß jedes Fünkchen Liebe, das uns die Menschen darbringen, ein hohes, unverdientes Glück ist, daß wir für jeden Pulsschlag, der uns im kalten Leben warm entgegenschlägt, Dank schuldig sind, davon ahnte seine Seele nichts.
Anna wußte sehr wohl, wie es in ihm aussah, und daß sie es wußte, das war eben Beider Unglück. Wäre sie weniger wahr gewesen, sie hätte ihre Hingebung mitunter gezügelt, wäre sie weniger stolz gewesen, sie hätte mit den Beweisen ihrer Liebe mehr gegeizt, so aber verschmähte sie jedes Mittel, seine fliehende Liebe festzuhalten. »Ich will ihm gegenüber nicht Komödie spielen,« sagte sie, »ich will handeln, einzig und allein wie mir ums Herz ist.«
Wenn sie daran dachte, daß sie sein Herz nicht behalten würde, so machte sie ihm gegenüber kein Hehl daraus, und wenn er ihr dann im besten Glauben, in den leidenschaftlichsten Worten seine Liebe versicherte, so wurde ihre Traurigkeit dadurch nicht gemindert und sie verbarg ihm das nicht. So wurde denn die Trennung von ihr, die mit Entsetzen an sie dachte, zuerst selten und dann immer häufiger zur Sprache gebracht, von ihm, der an ihre Möglichkeit nicht geglaubt hatte, anfangs heftig, dann immer schwächer und schwächer bekämpft.
Hätte er einen Beruf gehabt, der ihn befriedigte und beschäftigte, wäre Anna nicht seine Braut, sondern seine Frau gewesen, so hätte sich, was zwischen ihnen stand, wohl ausgeglichen, so aber mußte ihr Verhältniß sich zu einem unleidlichen gestalten. Sein lebhafter Sinn, sein feuriges Blut verlangten nach Leben und Bewegung, seine jugendlichen Kräfte begehrten, sich im Streite und Kampfe mit Andern zu messen, er hatte sich aber selbst jeden Umgang abgeschnitten. Er kam zu Anna und fand in ihr nur das Echo seiner Worte, seiner Ansichten. Er fand sie verweint. Von Mitleid und Liebe ergriffen, fragte er sie, warum sie geweint habe. Sie umschlang seinen Hals und weinte heftiger. Er beschwor sie in den feurigsten Worten, seiner Liebe zu vertrauen, an seine Beständigkeit zu glauben – sie wußte, daß er, ohne sich dessen bewußt zu sein, die Unwahrheit redete und weinte nur noch mehr. Er wurde ungeduldig, zornig, er schalt sie in den heftigsten Worten – bleich wie eine Leiche, ergeben wie eine Märtyrerin saß sie vor ihm. Dann überkam ihn wohl ein grimmiger Jähzorn, der ihn mit scheinbarer Kälte das härteste Wort, den schmerzendsten Spott aussprechen ließ, bis er von ihr eilte und irgendwo im Walde seinen Zorn austobte.
Eines Tages saß er, wie jetzt so oft, müßig am Fenster und schaute müde und verdrossen auf die Straße. Die Ferien hatten bereits begonnen, all das lustige, junge Volk, das sonst die Straße belebte, war nach allen Seiten auseinander geflogen. Die Einen waren zu Hause bei den Ihrigen, die Andern durchschweiften in Gesellschaft oder allein Berg und Thal, ein Geist tödtlicher Langeweile ruhte auf dem Städtchen. Es regnete bereits seit Tagen. Es war kein Regen, wie ihn der Sturm, der wilde Geselle, vor sich hertreibt, es war auch kein Regen, wie ihn die schwarze Gewitterwolke zur Erde fallen läßt, der auf den Dächern dumpf aufschlägt und die Straße plötzlich unter Wasser setzt, nein, es war ein ruhiger Regen, der so langsam, gleichmäßig und langweilig herabfällt, wie es sich für einen Regen geziemt, der an einem kalten, feuchten Augusttage in einer kleinen Universitätsstadt, die augenblicklich ohne Studenten ist, niederfällt. Auf der Straße ist kein Mensch sichtbar. Gerade vor dem Hause, an dessen Fenster Heinz sitzt, hat sich in dem schlechten Pflaster eine große Wasserlache gebildet und Heinz zählt die Regentropfen, die von Zeit zu Zeit hineinfallen und das trübe, schmutzige Wasser ein wenig aufspritzen machen, so sorgfältig, als wenn er sich eigens zu diesem Zwecke an's Fenster gesetzt hätte.
In der Ferne holpert ein Wagen über die unregelmäßigen Steine des Pflasters. Das ist ein Ereigniß. Horch – jetzt muß er in der Langstraße sein, jetzt muß er gleich um die Ecke kommen. Da ist er. Es ist einer jener Wagen, wie sie an der Eisenbahnstation halten, um von dort aus den Verkehr in's Land hinein zu vermitteln. Heinz betrachtet das Gefährt, das sich in diese Einsamkeit wagt, mit großer Aufmerksamkeit. Er wird immer aufmerksamer, er lehnt sich aus dem Fenster, und als der Wagen vor seiner Thüre hält, schnellt er wie elektrisirt zurück und eilt die Treppe hinunter.
»Horace, mein lieber Horace,« ruft er, als er den jungen Mann umarmt, der aus dem Wagen gesprungen ist.
Als die ersten Freudenbezeigungen vorüber und Beide auf Heinzens Zimmer waren, legte dieser seinen Arm um des Freundes schlanke Taille und fragte:
»Nun sage mir, wo kommst Du her?«
»Mein lieber Heinz,« erwiderte Horace, indem er mit seinen feinen, weißen Händchen Heinzens Hand streichelte, »ich freue mich, daß ich endlich in der Lage war, dem Verlangen meines Herzens zu genügen und Dich aufzusuchen. Ich kann Dich versichern, daß ich es nur sehr schwer ertragen habe, so lange von Dir getrennt gewesen zu sein. Ich bin wirklich sehr erfreut! Ich komme mit meiner Mama und Madeleine, die Dich natürlich grüßen lassen, aus Italien. Ich ließ die Meinigen nicht gern im Stiche, Du weißt, auf Eisenbahnen ist man vor Kreti und Plethi nicht ganz sicher und sie müssen noch bis C –, wo sie mich im Weißen Schwane erwarten werden, aber meine Sehnsucht nach einem Wiedersehen mit Dir war eben ganz unüberwindlich.«
Heinz drückte dem Freunde herzlich die Hand.
»Nun, Ihr habt eine schöne Reise gemacht?«
»Ach, Heinz, eine sehr schöne Reise! Diese Kunstschätze! Man würde Italien übrigens allerdings noch mehr genießen, wenn die Küche dort nicht so abscheulich schlecht wäre. Nein, diese Menü's! Dazu sind alle Speisen affreuser Weise mit Knoblauch angerichtet. Ich versichere Dich, mir wird ganz schlimm, wenn ich nur daran denke. Und auch sonst hat man dort entsetzlich wenig Comfort. Diese Betten! Ich versichere Dich, es ist, als ob man auf einem Steine schliefe. Von Venedig ab, wo wir in einem deutschen Gasthofe sehr gut aufgehoben waren, haben wir durch ganz Italien kein irgend erträgliches Hotel gefunden. Auch in Neapel sind die Betten miserabel, aber der Golf ist wohl wunderschön. Und dann dieses Capri! Ich machte dort die Bekanntschaft eines Engländers, eines sehr unterrichteten Herrn und bekam durch seine Vermittelung dort einen Lacrimae Christi, wie ich solchen noch nie getrunken hatte. Nachher habe ich freilich in Palermo diesen Wein von derselben Qualität getrunken.«
»Nun, und wart Ihr auch in Rom?«
»Natürlich. Wir wohnten dort in einem leidlichen Hotel, aber die Preise waren horribel.«
»Hat Euch der Krieg nicht gestört?«
»Ach nein. Wir kehrten über Frankreich zurück. O, diese französischen Truppen! Ich versichere Dich, es ist eine herrliche Armee! Und die Marseillaise! Wir lernten in Genua einen Colonel Loseron kennen, es war ein ganz charmanter Mensch, ganz charmant, der ließ sein Bataillon stets die Marseillaise singen. Parole d'honneur! Madeleine war entzückt, wenn sie den Gesang hörte. Madeleine liebt die Freiheit außerordentlich. Aber nun erzähle, lieber Heinz, was treibst Du? Hast Du Deine Studien noch nicht beendet? Entschuldige, wenn Dir meine Fragen indiscret erscheinen sollten, ich stelle sie wirklich nur aus Interesse.«
Heinz antwortete anfangs ausweichend, nachher wurde er warm und sprach, wie ihm um's Herz war. Horace hörte ihm mit der größten Aufmerksamkeit zu. Als Heinz schwieg, faßte er seine Hand und sagte in seiner weichen, einschmeichelnden Weise: »Mein liebster Heinz, das ist ja Alles ganz natürlich! Ich habe immer geglaubt, daß Du zum Gelehrten zu Schade bist. Bei Deiner Energie, bei Deinem auf das Praktische gerichteten Geiste muß Dir eine solche Beschäftigung, die ich mir, bei aller Hochachtung natürlich vor der deutschen Wissenschaft, mit der Thätigkeit eines Maulwurfs zu vergleichen erlaube, unerträglich werden. Ich muß Dir sagen, daß ich mich während meiner Studien gewissermaßen von der deutschen Wissenschaft emancipirt habe. Ich finde, daß sie zu abstrakt ist. Ich möchte an die deutsche Philosophie erinnern. Man kann die Untersuchungen der französischen und englischen Philosophen mit Interesse lesen, aber wer mag Hegel oder Schelling heut zu Tage noch vornehmen? Es muß doch jedes Ding einen erkennbaren, greifbaren Nutzen gewähren und doch dürfte sich ein solcher von einem großen Theile der deutschen Wissenschaft schwerlich erhoffen lassen. Du solltest Dich emancipiren, Heinz, Du solltest die Tagelöhnerarbeit den geistigen Tagelöhnern überlassen. Du hast Dich, wie Du sagst, ausschließlich mit dem Mittelalter beschäftigt – das ist eine affreuse Zeit, die Leute waren damals doch noch sehr zurück in der Kultur, Du mußt das Mittelalter aufgeben und Dich der modernen Zeit zuwenden. Ludwig der Große, Friedrich der Große, Napoleon der Große, das sind würdige Gegenstände der Studien. Die Hohenstaufen, ich bitte Dich, es sind im Grunde doch nur Barbaren. Du solltest Dich hier nicht so einrosten lassen, Heinz! Du solltest nach Berlin gehen. Nun, ich liebe diese Stadt nicht, sie ist ein wenig frostig, aber ich glaube, daß sie in wissenschaftlicher Beziehung viel Anziehendes bietet. Du solltest Ranke hören, der einen sehr weltmännischen und sympathischen Eindruck auf die Gemüther macht. Ich glaube, daß Dich auch Droysen fesseln würde, mir ist er zu preußisch, und mir ist das ganze Preußenthum in der Seele zuwider, aber interessant sind die Droysen'schen Vorlesungen immerhin. Bei Beiden ist man jedenfalls das schreckliche Mittelalter, die ewigen Papst- und Kaiserkämpfe los. Du solltest immerhin nach Berlin gehen, Heinz. Das Leben in diesen kleinen deutschen Universitätsstädten ist auf die Dauer doch unerträglich. Die Bevölkerung besteht aus Professoren, Studenten und Philistern. Wenn wir sie ein wenig näher betrachten, so finden wir, daß sie Alle eigentlich nur einen Stand ausmachen, nämlich den der Philister. Der Professor der kleinen Universitätsstadt ist auf dem Katheder zwar ein Heros, aber doch ein philiströser Herr, wie die Generäle Friedrich's des Großen auf dem Wilhelmsplatze – antikes Kostüm und Zopf. Er bringt die kühnsten Gedanken vor, aber er liest sie aus einem Hefte ab und liest sie noch dazu schlecht ab. Nun, auf dem Katheder geht der Mann immer noch an, aber kaum hat er dieses verlassen, so ist er nicht um ein Haarbreit weniger langweilig und platt und weit hochmüthiger, als sein ungebildeter Hausnachbar, der Schuhmacher. Nun, und ist der deutsche Student nicht auch ein Philister? Ist er nicht auch ein Mensch, der sich ohne alle Initiative in dem hergebrachten Gleise fortbewegt und flott ist, nicht, weil ihm das aus der Seele kommt, sondern weil die Andern es sind? Du wirst nicht verlangen, Heinz, daß ich Dir auch noch das Gros der Philister schildere. Es ist eine gedankenlose, sehr wenig liebenswürdige Menge. Der Papa ist ein unverschämter, winselnder Geselle, die Mama ist ein wenig dummdreist, wenn man das von Frauen sagen darf, die Töchter sind jeder Zoll Leimruthe, studirende Gimpel daran zu fangen. Du solltest nach Berlin gehen, Heinz!«
Horace sprach das Alles so ungemein rasch und mit so weicher Stimme, daß, wenn Jemand ihn, ohne die Worte zu verstehen, hätte sprechen hören, er gemeint haben würde, Horace trage einer hochgestellten Person eine Bitte überaus eindringlich vor.
Heinz war aufgesprungen und durchmaß mit großen Schritten das Zimmer. Fortgehen! Er hatte sich das selbst schon so oft gesagt, und doch schrak er bis in's innerste Herz zusammen, als Horace es jetzt aussprach. Was sollte er noch in Fischersbach? Examen machen. Und dann? Dann nach Hause gehen. Und dann? Dann Lehrer werden. Nein! das nicht! Das war ganz unmöglich! Was aber sonst? Auf eine Professur ausgehen. Und dann? Dann sein Leben lang Geschichte dociren. Nein! Das nicht! Das war nicht möglich, er mochte kein Buch ansehen. Was denn aber sonst? Reichen seine Mittel aus, um verheirathet ohne Amt leben zu können? Nein! Und welches Amt konnte er bekleiden? Keines! Sollte er Anna sagen: »Ich bin nichts geworden, ich habe nichts, warte, bis ich was werde?« Nein! Das ging nicht. Was aber sonst? Was sonst?
Diese Gedanken schossen ihm durch den Kopf, während er im Zimmer auf und ab ging, an seiner Unterlippe nagte und Horace sprechen hörte.
Es war nicht das erste Mal, daß er so durch das Zimmer lief, während die Gedanken sich in seinem Kopfe jagten, wie die fallenden Schneeflocken auf der winterlichen Haide.
O, dieses leidige: »Was sonst?« Es war ihm seit Monaten ein schrecklicher Gesellschafter geworden, der sich ihm in seiner Einsamkeit aufdrängte und ihn keinen Augenblick verließ. Wenn Heinz Stunden lang vor seinen Chroniken gesessen hatte, dann war er wohl plötzlich aufgefahren und hatte bemerkt, daß er auch nicht eine Zeile gelesen, daß er die ganze Zeit über stets diese eine Gedankenreihe in seinem schmerzenden Kopfe umhergewälzt hatte. Wenn ihn bei seinem einsamen Mahle die Frage des Kellners, ob das Essen nicht gut sei, aus seinen Träumen aufschreckte, so hatte er diesen Gedanken verfolgt. Wenn er Stunden hindurch schweigend neben Anna gesessen und finster vor sich hingebrütet hatte, so fuhr er auf mit: »Was aber sonst? Was sonst? Was sonst?«
Horace saß in seiner Sophaecke, rauchte seine Cigarre, besah dazwischen seinen Siegelring und sprach eindringlich zu dem Freunde:
»Du solltest wirklich nach Berlin gehen, Heinz. Du wirst dort viel Anregung finden. O, welche Anregung! Auch in politischer Beziehung. Ich denke mir, daß der Historiker auch immer zugleich Politiker sein muß. Die Geschichte ist doch, ich möchte sagen, die erstarrte Lava-Politik. Was denkst Du zu diesem Bilde, Heinz? Dürfte es nicht zutreffend sein? Ich bin auf Deine Meinung ein wenig gespannt.«
»Wie sagtest Du?« fragte Heinz, aus seinen Gedanken auffahrend.
»Ich vergleiche die Geschichte mit der erstarrten Lava. So lange sie im Fluß ist, nennen wir sie Politik.«
»Horace, die Sache ist nicht so einfach. Mir kann keine Anregung helfen, mir ist die Wissenschaft als solche zuwider. Ich mag kein Buch mehr sehen.«
Horace sprang auf: »Lieber Heinz, Du erschreckst mich ungemein. Du bist so aufgeregt, Du bist krank.«
»Ja und nein. Ich erkenne mich selbst nicht mehr. Du kennst mich, Du weißt, daß ich die Wissenschaft liebte, daß ich fleißig war, nun bin ich wie verwandelt. Ich habe alle Freude am Arbeiten verloren, die Wissenschaft erscheint mir wie eitel Lug und Trug. Es liegt nicht nur in der Methode, es liegt in der Sache. Es ist kein Fortschritt in der Sache, Horace. Die Menschheit weist keinen Fortschritt auf, keinen wahrhaften Fortschritt. Die Coulissen wechseln, die Bühne wechselt, die Acteure wechseln, aber das Stück, das aufgeführt wird, bleibt immer dasselbe. Es ist eine schale Komödie, eine elende Posse. Der König mag nun eine Stirnbinde, eine Krone oder einen Helm auf dem Kopfe haben, er bleibt immer derselbe selbstsüchtige Gewalthaber; der Staatsmann mag in der Toga oder im Frack einhergehen, er bleibt immer derselbe Selbstsüchtige, Ehrgeizige, der Priester mag im weißen, blauen oder schwarzen Talar dahinschreiten, er bleibt immer derselbe herrschsüchtige Pfaffe; der große Hausen der Statisten bleibt immer dieselbe dumme, schmeichelnde, geifernde, neidische Menge, die sich um die vom Könige, Staatsmann oder Priester unter sie geworfenen Schlagworte balgt, stößt und todtschlägt. Es ist kein Fortschritt in der Sache, Horace, es lohnt sich nicht der Mühe, wieder hinzugehen, wenn man einmal dagewesen ist. Weiber, Kinder und Pöbel mögen es thun, um sich an den bunten Kleidern satt zu sehen, dem Manne bringt seine Bildung wenigstens das eine Gute – daß er Komödie nicht für Leben nimmt.«
»Liebster Heinz, Du darfst mir das nicht übel nehmen, aber Du bist wirklich krank. Du hast Dich überarbeitet, Deine Nerven sind angegriffen. Du mußt Dich erholen. Komm mit mir nach Parkhof. Bleibe bei uns, so lange es Dir gefällt und thue dann, was Du willst. Bleibst Du dann dabei, die Beschäftigung mit der abstrakten Wissenschaft aufzugeben, nun, so werde Landwirth. Einem Manne wie Dir steht die ganze Welt offen, und welchen Beruf Du auch ergreifen mögest, Du wirst ihm immer zur Zierde gereichen. Pachte Parkhof oder einen seiner großen Beihöfe, oder kaufe Dich an, meine Kasse steht ganz zu Deiner Verfügung. Ich bin nie froher über meine Wohlhabenheit gewesen, als bei der Aussicht, Dir durch dieselbe gefällig sein zu können.«
Horace hatte seine Arme um Heinzens Nacken geschlungen und schritt neben ihm her.
Was sollte er noch in Fischersbach? Examen machen. Und dann? Dann nach Hause gehen. Und dann? Dann Lehrer werden. Nein! das nicht, das war ganz unmöglich! Was aber sonst? Landwirth werden. Und dann? Anna heirathen. Und dann? Ein glückseliges Leben führen auf der grünen, heimischen Erde, in der frischen, heimischen Luft!
Es war, als hörte der wirbelnde Tanz der Schneeflocken auf, als zeigten sich dem Verirrten endlich die dunkeln Umrisse des erstrebten Daheims, dunkel zwar noch, unbestimmt und zerflossen, aber es war doch etwas Anderes als das ewige Einerlei der wirbelnden Flocken.
»Der Gedanke ist mir ganz neu, Horace!«
»Ueberlege ihn Dir, Heinz. Ich werde jedenfalls ein paar Tage bei Dir bleiben, ich kann ja an Mama telegraphiren – es giebt hier doch einen Telegraphen? Nun, ja wohl, ich dachte es mir. Ich kann ja Mama telegraphiren, daß ich erst Sonnabend komme. Wir wollen heute nicht mehr davon sprechen, Heinz, aber überlege Dir meinen Vorschlag. Er ist ja auch meinerseits natürlich vorläufig noch ganz in's Blaue hinein gethan, aber überlege ihn Dir, Heinz. Nun noch eine Frage: Kann ich die Nacht bei Dir bleiben, ich nehme natürlich mit Deinem Sopha fürlieb, oder muß ich in's Hotel? Ich hoffe, Du wirst mir es ganz offen sagen, falls ich Dir lästig falle.«
Heinz bat Horace natürlich, bei ihm zu bleiben.
»Ich danke Dir, Heinz. Ich bin das Leben in den Hotels entsetzlich überdrüssig. Es fehlt ja den deutschen Hotels keineswegs an Comfort, aber dies ewige Geklingel und die dummen Gesichter der Mägde, die eilfertigen Kellner und dann diese ewigen Trinkgelder? Ich bitte Dich, lieber guter Heinz, ist es nicht (wenn Du erlaubst, ziehe ich mir den linken Stiefel ein wenig aus, er drückt mich) ist es nicht fürchterlich, daß, wenn man ein Hotel verläßt, man sich immer erst durch eine ganze Bande von Kellnern, Hausknechten und Portiers durchschlagen muß? Wodurch unterscheiden sie sich von den Bettlern Italiens, als daß sie wohlfrisirt und gut costümirt sind?«
Horace erzählte nun den ganzen Abend von Italien, ohne zwischen Großem und Kleinem, zwischen Kunsteindrücken und Hôtelerlebnissen und Menü's irgend einen wesentlichen Unterschied zu machen. Heinz hörte zerstreut zu und verfolgte in Gedanken den neuen Plan.
Schließlich weihte er Horace auch in sein Liebesverhältniß ein. Er that es, obgleich er es eigentlich nicht thun wollte, bevor er sich mit Anna besprochen, aber er hatte so lange jedes vertrauten Umganges entbehrt, daß er nun Alles hingab.
Horace schien von der Mittheilung des Freundes nicht eben erbaut zu sein. Er war viel zu höflich und discret, um seinen Gedanken Ausdruck zu verleihen, aber sein Gesicht zeigte deutlich, daß Alles, was Heinz jetzt erzählte, ihm mißfiel.
»Nun, und Du scheinst zu fürchten, daß Dein Fräulein Braut nicht darin willigen wird, daß Du Landwirth wirst,« sagte er endlich.
»Nein, das nicht, Anna thut, was ich will.«
»Wohlan, dann fahre morgen hinaus und sprich mit ihr.«