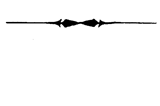|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Es waren ein paar Wochen seit der Verlobung vergangen, ehe Hellberg sich entschloß, Lindenruh zu besuchen, um seine Cousine zu beglückwünschen. In der Thür begegnete ihm Marie.
»Du kommst wohl mit einem allerunterthänigsten Glückwunsche?« fragte sie spöttisch.
»Ja, mit einem Glückwunsch allerdings.«
»Und der ist sehr aufrichtig gemeint?«
»Sehr aufrichtig, Marie.«
Marie erfaßte seinen Arm und führte ihn ein wenig bei Seite. Dann sagte sie mit vor Leidenschaft zitternder Stimme:
»Du bist unbeschreiblich feig. Ich wünschte, ich wäre ein Mann, dann sollte Alles bald anders werden.«
»Was würdest Du denn thun, Marie?«
»Ich würde ihn fordern und ihn niederschießen. Lächle nicht, Hellberg, hörst Du, lächle nicht. Da ist nichts Komisches. Ich kann es nicht thun. Wenn ich ihn forderte, so würde er vielleicht die Frechheit haben zu lächeln, wie Du jetzt, und würde mich abweisen, aber thue Du es. Dieser Mensch ist ein Zauberer, der es Anna angethan hat. Sie ist wie eine Marionette, die nach seinem Willen weint und lacht, fröhlich ist und traurig. In vier Wochen muß er sie überdrüssig sein und sie mißhandeln.«
Hellberg sah verwundert in Mariens glühendes Gesicht.
»Kind, was weißt Du von solchen Dingen,« sagte er.
Sie gingen unterdessen langsam bergan, vom Hause weg. War es die Steile des Berges oder der Gegenstand des Gespräches – sie athmeten kurz und schwer.
»Wenn sie thut, was er will,« fuhr Hellberg fort, »so wird er mit ihr zufrieden sein und sie nur noch mehr lieben.«
Während er sprach, sah er Marie an, als ob er beobachten wollte, ob sie an die Aufrichtigkeit seiner Worte glaube. Sie erwiderte seinen Blick und sagte dann in ihrer kurzen, wegwerfenden Weise:
»Geh', das glaubst Du selbst nicht.«
»Warum nicht?«
»Unsinn! Sollen wir jetzt Silben stechen und uns an Worte klammern? Wir müssen handeln.«
Sie gingen eine Weile schweigend neben einander her. Endlich sagte Marie:
»Wirst Du ihn fordern?«
»Nein.«
»Warum nicht?«
»Was wäre damit gewonnen?«
»Du mußt ihn niederschießen!«
»Und dann?«
»Nun, dann wäre er weg.«
»Wäre aber auch der Zauber, den er auf Anna ausübt, weg?«
»Mit der Zeit gewiß.«
»Wie aber, wenn Du Dich täuschest? Wenn er sie so umstrickt hätte, daß sein Fall sie mitreißt? Was dann?«
Sie waren bis zur Mitte des Bergabhanges gekommen. Dort stand unter einer Eiche eine Moosbank, von der aus man das Thal übersah. Sie lag auf der Schattenseite, aber die andere Thalwand lag bereits im hellen Sonnenscheine da und bald mußten die Strahlen der Sonne auf das Pfarrhaus unten im Thale fallen. Der Morgen war ungewöhnlich frisch, die Landschaft unendlich lieblich; aber die Beiden dachten an andere Dinge und wurden nichts davon gewahr.
»Hier sitzen sie jetzt immer,« sagte Marie, indem sie stehen blieb und auf die Moosbank wies, ohne doch selbst hinzusehen. »Da kannst Du sie Dir vorstellen.«
»Also hier!«
»Ja, hier. Nimm Dir doch Moos mit von der Bank zur angenehmen Erinnerung.«
»Ich bedarf keines äußeren Erinnerungszeichens, Marie. Ich werde diese Stätte ohnehin nie vergessen.«
»Nicht? Willst Du hier einmal eine Kapelle bauen?«
»Auch das wäre möglich, Marie. Pflegen wir doch an den Orten, an welchen Leute verunglückt sind, ein Kreuz aufzurichten.«
Marie wandte sich kurz um und eilte dem Thale zu.
Hellberg blieb stehen und schaute ihr nach. Er sah, wie sie stürmisch bergab lief, mehr sprang als ging, bis sie endlich in den Gärten verschwand.
»Welch eine maßlose Leidenschaftlichkeit,« dachte er. »Diese beiden Schwestern, die sanfte Anna und die wilde Marie – wie unähnlich sind sie einander und doch wie ähnlich! Von dem einen Gefühle ganz beherrscht, muß in ihnen jede andere Empfindung völlig weichen. Und ich? Bin ich nicht kalt und gefühllos? Nein, nein. Fort mit solchen Gedanken! Habe ich umsonst mein Leben lang darnach getrachtet, mir die Ruhe der Seele zu wahren? Maßvoll und gerecht durch's Leben zu gehen? Soll ich jetzt der Leidenschaft gestatten, mir den klaren Blick, den gerechten Sinn zu trüben, zu verwirren? Anna liebt ihn. Sie wird sich ihm hingeben ganz und gar. Sie wird keine andern Gedanken haben, als die seinen, keinen andern Wunsch als den, ihm zu gefallen. Er wird ihre schrankenlose Liebe Anfangs hinnehmen wie etwas Selbstverständliches, wie etwas Angenehmes, denn sie wird seiner Eitelkeit schmeicheln. Dann wird sie ihm langweilig werden. Ein Mensch wie er braucht Aufregung und Kampf. Der Instinkt des Hasses hat Marie richtig fühlen lassen. Er wird sie reizen, um sie zum Kampfe zu bringen. Das wird mißlingen. Nun wird sie ihm einfach lästig werden. So wird es, so muß es kommen. Darüber kann ich mich keiner Täuschung hingeben. Ich kann Heinz, kann Anna nicht zürnen. Ihr Geschick muß sich erfüllen. Kann ich dem Schicksal in den erhobenen Arm fallen und ihm gebieten?«
Als Hellberg nach ein paar Stunden in's Pfarrhaus trat, sah er so ruhig und gleichmüthig aus wie immer.
Marie war unterdessen nach Hause und auf ihr Zimmer geeilt. Sie war bis in's innerste Herz empört über den Vetter. Der Wunsch, sich des gehaßten Mannes, den sie als Nebenbuhler in der Gunst der angebeteten Schwester und als den gefährlichsten Feind derselben ansah, zu entledigen, ließ sie nicht daran denken, daß ihr Ziel nur durch ein Verbrechen zu erreichen war, daß jeder Schlag, der gegen Heinz geführt wurde, auch Anna treffen mußte. In dem aufgeregten Zustande, in dem sie sich befand, erblickte sie in Hellbergs Weigerung nur Mattherzigkeit, ja Feigheit.
»Läßt Du mich auch im Stiche,« murmelte sie zornig, »so kenne ich doch einen Anderen, der muthiger und entschlossener ist.«
Sie schrieb ein Briefchen an Hanning, in welchem sie ihn bat, sich womöglich gegen Sonnenuntergang an einer näher bezeichneten Stelle des Waldes einzufinden. Sie habe mit ihm Wichtiges zu verhandeln. Dann lief sie mit dem Briefe in's Dorf und schickte ihn durch einen Knaben nach Fischersbach. Vor der Thür des väterlichen Hauses traf sie mit Hellberg zusammen und schlüpfte mit einem so triumphirenden Gesicht an ihm vorüber, daß dieser die mühsam erkämpfte Ruhe fast verlor. Seine Erregung klang noch in der Stimme nach, als er Anna seinen Glückwunsch darbrachte.
»Ich wußte, daß Du an meinem Glücke theilnehmen würdest, Johannes,« sagte sie, indem sie ihm herzlich die Hand drückte; »warst Du mir doch im Unglück ein treuer Genosse. Komm, setze Dich her zu mir und erzähle, warum Du so lange nicht bei mir gewesen bist.«
Das Gespräch kam natürlich bald auf Heinz, denn wovon kann eine leidenschaftlich liebende Frau anders reden, als von ihrem Lieblinge?
»Warum ist er nicht hier?« fragte Hellberg.
»Ich erwarte ihn in jedem Augenblicke,« war die Antwort.
Sie fragte darauf, wie Heinz in der Burschenschaft stehe, und bewies während des Gespräches sehr deutlich, wie sehr ihre ganze Seele von ihm eingenommen war. Nach ihrer Meinung hatte er in jeder Beziehung recht; was er that, war das Richtige; seine Gegner, deren Namen, wenn sie ihr unbekannt waren, sie sich zweimal nennen ließ, handelten durchaus aus unlauteren Motiven. Hellberg bekämpfte diese Ansicht, aber er sprach vergeblich, ja, sie wurde sogar zum ersten Male heftig.
»Du bist selbst sein Gegner,« sagte sie. Sie sagte das in einem Tone, als ob damit eine völlige Verurteilung Hellbergs ausgesprochen sei.
»In einer Beziehung gewiß,« erwiderte dieser ruhig; »denn auch ich bin der Ueberzeugung, daß Heinz ein allzugroßes Gewicht auf Aeußerliches legt, daß er Unrecht hat, wenn er den Schwerpunkt unserer Verbindung auf die Mensur verlegen will.«
»Also Du findest, daß Heinz, weil er ein guter Fechter ist und damit großthun will, die Ziele Eurer Verbindung verrückt?«
»Ich glaube nicht, Anna, daß das die logische Folge aus meinen Worten ist.«
»Also,« fuhr Anna aufs Höchste erregt fort, »die Arminen finden, daß Heinz nur aus Beweggründen der Eitelkeit seine Kräfte der Verbindung widmet, nur aus Eitelkeit die Zeit, die er seinen Studien entzieht, im Interesse der Corporation verwendet? Nun wohlan, ich will dafür sorgen, daß der Anblick dieser eitlen Bestrebungen Eure edlen Herzen nicht länger verletzen soll! Keinen Tag mehr soll Heinz Eurer Verbindung angehören, keinen einzigen Tag.«
Hellberg beobachtete mit schmerzlichem Erstaunen, wie sehr die Leidenschaft die sonst so ruhige und maßvolle Frau verändert hatte, wie heftig die sonst so Verständige geworden war, wie verkehrt, wie ungerecht ihr Urtheil. Selbst ihre Stimme erschien ihm anders; aus ihrem weichen, gedeckten Organe hörte er Heinzens scharfen, absprechenden Ton heraus. Marie hatte Recht, Anna stand unter einem Zauber – unter dem Zauber der Leidenschaft. Was sollte er noch bei ihr? Er stand auf und reichte ihr zum Abschiede die Hand. Sie nahm sie nicht.
»Es ziemt sich nicht, daß ich seinem Gegner die Hand reiche,« sagte sie und sah ihn feindselig an.
»Ich bin nicht sein Gegner,« sagte Hellberg traurig.
Er sprach die Wahrheit. Er fühlte in diesem Augenblicke sehr deutlich, daß die Beiden sich jetzt gegenseitig die Zuchtruthen banden, die sie zerfleischen mußten – er zürnte Heinz auch jetzt nicht – er bedauerte ihn.
Anna legte endlich zögernd ihre Hand in die seine.
»Ich gebe sie Dir nur, weil ich Deinen Worten glaube,« sagte sie. »Ich gehöre zu ihm. Seine Gegner sind meine Gegner, wer ihn nicht liebt, kann auch mich nicht lieben. Was früher gewesen ist, das lösche ich aus meinem Gedächtnisse« – sie fuhr sich mit der Hand über die Stirn – »er mag nun hineinschreiben, was er will.«
Hellberg zuckte die Achseln und ging.
Anna blieb voll Unruhe zurück. Hatte sie recht gethan, ihm so zu begegnen? Daß sie so heftig gewesen war, machte sie mißtrauisch gegen sich selbst. Sie erinnerte sich der Worte Hellbergs und sah ein, daß er nichts für Heinz Verletzendes gesagt hatte; sie zog daraus aber nicht den Schluß, daß sie ihm eine Sühne schuldig sei, sondern folgerte daraus nur, daß jedes Zusammensein mit einem anderen Menschen als mit Heinz ihr Gefühl verwirren müsse.
»Ich muß künftighin nicht mehr mit Andern von ihm sprechen, denn auch die Guten verstehen ihn nicht; er ist ihnen zu groß.« Damit schloß sie ihre Betrachtung.
Sie mußte heute lange auf Heinz warten und die Sommersonne stand bereits tief im Westen, als er kam. Er hatte im historischen Seminar einen ärgerlichen Zwist gehabt, der ursprünglich rein wissenschaftlicher Natur war, den seine Heftigkeit aber bald auf das persönliche Gebiet hinübergeführt hatte. Er war darüber auch mit dem das Seminar leitenden Professor, einem überaus tüchtigen und ihm sehr wohlgesinnten Manne, hart an einander gerathen. Als er dies Abenteuer Anna und ihrem Vater erzählte, gerieth er wieder in großen Zorn und gebrauchte die derbsten Ausdrücke. Der Pfarrer, der mit dem Professor befreundet war und ihn als einen gemäßigten, gerechten Mann kannte, widersprach und bemühte sich, Heinz zu beweisen, daß er Unrecht habe; Anna aber stand zu ihm und sah mit Entzücken, wie wohl es ihm that, daß sie für ihn Partei nahm. Um ihm diese Freude zu machen, hätte sie schwarz für weiß und Eis für Feuer erklärt. Daran, daß sie ihn dadurch in seinem absprechenden, eigenwilligen Wesen nur noch bestärkte, dachte sie nicht; denn die Dinge zerfielen für sie nur noch in zwei Kategorien: in solche, die Heinz wohl, und solche, die ihm wehe thaten.
Für diesmal wirkten ihre Worte übrigens beruhigend auf Heinz. Nachdem sie eine heftige Rede gegen den schuldigen Professor beendet hatte, schloß er ihr den Mund mit einem Kusse und versicherte lachend, sie sei die beredtste Person von der Welt. Der Quell ihrer Beredtsamkeit sei so groß, daß sie selbst einer schlechteren Sache als der seinigen zum Siege verhelfen müsse, und so lange er an ihr einen so trefflichen Advokaten besitze, sei jeder Angriff auf ihn total vergeblich.
Der Pfarrer blieb bei seiner Meinung. »Sie sind sehr hochmüthig, Eichenstamm,« sagte er, »sehr hochmüthig.«
Heinz zuckte die Achseln. »Nur Lumpen sind bescheiden,« erwiderte er. »Es ist nicht zu vermeiden, daß der hohe Sinn des Einen die Andern, welche niedriger denken, ärgert, beleidigt. Soll ich mich deshalb bemühen, zu denken wie sie? Tragen wir nicht den einzig competenten Beurtheiler unserer Gesinnungen, unserer Handlungen in uns selbst? Der Knabe, der mir widersprach (Heinz nannte den Studenten, mit welchem er in Zwist gerathen war, nur den ›Knaben,‹ obgleich derselbe älter war als Heinz), brachte ganz abgeschmackte, alberne Dinge vor; warum sollte ich ihm das nicht sagen, warum ihn nicht zurechtweisen? Daß der Professor sich seiner Meinung anschloß, kann ich durchaus nur als persönliche Rancüne gegen mich betrachten; denn wenn er auch keine hervorragende Capacität ist, im Gegentheil, ich ihn nur für einen fleißigen, aber unbedeutenden Compilator halten kann, so viel Verstand muß er doch immerhin haben, um einzusehen, daß mein Gegner hellen Blödsinn sprach. Nicht wahr, Anna?«
Obgleich nun Anna über diesen Punkt unmöglich eine selbstständige Meinung haben konnte, so nickte sie ihm doch eifrig zu.
Dem Pfarrer schien die Gelegenheit günstig, dem künftigen Schwiegersohne einmal gründlich die Wahrheit zu sagen.
»Ich wünschte,« begann er, »daß Sie sich selbst hören könnten, Eichenstamm; ich wünschte, daß Sie Ihre Worte ein paar Wochen lang durch fremde Ohren hören könnten. Sie werden es mir nicht glauben wollen, aber ich versichere Sie allen Ernstes, daß Sie nun alle Professoren der Hochschule für fleißige, aber unbedeutende Menschen erklärt haben. Und dieser, entschuldigen Sie den Ausdruck, dieser vorläufig noch durch nichts gerechtfertigte Hochmuth nimmt consequent zu. Es giebt für Sie keinerlei Autorität mehr. Wenn Sie von Waitz, von Droysen, von Giesebrecht sprechen, so gebrauchen Sie zwar nicht gerade diese Worte, wohl aber klingt die Melodie Ihres Lieblingsliedes: ›fleißige, aber unbedeutende Leute,‹ beständig durch.«
Anna blickte erschreckt auf den Vater, dann wandte sie sich besorgt zu Heinz.
»Vater scherzt nur,« sagte sie, indem sie ihre Hand auf seine Schulter legte.
»Nein, mein Kind,« erwiderte der Pfarrer. »Ich scherze durchaus nicht; es ist mein voller Ernst. Ich glaube, daß ich Eichenstamm einen guten Dienst erweise, wenn ich ihn auf diesen Fehler aufmerksam mache, und Du thätest gut, meinem Beispiele zu folgen. Wie sollen wir zur Selbsterkenntniß gelangen, wenn die uns Nahestehenden zu ängstlich sind, um uns ihre Urtheile über uns mitzutheilen. Eichenstamm weiß sehr wohl, daß meine Worte ihn nicht beleidigen sollen und er wird sie auffassen, wie sie gemeint waren. Nicht wahr, mein junger Freund?«
Damit reichte er Heinz die Hand hin, dieser aber wies sie rauh von sich und sprang hastig auf.
»Ich glaubte bei Ihnen auf Theilnahme und Verständniß rechnen zu können, Herr Pfarrer,« rief Heinz zornig; »statt dessen scheinen Sie es darauf abgesehen zu haben, mich zu beleidigen. Ich bin der Mann nicht, der sich so etwas gefallen läßt.«
Damit ergriff er seine Mütze und stürmte hinaus. Der Pfarrer zuckte die Achseln, lächelte der Tochter gezwungen zu und ging in sein Zimmer. Anna eilte, ohne ein Wort zu sagen, Heinz nach. Als sie ihn, nicht ohne Mühe, eingeholt hatte, legte sie ihren Arm in den seinigen und schritt neben ihm her. Anfangs ließ er den Arm, den sie ergriffen hatte, herabfallen, dann besann er sich aber eines Besseren und faßte ihre Hand. So gingen sie schweigend zu ihrem Lieblingsplatze unter der Eiche. Von dort aus war die scheidende Abendsonne, die drüben in ein rosenrothes Wolkenmeer hinabzutauchen schien, noch sichtbar, während die Häuser im Thale sich allmälig in Dunkelheit hüllten. Dann sank die Sonne hinab und nur noch ihre Strahlen reichten als breite, hellrothe Streifen bis zu den Lämmerwölkchen am Zenith.
Heinz war bis in's innerste Herz erregt. Er mußte sich sagen, daß der Pfarrer Recht hatte; er erkannte gar wohl, daß er sich wirklich so ziemlich über alle Professoren in der ihm vorgehaltenen Weise geäußert hatte und empfand lebhaft, wie lächerlich das sei; aber eben darum war er voll Zorn, denn seine Eitelkeit war auf's Tiefste gekränkt.
»Mein theurer Heinz,« begann Anna, »Du mußt dem Vater sein hartes Wort nicht allzusehr verdenken. Es ist natürlich, daß der ältere Mann den jüngeren nicht versteht; er meint es aber gewiß nur gut. Männer, die weit über das Mittelmaß der Menschen hervorragen, dürfen es den Leuten nicht übel nehmen, wenn diese nicht geneigt sind, ihre überlegene Begabung sogleich anzuerkennen. An und für sich müßte es ja gewiß getadelt werden, wenn ein Jüngling so über erprobte Männer aburtheilt; der Fehler des Vaters liegt nur darin, daß er Dich mit demselben Maße mißt, wie die Andern. Halte Dich an mich, Heinz. Ich verstehe Dich vollständig. Ueber die Gelehrsamkeit der Fischersbacher Professoren habe ich ja kein Urtheil; aber daß sie nichts weniger als sehr begabt sind, davon bin ich überzeugt. Ich kenne die meisten von ihnen. Die stete, jahrelange Beschäftigung mit den Wissenschaften hat ihnen einen gewissen Schulverstand gegeben. Wenn sie über Gegenstände, welche in ihr Fach schlagen, reden, kann man ihnen mit Vergnügen zuhören; aber sobald das Gespräch auf andere Dinge kommt, weisen sie meist nur eine geringe Begabung auf.«
Obwohl nun Heinz Anna's Worten mit Wohlgefallen lauschte und obgleich sie seinem Herzen ebenso wohlthaten wie seiner Eitelkeit, so war er doch innerlich zu klug und zu wahr, um nicht einzusehen, daß sie nicht eben das Richtige enthielten.
»Mein liebes Herz,« sagte er, »ich danke Dir, daß Du so warm für mich eintrittst; aber darin hat der Vater denn doch recht, daß Jene sich bereits bewährt, während ich noch nichts Positives geleistet habe.«
»Nicht doch, Heinz,« eiferte Anna. »Durchaus nicht. Der gewöhnliche Mensch erhält seine Bedeutung erst durch das, was er leistet; er ist gleichsam eine Null, die erst durch ihr vorgesetzte Thaten Bedeutung erhält. Das Genie ist etwas an und für sich, seine bloße Existenz ist schon seine Berechtigung zu existiren. Du darfst Dich nicht geringer machen als Du bist, Heinz; Dir ziemt es nicht, bescheiden zu sein.«
Heinz drückte sie zärtlich an sich. Was sie sagte, klang seinem Ohre plausibel; zumal der Passus, der vom Genie handelte, gefiel ihm überaus.
Während Heinz sich in dem Gefühle berauschte, nun gefunden zu haben, wonach er sich so heiß und leidenschaftlich gesehnt hatte, ein Wesen, das ihn ganz verstand, eine Liebe, die schrankenlos, völlig selbstvergessen war, während sein Auge mit Entzücken auf der schönen Frau ruhte, welche die Liebe zu ihm zu seiner Sklavin gemacht hatte – harrte, kaum ein paar Tausend Schritte von ihm entfernt, Marie voll Ungeduld des Freundes, um durch ihn die Schwester zu rächen, noch ehe sie verrathen war.
Hätte man Marie, während sie unruhig zwischen den Buchenstämmen hin und her schritt, gesagt, daß sie eben jetzt Alles aufbiete, um ein Verbrechen herbeizuführen, sie wäre heftig erschrocken und hätte ihr Vorhaben aufgegeben; so aber folgte sie, ohne sich der Tragweite ihres Thuns irgend bewußt zu werden, nur dem Zuge ihres leidenschaftlichen, von Eifersucht und Haß erfüllten Herzens und harrte voll Ungeduld Hannings.
Dieser hatte Mariens Brief mit der größten Verwunderung gelesen. Was hatte das zu bedeuten? Wozu das Geheimnißvolle? Er stand mit Marie durchaus auf dem Neckfuße; was konnte sie veranlassen, ihn zu einem so geheimnißvollen Rendezvous einzuladen?
In solcher Lage stellte er das gestörte Gleichgewicht seiner Empfindungen zunächst dadurch wieder her, daß er sich, obgleich er in seinem Zimmer ganz allein war, mehrere Male auf den Kopf stellte. Sodann begab er sich zu Fräulein Eulalie Kluge und erlangte durch ihre Vermittelung eine Portion Kotelettes und vier Dutzend Krebse, nebst einem großen Steinkruge Bier.
Nachdem er sein Frühstück unter mehrfachem Kopfschütteln und tiefem Nachdenken zu sich genommen hatte, stieß er den Ruf: »Ich hab' es!« so laut und gellend aus, daß er Fräulein Rosalie, die sich im Nebenzimmer befand, so sehr erschreckte, daß sie nach ihrer eigenen, im reinsten Hochdeutsch abgegebenen Erklärung beinahe in Ohnmacht gefallen wäre. Diese Erklärung konnte auf einen Mann, der soeben kräftig gefrühstückt hatte, keinen großen Eindruck machen; Hanning begnügte sich daher, mit einem wohlgefälligen Grinsen zu versichern, daß es offenbar auf eine Fopperei angelegt sei, und ging davon, es der jungen Dame überlassend, sich aus seinen letzten geheimnißvollen Worten einen Vers zu machen.
Als Hanning am Abende die ziemlich steile Wand einer Schlucht heranklomm, an deren Rande er Marie erblickt hatte, rief er in seiner albernen Weise:
»Guten Morjen, Fräulein Marie, Burgfräulein – Söller – winken – herbeieilen – Vieh – Sacktuch – Handschuh – Kuß.«
Als er aber, oben angelangt, ihr Gesicht erblickte, erschrak er.
»Wie sehen Sie aus, Fräulein Marie!« rief er. »Was ist geschehen? Verzeihen Sie meine unpassenden Späße, ich wußte nicht, daß es sich um etwas Ernstes handelt.«
Marie nickte ihm nur leicht zu und ging schweigend ein paar Dutzend Schritte in den Wald hinein. Dann blieb sie stehen und lehnte sich an einen Baum. Hanning, der ihr gefolgt war und ihr seltsames Gebahren mit der größten Verwunderung betrachtete, blieb ebenfalls stehen.
»Sind Sie mein Freund, Hanning?« fragte sie.
Hanning war durch Mariens entstelltes Aussehen und ihre feierliche Rede wirklich in Angst versetzt; aber er war so sehr daran gewöhnt, nur in einem albernen Tone zu sprechen, daß er auch jetzt nicht umhin konnte zu erwidern:
»Ich bin Dein Freund, sprach der Fuchs zur Henne.« Da ihm aber in demselben Augenblicke einfiel, daß sein Scherz sehr zur unrechten Zeit komme, so fügte er noch ein »Pardon« und eine tiefe Verbeugung hinzu und schwieg dann.
»Sind Sie auch bereit, mir Ihre Freundschaft durch Thaten zu erkennen zu geben?« fragte Marie weiter, ohne, wie es schien, die Abschweifung, die er sich erlaubt hatte, irgend zu beachten.
Hanning fuhr sich erst mit der Scheide der Hand über die Gurgel, führte die Bewegung aber nicht ganz zu Ende, ließ die Hand fallen und versicherte:
»Ich bin bereit. Was soll ich thun?«
»Sie« – Marie zögerte ein wenig, während sie ihn scharf ansah – »Sie sollen Eichenstamm fordern.«
Hanning trat einen Schritt zurück.
»Wen?« fragte er. »Eichenstamm?«
»Ja, Eichenstamm.«
Hanning traute offenbar seinen Ohren nicht und da er gewohnt war, in solchen Fällen seinem Verständnisse dadurch zu Hülfe zu kommen, daß er seinen Körper in eine andere Lage versetzte, so kletterte er zunächst an dem neben ihm stehenden Baume empor, bis er einen niedrig gelegenen Ast erreicht hatte, setzte sich dann rittlings auf denselben und fragte nun von oben:
»Hat er Sie denn beleidigt?«
»Nein.«
»Ist die Verlobung mit Ihrer Frau Schwester auseinandergegangen?«
»Nein, leider nicht.«
Hanning schwenkte das eine Bein über den Ast und ließ sich wie einen Klotz herabfallen.
»Ja, aber warum soll ich ihn dann fordern?« fragte er, als er wieder auf den Beinen stand.
»Weil er meine arme Schwester sehr unglücklich machen wird.«
»Ja, aber – abwarten – Kirschen essen, Fräulein Marie – das weiß man doch noch nicht ganz gewiß. Vielleicht macht er sie auch noch sehr glücklich. Solche Fälle kommen vor. Ich für meine Person könnte mich auch nicht entschließen, Eichenstamm zu heirathen – bei Gott nicht – und es freut mich, daß es Ihnen ebenso zu gehen scheint; aber deshalb dürfen wir doch nicht annehmen, daß es Allen so geht. In meinem väterlichen Dorfe lebte ein Schuster, früherer Husar, Jacob Krett, der war –«
Marie unterbrach ihn heftig: »Wollen Sie ihn fordern oder nicht?«
»Wen? Jacob Krett? Er ist schon todt.«
Marie wandte sich um und ging mit raschen Schritten in den Wald. Hanning folgte ihr und suchte sie vergeblich zu bewegen, still zu stehen. Ihr ganzes Gebahren mußte in ihm nothwendig den Gedanken wachrufen, ob sie nicht am Ende geisteskrank sei, ein Gedanke, bei dem ihm der Humor ganz und völlig ausging.
»Liebes Fräulein,« sagte er sehr ernsthaft, »ich bitte Sie inständigst, noch einen Augenblick stillzustehen und mich anzuhören.«
Marie blieb stehen.
»Sie verlangen von mir,« fuhr Hanning fort, »daß ich Eichenstamm fordere. Einmal kann ich das nicht, weil er mit mir in derselben Verbindung ist; indeß – ich könnte austreten. Zweitens aber kann ich ihn auch deshalb nicht fordern, weil man in solch einem Falle doch irgend einen Grund angeben muß und ich doch unmöglich sagen kann: ›Ich fordere Eichenstamm, weil er nach der Ansicht von Fräulein Marie deren Schwester, Frau von Oehe, unglücklich machen wird.‹ Das geht doch nicht, Fräulein Marie, das müssen Sie doch selbst einsehen. Drittens und endlich kann ich ihn auch aus dem Grunde nicht fordern, weil es mir gegen das Gewissen geht. Handelte es sich hier um eine einfache Studentenmensur, so wäre ich natürlich auf den ersten Wink bei der Hand; aber mit einer solchen kann Ihnen ja nicht gedient sein. Soll Ihnen geholfen werden, so muß ein Mensch zum Krüppel geschossen oder getödtet werden. Bedenken Sie wohl, was das heißt, Fräulein Marie. Bei solchen Dingen bin ich nicht dabei. Offen gestanden, ich bin in Verwunderung, daß Sie an mich eine solche Aufforderung richten. Ich bin überzeugt, Fräulein Marie, daß Sie sich der Tragweite Ihres Planes gar nicht bewußt geworden sind. Sie verlangen von mir, ich soll meinen früheren Leibfuchs, meinen jetzigen Senior, ich soll Heinz Eichenstamm, den ich, trotzdem, daß er sehr hochmüthig, üppig und oft unwirsch ist, so lieb habe wie meinen Bruder, diesen Mann soll ich fordern? Nein, Fräulein Marie, so etwas dürfen Sie von mir nicht verlangen, so etwas dürfen Sie selbst nicht wollen. Solch ein Gedanke kann Ihnen wohl einmal durch den Kopf gehen, weil Sie heißblütig sind und rasch im Empfinden; aber Sie müssen ihn hinausweisen. ›Wirf den Bock hinaus‹, sagte meine Mutter, wenn wir eigensinnig wurden, ›pack' den bösen Bock an den Hörnern und wirf ihn hinaus.‹«
Marie brach in heftiges Schluchzen aus.
Hanning, dem der Anblick in's Herz schnitt, war im Begriffe, ihrem Beispiele zu folgen, hielt sich aber die Thränen mannhaft fern, indem er mit zitternder Stimme eine unsäglich alberne Geschichte aus seinem väterlichen Dorfe erzählte. Er sprach überhaupt immerfort, weil ihm ein richtiges Gefühl sagte, er erleichtere es dadurch Marie, sich zu fassen.
Nach einiger Zeit sagte sie dann auch ruhiger: »Sie haben ganz recht, Hanning. Ich wußte nicht, was ich that. Verzeihen Sie mir meine thörichte Bitte.«
Sie reichte ihm die Hand, die er mit seinen beiden umfaßte und herzlich drückte.
»Nun wollen wir nach Hause gehen, Fräulein Marie,« sagte er.
Sie nickte mit dem Kopfe und sie gingen nun Beide durch den allmälig dunkelnden Wald dem Dorfe zu.
»Darf ich Ihnen jetzt die Geschichte aus meinem väterlichen Dorfe, die Geschichte von Jacob Krett, zu Ende erzählen?« fragte Hanning. »Ich lasse eine angefangene Geschichte höchst ungern unbeendet.«
Marie lachte zum ersten Male wieder.
»Erzählen Sie,« hieß es.
»Nun also, Jacob Krett war ein Schuster, ein ehemaliger Husar und gegenwärtig ein Säufer. Ich erinnere mich seiner noch ganz genau. Er trug immer einen alten Frack, den er sich, wer weiß wo, erworben hatte, und er war mit seiner kleinen Habe eben fertig, als er sich in das schwarze Gretchen, das hübscheste Mädchen im Dorfe, einer reichen Wittwe Tochter, verliebte. Das wäre noch nicht so allewelt auffallend gewesen; merkwürdig war aber, daß sich das schwarze Gretchen auch in ihn verliebte. Hören Sie auch, Fräulein Marie?«
»Ja, erzählen Sie nur weiter.«
»Passen Sie auf. Jetzt kommt zwar noch nicht die Moral, aber doch schon der Effect. Als Jacob Krett den ersten Kuß bekommen hat, schwört er, daß er am selben Tage den letzten Trunk gethan habe, und hält seinen Schwur. Die vertrunkene Habe bekommt er aber dadurch natürlich nicht zurück und bleibt nun zwar nüchtern, aber auch arm wie eine Kirchenmaus. Sie errathen, was kommt. Die Wittwe will nichts davon wissen, daß Jacob Krett ihr Schwiegersohn wird und als die Tochter nicht von ihm läßt, obgleich die Mutter ihr in rührenden Worten vorstellt, daß sie an seiner Seite nothwendig unglücklich werden muß, da sperrt diese die arme Dirne ein und mißhandelt sie alle Tage, damit sie dem Unglücke, von Krett mißhandelt zu werden, entgehe. Die Sache kam schließlich vor die Gerichte und machte großes Aufsehen. Ist diese Geschichte nicht gut? Ist es nicht eine wahre Geschichte? Ich bitte Sie, Fräulein Marie, denken Sie mitunter an diese Geschichte. Einmal wäre mir das angenehm, weil bei dieser Gelegenheit sich nicht vermeiden ließe, daß Sie auch des Mannes gedenken, der diese Geschichte erzählt hat, dann aber auch um des schwarzen Gretchens willen.«
»Ich will an Ihre Geschichte denken,« sprach Marie. »Ich verspreche Ihnen das.«
Unterwegs holten sie Anna und Heinz ein. Unten im Pfarrhause stellte ein herzlicher Händedruck das Einvernehmen wieder her und die Fünf verlebten noch einige heitere Stunden.
Nachdem Heinz und Hanning davongegangen waren und die Schwestern ihr Schlafzimmer aufgesucht hatten, setzte sich Marie, die sich in der letzten Zeit in der Regel ohne ein Wort zu reden, zu Bett gelegt hatte, wieder wie in alter Zeit auf ein Schemelchen zu Anna's Füßen, küßte der Schwester Hand und sagte warm:
»Wollen wir wieder sein, wie wir früher waren, ein paar treue Gefährten! An der Zukunft kann Niemand etwas ändern.«
Anna drückte die Schwester herzlich an sich.
»Du weißt,« sagte sie, »wie schwer ich darunter gelitten habe, daß etwas zwischen uns lag. Ist es auch traurig, daß unser Geschmack ein verschiedener ist, auseinanderbringen darf uns das nicht. Mir geht es übrigens glücklicher als Dir – mir gefällt ein gewisser Jemand sehr gut.«
Marie sprang auf und fiel wieder einmal in der alten stürmischen Weise über die Schwester her, so daß diese sich vor ihren Küssen nicht zu retten wußte, bis sie es machte wie in alten Tagen, jeden Widerstand aufgab und sich geduldig der kräftigen Zärtlichkeit der Schwester fügte. Marie hob sie auf, trug sie im Zimmer auf und nieder wie ein Kind und setzte sie dann wieder auf den Stuhl.
»Du zerbrichst mir die Glieder,« klagte Anna.
»So? Bin ich stark? Nun, sei nur ruhig, Dir thue ich nichts; im Gegentheil, schlimmsten Falls trete ich für Dich ein, trotz Krett und dem schwarzen Gretchen.«
»Was heißt das?«
Marie lachte und verrieth ihr Geheimniß nicht.
»Also wieder gute Kameradschaft,« sagte sie und umschlang die Schwester.