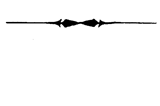|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Seit jenem Tage veränderte sich Mariens Betragen gegen Heinz und die Schwester. Blieb sie auch nach wie vor dem Ersteren gegenüber schroff und abwehrend, so vermied sie es doch, ihn zu reizen und war zugleich gegen Anna die Alte. Ja, es schien, als ob sich ihre Zärtlichkeit und Sorgfalt verdoppelte, denn sie bewies der Schwester eine Rücksicht, die sonst eben nicht in ihrer Natur lag und Anna eines Tages zu der Bemerkung veranlaßte, daß Marie mit ihr umgehe, wie mit einer Kranken. Sie hatte erwartet, daß Marie über diese Worte lachen werde, diese aber sagte trocken: »Ja, wie mit einer, die schwer krank ist« und ging davon.
Heinz war sehr glücklich. Sobald die Sonne über Mittag hinausgekommen, war er im Walde und auf dem Wege nach Lindenruh. Er hatte die letzten Jahre bunt und doch innerlich einsam verbracht, er hatte es mitunter sehr schmerzlich empfunden, daß er so ganz allein stand in der Welt. Jetzt gab es nun wieder einen Ort, wo man an ihn dachte, wo man ihn erwartete, ihn willkommen hieß. Dazu schien Anna allen Anforderungen zu entsprechen, die er in seinen kühnsten Träumen an das Schicksal gestellt hatte. Sie befriedigte seinen Verstand, denn sie war klug und gebildet, seine Eitelkeit, denn sie war sehr schön, seine Herrschsucht, denn sie that, was er wollte. Sie fügte sich, auch wenn seine Wünsche noch so thöricht und absonderlich waren, und er sah, wie wohl es ihr that, ihm ein Opfer zu bringen.
Als sie sich verlobt hatten, wollte sie die dunkeln Gewänder ablegen und sich in helle Farben kleiden; er verbot es ihr und sie ließ es. »In hellen Kleidern bist Du noch schöner,« sagte er, »ich will nicht, daß auch andere Leute Dich bewundern.« Er schrieb ihr den Schnitt der Gewänder vor. Sie durfte keiner Einladung folgen, – »ich will nicht,« hieß es wiederum, »daß die Leute Dich angaffen.« So lebte sie denn so einsam, wie im Kloster.
Eines Tages, als er mit Hellberg und Hanning allein zusammen gewesen, hatte er, wie schon oft, seinen Gefühlen einen lebhaften Ausdruck verliehen. Er hatte Anna's Hingebung und den Zauber, den sie auf ihn ausübte, mit lebhaften Farben geschildert und sich glücklich gepriesen, daß ihm eine solche Gefährtin zu Theil geworden sei. Als Hellberg gegangen war, war Hanning noch zurückgeblieben.
»Senior,« sagte er, »ich halte es für meine Pflicht, Dich darauf aufmerksam zu machen, daß Du, ohne es zu wollen, mitunter in den Wunden eines anderen Menschen wühlst.«
»Wie so?« fragte Heinz erstaunt.
»Sollte es Deinem Scharfblick entgangen sein,« fuhr Hanning fort, »daß Hellberg Deine Braut liebt, und daß es für ihn sehr hart sein muß, Dein Entzücken anzuhören.«
Heinz schlug sich mit der Hand gegen die Stirn.
»Du hast ganz recht,« rief er, »ich will dafür sorgen, daß seine Wunden künftighin ungestört heilen können.«
»Das ist hübsch, Heinz,« erwiderte Hanning, »ich dachte mir schon, daß Du nicht wußtest, was Du thatest.« Damit ging er.
Heinz meinte es anders, als Hanning glaubte. Nicht um Hellbergs willen war er fest entschlossen, jeden Verkehr zwischen diesem und Anna künftig zu verhindern, nein, seinem eigenen eifersüchtigen Herzen war es längst unerträglich gewesen, daß der Vetter dort so zu Hause war. Er wußte sehr wohl, daß weder Hellberg noch sonst ein Sterblicher ihm gefährlich werden konnte, ihn in Anna's Liebe schädigen würde; aber es war ihm unleidlich, daß auch noch andere Leute sie liebten, mit ihr verkehrten. Er hätte sie am liebsten in irgend einem einsamen Winkel verborgen, an einem Orte, wo Niemand sie sehen, Niemand sie sprechen konnte, und es fiel ihm nicht ein, daß sein Verlangen nur erfüllt werden konnte, wenn Anna sich von Allem losriß, was sie liebte, daß die Erfüllung seiner Wünsche nur unter tiefem Schmerze des von ihm geliebten Wesens möglich war. Sein leidenschaftliches, selbstsüchtiges Herz wollte es so, – wenn sie ihn liebte, so schloß er, so mußte sie es auch so wollen.
Als er am andern Tage bei Anna war, sagte er ihr, daß sie gut thun würde, mit Hellberg zu brechen. »Er liebt Dich,« sagte er, »darum darfst Du nun, da Du meine Braut bist, nicht mehr mit ihm verkehren.«
Anna hatte den Vetter, mit dem sie zusammen aufgewachsen war, den sie als einen treuen, zu jeder Zeit erprobten Freund schätzte, sehr lieb. Sie wußte, daß sein Herz ihr eine Neigung widmete, welche sie nicht erwidern konnte, sie wußte aber auch, daß er sich keinen Illusionen hingab. Wenn er trotzdem gern mit ihr zusammen war, froh war über das kleinste Zeichen von Vertrauen, das sie ihm gab, – durfte sie, die, ohne es zu wollen, ihm ohnehin so tiefe Wunden geschlagen hatte, ihm auch noch das geringe Glück rauben, das er im Zusammensein mit ihr fand?
»Ich verstehe Deine Besorgniß und ich achte sie,« erwiderte Anna, »aber ich kann sie nicht theilen. Du beurtheilst Johannes nicht aus seinem Wesen heraus, sondern nach Dir. Ich weiß, daß er mich seit den frühesten Kinderjahren liebt, aber ich weiß auch, daß er sich schon sehr früh darin gefunden hat, seine Neigung unerwidert zu sehen. Ich glaube, daß er mich schon seit lange liebt, wie der Freund die Freundin.«
»Du hast mich mißverstanden, Anna,« rief Heinz. »Nicht um seinetwillen verlange ich, daß Du ihn meidest, sondern um meinetwillen.«
»Wie, um Deinetwillen?«
»Ja, um meinetwillen!«
»Aber, Heinz, Du bist doch nicht eifersüchtig auf Johannes?«
»Ja, ich will nicht, daß Du Freunde hast. Wozu bedarfst Du ihrer? Hast Du nicht mich? Genüge ich Dir nicht? Welchen Werth hat Deine Liebe, wenn sie Dein Herz nicht ganz ausfüllt, wenn sie in ihm noch Platz läßt für die Bilder anderer Leute.«
»Heinz, ich habe Hellberg neulich um Deinetwillen beleidigt, soll ich ihn jetzt ganz von mir stoßen?«
»Das sollst Du. Wenn Du mich liebst, darfst Du nach dem Wohl und Weh' anderer Leute nicht fragen. Was kümmert es Dich, wie es in Hellbergs Herzen aussieht, was aus ihm wird? Du darfst nach keinem andern Herzen fragen, als nach meinem.«
»Wie Du willst, Heinz,« antwortete Anna innig, »Dein Wille ist mein Wille.«
Sie war traurig, daß sie Hellberg wehe thun mußte, und doch wieder froh, dem Liebling ihrer Seele ein neues Opfer bringen zu können.
»Soll ich an ihn schreiben, Heinz?« fragte sie.
Heinz wollte selber mit ihm sprechen, aber Anna machte ihn darauf aufmerksam, daß Hellberg sich dann möglicherweise doch noch an sie selbst wenden würde. So fügte er sich denn und Anna schrieb Hellberg, daß sie von seinem Zartgefühl erwarte, daß er ihr väterliches Haus nicht mehr betreten werde, da Heinz es nicht wünsche. »Lebe wohl, mein lieber, lieber Johannes,« schrieb sie, »und verzeiht mir, daß ich Dir die große Liebe, die Du stets für mich gehegt, nicht vergelten kann. Du wirst es nicht billigen, aber Du wirst es verstehen, daß es für mich nur noch ein Gesetz giebt – Heinzens Wille.«
Als Heinz das nächste Mal mit Hellberg zusammentraf, war dieser kalt wie Eis. Heinz war das ganz recht. Was ging ihn Hellberg an! Er hatte ihn früher geliebt, obgleich sie sehr verschiedene Naturen waren, aber die Leidenschaft hatte ihn so erfaßt, daß er die alten Bande gleichgültig reißen sah.
Marie erfuhr durch Hanning davon. »Ihre Geschichte stimmt nicht,« sagte sie. »Jacob Krett war noch ein Trunkenbold, als er um Gretchen freite.«
»Heinz ist wie verwandelt,« klagte Hanning. »Eins verspreche ich Ihnen, Fräulein Marie: sollte Ihre Ahnung Sie nicht trügen, so werden Sie mich an Ihrer Seite finden.«
Als er am Abend mit Heinz zur Stadt zurückkehrte, fragte er plötzlich:
»Du hast Hellberg das Haus verboten. Mit welchem Rechte?«
»Möge er versuchen zu kommen,« erwiderte Heinz drohend.
»Er wird nicht kommen; aber ich frage Dich, mit welchem Rechte hast Du Anna dazu veranlaßt, ihrem Vetter und Freunde das Haus zu verbieten.«
»Ich wüßte nicht, daß Anna oder ich verpflichtet wären, Dir über unsere Handlungen Rechenschaft abzulegen.«
»Ich denke doch, daß unsere Freunde berechtigt sind, uns nach den Motiven unserer Handlungen zu fragen, wenn diese so absonderlich sind.«
»Wer sagt Dir denn, daß Du mein Freund bist?«
»Heinz!«
»Du hältst es mit Hellberg, Du bist nicht mein Freund.«
»Was ist Dir, Heinz? Du bist wie besessen.«
»Durchaus nicht. Die Sache liegt ganz einfach. Wer mich lieb hat, der billigt, was ich thue; man tadelt nur die Handlungen von Feinden.«
»Du verlangst also, daß Deine Freunde alles billigen, was Du thust?«
»Ich verlange von meinen Freunden, daß sie den Verkehr mit meinen Feinden abbrechen.«
»Auch wenn Du sie Dir muthwillig zu Feinden gemacht hast?«
»Ja, auch dann.«
»Dann bin ich Dein Freund nicht.«
»Eben das ist meine Meinung.«
Hanning kehrte um. Er ging langsam, denn er hoffte, Heinz würde ihn zurückrufen, aber es geschah nicht, und als er sich endlich umsah, war Heinz seinen Blicken entschwunden. Heinz kehrte allein zur Stadt zurück. Es war, als ob die eine Leidenschaft auch alle andern wieder in ihm angefacht hätte. Er war während der beiden letzten Jahre auf dem besten Wege gewesen, ein Anderer zu werden. Die stete Gesellschaft, in der er sich befand, hatte ihn daran gehindert, das alte Traumleben fortzuführen, hatte seinen Ehrgeiz auf die Erreichung möglicher Ziele gewendet. Er hatte unter den Commilitonen glänzen wollen, und er war Senior geworden, er hatte sich in der Wissenschaft auszeichnen wollen, und es war ihm in hohem Grade gelungen, die Aufmerksamkeit der Professoren auf sich zu lenken. Er war auch da nicht eigentlich liebenswürdig gewesen, er war immer rauh und absprechend, heftig und hochmüthig, aber er erschien vielleicht eben deshalb um so einnehmender, wenn es ihm gefiel, freundlich und sanft zu sein. Jetzt aber fühlte er die alten Dämonen, die schon des Knaben Brust zerrissen hatten, wieder erwachen. Die Eifersucht lebte in voller Kraft wieder in ihm auf, der Hochmuth raubte ihm die Vernunft, der Jähzorn die Besonnenheit.
»Ich will sie ganz besitzen oder gar nicht,« sagte er entschlossen. Darnach handelte er.
Anna hatte noch aus der Kinderzeit her eine Freundin, die sie sehr liebte, und das umsomehr, als diese an demselben Orte verheiratet lebte, in welchem auch Anna's kurzes Eheglück dahin gegangen war. Julie, so hieß die Freundin, hatte Anna damals, als mit dem Tode des Kindes ihr Glück zusammenbrach, getreulich gepflegt, und so kam es denn, daß die kleine, kluge Frau, in welcher der Verstand eine viel größere Rolle spielte, als Phantasie und Gemüth, Anna's Vertraute wurde und blieb.
Frau Julie war die einzige Person, welche durch Anna von Heinz Kunde erhielt, und sie ersah mit Besorgniß aus dem schwärmerischen Tone der Briefe, daß Anna's Herz von einer heftigen Leidenschaft ergriffen sei. Sie kannte ihre Freundin hinreichend, um zu wissen, daß eine so plötzliche Sinnesänderung für dieselbe mit großen Gefahren verbunden war, und bemühte sich daher in ihren Briefen, die phantastisch erregte Frau zur Ruhe und Prüfung zu veranlassen. Als sich ihr im Hochsommer die Gelegenheit bot, ihr Haus auf einige Tage verlassen zu können, eilte sie, die persönliche Bekanntschaft von Anna's Bräutigam zu machen.
Anna hatte die unerwartet eintreffende Freundin auf's Herzlichste begrüßt und dieser einen vollen Einblick in ihr Gefühlsleben gestattet.
»Du wirst es nur billigen,« sagte Anna, während sie mit der Freundin auf die Kirche zuging, denn sie hatte derselben versprochen, ihr auf der Orgel vorzuspielen, »Du wirst es nur billigen, daß ich mich bemühe, in Allem und Jedem ihm zu Willen zu sein. Wenn wir lieben, so sollen wir ganz lieben, und die schönste Blüthe der Liebe ist die, daß man den eigenen Willen ganz aufgiebt, ja, daß es uns Freude bereitet, dem Freunde die Wünsche des eigenen Herzens zum Opfer zu bringen. Nur, wenn unsere Liebe eine solche, wenn unsere Hingabe eine ganz rücksichtslose ist, können wir selbst in ihr Befriedigung finden, können wir Andere befriedigen.«
Julie widersprach. »Eine rücksichtslose Hingabe an den Willen des Andern,« sagte sie, »ist nicht nur nicht richtig, sondern geradezu unstatthaft, denn einmal kann dieselbe doch keineswegs eine völlige sein, da sie an den von der Sittlichkeit gezogenen Schranken nothwendig wird Halt machen müssen, sodann wird sie aber überhaupt auch nur schädlich wirken. Niemand kennt uns so genau, Niemand kann die Motive unserer Handlungen so klar erkennen und sie uns selbst zum Bewußtsein bringen, als die Personen, die uns nahe stehen. In so weit uns überhaupt eine Förderung unseres sittlichen Standpunktes durch Andere zu Theil werden kann, wird sie von unsern allernächsten Freunden ausgehen müssen. Stehen diese nun auf dem Standpunkte unbedingter Verehrung, betrachten sie unsere oft verkehrten Willensäußerungen wie Befehle, denen zu gehorchen eine süße Pflicht ist, so schädigen sie uns schwer. Wir gewöhnen uns dann, uns innerlich ausschließlich auf den Verkehr mit den Unsrigen zu beschränken, da dieser jedenfalls der angenehmere und bequemere ist, und werden so immer einseitiger, immer einsamer. Zugleich werden wir immer begehrlicher, immer tyrannischer. Auch der bescheidenste, vernünftigste Widerspruch erscheint uns endlich als ein unerlaubter, und wir ruhen nicht eher, als bis unsere ganze Umgebung aus sittlich gebrochenen, marklosen Persönlichkeiten besteht. Wer dazu beiträgt, uns zu isoliren, ist unser Feind; denn die schlimmste Gefährtin des Menschen, dieses durch und durch geselligen Wesens, ist stete Einsamkeit, ist die Vereinzelung. Wer liebt, dem ist es ja allerdings natürlich, den eigenen Willen gänzlich hinzugeben, trotzdem kann das nicht als unerlaubt erscheinen, zumal in Deinem Falle, Anna. Der vierzigjährige Mann, über den des Lebens Sturm dahingefahren ist, kann in der völligen, widerspruchslosen Hingabe einer Frau Befriedigung finden, denn sie kommt einem Bedürfnisse seiner Natur, dem Bedürfnisse nach Ruhe entgegen – dem Jünglinge aber muß sie bald lästig erscheinen, denn er verlangt, der Natur der Dinge zufolge, nach Widerspruch und Kampf.«
Anna lächelte ungläubig.
»Wie kann erwiderte Liebe je lästig werden?«
»Doch, Anna, doch. Eine der sichersten, festesten Säulen eines Liebesbundes zwischen bedeutenderen Menschen wird immer das Bewußtsein bilden: Der innige Verkehr mit dem Andern macht mich besser, er ist mir sittlich eine Stütze. Er wacht ängstlich darüber, daß ich zu den Besten gehöre; er wird es um meinetwillen nicht zulassen, daß ich in Selbsttäuschungen befangen bleibe. Das Bild des Andern verschmilzt so in uns aufs Engste mit unsern edelsten Bestrebungen, wir sind glücklich, in ihm einen treuen Eckart, einen unbestechlichen Warner zu haben und brechen mit ihm heißt soviel, wie brechen mit allem Guten in uns. Der Geliebte soll uns ein Vertrauter sein, nicht aber ein Echo, daß nur das zurückschallen läßt, was wir hineinriefen.«
Anna erschien, was die Freundin sprach, recht nüchtern und prosaisch.
»Für manche Naturen,« erwiderte sie, »mag', was Du sagst, sehr zutreffend sein, vergiß aber nicht, daß nicht alle Menschen mit gleichem Maaße gemessen werden können. Der geniale Mann wird nur in der völligen Hingabe der Frau Befriedigung finden, und wenn sie sein Echo wird, so geschieht das, weil seine Worte viel herrlicher sind, als sie je welche erfinden könnte. Es ist das naturgemäß, Julie, daß der Mann der Herr der Frau ist. In rohen Zeiten herrscht er über sie durch Physische Kraft, in einer Epoche der Bildung durch seinen überlegenen Geist. Ihm ist das Herrschen so natürlich, wie uns das Gehorchen, er findet in der Selbstständigkeit ebenso volle Befriedigung, wie wir in der Hingabe. Du hattest immer etwas Männliches an Dir, Julie, ich brauche Dich nur daran zu erinnern, daß Du immer in der Mathematik, dieser dürren, unleidlichen Wissenschaft, die beste Schülerin warst. Dir mag meine Anschauung widerstehen, sie mag Dir unwürdig erscheinen, der Mehrzahl der Frauen wird sie die natürliche sein.«
»Wie doch unsere Grundsätze nur zu leicht nichts sind, als der Ausdruck unseres Temperaments, unserer Neigungen,« rief Julie unwillig. »Wenn Chamisso einem liebenden Mädchen die Worte: ›Darfst mich niedre Magd nicht kennen, hoher Stern der Herrlichkeit,‹ in den Mund legt, so ist das schon stark, aber man kann das als einmalige Aeußerung des leidenschaftlich erregten Gefühls hinnehmen, wie man aber daraus einen Grundsatz machen kann, verstehe ich nicht. Das ist noch ärger, als wenn ein Sclave eine Rede über die Sclaverei als sittliches, naturgemäßes Institut halten wollte, ja es ist noch schlimmer, denn Du begiebst Dich freiwillig und, scheinbar wenigstens, mit vollem Bewußtsein in die Sklaverei.
»Ja,« sagte Anna, »mit vollem Bewußtsein. Die Freiheit ist das Elend, in der Gebundenheit, in der Abhängigkeit liegt das Glück.«
Die kleine Frau schwieg entrüstet und machte sich an ihrem Haare zu schaffen. Sie war seit Jahren so glücklich verheirathet, wie man es nur sein kann und fand, obgleich ihre Ehe kinderlos war, in dem innigsten Freundschaftsbunde mit ihrem Manne, an dessen Arbeiten theilzunehmen Befähigung und Bildung ihr möglich machten, die vollste Befriedigung. Es wurde ihr sehr schwer, solche Grundsätze aussprechen zu hören.
Sie waren nun in der Kirche angelangt und Anna spielte auf der Orgel. Sie spielte in freien Variationen, was ihre Seele empfand, und Julie, die eine leidenschaftliche Musikfreundin war, lauschte entzückt den herrlichen Tönen. »Arme Anna,« dachte sie, »die Töne werden, so mächtig sie sind, das Gewölbe der Kirche nicht sprengen, denn es ist aus starkem Stein gefügt; wird aber auch Dein weiches Herz die Leidenschaft ertragen, aus der sie entquellen?
Unterdessen stieg Heinz zum Dorfe hinab. Schon zeigten die Felder nur noch Stoppeln und das Laub der Buchen färbte sich herbstlich. Die Luft war herrlich klar und durchsichtig, weither aus den Thälern ertönte dazwischen ein Ruf oder das Bellen eines Hundes Aus der Kirche drangen die Orgeltöne hervor und klangen an der Thalwand hinauf, Heinz zum Willkomm und Gruß. Unter der Eiche blieb er stehen und lauschte den Tönen. »Jetzt sitzt sie mutterseelenallein in der Kirche und harrt meiner. Niemand ist bei ihr, sie sehnt sich nach Niemand. Sie hat mich – das genügt ihr, ich habe sie – das genügt mir. Nicht in der Außenwelt liegt das Glück, – die ist schmutzig und gemein, nein, in den Herzen edler Menschen liegt es. Nach der Welt verlangen diese nicht, die Welt versteht sie nicht und rächt sich durch Spott für die erfahrene Verachtung. Nein, Anna, wir wollen alles abweisen, was uns in unsern Empfindungen stört, wollen nur für einander leben.«
Er stieg hinab und betrat leise das Kirchlein.
Er wollte erst lauschen, wie Anna spielte, wenn sie allein war, wollte sie dann überraschen. Er stutzte, als er die fremde Dame, die ihn noch nicht bemerkt hatte, gewahr wurde. Wer war das? Also, so folgerte er merkwürdiger Weise, also Anna dachte nicht an ihn, während sie spielte, dachte an die Fremde, spielte für die Fremde! Er war bereits so verwöhnt, daß er zornig wurde, wenn er sah, daß Anna andern Leuten auch nur die geringste Beachtung schenkte. »Sie spielt Andern vor,« dachte er voll Unwillen, »sie entweiht mein Orgelspiel dadurch, daß sie es vor Andern hören läßt! Sie weiß, wie lieb mir diese Klänge sind und sie hält so wenig mit ihnen zurück!«
Leise, wie er gekommen war, verließ er die Kirche und ging mit großen Schritten dem Pfarrhause zu.
»Wer ist die Fremde in der Kirche?« fragte er Marie.
»Anna's Freundin, Julie,« erwiderte diese. »Sie ist auf einige Tage zu uns gekommen, um wieder einmal mit Anna zusammen zu sein, und ich hoffe, sie wird recht lange hier bleiben.«
Der herausfordernde Blick, mit dem Marie ihre Worte begleitete, reizte Heinz nur noch mehr. Er war sehr geneigt, es wie offenbaren Verrath anzusehen, daß Anna die Freundin überhaupt empfangen hatte.
»Dann bitte ich Sie,« rief er, »Anna zu sagen, daß ich nach Fischersbach zurückkehre und dort auf den Zeitpunkt warten werde, an welchem sie wieder für mich zu sprechen sein wird.«
»Schön, schön,« antworte Marie mit erkünsteltem Gleichmuthe.
Heinz wandte sich um und ging davon. Es schien ihm, als höre er hinter sich Mariens kurzes, rauhes Lachen! Ihm war das Herz voll Kummer und Schmerz. »Sie liebt mich nicht,« rief er ein über das andere Mal. Seine Empfindung war so unberechtigt, wie nur möglich, aber in einem Verhältnisse, in welchem die Saiten so überspannt sind, wie in dem vorliegenden, reißt allaugenblicklich eine. Der Vater der Leidenschaft ist der Eigenwille, ihre Mutter die Selbstsucht, der Schmerz und die Verzweiflung sind ihre Geschwister. Wer den Jüngling gesehen hätte, wie er dort oben in der Waldschlucht sich weinend auf den Rasen wirft und sich wie ein Wahnsinniger geberdet, der hätte geglaubt, daß ihn ein schweres Unglück betroffen. Die Leidenschaft fühlt sich, wie der Salamander der Sage, nur wohl in der lodernden Flamme, selbst dem kalten Stein entlockt sie den zündenden Funken. Anna's Liebe benahm ihr bei Heinz jeden Vorwand, jetzt hält sie sich an die zerstreuten Strohhalme am Boden, um daraus eine Flamme anzufachen.
Als Anna und Julie zurückkehrten, erfuhren sie von Marie, daß Heinz dagewesen, und sogleich wieder fortgegangen sei. Anna las auf Mariens Gesicht schlimme Botschaft. Sie nahm die Schwester bei Seite und fragte erregt:
»Marie, was hat das zu bedeuten? Warum ging er?«
Marie zuckte die Achseln. »Er läßt Dir sagen,« berichtete sie, »daß er nach Fischersbach zurückkehre und dort auf den Zeitpunkt warten werde, an welchem Du wieder für ihn zu sprechen sein wirst.«
Anna brach in Thränen aus. »War er mir böse?« fragte sie.
Sie sah Marie so ängstlich an, als ob sie aus ihrem Munde einen Spruch über Leben und Tod erwarte.
Marie lächelte verächtlich.
»Ich weiß nicht,« antwortete sie.
»Warum, Marie, warum?«
»Er scheint es übel zu nehmen, daß Julie Dich besucht hat.«
»Ja, Du hast recht,« sagte Anna und wandte sich zur Thür, »ich will Julie bitten, uns zu verlassen, ich weiß, daß er es nicht gern hat, wenn ich mit andern Menschen zusammen bin.«
Marie vertrat ihr den Weg.
»Wenn Du das thust, Anna,« rief sie wild, »so sind wir für alle Zeit geschiedene Leute. Höre mich an. Ich weiß, daß Du jetzt nicht die Kraft hast, Dich seinen tollen Launen zu widersetzen, ich will dafür sorgen, Julie zu entfernen, aber hörst Du, Du selbst sprichst zu ihr kein Wort über diesen Punkt.«
Anna willigte ein. Sie war den ganzen Abend über still und niedergeschlagen, ihre Gedanken weilten bei Heinz. Sie, die ihn so liebte, hatte ihm wehe gethan, sie war schuld daran, daß er den Abend nicht nach seinem Willen bei ihr, daß er ihn einsam verbrachte. Wie sehnte sie sich nach ihm! Wie fühlte sie in jeder Fiber, daß sie ein Leben in Einsamkeit verbringen könnte, wenn er nur dazwischen zu ihr käme. Wie in einem Nebelmeere war alles Andere um sie her versunken, nur er allein war zurückgeblieben und blickte sie aus seinen stolzen, strengen Augen zürnend und herrisch an.
In der Nacht, als Alle zur Ruhe gegangen waren, kam Marie zu Frau Julie und erzählte ihr unter bitteren Thränen, wie alles so gekommen. Sie brachte Julie auf deren Verlangen Heinzens Bild.
»Es ist ein schöner Jüngling,« sagte Julie.
»Ja, schön wie Lucifer,« antwortete Marie.
Frau Julie schüttelte besorgt den Kopf.
»Ich fürchte, das wird ein schlechtes Ende nehmen,« sagte sie. »Was so jäh beginnt, Pflegt auch jäh zu enden.«
»Können wir denn nichts thun?« fragte Marie.
»Ich fürchte – nichts. Löschen können wir die Flamme nicht; dadurch, daß wir dareinschlagen, fachen wir sie nur noch mehr an. Ich will morgen fort – schreib mir, was Du siehst, Marie.«
Am folgenden Tage fuhr Frau Julie fort, ohne daß zwischen ihr und Anna noch von Heinz die Rede gewesen wäre. Anna aber schrieb an Heinz: »Komm, mein Liebling! Ich bin nun ganz allein, habe weder Freund noch Freundin mehr. Ich bin wie jener Mann, der wußte, daß in einem Acker ein Schatz war und nun hinging, alles was er hatte verkaufte und den Acker erwarb. Komm, mein Schatz, zu Deiner nun ganz einsamen und doch überglücklichen Anna.«