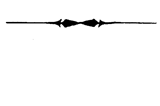|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Am folgenden Morgen weckte der Doctor Heinz und befahl ihm, so leise als möglich das Schlafzimmer zu verlassen und sich in seinem Schreibzimmer anzukleiden; die Mutter sei in der Nacht erkrankt. Heinz zog ganz in des Vaters Zimmer hinüber und wurde, so sehr er auch bat, nicht zur Mutter gelassen. Trotz seiner Unerfahrenheit merkte er doch, daß ihre Krankheit eine gefährliche sein müsse. Tante Agathe war ganz herübergezogen und blieb Tag und Nacht bei der Kranken, und am Abend kamen auch noch abwechselnd Frau Irene oder Frau Adelheid und blieben die Nacht über da. Täglich kam auch Onkel Konrad, und wenn er bei der Kranken gewesen war, ging er mit dem Doctor in dessen Zimmer und schloß sich mit ihm ein. Der Doctor selbst war finsterer und rauher denn je, und die Dienstboten sahen alle sehr traurig aus und blickten Heinz so mitleidig an. Fräulein Berg war in der Schule wo möglich noch freundlicher gegen ihn als sonst, und wenn er nach Hause ging, redete ihn Wohl dieser oder jener fremde Herr an und fragte, wie es seiner Mutter gehe.
Dann kam eine Zeit, in der die Straße mit Stroh bedeckt wurde, damit das Wagengerassel nicht gehört werde; eine Zeit, wo alle Hausbewohner nur auf den Fußspitzen gingen und nur mit einander flüsterten. Die Tanten, die Dienstboten und Fräulein Berg wurden noch herzlicher gegen Heinz; allerlei Verwandte vom Lande kamen zur Stadt gefahren und besuchten den Doctor, und Morgens fanden sich fremde Diener und Dienstmädchen ein, um sich im Namen ihrer Herrschaften nach dem Befinden der Frau Doctorin zu erkundigen. Wie ein Alp lag es auf des Knaben Brust. Er brachte die Geschichte mit dem Hahn in Zusammenhang mit der Mutter Krankheit, und er war fest davon überzeugt, der liebe Gott werde, um ihn zu strafen, die Mutter sterben lassen. Ja, sie wird sterben, zweifellos! Hatte er doch gehört, wie der Onkel Konrad zu Tante Irene sagte: »Gott helfe Heinrich den Schlag überleben; sterben wird sie! Wir Eichenstamms überstehen nie ein Nervenfieber.« »Ja, sie wird sterben!« Der Knabe weiß nicht, was es heißt: sterben; aber er weiß, daß es etwas Schreckliches ist, er weiß, daß, wenn Jemand stirbt, man ihn nie wieder sieht, und wenn er daran denkt, daß er seine Mutter nie wieder sehen soll, geräth er in Verzweiflung. Aber noch lebt sie ja. Er muß sie sehen, obgleich die Tante seine Bitte, zur Mutter gehen zu dürfen, rund abschlägt. Er muß zur Mutter! Er wartet tagelang auf eine günstige Gelegenheit; endlich kommt sie. Tante Agathe verläßt auf einen Augenblick das Krankenzimmer und er schlüpft unbemerkt hinein.
Das Zimmer ist sehr dunkel, aber sein Auge gewöhnt sich an die Dunkelheit. Ist die Gestalt dort im Bette seine Mutter? Kaum erkennt er sie. Wie ist sie hager geworden, wie abgezehrt ist ihr Gesicht, wie treten die Augen aus den Höhlen hervor, mit wie unheimlich loderndem Glanze starren sie ihn an! Sie heißt ihn nicht willkommen, sie ruft ihn nicht heran, drückt ihn nicht an's Herz. Die Lippen ihres Mundes sind so eigenthümlich verzerrt, ihr Leib windet sich so seltsam unter der Decke. Das ist der Tod, der schreckliche, entsetzliche Tod! Namenlose Angst saßt ihn, Angst vor ihr, der Mutter! Tante Agathe kommt herein und führt ihn aus dem Zimmer. Er folgt ihr willenlos. Das also ist der Tod, und er hat ihn verschuldet! Er erzählt der Tante, was er gethan. Sie tröstet ihn und versichert, daß die Mutter auch erkrankt wäre, wenn der Hahn noch lebte; sie sagte ihm, daß es nicht unmöglich sei, daß Gott die Mutter noch erhalte. Er glaubt ihr nicht, er glaubt ihr beides nicht. Er weiß, daß die Mutter sterben wird, er weiß auch, daß er sie getödtet hat.
Es folgt wieder ein Tag, ein langer Tag, an welchem Heinz nicht in die Schule geschickt wird. Er soll zur Hand sein, falls die Mutter zur Besinnung käme und nach ihm verlangte. Der Tag ist sehr lang, – endlich kommt der Abend. Als er eben anbricht, kommt Tante Irene laut schluchzend aus dem Krankenzimmer. Sie zieht Heinz an sich, küßt ihn und überströmt ihn mit ihren Thränen. Er weiß nun, daß die Mutter todt ist. Nach einiger Zeit wird auch er in das Zimmer der Mutter geführt. Das Zimmer ist jetzt ganz hell und am Bette kniet der Vater. Neben ihm stehen die Tanten und der Onkel Konrad. Die Mutter liegt noch immer im Bett, aber sie sieht Heinz, nicht mehr an, ihre Lippen bewegen sich nicht mehr, ihr Leib windet sich nicht mehr. Ihre Augen sind geschlossen, sie liegt unbeweglich. Die Züge ihres Gesichtes sind kalt und scharf. Das ist nicht das freundliche Gesicht seiner Mutter, sie gleicht jetzt ganz dem Vater, sieht aus wie die andern Eichenstamms auch, kalt, klug, energisch. Die Lippen sind so fest aufeinander gepreßt, die Brauen leicht zusammengezogen, wie sich's für des Doctors Nichte gehört.
Die Tanten und der Onkel sehen Heinz verwundert an und begreifen nicht, wie er die Leiche so kalt betrachten kann. Sie wissen nicht, daß diese kalte Frau nicht seine weiche Mutter ist, daß sie für ihn jetzt nichts ist, als eine Eichenstamm, vor der er Furcht hat, irr deren Nähe ihn friert.
Das Gesicht des Vaters kann Heinz nicht sehen. Es ist tief in die Kissen des Bettes begraben, aber er sieht, wie sein Körper von Zeit zu Zeit bebt. Dann gehen die Tanten hinaus und nehmen Heinz mit sich. Er geht gern. Die Frau da mit den eisigen Zügen kann ja seine Mutter nicht sein! Das Ganze muß ein Traum fein, ein schrecklicher Traum, aus dem ihn die Mutter mit einem warmen Kuß und lächelndem Scheltwort erwecken wird. Die Mutter wird ihn nicht mehr erwecken, er wird ihr nicht mehr in die leuchtenden Augen sehen, wird nie mehr ihr holdes: »Mein Herzens-Heinz« hören, wird ihr nie mehr sein volles Herz ausschütten können. Sie wird ihm kein Mährchen mehr erzählen, sie wird nicht mehr mit ihm arbeiten, nie mehr mit ihm lachen und mit ihm weinen. Aber darum hat er sie doch nicht auf ewig verloren. Wenn er älter geworden sein wird, wird sie wieder bei ihm sein; wenn er wird sündigen wollen, wird ihr Bild zwischen ihm und der Sünde stehen; wenn die Reue ihm wird an's Leben wollen, wird sie ihn schützen gegen sich selbst; wenn der Tod endlich an ihn herantreten wird, – wird sie ihm Winken und er wird ihr freudig folgen.
Nach drei Tagen begrub man Frau Agnes, und sie fand ein Begräbniß, wie eine Eichenstamm es sich nur wünschen konnte. Ein Eichenstamm hielt ihr die Grabrede, sechs Eichenstamms trugen sie zu Grabe, und ihr Grab lag unter lauter Eichenstamm'schen Gräbern. Aber keiner der Eichenstamms, unter denen sie gelebt hätte, wußte, daß Frau Agnes noch etwas Anderes gewesen, als eine pflichttreue, verständige, häusliche und gehorsame Frau, daß sie dahingegangen war, ohne erfahren zu haben, wonach sie sich täglich so heiß gesehnt: warme, selbstlose, freundliche Liebe; daß sie gelebt hatte und gestorben war mit einem Herzen voll ungestillter, halb unbewußter Sehnsucht. Keiner wußte das, als der kleine Knabe, der jetzt vereinsamt an ihrer Gruft stand und dem unheimlichen Gepolter der Erdschollen, die auf ihren Sarg fielen, lauschte, und auch der wußte es nicht, – er ahnte es nur.
Der Doctor war am Beerdigungstage sehr gefaßt, es schien ihm selbst der Verlust der Frau nicht eben nahe zu gehen. Er unterhielt sich unbefangen mit Diesem und Jenem, ja, er machte wohl gar gelegentlich eine seiner schneidigen Bemerkungen. Sein Benehmen machte auf die nicht zur Verwandtschaft gehörigen Anwesenden einen sehr unangenehmen, auf die Rechbergs einen sehr schmerzlichen Eindruck. Die Verwandtschaft fand es ganz in der Ordnung – jeder der Eichenstamms hätte in gleicher Lage genau so gehandelt. Ein rechter Mann darf wohl Schmerz empfinden, aber er darf das nicht merken lassen. Wenn Gott die Eichenstamms geißelt, so sollen sie so wenig einen Schrei ausstoßen, wie spartanische Knaben im Tempel der Artemis. Ein Eichenstamm soll nie das Recht in Anspruch nehmen dürfen, einmal weich, einmal erschüttert zu sein. Weil das nie der Fall ist, darum trägt ja die Familie den Kopf so hoch. Ein Eichenstamm kann schlimme Dinge begehen, wenn der Zorn ihn überwältigt, wenn die Leidenschaft ihn beherrscht; aber er kann nie feig und verzagt sein. Wenn er von echter Art, wird er mit dem Tod in der Brust noch scherzen.
Der Doctor bestand die Probe und die Seinigen sind sehr stolz auf ihn. Tante Adelheid, Tante Irene und Onkel Konrad sind es am meisten, denn sie wissen, wie es im Herzen des Mannes aussieht, der so unbefangen scherzt. Sie sehen von ihm auf Heinz, und ihr Auge ruht mit Wohlgefallen auf dem Knaben. Sie glauben, er gleiche dem Vater nicht nur äußerlich; sie verstehen Heinz eben so wenig, wie sie seine Mutter verstanden haben. Nicht sein Wille macht ihn so ruhig, sondern völlige Betäubung. Wenn er aus ihr erwachen wird, nach Tagen – dann wird er sich so unsinnig benehmen, wie nur je ein leidenschaftlicher, heißblütiger Knabe, der zum ersten Male einen unersetzlichen Verlust erlitten hat.
Im Hause des Doctors änderte sich vorläufig nichts, als daß Tante Agathe jetzt viel mehr im großen Hause war und sich mehr mit Heinz beschäftigte als früher. Von Frau Agnes sprach der Doctor nie, und die einzigen Umstände, die darauf schließen ließen, daß er sie nicht vergessen hatte, fanden in der Beobachtung, die Weinthal gemacht haben wollte, ihren Ausdruck: »Der gnädige Herr lesen jetzt immer auf der Couchette liegend, was der gnädige Herr sonst nie gethan haben,« und: »Der gnädige Herr sind jetzt gegen die alten Weiber im Lazarus (so hieß das städtische Armenhaus) so freundlich, wie sonst gegen keinen Menschen nicht.«
So blieb Alles bis zum August. Der Doctor sprach weniger denn je; Heinz plauderte in den Freistunden mit den Dienstboten oder saß irgendwo auf dem Hofe und hing einsam seinen Träumen nach, in denen er ein großer Herr war und mit Lelia in einem prachtvollen Schlosse lebte. Alle Welt gehorchte da seinen Winken, und auch Lelia that, was er wollte.
In den ersten Tagen des August fuhr der Vater auf einen ganzen Tag fort und kam erst spät Abends nach Hause. Am andern Morgen ließ er Heinz rufen und theilte ihm in seiner kurzen Weise mit, daß Heinz zum Onkel Konrad auf's Land solle, um dort mit dessen Söhnen erzogen zu werden. Dieser Onkel Konrad, ein jüngerer Bruder des Doctor Heinrich, war Pastor in Parkhof. Er war eine selbstherrische Eichenstamm'sche Natur, aber ein rechtschaffener, pflichttreuer, thätiger Herr. Wenn er nicht der Neffe eines kinderlosen Pastors gewesen wäre, so hätte er wahrscheinlich nicht Theologie studirt; aber da er einmal Pastor war, so that er auch eifrig seine Pflicht als solcher, und wenn er nicht gerade unter der Herrschaft des Jähzornes stand, in welchem Fall er sich nicht in der Gewalt hatte, gab er sich erfolgreiche Mühe, seiner Gemeinde als Geistlicher, Landwirth, Vater und Mensch ein gutes Beispiel zu geben. Alles freilich, was mit dem Gemüthsleben des Menschen zusammenhing, war ihm fremd und unverständlich, jede Aeußerung des Gefühls im höchsten Grade widerwärtig. Pflichttreue, Verständigkeit, Sparsamkeit waren die Worte, die in seinen Reden beständig wiederkehrten. Seiner religiösen Gesinnung nach war er orthodox im Geiste des 17. Jahrhunderts, seinem Aussehen nach ein schöner, stattlicher Mann.
Aus den Worten des Doctors: »Ich will mit dem Kinde meiner Agnes in Frieden leben, und wenn wir zusammen bleiben, wird es nicht geschehen,« hörte der Pastor heraus: »Der Junge muß scharf gehalten werden.« Dazu hatte Frau Irene viel davon erzählt, wie trotzig und leidenschaftlich Heinz sei und wie sehr ihn die Mutter verwöhne, und darauf hin beschloß der Pastor, dem Wunsche des Bruders nachzukommen. Wenn der Doctor von Heinzens Seite Widerstand gefürchtet hatte. so irrte er. Seit die Mutter todt war und Leila sich so zurückhaltend gegen ihn zeigte, war ihm die Welt, in der er bisher gelebt, gleichgültig geworden. Er sehnte sich hinaus aus dem stillen Hause, fort von dem kalten, finsteren Vater. Er hatte soeben die ganze Langeweile einsam verbrachter Ferien durchgekostet; es lockte ihn die Aussicht, künftig mit Altersgenossen zusammen zu fein. Tante Agathe that dazu das Ihrige, ihm die Zukunft in möglichst rosigem Lichte erscheinen zu lassen, und erzählte ihm, daß alle Eichenstamms von jeher auf dem Lande erzogen seien und daß man nur auf dem Lande ein echter Eichenstamm werden könne. Freilich, die Trennung von den Dienstboten war ein hartes Stück, und als nun die Scheidestunde schlug, war es Heinz kein geringer Trost, daß Weinthal ihn nach Parkhof bringen sollte.
Er nahm einen thränenreichen Abschied von Tante Agathe, Annettchen, Emma und Ziep, küßte dem Vater ziemlich gleichgültig die Hand, schaute noch einmal mit einer gewissen Abneigung in dessen ehernes Gesicht, hörte sein kaltes: »Lebe wohl, Heinz, und sei fleißig,« und stieg dann getrost mit Weinthal in den Wagen, während Tante Agathe, Annettchen und Emma dem Wagen noch lange nachblickten und ihn mit Segenswünschen begleiteten.
Die getroste Stimmung hielt bei Heinz nicht lange an. Als der Wagen am Friedhofe vorüberfuhr, auf dem die Mutter ruhte, und von dem die schwarzen und weißen Kreuze herüberwinkten, faßte ihn das Heimweh und Weinthal gab sich vergebens alle Mühe, ihn bei gutem Muthe zu erhalten. Je näher sie dem Pastorate kamen, um so banger wurde es Heinz um's Herz. Bei jedem Gesinde fragte er ängstlich, ob das schon Parkhof sei, und als des Doctors Falben jetzt rechts abbogen, durch eine kurze Birkenallee trabten und nun der Wagen vor der Veranda des Pastorates hielt, stand ihm das Herz fast still vor Furcht und Erwartung. Von der Veranda aus winkte ihm die Tante freundlich zu; die beiden kleinen Vettern starrten ihn verwundert an und der Pastor kam die Stufen herab, um ihm aus dem Wagen zu helfen.
»Komm' her, mein Jungchen!« rief die Tante mitleidig, »Du sollst nun an mir eine zweite Mutter haben.«
Die freundlichen Worte und die herzliche Umarmung brachten Heinz volles Herz zum Ueberfließen; er brach in lautes und heftiges Weinen aus.
»Frau, verwöhne mir den Jungen nicht!« rief der Pastor ärgerlich; »seine selige Mutter hat ihn ohnehin verwöhnt.«
»Und Du, Bursche,« wendete er sich rauh zu Heinz, »hörst mir augenblicklich mit dem Weinen auf! Augenblicklich! Hörst Du Ein Junge darf nicht weinen, wenn man ihm den Kopf abreißt, und hier ist gar kein Grund, sich so zu geberden. Scenen machen und Komödiespielen dulde ich nicht in meinem Hause, das merke Dir ein- für allemal. Wer bei mir Komödie spielen will, bekommt die Ruthe!«
»Du mußt das Kind nicht so einschüchtern, Konrad,« sagte die Tante. »Komm, Heinz!« fuhr sie dann fort, »ich will Dir Deine kleine Kommode zeigen. Da kannst Du dann mit Hülfe von Heinrich und Friedrich Deine Sachen hinein legen.«
Damit nahm die Tante Heinz an die Hand, die Vettern folgten, und sie kamen, nachdem sie eine Treppe hinaufgestiegen, in ein großes, freundliches Zimmer, in dem drei Betten standen.
»So, Heinz!« hieß es, »hier ist Euer Zimmer; das da Dein Bett, dies Deine Kommode. Sei nun recht ordentlich und fleißig, so wirst Du uns ein lieber Sohn werden.«
Sie hatte diese Worte mit weicher Stimme gesprochen, um ihm aber gleichsam zu beweisen, daß nicht einmal die Gattin eines Eichenstamms fünf Minuten hindurch in weicher Stimmung bleiben könne, fügte sie nun in scheltendem Tone hinzu: »Ja, ein besserer Sohn als der Schlingel, der Heinrich da! Hältst Du schon wieder Deine Hände in den Hosentaschen, Du Taugenichts!« – Dabei gab sie ihrem Sohne einen derben Schlag.
Nach diesem Ausbruche wurde die Tante wieder freundlich, nahm Heinz wieder an die Hand und klopfte an eine geschlossene Thür. Diese wurde rasch geöffnet, Heinz fühlte sich von der Tante in ein Zimmer geschoben, in das sie ihm nicht folgte, und sah sich nun einem kleinen, untersetzten Manne gegenüber, den er nie zuvor gesehen hatte. Der Mann trug eine Brille, hatte schwarzes, stark gelocktes Haar und war in einen grauen Schlafrock gehüllt.
»Ach, Du bist wohl der kleine Neffe aus der Stadt?« fragte der Mann, indem er Heinz vom Kopfe, bis zu den Füßen musterte. »Nun, Du siehst mir nicht aus, wie Einer, der gern arbeitet, aber wir wollen Dir das schon beibringen. – Nicht wahr, Frau Pastorin?« rief er überlaut.
»Gewiß, Herr Candidat!« antwortete die Tante aus dem Nebenzimmer. »Sie werden aber Anfangs etwas Nachsicht mit ihm haben müssen; er ist übermäßig verwöhnt.«
»Ich liebe keine verwöhnten Kinder,« fuhr nun der Candidat, mit zornigem Stirnrunzeln gegen Heinz gewandt, fort. »Verwöhnte Kinder sind mir ein Gräuel! Nicht wahr, Frau Pastorin?« hieß es nun wieder laut.
»Gewiß, Herr Candidat!« schallte es zurück; »aber Sie sind der Mann dazu, sie zu entwöhnen.«
Herr Stabmeister, so hieß der Candidat, schmunzelte über das Wortspiel als über ein Kompliment und wandte sich dann, indem er eine lange Pfeife aus einem, auf dem Tische stehenden Tabakskasten langsam füllte, wieder zu Heinz.
»Das merke Dir von vornherein, kleiner Mann, verwöhnt wird hier Niemand. Dann noch eins! Der Herr Pastor hat mir gesagt, daß Du Scenen liebst und nicht gern gehorchst. Davon sind wir hier keine Freunde, und Fräulein Schlank – er wies dabei auf eine schlanke Reitgerte, die unter einer grünen Mühe und einem alten Rappier an der Wand hing – würde Dir die Lust dazu bald austreiben. Vor der nimm Dich überhaupt in Acht. Und nun geh' und sei mir ein gehorsamer, fleißiger Schüler!«
Es wäre vergeblich, den Kummer und die Verzweiflung, die sich in der letzten Viertelstunde Heinzens bemächtigt hatte, schildern zu wollen. Er kam sich so trostlos vereinsamt und verlassen vor, eine so namenlose Angst schnürte ihm die Kehle zu, die Zukunft erschien ihm so entsetzlich, daß er sogar die Fähigkeit zu weinen verlor. Aber bald wich die Betrübniß der Erbitterung. Was hatte er denn gethan, daß man so zu ihm sprechen durfte? War er nicht bei Fräulein Berg immer seines Fleißes wegen belobt worden? – Sein Herz schloß sich fest zu vor diesen Leuten, die ihn verurtheilten, ehe sie ihn kannten; sein Trotz bäumte sich auf gegen die in Aussicht gestellten Züchtigungen.
Wie wenig wissen die Erwachsenen oft, was im Kinderherzen vorgeht – und sind doch alle selbst Kinder gewesen! Sie waren durchaus keine bösen Menschen, diese Drei, und meinten es treu und redlich mit Heinz, und doch verdarben sie ihn im ersten Augenblicke gründlich und für lange Zeit, verschlossen sich muthwillig selbst den Zugang zu seinem Herzen. Einmal mit dem, was jetzt in seiner Brust wogte, fertig geworden, einmal daran gewöhnt, die Regungen seines, im Guten wie im Bösen stürmischen Herzens zu unterdrücken und für Sentimentalität zu halten, – wird der Knabe bald hieb- und schußfest werden, und alle Zwangsmaßregeln werden sich als vergeblich erweisen. Sie meinten es so gut und handelten doch so thöricht; sie meinten ein verwildertes Kind zu veredeln – und sie verwilderten ein edles Kind!
Heinz stand noch immer in des strengen Herrn Lehrers Zimmer und starrte ihn düster an. »Du kannst jetzt gehen!« wiederholte der Lehrer ungeduldig.
»Komm', Heinz, wir wollen Deine Sachen einkramen,« rief die Tante. Er hörte ihre Worte, aber er verstand sie nicht, und erst als ein Vetter Heinrich ihn am Arme nahm und mit sich aus dem Zimmer zog, folgte er ihm, um theilnahmlos dabei zu stehen, während die Tante und die Vettern seine Wäsche, Kleider und Spielsachen aus dem Mantelsacke nahmen und in die Schubladen der Kommode legten.
Von Zeit zu Zeit, wenn irgend eine recht hübsche Spielsache zum Vorschein kam, stießen die Knaben ein lautes »Ach!« aus und sahen verwundert den unbegreiflichen Vetter an, der im Besitze solcher Herrlichkeiten so traurig aussehen und so stumm und regungslos dastehen konnte.
»Höre, Friedrich,« sagte Heinrich, »der Heinz hat fast noch schönere Sachen als Horace! Dies Pferd hier hat sogar wirkliche Mähnen.«
»Ach geh'!« war die Antwort; »Horacens Sachen sind zehnmal hübscher. Ein Pferd kann Jeder haben, aber Horace hat auch einen Stall. Das macht es!«
»Höre, Heinz, bist Du auch katholisch?« fragte Heinrich.
»Was ist das, katholisch?« brachte Heinz mühsam heraus.
»Nun das, was Horace ist.«
»Nein,« antwortete für den Gefragten die Tante lachend, »Heinz ist ein Eichenstamm, und die sind, Gottlob, alle lutherisch. Gott bewahre! Nein, Heinz ist durchaus lutherisch! Es hat nie einen Eichenstamm gegeben und wird nie einen geben, der nicht lutherisch wäre.«
»Sind nur die Edelleute katholisch?« fragte Friedrich.
»Nein, wie kommst Du darauf? Unsere Edelleute, die guten, alten Edelleute, sind alle lutherisch, so gut wie die Eichenstamms!«
»Aber, Mama, Horacens Vater war doch auch ein Edelmann?«
»Der? Der war so wenig ein Edelmann, als der Parkhöf'sche Krüger. Er war nicht einmal ein Landeskind, sondern ein hergelaufener Fremder!«
Damit ließ die Tante die Kinder stehen und ging hinunter. Heinz stand noch eine Weile da und sah stumm vor sich nieder, dann war sein Entschluß gefaßt.
»Könntet Ihr mich nicht zu Weinthal führen?« bat er die Vetter.
Diese gingen mit ihm hinab Leutezimmer, wo sie Weinthal fanden.
»Ich will hier nicht bleiben,« sagte Heinz, indem er Weinthals Arm ergriff; »ich werde wieder mit Ihnen fahren.«
»Das geht nicht, Jungherrchen, das geht nicht. Jungherrchen müssen hier bleiben. Ich kann Jungherrchen nicht wieder mitnehmen, das erlauben Jungherrchen sein gnädiger Herr Vater nicht!«
»Sie werden mich aber doch wieder mitnehmen, denn hier bleibe ich auf keinen Fall!«
»Jungherrchen werden doch keine Geschichten nicht machen. I, wo werden Sie denn nicht hier bleiben!«
»Nein, Weinthal, wenn Sie mich nicht mitnehmen, laufe ich zu Fuß nach Hause.«
»Bist Du toll, Heinz!« riefen Heinrich und Friedrich wie aus einem Munde.
»Ich bin nicht toll,« schrie Heinz laut, »ich will nicht hier bleiben! Nach Hause will ich!«
»Höre, Heinz, nimm Dich in Acht, daß Papa Dein Geschrei nicht hört,« warnte Friedrich, »es könnte Dir sonst übel ergehen.«
Das war Oel in's Feuer gegossen.
»Glaubst Du, ich fürchte mich vor Deinem Papa?« schrie er nur noch lauter. »Was kann er mir thun«? Ich will nach Hause und ich werde nach Hause. Ja, ja, ja!« Heinz stampfte mit dem Fuße und schrie immer fort »ja,« obgleich Niemand ihm widersprach und Alle voll Angst, der Pastor könne durch das Geschrei herbeigerufen werden, dastanden.
So geschah es denn auch. Der Pastor kam herbei und sein Zorn entzündete sich an des Knaben ungeberdigem Wesen so rasch wie ein Strohdach an einem Kienbrande. Es kam zu einem heftigen Kampfe zwischen dem Pastor und Heinz, der natürlich mit der Niederlage des Letzteren endigte. Der Pastor packte ihn am Kragen, trug ihn die Treppe hinauf und sperrte ihn in einen dunklen Bodenraum, dessen Thür er von außen verschloß.
Heinz tobte wie ein wildes Thier an den Wänden des Verschlages; aber dieser war fest und wich nicht. Dazwischen betete er wilde, gottlose Gebete gegen den Onkel – aber auch sie machten ihn nicht frei.
Stunden vergingen so, nichts rührte sich um ihn. Sein Zorn war verraucht, sein Trotz blieb fest. »Sie mögen thun, was sie wollen,« knirschte er, »ich werde doch nach Hause. Nimmt mich Weinthal nicht mit, so gehe ich allein!«
Endlich kam der Pastor. »Wirst Du jetzt artig sein?« fragte er.
»Ich werde doch nach Hause,« erwiderte Heinz trotzig.
Der Pastor ging, ohne ein Wort zu sagen, wieder davon und ließ Heinz lange Zeit, über sein Verhalten nachzudenken. Dieser sah ein, daß es so nicht ging. Als der Pastor wiederkam, sagte er, er wolle dableiben, war jedoch fest entschlossen, davon zu laufen. Er verbarg von jetzt an seine Gedanken so sorgfältig, daß es ihm am dritten Tage, an dem man ihn nicht mehr beobachtete, gelang, die Landstraße zu erreichen.
Heinz hatte beim Abschiede vom Hause von Tante Agathe einen Rubel geschenkt bekommen und hoffte durch denselben einen vorüberfahrenden Bauern oder Juden willig zu machen, ihn mitzunehmen. Er mochte eine Meile gegangen sein, als er einen mit vier Schwarzschecken bespannten herrschaftlichen Wagen hinter sich herkommen sah. In dem Wagen saßen ein Herr mit einem langen, weißen Schnurrbart und ein kleines, lichtblondes Mädchen. Als sie Heinz erreicht hatten, wendeten sie sich Beide verwundert nach ihm um, dann ließ der Herr halten.
»Bist Du nicht ein kleiner Eichenstamm?« fragte er den Knaben.
»Ja,« erwiderte Heinz.
»Ein Sohn vom Pastor?«
»Nein, mein Vater ist Doctor in der Stadt.«
»Nun, und wie kommst Du denn hier auf die Landstraße?« fragte der Herr weiter.
»Ich gehe von Parkhof zur Stadt,« erwiderte Heinz.
»Aber das ist doch wirklich unverantwortlich,« meinte der Herr, ein Kind so weite Wanderungen allein machen zu lassen. Hast Du denn keine Furcht, so allein daher zu gehen?« wandte er sich wieder an Heinz.
»Ich habe einen Rubel,« erwiderte Heinz, »und hoffe damit einen Bauern zu bewegen, mich mitzunehmen!«
Der Baron, denn ein solcher war der Herr, lachte.
»Nun, spare Deinen Rubel und setze Dich zu uns in den Wagen,« sagte er. »Rücke etwas bei Seite, Duding,« Lettisch: Täubchen. wandte er sich an die Tochter.
Diese, die unterdessen Heinz mit vieler Aufmerksamkeit betrachtet hatte, machte bereitwillig Platz und Heinz setzte sich zu ihnen.
Als sie weiter fuhren, fragte ihn der Baron über feine Verhältnisse aus, und Heinz machte ihm kein Hehl daraus, daß er seinem Onkel davongelaufen sei. Der Baron, der in seinem Aeußeren etwas ungemein Vertrauenerweckendes hatte, lachte darüber, daß ihm die Thränen über die Wangen rollten und setzte ihn schließlich vor der Thür des väterlichen Hauses ab, indem er ihm noch zurief: »Sage Deinem Vater, wenn er nach mir fragen sollte, daß es der Baron Gustav Schweinsberg war, der Dich nach Hause brachte.«
Als Heinz das Haus betrat, kam er zu einem neuen Entschlusse. Daß ihn der Vater nicht bei sich behalten könne, sah er ein; er wollte also gegen das Zurückgeschicktwerden von vornherein nichts einwenden und sich damit begnügen, daß er sein Wort: »Ich werde doch nach Hause!« gelöst und seinen Willen durchgesetzt habe.
In der Stadt erschreckte er durch seine Ankunft Tante Agathe auf's Aeußerste, denn sie wußte durchaus nicht, wie sie seine Rückkehr dem Doctor mittheilen sollte, ohne ihren Liebling einer harten Züchtigung auszusetzen. Wider Erwarten nahm der Doctor ihren Bericht ziemlich kaltblütig auf, erklärte aber Heinz entschieden, daß er zurück müsse. Heinz weigerte sich auch nicht, und als einige Stunden nach seiner Ankunft der Pastor in großer Aufregung eintraf, erklärte er sich bereit, ihn zu begleiten und kehrte mit dem festen Entschlusse nach Parkhof zurück, sich stets bis aufs Aeußerste zu widersetzen.
Unterdessen dachte der Pastor zornig darüber nach, wie er es wohl anfangen könne, den unerhörten Trotz des Knaben zu brechen, und der Doctor ging zu Hause unruhig auf und ab, nagte an der Unterlippe und dachte voll schwerer Sorge an den Sohn.