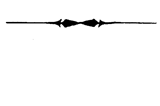|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Frau Irene war eine sehr kluge Frau und Niemand wußte das besser als sie. Sie war auch eine sehr thätige, sparsame Hausfrau, wohl vertraut mit der Nadel und wohl bewandert in Küche und Keller. Sie war ferner sehr häuslich und pflichttreu in jedem Sinne. Sie war von tadelloser Kirchlichkeit und hätte einer Andersgläubigen nicht nur auf's Genaueste angeben können, woran eine Lutheranerin, bei Verlust ihrer Seligkeit, zu glauben hat, sondern sie hätte ihr auch die Stellen in der Bibel aufschlagen können, auf welche die lutherische Kirche ihre Lehre gründet. Dabei hielt sie sich fern von aller Sentimentalität und war überhaupt durchaus vernünftig, wie sie denn kein Wort so häufig im Munde führte, als das Wort Vernunft oder sein Gegentheil. Sie war viel zu vernünftig, um je ein anderes Buch in die Hand zu nehmen als die Bibel, oder ihre Zeit auf das Anschauen eines Gemäldes zu verwenden, und hielt auch von der Musik so viel wie ihr Bruder Heinrich. Es war kein Wunder, daß Frau Irene bei ihren vielen Vorzügen auch viel auf sich hielt. »Betrachtet mich, wie rein ich bin,« sagte ihre hohe Stirn; »seht uns an, wie vernünftig wir blicken,« sprachen die hellbraunen, großen Augen. »Seht Ihr mich je von meinem Willen abgehen?« fragten die dünnen Lippen des kleinen Mundes und die kühn geschwungene Adlernase. »Ich habe nie gelogen,« sprach der steife Nacken. »Ich danke Dir, lieber Gott, daß ich nicht bin wie andere Leute,« sprach es aus ihrem ganzen Wesen.
Frau Irene war durchaus eine Achtung gebietende Persönlichkeit, und sie fand so viel Achtung, als ihr Herz nur immer verlangen mochte. Ihr Mann empfand hohe Achtung vor ihr, ihre Kinder eine noch höhere und fremde Leute die höchste. Die Folge davon war, daß ihr Mann es nicht ungern sah, daß sein Beruf ihn den größten Theil des Tages über von seiner Frau entfernt hielt, daß ihre Kinder den Abend, an dem die Mama einmal ausging, als ein hohes Fest begingen, und daß fremde Personen die größte Abneigung zeigten, längere Zeit in der Gesellschaft einer so hohe Achtung einflößenden Frau zu verweilen. Kein Wunder, daß die Armen, die sie unterstützte, und sie unterstützte viele, einer solchen Frau nur mit Zittern und Zagen sich nahten.
Daß Frau Irene so viel Achtung einflößte, lag keineswegs nur in ihrer geschlossenen Persönlichkeit; auch wer sie in den Tod nicht leiden mochte, und deren gab es Viele, mußte ihr zugestehen, daß in ihrer Gegenwart nichts Schlechtes, Unreines oder Thörichtes vorkommen konnte, daß der Einfluß, den sie auf ihre Umgebung ausübte, doch ein wirklich sittlicher war, da man Fleiß, Pünktlichkeit und rücksichtslose Pflichterfüllung nirgends so gut als in Frau Irenens Umgang lernen konnte.
Frau Irene war heute in sehr aufgeregter Stimmung. Sie sah in der Regel Alles, wußte Alles und doch mußte sie sich heute sagen, daß sie von Heinzens und Adelheids gemeinsamen Ausflügen nichts gesehen und nichts gewußt hatte, ja, daß sie vielleicht noch lange davon nichts gesehen und nichts gewußt hätte, wenn nicht der Tischler Dreiband zu ihr gekommen wäre, um ihr mitzutheilen, daß er die Beiden jeden geläuteten Sonntag an seinem Garten vorübergehen sehe. Dadurch aufmerksam gemacht, sei er ihnen einmal gefolgt und habe gesehen, wie Heinz Adelheid mehrmals geküßt habe. Ernstliche Besorgnisse waren deshalb in Frau Irene nicht wach geworden, dazu hielt sie viel zu viel von der natürlichen Güte des Eichenstamm'schen Blutes, aber sie war einmal zu vernünftig, um nicht eine geschworene Feindin aller frühen Verlobungen zu sein, und sie war ferner darüber erzürnt, daß ihr so etwas so lange hatte verborgen bleiben können. Es war ein hartes Ding für eine Frau von ihrem Schlage, dem Tischler, der, da er als Knabe im Hause ihres Vaters Diener gewesen war und sich daher als zur Familie gehörig betrachtete, auf seine Frage: »Ob sie um diese Ausflüge wisse?« mit »nein« antworten zu müssen, aber sie war doch der Wahrheit getreu geblieben. Ihren Mann freilich hatte sie glauben lassen, der Tischler habe seine Beobachtungen nur im Auftrage von Frau Irene angestellt, um den Triumph zu genießen, daß er, der an der Wahrheit des Gehörten gezweifelt hatte, sich nun durch den Augenschein überzeugen lassen mußte.
Am Abend, als Alles im Hause zu Bette gegangen war, saß sie in dem Arbeitszimmer ihres Mannes und berieth mit ihm, was zu thun sei.
»Wasche den Beiden tüchtig den Kopf,« sagte der Mann, »und nimm die Adelheid künftig mit Dir, wenn Du in die Kirche gehst, weiter wird sich dabei nichts machen lassen.«
»Das wäre wenig vernünftig, Friedrich,« erwiderte Frau Irene und schaute nachdenklich auf ihre Hände. Obgleich Frau Irene wohl 35 Jahre alt sein mochte, so hatte sie doch noch wunderschöne weiße Hände. »Damit erringen wir nichts,« fuhr sie dann fort. »Wollen die Beiden zusammenkommen, so werden sie es thun, wir mögen Acht geben, so viel wir wollen, und wenn, wie ich fürchte, nicht nur unbedachter, jugendlicher Unternehmungsgeist, sondern eine Verlobung zu Grunde liegt, so kann man es ja nicht einmal wünschen, daß sie sich so leicht auseinander bringen lassen.«
»Da hast Du Recht! Das ist wahr!«
»Und doch können wir,« fuhr Frau Irene fort, »es vernünftiger Weise unmöglich zulassen, daß ein so unvernünftiges Verhältniß länger fortbesteht, in unserem Hause fortbesteht. Wir würden überdies das Vertrauen, das Dein Bruder in uns setzte, da er uns sein Kind anvertraute, auf's Gröblichste täuschen. Das geht durchaus nicht.«
»Nein, das geht durchaus nicht.«
Onkel Friedrich läßt sich durch diese Schwierigkeit auch nicht einen Augenblick beunruhigen. Er ist fest davon überzeugt, daß seine kluge Frau binnen einer Stunde ein Auskunftsmittel finden wird, und raucht mit Behagen seine Cigarre, während Frau Irene nachdenklich vor sich hinsieht.
»Sind sie doch Beide noch ganz und gar Kinder,« sagt sie.
»Kleine Kinder,« ruft Onkel Friedrich.
»Höre, Friedrich, das Mädchen muß aus der Stadt!«
»Natürlich, aber bis Weihnachten ist noch viel Zeit.«
»Nein, sie muß sofort aus der Stadt, noch in dieser Nacht.«
»Wo soll sie denn hin?«
»Nach Hause.«
Onkel Friedrich ist als ein sehr energischer Mann bekannt und hält sich selbst für einen solchen; trotzdem fühlt er in solchen Augenblicken auf's Lebhafteste, wie sehr seine Frau ihm an Unternehmungsgeist überlegen ist. Er legt die Cigarre weg und sagt: »Potz Blitz!«
»Ja, Friedrich,« fährt Frau Irene lebhaft fort, »noch in dieser Nacht! Das sind wir Deinem Bruder schuldig.«
»Aber Du kannst doch das Mädchen unmöglich allein in den Postwagen setzen wollen?« sagt der Mann.
»Nein, das nicht. Dreiband soll sie begleiten. Er ist uns Dank schuldig und uns zugethan, er wird uns den Gefallen thun. Gehe sogleich zu ihm und sprich mit ihm; ich weiß, daß er seiner Holzeinkäufe wegen immer einen Paß hat. Ich schreibe unterdessen an Deinen Bruder und spreche mit Adelheid.«
Friedrich Eichenstamm fand Geschmack an der Sache. Er war kein Freund langer Berathungen, »je schneller, je besser,« war sein Wahlspruch. »Ich komme mit Dreiband und den Postpferden zurück,« sagte er, indem er aufstand und Hut und Stock ergriff. »Bereite Du unterdessen Alles zur Reise vor.« Er ging.
Frau Irene theilte nun der Schwägerin in einem Briefe die Veranlassung ihres Verfahrens mit, versiegelte und adressirte diesen und ging dann in Adelheids Zimmer.
Sie fand Adelheid noch wach, aber schon im Bette.
»Steh' rasch auf,« rief sie ihr zu, »der Onkel hat mit Dir zu sprechen,« und ging wieder hinaus.
»Was ist das?« dachte Adelheid, während sie sich ankleidete. »Sollten die Beiden uns auf die Spur gekommen sein?« Die Stimme der Tante hatte so besonders geklungen. Adelheid klopfte das Herz zum Zerspringen, als sie in des Onkels Zimmer trat.
Sie fand dort nur Tante Irene.
»Du hast uns belogen, Adelheid,« sagte diese streng. »Du bist nicht in der Kirche gewesen, sondern bist mit Heinz zu Boot gefahren.«
»Ich bin allerdings –« sagte Adelheid stockend.
»Wie? Bist Du in der Kirche gewesen? Ja oder nein?«
»Ja!«
»Also Du leugnest, daß Du mit Heinz während der Kirchenzeit zu Boot gefahren bist?«
»Nein, ich war erst in der Kirche und fuhr dann zu Boot.«
Tante Irene hätte für ihr Leben gern gewußt, ob sich die Beiden verlobt hatten, aber sie mochte nicht darnach fragen.
»Weißt Du auch, daß Du die Ruthe verdient hast?« sagte sie heftig.
Das schnöde Wort regte in Adelheid, die bisher, im Bewußtsein ihrer Schuld, mit gesenktem Haupte dagestanden hatte, die Eichenstamm auf.
»Ich muß Dich bitten, liebe Tante, Dich künftig mir gegenüber passender auszudrücken,« sagte sie. »Du sprichst mit einem erwachsenen Mädchen.«
Die Tante lenkte ein.
»Womit willst Du Dein unpassendes, unschickliches, unweibliches Betragen entschuldigen?« fragte sie.
»Ich kann darin, daß ich mit Heinz spazieren gefahren bin, nichts Unweibliches erblicken,« erwiderte Adelheid stolz. »Außerdem bin ich mit Heinz verlobt.«
»Ah, ich gratulire!« rief die Tante spöttisch. »Uebrigens,« fuhr sie fort, »steht Euch dann eine lange Trennung bevor. Du wirst in zwei Stunden abreisen.«
»Wohin, Tante? Wohin?« rief Adelheid entsetzt.
»Nach Hause, zu Deinen Eltern.«
Adelheid warf sich vor der Tante auf die Kniee.
»Tante,« rief sie, »gute, liebe Tante, das kann doch Dein Ernst nicht sein. Wollt Ihr mich aus Eurem Hause stoßen, blos weil ich mich in allen Ehren mit Heinz verlobt habe?«
»Steh' auf,« sagte die Tante kalt; »Du weißt, daß ich das Komödiespielen nicht leiden kann.«
Adelheid hielt sie am Kleide fest, aber die Tante riß sich los.
»Hilf mir Deine Sachen packen,« sagte sie, »in zwei Stunden wirst Du abreisen.«
»Aber warum, warum?«
Adelheid überlegte blitzschnell. Sie kannte Tante Irene hinreichend, um zu wissen, daß sich an ihrem Entschlusse nichts ändern ließ; sie wußte auch, daß sie beim Onkel auf keinerlei Unterstützung rechnen durfte. Obgleich sie vor Aufregung und Leidenschaft bebte, überlegte sie doch kalt und übersah klar ihre Lage. Sie erkannte, daß sie sich fügen müsse, und sah stillschweigend zu, wie man ihre Sachen in die Koffer packte. Sie machte auch keinen Versuch, auf den Onkel einzuwirken, als dieser mit dem Postwagen und Dreiband, der sich sogleich zur Fahrt bereit erklärt hatte, ankam. Sie erwiderte nichts auf die ernsten Worte, mit denen die Tante von ihr Abschied nahm, nur die Thränen perlten reichlich über ihre Wangen und die ganze Leidenschaftlichkeit ihrer Natur bahnte sich einen Ausweg, als sie über die Hausschwelle in den hellen Sommermorgen hinaustrat.
»Ich lasse Euch meinen Fluch!« schrie sie überlaut, die krampfhaft gefalteten Hände zum Himmel erhebend.
Der Tischler Dreiband nickte dem Onkel und der Tante lächelnd zu, als wollte er sagen: »Das kennen wir, das giebt sich!« und der Postillon fuhr ab.
Herr Dreiband war ein großer, dicker Mann mit einer stets heisern Stimme und einem stets fröhlichen Gemüthe. Eigentlich Tischlermeister, fand er doch an dem Handwerke keine rechte Freude und benutzte gern jede sich bietende Gelegenheit, seinem Hange zum Umherschweifen nachzugeben. Er war Kommissionär verschiedener Holzhändler, spekulirte gelegentlich selbst in Brettern, Balken und Schalkanten und kam dabei vorwärts. Er hatte ein ungemein offenes Gesicht, wie man zu sagen pflegt, und schlug, als ein industrieller Mann, nach Herzenslust daraus Kapital. »Ich bin ein einfacher, ehrlicher Mann,« war seine Lieblingsredensart. Mit dieser Redensart und seinem offenen Gesichte hatte er schon manches vortheilhafte Geschäft gemacht. So wurde er denn mit jedem Jahre offener.
Anfangs ließ er Adelheid sich ruhig ausweinen und überschlug seinerseits in Gedanken, wieviel ihm diese Reise einbringen würde. Er hoffte auf ein erkleckliches Sümmchen, denn er wußte, daß Adelheids Vater ein sehr wohlhabender Mann war. Er wollte die Rückreise dazu benutzen, um sich im Schaulenschen ein wenig nach Eichen umzusehen.
Nach längerem Schweigen wandte er sich an Adelheid mit der Frage, ob sie gut sitze. Als sie darauf keine Antwort gab, dachte er: »Nun, Du bist noch nicht fertig, ich kann warten,« und vertrieb sich die Zeit damit, in Gedanken den ganzen schönen Wald, durch den sie fuhren, niederhauen und zu Brettern zersägen zu lassen. Er verkaufte dann Bretter, Köpfe und Abfall zu enormen Preisen. Als er damit fertig war, fragte er Adelheid, ob sie wohl nichts dagegen habe, wenn er sich ein Pfeifchen anzünde.
Sie hatte nichts dagegen.
»Fräuleinchen,« begann Dreiband, »es war doch recht einfältig von dem Jungherrn!«
»Was?« fragte Adelheid.
»Das hätte ich nicht von ihm geglaubt.«
»Was denn?« fragte Adelheid, aufmerksam werdend.
»Ich bin ein einfacher, ehrlicher Mann, ich kann so etwas nicht verstehen!«
»Was sprechen Sie denn da, Dreiband?« fragte Adelheid.
»Sitzen Sie gut, Fräuleinchen?«
»Ja, ja, aber was können Sie nicht verstehen?«
»Ich meine,« erwiderte Dreiband und sah dabei so offen aus, wie ein geöffnetes Stadtthor, »daß der Jungherrchen von so etwas erzählt.«
»Wie? Hat Heinz, hat mein Vetter Jemand von unserer Verlobung erzählt?«
»Nun, wissen Sie denn das nicht?«
»Nein, ich weiß von nichts,« erwiderte Adelheid bitter; »man hat mich eingepackt wie meine Koffer und fortgeschickt.« Sie weinte wieder.
»Du meine Güte,« rief Dreiband, »also wissen Sie gar nicht, wie Ihr Herr Onkel davon erfahren?«
»Ach, ich weiß nichts, erzählen Sie!«
»Der Jungherrchen hat es dem Fräulein Rechberg erzählt und diese hat es dem Herrn Rechberg mitgetheilt, und dieser ist natürlich gleich zu Ihrem Herrn Onkel gekommen und hat ihm Alles erzählt.«
»Hat Ihnen das mein Onkel gesagt?« fragte Adelheid heftig.
»Nun, natürlich.«
In Adelheid stieg ein grimmiger Haß gegen Lelia auf.
»Also daher kommt dieser Streich,« dachte sie und gelobte sich hoch und theuer, ihrerzeit Rache dafür zu nehmen. Jetzt war's ja heraus, sie hatte doch Recht gehabt, wenn sie Lelia für eine Scheinheilige gehalten. Adelheid war herzlich froh darüber, einen Grund zu haben, die Cousine zu hassen. Sie war auch froh darüber, daß Heinz von der Sache gesprochen, wenn sie ihm auch zürnte, daß er es gerade Lelia gegenüber gethan, aber sie sah doch daraus, daß er sich auch für gebunden hielt. Sie ahnte nicht, daß Herr Dreiband seine Darstellung des Sachverhalts eigens zu dem Zweck erfunden hatte, um sich bei ihr beliebt zu machen, da er richtig voraussetzte, daß es in Bezug auf seine Gratifikation keineswegs gleichgültig sei, wie er sich mit seiner Schutzbefohlenen stelle. Auf die Rechbergs war er ganz zufällig verfallen.
Eine Weile schwiegen Beide, dann sagte Adelheid zögernd: »Dreiband, würden Sie wohl die Freundlichkeit haben, einen Brief an meinen Vetter zu überbringen?«
»Natürlich, Fräuleinchen, natürlich,« war die Antwort. »Sie thun mir so leid, ich würde Ihnen Alles zu Liebe thun.«
Adelheid athmete auf. Sie hatte zwar jedenfalls an Heinz schreiben wollen, aber wenn der Brief durch die Post befördert wurde, konnte er doch nicht in fremde Hände kommen.
Auf der ersten Station, in der sie Nachtruhe hielten, schrieb Adelheid an Heinz. Sie schrieb ihm, daß er ihretwegen außer aller Sorge sein solle, sie würde ihm unter allen Umständen treu bleiben, bat ihn aber, nicht an sie zu schreiben, da seine Briefe doch jedenfalls aufgefangen werden würden. »Bleibe nur ruhig und kalt,« schloß sie, »wir Beide wollen uns schon finden und dann der Lelia eintränken, was sie uns angethan hat.«
Diesen Brief erhielt Dreiband, der ihn, sobald er auf der Rückreise im Wagen saß, aufbrach und mit vielem Vergnügen las. Dann zerriß er ihn in kleine Fetzen und gab ihn dem Winde preis. »Da kennst Du mich schlecht,« murmelte er, »wenn Du glaubst, daß ich Herren, die so anständig bezahlen, wie Dein Herr Papa und Dein Herr Onkel, hintergehen werde! Na, so blau!«
Heinz, der von Adelheids Schicksal noch nichts erfahren hatte, konnte den Schluß des Unterrichts kaum erwarten, um zu ihr zu eilen und ihr zu sagen, daß sie irre, wenn sie glaube mit ihm verlobt zu sein. Er war in hohem Grade unzufrieden mit sich und verwünschte sein träumerisches Wesen, das ihn verhindert hatte, gewahr zu werden, in welche schiefe Lage er sich gebracht. Tante Irene trat ihm entgegen.
»Es ist gut, Heinz, daß Du kommst,« sagte sie; »ich habe mit Dir ein paar Worte zu sprechen.«
Sie führte ihn hinauf in ein Nebenzimmer, schloß die Thür und sagte:
»Ich hätte Dich für vernünftiger gehalten, Heinz.«
»Was meinst Du, liebe Tante?«
»Ich hätte nicht geglaubt, daß Du so thöricht und unvernünftig sein könntest, Dich als Schüler zu verloben.«
»Hat Dir Adelheid gesagt, daß wir verlobt seien?« fragte Heinz.
»Ja, erwiderte die Tante, »sie selbst hat es uns gestanden.«
Heinz war in der peinlichsten Verlegenheit. Sollte er Adelheid jetzt so blosstellen, daß er sagte, sie habe sich geirrt? Auf der andern Seite mußte er ihr doch reinen Wein einschenken.
»Kann ich vielleicht Adelheid auf einen Augenblick sprechen?« fragte er.
»Nein,« erwiderte die Tante, sie ist nicht mehr hier, wir haben sie noch in dieser Nacht fortgeschickt.«
Heinz erbleichte. »Ihr habt sie doch nicht aus dem Hause getrieben!«, rief er, »das ist ja unmöglich!«
»Nein, das natürlich nicht; aber wir haben sie in einen Postwagen gesetzt und sie mit Dreiband nach Hause geschickt. Und nun, Heinz, verlange ich von Dir, daß Du mir Dein Wort giebst, wenigstens so lange Du noch hier bist, nicht an Adelheid zu schreiben. Ich thue das in ihrem und Deinem Interesse.«
Sie reichte ihm ihre Rechte und er schlug ein. Er konnte sich nicht entschließen, jetzt, da Adelheid abwesend war, hinter ihrem Rücken gleichsam, das Mißverständniß aufzuklären, aber er nahm sich vor, mit der nächsten Post an sie zu schreiben und die Angelegenheit zum Ende zu bringen.
»Du mußt mir noch einen Brief erlauben,« sagte er.
»Nein, Heinz, nicht einen einzigen, ich habe Dein Wort.«
»Ja, das bezieht sich auf eine förmliche Correspondenz, nicht auf den einen Brief. Den muß sie haben.«
»Du kannst ja Dein Wort brechen,« sagte die Tante unwillig und wandte sich ab.
»Liebe Tante,« sprach Heinz, der sich in der peinlichsten Lage befand, »sei überzeugt, daß ich diesen einen Brief durchaus schreiben muß. Ich bin das meiner Ehre schuldig.«
»Thu', was Du willst,« rief sie heftig und verließ das Zimmer. Heinz blieb in verzweifelter Stimmung zurück. Ihm blutete das Herz, wenn er an Adelheid dachte, die er doch immerhin lieb hatte und der er nun so schweres Herzeleid bereitet, und es kam seiner Eitelkeit schwer an, sich sagen zu müssen, daß er überaus thöricht und kindisch gehandelt. Was sollte er nun thun? Unschlüssig ging er im Zimmer auf und nieder, dann faßte er einen Entschluß und suchte die Tante auf.
»Komm' auf einen Augenblick mit mir in den Garten,« bat er, »ich muß mit Dir sprechen.«
Er sagte das sehr ernst, es schien ihm sehr schwer zu werden, die Worte auszusprechen. Die Tante erschrak bis in's innerste Herz.
»Komm!« sagte sie und ging mit raschen Schritten voran. Im Garten hielt sie still. »Was hast Du mir zu sagen?« fragte sie.
»Tante, ich habe sehr thöricht gehandelt.«
Tante Irene konnte kein Wort sprechen, sie nickte nur mit dem Kopfe.
»Ich habe sehr unbesonnen gehandelt, Tante,« fuhr Heinz fort, »und habe Adelheid gewissermaßen selbst dazu verleitet, sich für meine Braut zu halten; aber wir sind nicht verlobt und es wäre auch schändlich von mir, wenn ich mich mit ihr verlobt hätte, denn ich liebe sie nicht. Es thut mir sehr, sehr leid, daß ich Adelheid in diese peinliche Lage gebracht habe und es wird mir sehr schwer, das gleichsam hinter ihrem Rücken zu sagen, aber ich glaube, daß ich es der Wahrheit schuldig bin. Ich kann Dich versichern, daß ich heute zu Euch kam, um Adelheid selbst zu sagen, daß ich es nicht so gemeint habe.«
Die Tante athmete erleichtert auf, sie freute sich, daß Heinz sanftmüthig auftrat, so hatte sie ihn noch nie gesehen; aber ein paar harte Worte konnte sie sich dennoch nicht versagen.
»Du hättest Dir das früher überlegen sollen, Heinz,« sagte sie. »So hast Du immerhin uns Beide betrogen, Adelheid und mich.«
Die Tante hatte das nur noch so gesagt, damit er seine Schuld nicht so bald vergesse; aber die paar Worte genügten, in Heinz einen völligen Umschlag hervorzubringen.
»Wenn das Jemand betrügen heißt,« sagte er heftig, »daß man mit seiner Cousine, auf ihren Wunsch, ein paar Stunden zu Boot fährt, so habe ich allerdings betrogen; wenn aber ein einfältiges Mädchen und ihre Tante sich deshalb einbilden, daß man deshalb auch verlobt sein müsse, so weiß ich nicht, wie ich das nennen soll, Klugheit ist das gewiß nicht.«
Damit ließ Heinz die Tante stehen und verließ mit schnellen Schritten den Garten. In ihm ging es wild her. »Das kommt davon,« dachte er, »wenn ich demüthig bin und mir selbst die Schuld gebe. Da glaubt Jedermann auf mich loshacken zu dürfen.« Er redete so lange in sich hinein, bis er fest davon überzeugt war, Adelheid auch nicht die mindeste Veranlassung Zu dem Glauben, daß seine Neigung eine wärmere als die eines Vetters zur Cousine sei, gegeben zu haben. Hochmüthig und launenhaft wie er war, rief er sich nun Alles, was ihm irgend an Adelheid mißfallen hatte, in's Gedächtniß zurück und hatte schließlich die Genugthuung, fest davon überzeugt zu sein, daß Adelheid ihm ganz unnützer Weise diese Unannehmlichkeit zugezogen, und daß er allen Grund habe, sich über ihre plötzliche Entfernung zu freuen.