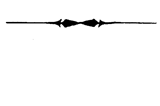|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Wir schweigen von dem Jammer der nächsten Tage. Heinrich Eichenstamm fand ein Begräbniß, so glänzend, wie er es sich nur je gedacht haben mochte. Das ganze Geschlecht und der größte Theil der Stadt begleiteten ihn zur letzten Ruhestätte. Sein jäher Tod hatte auch Manchen, der sich im Leben von ihm ferngehalten, mit ihm versöhnt. Man verglich jetzt den Zustand des Medicinalwesens, wie er es vorgefunden hatte, mit dem, in welchem er es hinterlassen; man rühmte sein Organisationstalent, seine Energie, seine Pflichttreue. Ein Zehntel der Anerkennung, die Heinrich Eichenstamm jetzt fand, hätte hingereicht, ihn bei seinen Lebzeiten weicher und besser zu machen, jetzt hatte sie nur die Wirkung, den Sohn, das ganze Geschlecht noch hochmüthiger zu machen, als sie es ohnehin schon waren.
Am selben Tage hatte man auch den Schwager begraben. Sein Tod erregte keinerlei Aufsehen, Niemand pries ihn, aber Mancher gedachte sein mit herzlicher Zuneigung.
In diesen Tagen hatte Heinz erkannt, wie sehr er doch den Vater geliebt, obgleich es ihm sonst nur zu oft geschienen hatte, als sei sein Herz ihm gegenüber kalt, und ohne die geringste Zuneigung. Jetzt, wo der Tod die Herzensthüren der Menschen aufgeschlossen hatte, da trugen die Verwandten mancherlei Zeugniß herbei, mündliches und schriftliches, wie sehr auch der Vater Heinz geliebt, wie er grundsätzlich hart gewesen war gegen den Sohn, und wie sehr ihm dessen Wesen wehe gethan hatte. Hätte Heinz bei des Vaters Lebzeiten auch nur ein Zehntel dieser Liebesbeweise in Händen gehabt – das Leben im Vaterhause hätte sich anders gestaltet.
Heinz wurde für einige Zeit gewissermaßen der Held des Tages. Als Waise bemitleidet, wurde er doch auch zugleich um seines, bei dem Brande bewiesenen Muthes und seiner Geistesgegenwart willen allerorten gepriesen.
Bei Rechbergs war, gleich nach dem Tode des Notars, dessen Bruder, ein Prediger, mit einem sehr sanften, guten Gesicht und so rosenrothen Wangen, wie sie nur bei lettischer Herkunft oder bei Schwindsucht möglich sind, eingetroffen, um seinen Vater und seine Nichte mit sich aufs Land zu nehmen. Sie sollten künftig ganz bei ihm leben.
Wenige Tage nach der Beerdigung kamen dann auch die Fuhren, um die Habe aus der Stadt auf's Land zu schaffen, und der Großvater ging mit Lelia und Heinz, der zu ihnen gekommen war, zum letzten Male durch das Haus, den Hof und das Gärtchen, in denen sie eine Reihe glücklicher Jahre verlebt hatten.
Auf dem Hofe gluckten die Tauben und Hühner, die mitgenommen wurden, bereits in großen Körben, während die Thüren des Taubenschlages und des Hühnerstalles weit geöffnet standen; zerbrochenes Geschirr, alte Kisten und Kasten bedeckten den sonst so reinlichen Hof. Im Hause sahen die leeren Zimmer wüst und öde aus, die Wände ohne Bilder, rings auf dem Fußboden Papierfetzen und Strohhaufen. Nur in dem Garten bemerkte man nichts von der Verwüstung. Bei dem frühen, warmen Frühjahre blühte der Flieder bereits, knospeten die Rosen, und nur nach der Kanalseite hin ließen die Bäume traurig die vom Feuer versengten Zweige hängen, durch die hindurch man die Trümmer des Eichenstamm'schen Hauses gewahrte. Noch stand dort unter der Linde die Bank, auf der der Notar so gern gesessen hatte. Dorthin setzten sich noch einmal die Drei. »Ob wir wohl einmal hierher zurückkehren werden?« dachte Lelia unwillkürlich laut.
»Es ist nicht wahrscheinlich,« erwiderte der Großvater, »indessen für Dich ist es immerhin noch möglich!«
»Ach, es ist so schwer, fortzugehen!« seufzte Lelia.
»Da empfinde ich anders,« nahm Heinz das Wort, »mir brennt hier der Boden unter den Füßen. Ich will fort, fort in die weite Welt.«
»Warum das, Heinz?« fragte Lelia.
»Aus tausend Gründen!« rief Heinz bitter. »Ist doch alles rings um mich her fort, was ich liebte, was soll ich hier?«
Lelia blickte ihn erstaunt an. Wie Vieles war ihr doch an dem Vetter unverständlich! Hatte er je, so lange der Vater lebte, anders als mit Abneigung, ja wohl gar mit Widerwillen von ihm gesprochen, und nun erschien ihm doch Alles öde und leer, weil der Vater gestorben war.
Der Großvater dachte ähnlich, und da er sich, wie es ihm schien, zu Heinzens Ungunsten über denselben getäuscht hatte, so ergriff er jetzt dessen Hand und sagte, indem er sie drückte, warm: »Es mag Dir sonderbar klingen, Heinz, aber es freut mich für Dich, daß Du den Tod des Vaters so schmerzlich empfindest.«
Heinz errieth sehr wohl, was der Alte meinte.
»Ihr mögt mich für herzloser gehalten haben, als ich bin, aber ich bin Euch die Erklärung schuldig, daß es nicht der Tod des Vaters allein ist, der mich aus der Heimath treibt. Ja, so wie ich meinen Vater kannte, kann ich seinen jähen Tod kaum bedauern, denn sein ganzes Herz hing an dem, was er in seinem arbeitvollen Leben erworben hatte. Er hätte den plötzlichen Untergang desselben doch schwerlich lange überlebt. Ich freilich muß es tief bedauern, daß gerade jetzt, wo unser Verhältniß anfing, sich besser zu gestalten, der Tod es zerschnitt. Ich werde es ewig beklagen, daß mir die Briefe, die er an den Parkhöf'schen Pastor geschrieben hat, und aus denen ich durch die oft rauhen Worte eine Fülle von Liebe zu mir herauslese, nicht früher zugänglich waren, als nach seinem Tode. Mußte ich doch nach seiner kalten, oft so harten Weise glauben, daß ich seinem Herzen vollkommen fern stand. Aber, wie gesagt, sein Tod ist's nicht allein, was mich fort treibt.«
»Was ist's denn?« fragte Lelia unwillkürlich, wenn es ihr auch in demselben Augenblicke, sie wußte nicht warum, unangenehm war, gefragt zu haben.
»Weißt Du das wirklich nicht?« fragte Heinz mit gepreßter Stimme und begleitete seine Worte mit einem Blicke, der wie ein plötzlicher Blitzstrahl für Lelia auf einen Augenblick alles erhellte und ihr zeigte, was die Ursache von Heinzens oft so räthselhaftem Benehmen gegen sie gewesen war. Von der neuen, unerwarteten Erkenntniß verwirrt, erröthete sie tief. Heinz, der thöricht genug war, dies Erröthen mißzuverstehen, war heftig aufgesprungen. »Geh' auf ein paar Augenblicke bei Seite,« bat er den Großvater; aber Lelia, die bei dem Anblicke seines entstellten Gesichts von der alten, jähen Furcht vor ihm ergriffen war, klammerte sich an den Arm des Großvaters und rief, obgleich sie selbst fühlte, wie albern sie handelte: »Geh' nicht, geh' nicht, laß ihn nicht zu mir.« Wohl wollte sie unmittelbar darauf dem rasch davoneilenden Heinz folgen und sich ihm gegenüber entschuldigen, aber der Schreck hatte ihre Glieder gelähmt, sie mußte sitzen bleiben. Einige Tage darauf erhielt Heinz folgenden Brief von ihr:
Lieber Vetter!
Meine alberne Furchtsamkeit von neulich thut mir sehr leid, entschuldige sie dadurch, daß ich in allen Dingen ein Hase bin. Ich schreibe Dir das, weil ich weiß, daß ich Dir wehe gethan habe, was ich gewiß nie wollte. Mit der Liebe einer Cousine und Spielkameradin bleibe ich, in der Hoffnung auf baldiges Wiedersehen
Deine
Lelia.
Als Heinz dieses Schreiben erhielt, hatte er bereits wichtige, über seine ganze Zukunft entscheidende Entschlüsse gefaßt. War auch der größere Theil des väterlichen Vermögens durch das Gut, dann durch die Seuche, zuletzt durch den Brand des Hauses verloren, so waren doch noch gegen 20 000 Rubel gerettet, eine Summe, die Heinz außerordentlich groß erschien. Durch die Ereignisse der letzten Woche mehr noch als früher der Schulwelt entrückt, war es ihm ganz unerträglich, jetzt wieder zu den Büchern zu greifen und für's Examen zu arbeiten. Seiner leidenschaftlichen Natur nach war er ganz außer Stande, die vielfach unerquicklichen Verhältnisse, in die er gerathen, allmählich abzuwickeln, statt den Knoten zu zerhauen, indem er jetzt schon in die Fremde ging. Mit dem ersten deutschen Grenzpfosten hoffte er Ruhe und Besinnung wieder zu finden, und er war viel zu hochmüthig, um nicht zu glauben, daß es ein unbilliges, wenn nicht gar lächerliches Verlangen sei, an seinen Lebensweg dieselben Anforderungen zu stellen, wie an den jedes andern Menschen.
So beschloß er denn, ohne sein Abiturientenexamen gemacht zu haben, ins Ausland zu gehen und dort zu studiren. Als er seinen Entschluß den Verwandten mittheilte, entstand freilich ein großer Sturm. Die Eichenstamms waren sehr stolz darauf, daß es unter ihnen fast nie vorgekommen war, daß ein Mitglied der Familie von dem hergebrachten, regelmäßigen Wege, der zum einheimischen Literatenthume führte, abgewichen, und statt durch die Thür durch Ueberklettern des Zaunes in die Hürde gekommen war, so daß sie sich nur schwer in den Gedanken zu finden vermochten, daß Heinz seine eigenen Wege, Wege, auf denen so Mancher schon verirrt und verkommen war, gehen wollte. Es war übrigens durchaus nicht Familienhochmuth allein, was sie dazu trieb, alle Beredtsamkeit aufzubieten, um Heinzens Entschluß rückgängig zu machen. Meist hatten sie ihn, trotz seines schroffen Wesens, lieb, und hofften Großes von ihm; nun glaubten sie zu sehen, wie er sich den Weg zum Vorwärtskommen selbst versperrte. Frau Irene führte alle die Gründe von neulich, nur in verstärktem Maße, in's Feuer. Von den Onkeln ging Heinzens Entschluß Onkel Konrad am meisten zu Herzen. »Du bist im Begriffe, einen überaus thörichten, verhängnißvollen Schritt zu thun,« sagte er. »Ich kann mir denken, daß ein Preuße in Heidelberg oder ein Badenser in Halle mit ganz demselben Erfolge studirt, wie wenn er eine einheimische Universität besucht; bei uns aber liegen die Verhältnisse ganz anders. Wer bei uns nach allen Richtungen frei und unbehindert fortkommen will, muß nicht nur in der Wissenschaft tüchtig sein, sondern er muß auch die einheimische Sprache beherrschen, und je bedeutender er ist, je mehr er sich nicht mit der handwerksmäßig betriebenen Praxis begnügen will, um so mehr bedarf er ihrer. Aber auch abgesehen davon werden einem jeden Gebildeten, der bei uns lebt und nicht auf der Landesuniversität studirt hat, sein Lebtag die Schlüssel zu Manchem in unserem Leben fehlen. Auch ich halte den Geist, der wenigstens meinerzeit auf unserer Hochschule herrschte, keineswegs für einen besonders guten; ich erinnere mich sehr wohl, daß das Laster des Schlemmens, daß Verschwendung, Kleinlichkeit und selbstzufriedener Dünkel dort mehr als gut im Schwange gingen, und ich glaube nicht, daß sich das mittlerweile sehr geändert haben wird, andererseits aber drücken sich doch auch wieder dort, wo unsere Jugend von allen Seiten her zusammenströmt, die guten und edlen Sitten unseres Wesens: das lebhafte, feine Ehrgefühl, das Gefühl für treue Freundschaft, der Familiensinn, die Pflichttreue lebhaft aus und befestigen sich in den Herzen. Du wirst es vielleicht lächerlich finden, daß ich das hervorhebe, als ob man sich das Alles nicht auch auf jeder beliebigen anderen deutschen Hochschule aneignen könnte. So meine ich das auch nicht, aber Du wirst mir zugeben müssen, daß es doch ein Unterschied ist, ob ich meine Jugend, die schönsten Lehrjahre meines Lebens in einem Kreise, von dem ich im späteren Leben durch weite Entfernung räumlich und darum auch in einigen Jahren geistig getrennt werde, verbringe, oder ob ich zusammen mit allen meinen Commilitonen nachher in's Leben trete und mit und unter ihnen wirke. Ich will Dir auch noch zugeben, daß dieser Umstand seine großen Schattenseiten hat, daß durch ihn Universitätscliquen oft genug störend und einengend in's bürgerliche Leben eingreifen; daß es viel wünschenswerther wäre, wenn auch bei uns, wie in Deutschland in jeder, auch der kleinsten Stadt, Leute lebten, die auf verschiedenen Hochschulen studirt haben, – aber das läßt sich nun eben nicht ändern. So aber, wie die Dinge einmal liegen, wirst Du Dir, wenn Du einst aus Deutschland zurückkehrst, bald genug in der eigenen Heimath wie ein Fremder vorkommen, und wenn ich auch keineswegs in Abrede stellen will, daß es Dir durch tüchtige Leistungen gelingen kann, Dir wieder in der Heimath das gesellschaftliche Bürgerrecht zu erwerben, so wird es doch immer angestrengter Arbeit bedürfen, um das zu erringen, was ein ganz gewöhnlicher, anständiger Junge, der auf unserer Landesuniversität studirt hat, von vornherein besitzt.«
»Wie kann mir je an irgend etwas gelegen sein, das ein ganz gewöhnlicher, anständiger Junge so ohne Weiteres besitzen kann,« sagte Heinz spöttisch.
»O ja, mein lieber Heinz, wenn das, was ein solcher Junge besitzt, Liebe und Freundschaft ist, so ganz gewöhnliche Schul- und Universitätsfreundschaft, so kann mancher sehr geistreiche und hochgelehrte Herr solch einen Jungen mitunter von ganzem Herzen beneiden. Außerdem ist Mancher auch nicht so klug, wie er sich einbildet.«
»Ja,« sagte Heinz, »mancher Andere wieder, der nie aus seinem Wiedehopfnest herausgekommen ist, glaubt natürlich, die ganze Welt rieche nach Wiedehopfen.«
Damit war denn das Gespräch wieder im Eichenstamm'schen Gleise, Onkel und Neffe wurden heftig gegen einander und trennten sich im größten Zorne.
Heinz blieb allen Abreden der Verwandten gegenüber fest. Er bewog den Onkel Konrad dazu, die Verwaltung seines kleinen Vermögens zu übernehmen, sorgte dafür, daß Tante Agathe ein Unterkommen fand, und daß die Dienstboten seines Vaters in der Familie gute Stellen erhielten; dann verabschiedete er sich von Horace mit dem Versprechen, im nächsten Jahre auf einer süddeutschen Universität mit ihm zusammenzutreffen, und sagte Karlchen Maier und den anderen Freunden herzliches Lebewohl. So fuhr er eines Tages, ohne Lelia wiedergesehen zu haben, an den Ruinen des Vaterhauses vorüber, der Fremde zu.