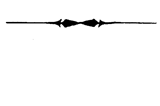|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Der Doctor fieberte am folgenden Tage und mußte auf Anordnung des herbeigerufenen Onkels Konrad das Bett hüten. Die weiche Stimmung vom gestrigen Abend hatte ihn völlig verlassen; er war wieder ganz in Eichenstamm'scher Laune. Obgleich selbst Arzt, war er doch der ungeduldigste Patient, der sich denken läßt, was sich nicht nur durch sein Temperament, sondern auch durch den Umstand erklärte, daß er fast nie krank oder auch nur unwohl gewesen war. Heinz hatte sich dem Vater zur Verfügung gestellt, seine Hülfe war aber, wenn auch in freundlicher Weise, zurückgewiesen worden, und Tante Agathe nebst Weinthal hatten die Aufgabe, den unruhigen Kranken zu pflegen. Heinz bedauerte des Vaters Unwohlsein umsomehr, als am Morgen Lelia die Nachricht brachte, daß ihr Vater in der Nacht heftig erkrankt sei. Sie war, nachdem ihr der Bescheid geworden, daß der Doctor selbst krank darniederliege, sogleich zu Onkel Konrad geeilt, und von diesem erfuhr nun Heinz, daß Rechberg aller Wahrscheinlichkeit nach den Scharlach habe, der augenblicklich epidemisch sei und meist überaus bösartig verlaufe.
»Du darfst auf keinen Fall hingehen, Heinz,« hatte der Onkel gesagt, aber kaum war er fort, so überschritt Heinz auch bereits den Kanal. Wenn er gewußt hätte, daß er sich dadurch einem gewissen, qualvollen Tode aussetzte, so hätte er deshalb doch keinen Augenblick gezögert.
»Vor allen Dingen muß Lelia entfernt werden,« murmelte er, indem er rasch über den Hof schritt.
Als er das Krankenzimmer betreten, währte es eine Weile, bis er sich an die in demselben herrschende Dunkelheit gewöhnte und Lelia und den Großvater, die am Bette des schwer stöhnenden Kranken saßen, gewahr wurde. Er winkte Lelia, ihm zu folgen, und als sie Beide das Zimmer verlassen hatten, ergriff er ihre Hand und rief eifrig:
»Du darfst durchaus nicht wieder hineingehen, Lelia! Dein Vater hat den Scharlach und Du hast diese Krankheit noch nicht gehabt. Dein Großvater und ich werden den Kranken besser pflegen, als Du es vermöchtest.«
»Du kannst doch unmöglich erwarten, Heinz,« erwiderte Lelia, »daß ich aus Furcht vor Ansteckung es unterlassen sollte, meinen kranken Vater zu pflegen?«
»Gewiß, Lelia, gewiß erwarte ich das. Du darfst ihn nicht pflegen, denn Du bist selbst nicht geschützt.«
»Aber Du ja doch auch nicht.«
»Was liegt an mir!«
Lelia betrachtete mit Verwunderung sein leidenschaftlich erregtes Gesicht. Der Gedanke, an Lelia's Statt gewissermaßen für sie zu leiden oder zu sterben, hatte für ihn nicht nur nichts Schreckliches, sondern war ihm wunderbar schön.
»Ich danke Dir, lieber Heinz,« sagte sie herzlich, »aber ich kann Dein freundliches Anerbieten nicht annehmen.« Damit wandte sie sich ab und wollte sich wieder zum Vater begeben, Heinz aber vertrat ihr den Weg.
»Du wirst nicht wieder zum Kranken zurückkehren,« sagte er mit fester Stimme, und als sie mit einer schnellen Bewegung an ihm vorüber huschen wollte, umfing er sie mit beiden Armen, trug sie ein paar Schritte zurück und ließ sie dann, ohne ein Wort zu sagen, wieder frei.
In Lelia kämpften Entrüstung über Heinzens gewaltthätiges und eigenwilliges Verfahren mit dem Bewußtsein, daß er es ja allerdings gut meinte und mit der Sorge um den Vater.
Die Entrüstung siegte. »Laß mich auf der Stelle gehen!« rief sie erzürnt, aber Heinz vertrat ihr nun erst recht den Weg.
»Du darfst nicht krank werden!« sagte er.
»Was geht Dich meine Krankheit an!« rief sie heftig. »Laß mich, Heinz, hörst Du; Du treibst mich dazu, nach Hülfe zu rufen! Laß mich, ich will zu meinem kranken Vater! Was geht es Dich an, ob ich krank werde oder nicht?«
Sie suchte unterdessen auf jede Weise an ihm vorüber zu kommen, aber er hielt sie schweigend zurück.
»Heinz, das ist nichtswürdig von Dir, das ist feig,« rief sie, in Thränen ausbrechend; »Du mißbrauchst Deine Kraft einem wehrlosen Mädchen gegenüber.«
»Du darfst nicht krank werden,« wiederholte er in einem Tone, der soviel hieß: »Und wenn ich Dich erschlagen müßte, aber krank werden darfst Du nicht.«
»Liebster Heinz,« bat Lelia nun, »bitte, bitte, laß mich zum Vater! Ich weiß ja, Du meinst es gut, aber ich würde vor Angst sterben, wenn ich nicht bei ihm wäre.«
Heinz schüttelte den Kopf. »Ich werde Dir, so oft Du willst, jede Auskunft ertheilen,« sagte er, »aber hinein sollst Du nicht und wenn die ganze Stadt Dir helfen würde!«
Lelia ging in größter Aufregung im Zimmer auf und nieder. Was sollte sie thun? Sie wußte, daß Heinz eigensinnig genug war, seinen Willen auch dem Großvater gegenüber geltend zu machen, und doch mußte sie zum Vater. Endlich war ihr Entschluß gefaßt. Sie eilte in's Vorhaus und Heinz sah mit Verwunderung, daß sie ihren Hut ergriff.
»Wo willst Du hin?« fragte er.
»Zu Onkel Konrad, zu Tante Irene. Die sollen mich von Dir befreien,« erwiderte sie schluchzend und verließ das Haus.
Heinz sah ihr lächelnd nach. »Du sollst nicht krank werden!« sagte er halblaut und kehrte in's Krankenzimmer zurück, dessen Thür er hinter sich verschloß und den Schlüssel in die Tasche steckte. Dem Großvater, der sein Gebahren mit Verwunderung angesehen hatte, erzählte er darauf mit leiser, flüsternder Stimme, was er gethan hatte, und daß er fest entschlossen sei, seinen Willen durchzusetzen. Der alte Mann erkannte sogleich, daß hier mit Zureden Nichts zu machen war und daß es kein anderes Mittel gab, den übereifrigen jungen Freund zum Nachgeben zu bringen, als ihm Zeit zum Nachdenken über das Gewaltsame seines Handelns zu lassen. Was ihn aber viel mehr beunruhigte, war, daß er aus Heinzens Verfahren die unumstößliche Gewißheit erhielt, daß derselbe seine Enkelin liebe, ein Umstand, der ihn mit großer Sorge erfüllte, denn wie gern er auch Heinz hatte, so erschien ihm dessen Charakter doch keineswegs geeignet, Lelia glücklich zu machen, selbst wenn sie späterhin andere als verwandtschaftliche Gefühle für ihn hegen sollte. Im entgegengesetzten Falle aber sah er voraus, daß Heinz nicht der Mann war, das geliebte Mädchen ohne Kampf die Braut eines Andern werden zu lassen.
Als Lelia nach einer halben Stunde mit Tante Irene und Onkel Konrad zurückkehrte und man die Thür verschlossen fand, wurde zunächst Kriegsrath gehalten. Tante Irene, bis in's innerste Herz über das eigenmächtige Verfahren des Neffen erzürnt, war dafür, einen Schlosser kommen und die Thür aufbrechen zu lassen.
»Wenn wir dem tollen Jungen solche Dinge durchlassen,« rief sie, »so wird er uns gelegentlich einmal das Haus über dem Kopfe anzünden. Wir sind es sowohl dem armen Kinde hier (dabei wies sie auf Lelia) als auch Heinz selbst schuldig, daß wir alle Energie anwenden, seinen Trotz zu brechen.«
Der Doctor Konrad, der ohnehin geneigt war, Heinzens in der Familie keineswegs unerhörtes Betragen von der humoristischen Seite aufzufassen, wendete dagegen ein, daß man doch unmöglich aus pädagogischen Rücksichten möglicherweise den Tod des Kranken herbeiführen könne, und redete Lelia zu, nachzugeben. Diese, der es einzig und allein darauf ankam, zum Vater zu gelangen und die von der größten Angst ergriffen war, ihr Vater könne sie unterdessen vermissen oder gar sterben, klopfte leise an die Thür und als des Großvaters Stimme fragte, wer da sei, bat sie flehentlich um Einlaß.
Der Großvater wandte sich nun an Heinz mit der Bitte um den Schlüssel, indem er ihm versprach, Lelia unter keiner Bedingung hereinzulassen, und er erhielt ihn darauf wirklich. Draußen gelang es ihm nicht ohne Mühe, von Lelia und den Uebrigen zu erlangen, daß sie ihm bis zum Abend Zeit ließen, Heinz zu erweichen, worauf er in's Krankenzimmer zurückkehrte und schweigend seinen Platz wieder einnahm.
Der Notar war sehr krank. Er lag, ohne irre zu reden, fast regungslos im Halbschlafe und griff nur von Zeit zu Zeit mit der Hand mechanisch nach dem Halse. Stundenlang saßen die beiden Pfleger schweigend nebeneinander. Dann ging der Greis ein wenig hinaus, tröstete Lelia soviel er konnte und brachte frisches Wasser hinein, mit dem sie den Kranken wuschen. Nachdem sie wieder ihre Plätze eingenommen hatten, sagte der Großvater:
»Arme Lelia!«
»Fürchtest Du, daß der Onkel sterben könnte?« fragte Heinz ängstlich.
»Ich fürchte es!« war die Antwort. »Joseph war nie kräftig; ich glaube nicht, daß er die Krankheit übersteht.«
»Großvater, thun wir nicht Unrecht, wenn wir Lelia herein lassen?«
»Gewiß nicht, Heinz. Selbst wenn wir wüßten, daß sie mit ihm sterben müßte, dürften wir sie nicht fernhalten.«
»Sie darf nicht sterben!« rief Heinz aufspringend und faßte den Großvater an die Brust, als wäre er der Tod.
Der Alte hatte Mühe, ihn zu beruhigen. Bei jungen Leuten sei der Scharlach meist nicht gefährlich, sagte er und betonte, wie sehr Lelia gegenwärtig leiden müsse.
Heinz öffnete die Thür, aber Lelia war nicht da. Er fand sie endlich in einem andern Zimmer auf den Knieen liegend.
»Verzeih' mir, liebe Lelia,« sagte er, »es mag Unrecht gewesen sein, Dich zurückzuhalten, aber ich konnte mich nicht überwinden.« Er reichte ihr die Hand, aber sie nahm die Hand nicht an, sondern eilte an ihm vorüber zum Vater.
Er folgte ihr und alle Drei saßen nun in dem dunklen Zimmer nebeneinander. Heinz verwandte kein Auge von Lelia, deren Gestalt sich nur wenig von dem dunkeln Hintergrunde abhob.
Am Abend wurde Heinz von Weinthal abgeholt. Der Vater habe nach ihm verlangt, hieß es.
Als er aufbrach, reichte er abermals Lelia die Hand und sie gab ihm die ihrige.
»Bist Du mir böse?« fragte er leise.
»Nein,« antwortete sie ebenso.
Sie meinte das ganz ehrlich; sie hatte die Erbitterung gegen ihn niedergekämpft und sein ungeberdiges Betragen durch sein Temperament und den guten Willen, der daraus sprach, entschuldigt, aber ihm erschien es wie Ironie. »Nein,« dachte er, »das heißt so viel wie: Unter der Bedingung, daß Du mich in Ruhe läßt, will ich sagen, was Du willst.« Er war von seiner Leidenschaft so beherrscht, daß er weder seines noch ihres Vaters Krankheit empfand.
»Wo warst Du, Heinz?« fragte der Doctor, als der Sohn in sein Zimmer trat.
Heinz erzählte, wo er gewesen war; der Vater schalt ihn heftig.
»Der Scharlach ist zwar eine Kinderkrankheit, aber kein Kinderspiel, zumal in diesem Jahre nicht, wo er sehr gefährlich auftritt. Nach dem, was mir Konrad erzählt, wird mein Schwager daran glauben müssen. Nun, viel verloren ist an dem Manne nicht. Er war immer ein Kind, so wird er auch an einer Kinderkrankheit sterben.«
Der gleichgültige, wegwerfende Ton, in dem der Doctor von Lelia's Vater sprach, empörte Heinz.
»Ich denke darüber anders,« sagte er scharf, »und ich werde meinen Onkel pflegen, auch auf die Gefahr hin, Deinem Willen entgegen handeln zu müssen.«
»Thu', was Du willst,« erwiderte der Doctor und wandte ihm den Rücken zu.
»Kann ich Dir vielleicht in anderer Beziehung einen Wunsch erfüllen?« fragte Heinz. »Du hast mich rufen lassen.«
Er erhielt keine Antwort. Er wartete eine Weile und wiederholte die Frage. Als auch diese ohne Antwort blieb und der Vater seine Gegenwart ganz zu ignoriren schien, verließ er das Zimmer und kehrte zu den Rechbergs zurück. Er fragte sich nicht, ob er ein Recht gehabt, so zu antworten; ihm war es unmöglich gewesen, in dieser Zeit so geringschätzend über Lelia's Vater reden zu hören. Daß der Vater von diesem Thema so bald nicht abgekommen wäre, wußte er.
Bei Rechbergs fand er Onkel Konrad. Er fragte ihn beim Weggehen, ob Grund zur Besorgniß vorhanden sei, und erhielt die Antwort, daß, aller menschlichen Voraussicht nach, der Notar die Nacht nicht überleben würde. Der Scharlach werde sich vermutlich auf's Gehirn werfen und einen Schlagfluß herbeiführen.
»Sei verständig, Heinz,« fügte der Onkel hinzu, »und plage das arme Mädchen jetzt nicht mit Deinen Liebesgeschichten.«
»Ich wüßte nicht, daß ich Dich um Rath gefragt hätte,« erwiderte Heinz trotzig.
Dem Onkel stieg das Blut zu Kopfe; er wollte ebenso antworten, beherrschte sich aber und ging. Heinz sah aus seinen Worten, daß der Onkel um seine Liebe wußte und bereute sein leidenschaftliches Verfahren vom Morgen nur noch mehr. Still und gedrückt trat er in's Krankenzimmer. Er wußte, daß er dort weder erwünscht, noch nöthig war, trotzdem konnte er jetzt nirgend anders sein, als an Lelia's Seite. Er hätte ihr gern noch einmal gesagt, wie leid ihm seine Heftigkeit thue, er fühlte aber, daß jetzt nicht die Zeit dazu war. Der Kranke redete irre, aber selbst in seinen Phantasien verleugnete er die gewohnte Sanftmuth nicht. Sein Lieblingsschriftsteller war Stifter; jetzt glaubte er der Pfarrer in Kars zu sein. So vergingen Stunden, so kam die Nacht.
Drüben, auf der andern Seite des Kanals, lag auch der Doctor noch wach. Er warf sich unruhig in seinem Bette hin und her. Die Sorge ließ ihn nicht schlafen. Er war am gestrigen Tage eben im Begriffe gewesen, zum Agenten zu fahren, um die abgelaufene Versicherung seines Hauses zu erneuern, als ihn die Schreckensbotschaft aus Waldhof abrief. So war sein Haus augenblicklich unversichert. Er hatte Heinz rufen lassen, um diesen mit der Versicherung zu beauftragen, hatte aber, geärgert durch dessen Ungehorsam, ihm keinen Auftrag ertheilen wollen und ihn so fortgehen lassen. Jetzt fiel ihm das auf die Seele. Er war nicht abergläubisch und lachte über Ahnungen und Träume, aber trotzdem hatte er heute das Gefühl, als müßte jeden Augenblick die Flamme zum Dache hinausschlagen. »Das kommt von dem abscheulichen Fieber,« rief er ärgerlich, »da kommt man sogar auf solche Narrheiten!« Trotzdem schickte er Weinthal unter allerlei Vorwänden von Zeit zu Zeit auf den Hof, so daß dieser nicht wußte, was er von seinem Herrn denken sollte. Dann wandten sich die Gedanken des Doctors auf den Sohn, für den er so lange gespart hatte und der das nun so gar nicht zu schätzen wußte, der sich so gar nichts aus dem Vater machte, daß er nicht einmal in der Krankheit bei ihm blieb. »Was liebt der Junge an dem Joseph Rechberg, dem Blumenmenschen, dem Lappen? Was zog ihn dahin? War es das dumme, sentimentale Ding, die Lelia? Aber das ist ja nach Irenens Bericht ganz unmöglich. Darnach liebt er ja die Adelheid, und das ist doch auch einzig und allein begreiflich, denn solch eine zimperliche Person wie Lelia kann unsereinem doch nicht gefährlich werden. Unsereinem? Ist denn der Junge von meinem Schlage? Ja, denn er ist energisch, fleißig, wahr und trotzig. – Nein, denn er hat keinen Ehrgeiz, kein Verständniß für die Freude des Herrschens, keines für das Besitzen. Aber das findet sich schon! Er ist doch von meinem Schlage und wird schon noch höher hinauf wollen. Ich habe soeben einen großen Verlust erlitten, es ist wahr, aber der Junge erhält doch einmal ein reiches Erbe. Aber wie, wenn es jetzt brennt? Thorheit! Warum wird es gerade heute brennen!«
Der Doctor schickte abermals hinaus, um nachsehen zu lassen, ob nicht wieder Rechberg'sche Tauben auf dem Dache des Nebengebäudes säßen. Er wolle das nicht länger dulden, sagte er. Weinthal wendete ein, daß ja Nachts die Tauben im Taubenschlage seien, aber der Doctor fuhr ihn rauh an: »Nicht raisonnirt! Gehorcht und geschwiegen! Wohin ich Dich schicke, hast Du zu gehen!« Und Weinthal ging schweigend hinaus.
Dort bei Rechbergs fragte Lelia den Großvater, ob er wohl glaube, daß der Vater sterben werde.
»Das steht bei Gott,« sagte der Alte. »Ist es des Allmächtigen Wille, so wird er ihn zu sich nehmen und wir werden dem Allgütigen Dank sagen auch für das Schwere, das er uns schickt.«
»Ach, Großvater, Großvater!«
Der Großvater faßt Lelia's rechte Hand und Heinz unwillkürlich ihre linke, die sie ihm auch ruhig läßt. Sie denkt nicht an ihn.
»Weine nur, mein Kind,« sagte der Großvater, »weine nur. Thränen erleichtern das beschwerte Herz und machen es ihm möglich, sich ergeben, ja freudig unter Gottes Willen zu beugen. Der Tod ist nur den Schlechten schrecklich und den Gottlosen. Uns Christen darf der Tod unserer Lieben nicht niederdrücken. Diese Erde ist doch nur eine öde Atmatte, ein leeres unfruchtbares Sandfeld, durch das wir armen Schäflein hungernd umherirren; sollen wir uns nicht freuen, die Unserigen auf blumenreichen Wiesen zu wissen? Der Vater war immer ein braver Mensch, ein liebender Gatte, ein guter Vater und Sohn; Gott wird ihm in der Schaar seiner Diener schon einen Platz anzuweisen wissen, an dem er ihn brauchen, wo er, sicher vor jeder Unbill und allen Beschwerden, uns erwarten kann. Wenn der Pflug über das Feld geht, mag es der Mutter Erde auch weh' thun, und doch würde sie ohne diese Schmerzen nur Disteln und Dornen tragen. So wird auch des Menschen Herz durch Trübsal und Kummer vom Unkraute gereinigt.«
So sprach der Alte und die Beiden lauschten seinen leise geflüsterten Worten, wie sie ihnen sonst gelauscht hatten, da sie noch als kleine Kinder neben ihm saßen und den Sinn seiner Worte nur ahnten und als er nun leise, leise das: »Wer nur den lieben Gott läßt walten« anstimmte und sie Beide einfielen und mitsangen, da war es Heinz, als wäre er nie älter geworden, nie fort gewesen, als müsse er so ewig bei diesen Beiden bleiben, als gäbe es weder Vergangenheit noch Zukunft, nur Gegenwart, herzerfüllende, die Seele erquickende Gegenwart.
Der Kranke richtete sich, als er die ihm so lieben Töne hörte, langsam auf und winkte ihnen mit dem Haupte, sie sollten fortfahren. Als der letzte Vers verklungen war, sank er zurück – mit einem leisen Röcheln war seine unschuldige Seele ihrer irdischen Hülle entflohen.
Bitterlich weinte Lelia am Sterbebette des Vaters, während große Thränen auch über das Antlitz des Großvaters langsam hinabrollten und Heinz das Gesicht mit den Händen verhüllte, die Thränen zu verbergen. Freilich galten sie weniger dem Todten, dessen Wesen ihm immer ein fremdes gewesen war, als dem Kummer der Tochter. Er erhob sich leise, entfernte die Tücher und Vorhänge, mit denen man die Fenster verhängt hatte und ließ den Mondschein in's Zimmer fallen.
Als er das Rouleau heraufgezogen hatte, blieb er entsetzt stehen: dort, aus dem Dache des väterlichen Nebengebäudes, züngelte eine kleine Flamme, nicht größer als eine Taube, empor. Auch Weinthal sah sie von der andern Seite.
»Feuer, Feuer!« rief Heinz unwillkürlich so laut er konnte, indem er aus dem Fenster in den Hof sprang und dem brennenden Gebäude zueilte.
»Feuer, Feuer!« gellte auch Weinthals entsetzter Ruf durch die stille Nacht.
In wenigen Augenblicken war auch der Doctor, halb bekleidet, auf dem Hofe, den auch der Sohn eben erreichte.
»Ein Beil her, ein Beil!« schrie der Doctor und beide stürzten in den Holzstall, in dem ein paar Aexte zum Holzspalten hingen. Im Augenblicke hatten sie dieselben, trotz des ungewissen Mondlichts, gefunden und eilten nun die Treppe hinauf auf die Gallerie, von dort die Bodentreppe hinan, dem Herde des Feuers zu. Ein paar gewaltige Hiebe und die verschlossene Bodenthür stürzt krachend ein.
Die vordere Hälfte des Bodens ist noch frei von Rauch, der aber in dichten Massen durch die Scherwand, die den Boden theilt, hindurchdringt. Dort auf der andern Seite findet das Feuer an Heu und Stroh reichliche Nahrung. Hier gilt es vor Allem, Luft zu schaffen – mit mächtigen Schlägen donnern die Beiden gegen die langsam weichenden Bohlen.
Unterdessen hat der Schreckensruf »Feuer, Feuer!« weithin ein schreckliches Echo gefunden. Entsetzt stürzen die Nachbarn auf die Höfe, auf die Straße, schreien jammernd nach den Spritzen, aber Keiner hat die Geistesgegenwart, selbst nach denselben zu eilen; Alle sind rathlos, denn noch ist von freiwilliger Feuerwehr in der Stadt nicht die Rede.
Endlich, als das Feuer bereits in gewaltigen Flammen zur einen Hälfte des Daches hinausschlägt, mit einem Regen von Funken die nächste Umgebung überschüttend, während der Rauch in dichter Wolke über den Häusern der Nachbarn sich lagert, als bereits ein Heer von unberufenen Rettern sich in das Wohnhaus gedrängt und Alles, ohne Rücksicht und Bedacht, auf die Straße hinabgeworfen hat, wo ein wüster Menschenhaufen sich um die noch nicht zerbrochenen Sachen reißt – da erst rasselt die erste Spritze heran.
Der Doctor und Heinz kämpfen unterdessen mit versengtem Haar und glimmenden Kleidern einen vergeblichen Kampf; denn was vermögen die paar Eimer Wasser, die Weinthal und der Kutscher, Annettchen und Emma keuchend die Treppe hinauf bringen, gegen des entfesselten Elementes Wuth?
»Zurück,« ruft der Doctor, »ohne Spritzen geht es nicht!«
Sie fliegen fast die Treppe hinab, den Spritzen zu; aber ach, der Mann, der zuerst mit seinen Pferden am Spritzenhause gewesen, hat nie solch ein Ding gefahren und hat sie herbeigebracht ohne Schlauch!
»Den Schlauch, den Schlauch!« schreien nun hundert Stimmen; aber es dauert eine Weile, bis Einige sich entschließen nach ihm zu laufen. Doch da kommt die zweite Spritze! Noch ist Rettung möglich, nur rasch her mit ihr! Die Spritze ist da, auch der Schlauch ist da – aber das Pumpenwerk läßt sich nicht bewegen!
Endlich die dritte Spritze, die anlangt, läßt sich in Thätigkeit setzen, aber unterdessen sind der Doctor und Heinz, die nicht unthätig zusehen können, wie ihre Habe verbrennt, schon längst wieder oben und kämpfen den bösen Kampf unausgesetzt weiter. Sie haben ein großes Wasserfaß hinaufgeschafft, aus dem sie nun schöpfen, während Einige von den Wenigen, die sich nicht damit begnügen, neugierig zuzusehen, oder gar unter dem Vorwande zu retten, im Vorderhause plündern, aus Eimern es immer wieder füllten.
Ist es die Thätigkeit der Spritze, hat das Feuer neue Nahrung gefunden? Genug, ein erstickender Rauch erfüllt jetzt auch den bisher noch freien Raum des Bodens. Halb erstickt, die Kleider von Zeit zu Zeit mit Wasser begießend, um sie vor dem Anbrennen zu schützen, stehen Vater und Sohn da. Ihre Arbeit ist vergeblich, ist nutzlos; sie wären dort unten weit mehr am Platze – sie wissen das, aber sie bleiben eigensinnig da und gießen fort und fort das spärliche Wasser in die Flammen.
Sie bemerken nicht, daß das Faß gleich erschöpft ist; sie nehmen nicht wahr, daß Niemand mehr neues Wasser herbeibringt; sie hören nicht den verzweifelten Schrei aus tausend Menschenkehlen, als plötzlich die ganze Gallerie in Flammen steht. Erst als der letzte Tropfen Wasser verbraucht ist, ergreift der Vater den Sohn am Arm und reißt ihn mit sich fort dem Ausgange zu – dort schlägt die lichte Flamme ihnen entgegen.
»Wir sind verloren!« ruft der Doctor dumpf.
»Noch nicht, Vater, noch nicht! Zum Kanal!« ruft der Sohn, und Beide eilen durch den dichten Rauch dem Giebel zu, in dem sich eine auf den Kanal führende Luke befindet. Mit tappender Hand fährt Heinz an der Wand hin, endlich findet er die Luke und stößt sie auf. Die Giebelseite des Hauses ist noch frei, aber der Vater ist nicht mehr an seiner Seite. Heinz stürzt noch einmal in den Rauch zurück, stolpert und fällt – Gottlob, es ist der Vater, über den er gefallen. Er ergreift ihn und schleppt ihn mit aller Kraft zur Luke, zur frischen Luft. Von der andern Seite des Kanals her hat man sie bemerkt. Heinz sieht, wie die Leute unruhig hin und her laufen; er sieht, wie der Großvater und Lelia, auf den Stufen des Rechbergschen Hauses auf den Knien liegend, für ihn beten, denn man hat keine Leitern! Er möge hinabspringen, hört er heraufrufen. Er hört auch, wie der eine Theil des Daches krachend einstürzt.
Die Gluth, der Rauch ersticken ihn fast; er stößt zuerst den wie leblos daliegenden Vater hinab, hört den schweren Körper auf einer der Querstangen hart aufschlagen, sieht das Wasser hoch aufspritzen und springt nun selbst nach. Die Sinne vergehen ihm. Er fühlt nicht, wie er in's Wasser stürzt, wie man ihn herauszieht und ihn neben den Vater legt, indem man Beide für todt hält. Er sieht nicht, wie die Flamme auch das Wohnhaus ergreift; er hört das Krachen nicht, mit dem das Dach, unter dem er erwachsen ist, und mit ihm der Wohlstand des Vaters einstürzt; er hört nicht Weinthals Jammergeschrei, als er sich über seinen todten Herrn wirft.
Aerzte eilen herbei und untersuchen Beide. Der Vater ist erstickt, der Sohn lebt noch. Man bringt die Leiche des Vaters und den betäubten Sohn in das Haus des todten Schwagers, während die entfesselten Flammen jubelnd und knisternd ihr wildes Werk vollenden.