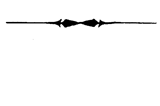|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Der folgende Tag fand Heinz schon früh auf. Er mußte zu Hellberg, mußte von ihm Näheres über Frau von Oehe erfahren. Warum ist sie so bleich, woher rührt die stille Trauer, die dieser Frau ganzes Wesen erfüllt? Er war oft bei Hellberg gewesen, aber er bemerkte erst heute, daß die Fenster die Aussicht auf Lindenruh boten. Er setzte sich mit dem Gesicht gegen das offene Fenster und sah durch die grünen Buchenwälder Anna zur Kirche gehen – das war die Stunde, in der sie auf der Orgel spielte.
»Warum hast Du mir früher nie von Deiner Cousine gesprochen?« fragte er und sah Hellberg prüfend an.
»Es bot sich keine Veranlassung dazu,« erwiderte dieser in seiner ruhigen Weise. Er schien nicht gerade zu wünschen, daß sie bei diesem Thema blieben, aber es schien ihm auch nicht unangenehm zu sein.
»Ich komme zu Dir, um Dich ein wenig über sie auszufragen,« sagte Heinz. »Willst Du mir das erlauben?«
»Gewiß, sehr gern. Was willst Du wissen?«
»Zunächst, warum sie so traurig ist. Auch wenn sie lächelt, behält ihr Gesicht den Ausdruck der Melancholie.«
»Sie war nicht immer so, Heinz. Es gab eine Zeit, in der sie so fröhlich war, wenngleich immer viel sanfter, wie Marie. Es gab eine Zeit, in der es auf viele Meilen umher keine beliebtere und leidenschaftlichere Tänzerin gab als sie.«
Wäre Heinz weniger aufgeregt gewesen, so hätte er bemerkt, daß Hellberg nur ungern sprach und er hätte ihn geschont, so aber fragte er gespannt:
»Nun und was geschah?«
»Sie wurde von einem schweren Unglücke betroffen.«
»Nun, nun?«
»Sie hat ihr einziges Kind im Schlafe erdrückt, Eichenstamm!«
»Entsetzlich!«
»Ja, Eichenstamm, es war entsetzlich.«
Sie schwiegen Beide und Heinz hörte in weiter Ferne klagende Orgeltöne und das Herz wollte ihm brechen vor tiefem Mitleide.
»Sie war immer etwas phantastisch,« fuhr Hellberg nach einer Weile fort, »und die seltsamsten Gefühle lagen in ihr dicht nebeneinander. Lange fürchteten wir für ihren Verstand, dann lange für ihr Leben; aber sie überwand den Schlag und seitdem ist sie so, wie Du sie kennen gelernt hast: mild und freundlich gegen Jedermann, unter heitern Menschen auch heiter; aber Du hast recht, sie lächelt nur mit dem Munde, nicht mit dem Herzen. Sie ist herzleidend und muß sehr geschont werden. Jede starke Aufregung kann ihrem Leben ein plötzliches Ende bereiten.«
»Wie konnte sie dann neulich tanzen?«
»Es war eine der Tänzerinnen plötzlich erkrankt und, gefällig wie sie ist, trat sie für dieselbe ein, um nicht der Schwester das Fest zu verderben. Sie bedurfte dazu keiner Vorbereitung, sie kannte den Tanz. Nachher schien die alte Tanzlust über sie gekommen zu sein.«
»Ach, Hellberg, wie tanzt sie herrlich!«
Hellberg nickte mit dem Kopfe, schwieg aber.
»Und wie war der Mann?«
»Er war ein guter, lieber Mensch. Er hatte ebenfalls etwas sehr Phantastisches in seinem Wesen, war ein warmer Patriot und ein echter Cavalier. Er trug seine Frau auf Händen, aber ich glaube nicht, daß er ihr gewachsen war, daß er sie verstand.«
»Nun, und wie starb er?«
»Er starb wenige Monate nach dem Kinde. Als man der Frau, die damals, schwer krank, beim Vater war, davon erzählte, da sagte sie: Auch das noch! Nun, wie Gott will!«
»Glaubst Du, daß sie ihn sehr geliebt hat?«
»Ja, aber ich glaube doch nicht, daß er der Rechte war.«
»Warum nicht? Warum nicht?«
»So etwas läßt sich nicht durch Gründe beweisen, Eichenstamm, man fühlt das. Man kann natürlich auch irren, aber meist irrt man nicht.«
»Vor etwa sechs Jahren. Anna hat sehr jung, mit 17 Jahren, geheirathet und war nur zwei Jahre vermählt.«
»Bist Du viel im Hause gewesen?«
»In welchem Hause, in dem meines Onkels oder in dem Oeheschen?«
»In dem Deines Onkels.«
»Ja, ich bin dort erwachsen; ich wurde mit Anna zusammen erzogen.«
Heinz dachte an Lelia. »Wurde sie Dir nicht gefährlich?« fragte er.
»Nein, wir stehen zu einander wie Geschwister.«
Heinz setzte in diese Angabe nicht den mindesten Zweifel. Wenn Hellberg ihm jetzt angeboten hätte, für ihn um Anna zu werben, so hätte er darin nichts Auffallendes gesehen.
»Ich liebe Deine Cousine,« sagte er.
»Ist das nicht etwa zu viel gesagt, Eichenstamm? Du kennst sie erst seit einigen Tagen.«
»Was thut das? Die Liebe kommt wie der Sturmwind und zählt die Zeit nicht nach Minuten.«
»Dann geht sie vielleicht auch wie er.«
»Gehen, gehen! Hellberg, Du sprichst wie der Blinde von den Farben. Was einmal den Menschen ganz erfüllte, seine Seele ganz einnahm, das kann ihn nimmermehr wieder ganz verlassen. Dieses Blut, das mir so heiß zum Herzen dringt, kann vergehen, ja – dieses frohe Leben in mir kann erlöschen, es ist wahr, aber diese Liebe kann nimmer vergehen, nie; denn ob auch die Pulse stocken, die Seele, die Seele lebt ewig. Ewig, Hellberg, ewig. Für dieses Gefühl giebt es keine Zeit, für dieses Gefühl giebt es kein Vergessen, kein Aufhören!«
So sprach Heinz fort und Hellberg hörte ihm schweigend zu. Dann ging Heinz. Als er gegangen war, bedeckte Hellberg sein Gesicht mit den Händen und seufzte schwer.
»Auch das noch!« murmelte er. »Ist es denn noch nicht genug der Qual? Ist es denn nicht genug, daß ich den Becher schon einmal bis auf die Neige geleert habe? Muß ich den unerträglichen Kampf noch einmal kämpfen? Wieder ruhig dabeistehen und müßig zusehen, wie sie abermals irrt, denn – auch er ist nicht der Rechte. Er wird sie zerbrechen und bei Seite werfen und ich – ich werde das nicht ändern können!«
Seitdem war Heinz oft in Lindenruh. Gleich Anfangs trieb es ihn täglich hinaus; aber in der ersten Zeit kehrte er oft kurz vor dem Dorfe wieder um und irrte dann bis zum Abend in den Bergen umher; später war er fast täglich im Pfarrhause. Marie sprach kein Wort mit ihm und machte aus ihrer Antipathie kein Hehl; der Pfarrer ließ Heinz gewähren. Er war eine humoristische und doch auch sehr ideale Natur und ließ die Dinge gern ihren Gang gehen, nur im dringendsten Fall in sie eingreifend. Er erkannte bald, daß Heinz hochmüthig und selbstsüchtig war; aber er hatte so oft gesehen, daß aus solchen Jünglingen tüchtige Männer wurden, daß er sich nicht sonderlich darum grämte – dann sah er auch, wie sehr Anna Heinz liebte, und er kannte sie hinreichend, um zu wissen, daß ihre Gefühle sich nicht durch vernünftige Erwägungen beeinflussen ließen – so that er, als sehe und höre er nichts.
Die Beiden verlebten selige Tage. Sie waren nicht von der Art, die das rasch empfangene Gefühl lange sorgfältig verbirgt, lange vor sich selbst, länger vor dem Geliebten. Sie sahen sich an und jeder Blick sprach: »Ich liebe Dich!« Wenn sie Anfangs allein in den Wald gingen, sprachen sie fast kein Wort. Sie gingen schweigend neben einander her und hörten, wie die Vögel sangen: »sie lieben sich,« wie die Bächlein plätscherten: »sie lieben sich,« und wie die Baumwipfel rauschten nach derselben holden Melodie. Wenn sie bergan stiegen, dann stützte sich Anna auf Heinzens Arm und sie fühlten mit Entzücken, wie ihre Pulse gleichmäßig schlugen und ihr Athem gleichmäßig ging. Wenn sie auf dem Gipfel des Berges standen und hinabschauten in die Thäler tief unter ihnen und hinauf zum blauen Himmel über ihnen, da drückte Anna nicht etwa leicht auf Heinzens Arm, nein, sie standen ganz still, ganz unbeweglich und fühlten, wie ihre Seelen übergingen in einander und eins wurden, und sie vergaßen Alles, was sie da unten im Thale geängstigt und verwirrt hatte.
Dann kam eine Zeit, da redeten sie mit einander holde Worte. Da sprachen sie mit einander von der Jugendzeit, und ein sonniger, heller Schein spielte um das Haupt deß, der da sprach, und fröhliches, holdseliges Kinderlachen klang in die Luft und heimliches Kichern von fröhlichen Kindern, die daheim geblieben sind, da die Eltern ausgingen, und die sich versteckt haben im halbdunkeln Zimmer, und die Eichkätzchen spielten unterdeß in den Buchenkronen über der Moosbank, auf der die Beiden saßen.
Und wieder sprachen sie dann von lustigen Schulgeschichten und neckischen Tanzstunden und fröhlichen Ausfahrten.
Da waren sie nun schon herzliche Freunde geworden. Und als sie einander herzliche Freunde geworden waren und treue Gesellen, da sprachen sie mit einander auch von anderen Dingen. Von solchen Dingen, von denen wir leise sprechen, sehr leise, als ob wir uns schämten, das nun offenbar zu machen, was wir so lange ängstlich verborgen haben; von solchen Dingen, bei denen uns das Herz stockt und die Thräne aus dem Auge quillt, und wir wenden uns ab, sie zu verbergen. Dann rückt der Lauschende dem Sprechenden näher und drückt ihm die Hand und streichelt sie mitleidig und drückt sie an die Lippen und stammelt Worte des Trostes. Und tiefer beugt sich und erinnerungsschwer das müde Haupt und lehnt sich vertraulich an des Andern Brust und lauscht entzückt dem heftigen Schlagen des Herzens. Dann fahren liebe Hände über das thränenfeuchte Antlitz und streichen ihm die langen, schwarzen Haare zurück, und er küßt sie auf die Augen, die Lippen suchen sich wie im Halbschlaf und finden sich und schließen sich fest zusammen. Dann umschlingen kräftige Arme den schlanken Leib und wieder sucht sich der Kopf sein trautes Nestchen und sie hört nun wieder süßes Liebesgeflüster und fühlt nun wieder liebes Streicheln. Verschwunden ist der Kummer, verschwunden die Sorge; jetzt ist sie da, die Seligkeit, die längst ersehnte, erhoffte. Jetzt heißt es still sein, regungslos still und mit dem Strome seligen Vergessens treiben. Der blaue Himmel, die grüne Erde, sie treiben mit; nur still, still, still.
Nun sind sie einig. Als herzliche Freunde, als treue Gesellen wanderten sie dort hinauf zur Moosbank; jetzt steigen sie als Verlobte hinab, gehen ruhig neben einander. Was soll nun alle Aufregung, was soll des Herzens unruhiges Pochen? Nun ist sie ja vorüber, die arge, die wonnige Zeit des Hangens und Bangens, nun sind sie ja verbunden für alle Zeit.
Leichtfüßig eilt sie voraus, er springt ihr nach und holt sie ein, nun hält er sie.
»Wir kommen noch früh genug zu den Menschen!« sagt er. »Wir, wir Beide! Lerchen, was seid ihr so träge, so mißmuthig! Was ist euer Jubel gegen den Jubel in meinem Herzen! Nicht mehr bin ich ›ich‹, ein einsames, sehnsüchtiges ›ich‹, jetzt bin ich ›wir‹, ein Theil von ›wir‹, ein glückliches, beseligtes ›wir‹!«
»Nun sieh mich an, ob mein Haar nicht verwühlt; wir müssen ordentlich unter die Leute kommen.«
»Wir, wir! Entzückendes ›wir‹! Ja, Dein Haar ist verwühlt; ich will es ordnen.«
»Geh' doch! Wo suchst Du mein Haar auf den Lippen?«
»O laß, was kümmert uns das Haar!«
»Nein, nein, wir müssen –«
»Wir müssen gehorchen und müssen schweigen.«
Wir schwiegen lange, dann fragen wir wieder:
»Nun, wie ist's mit dem Haare?«
»Wir sollen uns das Haar ein wenig ordnen und wir sollen nicht so zerstreut sein.«
»Ach ja, das Haar – und nicht zerstreut sein – ganz recht, ja das Haar – aber wie sollen wir denn das machen; wir können ja nicht hinweg über die Augen?«
So wurde aus Heinz Eichenstamm und Anna Oehe ein Brautpaar.
Unten im Dorfe, dort wo der Waldweg in die Dorfstraße mündet, klingt es wie lauter Jubelgesang. Des alten Schusters Kanarienvögel stimmen ihn an dem Brautpaare zu Ehren. Aus dem Schulhause dort dringen jauchzende Gratulanten hervor in hellen Haufen. Wissen sie es denn, daß die schöne Frau mit dem traurigen Antlitze, die sie so herzlich lieben, nun nicht mehr traurig ist? Wie sie sich um sie drängen, sie traulich beim Kleide fassen, ängstlich auf sie blicken, wenn der fremde Mann neben ihr die Kleinen emporhebt und stürmisch küßt. Wissen es denn schon Alle, auch die Frauen vor den Thüren, daß sie heute so ganz besonders freundlich grüßen, oder ist's nur der Wiederschein von der Röthe auf der Beiden Wangen, die ihre Gesichter so rosig färbt?
Da steht nun das Pfarrhaus unter den grünen Linden. So stand es doch schon vor vielen Jahren, gerade so, und doch ist es heute wie verwandelt.
In der Schreibstube sitzt der Vater. Als er sie eintreten sieht, da braucht er nicht erst zu fragen, was geschehen ist. Er weiß nicht, ob er sich freuen soll oder weinen; eines weiß er: der Herr lenkt alle Dinge zum Besten. So schließt er die Tochter in tiefer Bewegung an's Herz, und drückt Heinz herzlich die Hand.
Dem Becher der Wonne soll auch der Wermuth nicht fehlen. Als Marie hereintritt und die Gruppe sieht, da wendet sie sich entrüstet ab und wirft hinter sich die Thür klirrend in's Schloß. Anna eilt ihr nach und umfaßt sie.
»Laß mich, laß mich,« ruft Marie, sich sträubend, »ich hasse Dich!«
»Marie, was redest Du!«
»Laß mich, ich bin Deine Schwester nicht mehr! Ich will Dich nicht mehr sehen!«
»Marie, wenn Du wüßtest –«
»Wenn Du wüßtest, was Du mir eben angethan hast, was Du Dir und dem Vater angethan hast und Hellberg und uns Allen! Und weshalb? Um dieses abscheulichen Menschen willen.«
Anna läßt die Schwester los und wendet sich ab.
»Das darf ich nun nicht mehr hören,« sagt sie sanft.
Sie hofft, die Schwester werde sich besinnen, ihr nacheilen und sie zurückhalten; aber diese geht trotzig davon. Ihr Herz ist voll Haß und Eifersucht und voll gekränkter Liebe.
»Mich hätte man gewiß ein ›abscheuliches Mädchen‹ nennen können, ohne daß sie davongegangen wäre,« murmelt sie zornig. Sie schließt sich in ihrem Zimmer ein und kommt den ganzen Tag über nicht wieder zum Vorschein.
Unten blieben die Drei traulich beisammen.
»Nun müssen wir auch Verlobung feiern,« sagt Anna und bringt eine Flasche alten Rheinwein.
Hell klingen die Gläser.
»So klangen sie auch vor nun bald dreißig Jahren, da ich mit Deiner Mutter zum ersten Male anstieß,« sagte der Pfarrer und erzählte nun von seiner Verlobung. »Es gehen die Jahre dahin, es wechseln die Formen; die Gefühle bleiben ewig dieselben!«
»Nun will ich es machen, wie mein Schwiegervater selig es damals machte,« schloß der Pfarrer, »und will Euch allein lassen.«
Damit kehrte er wieder in sein Arbeitszimmer zurück.
»Nun mußt Du Dich dort in den Lehnstuhl setzen,« sagte Heinz.
»Warum?«
»Weil ich es so will.«
»Das ist über und über Grund genug, es zu thun. So, und was nun?«
»Nun mußt Du die Hände unter den Kopf legen.«
»Ist es so gut?«
»Nein, noch nicht ganz. Die Flechten müssen mehr hervorquellen. Siehst Du, so wäre es ungefähr recht, wenn Dein Haar nicht schwarz wäre, sondern braun.«
»Liebster Heinz, das kann ich leider nicht ändern.«
»Nein, das kannst Du nicht ändern.«
Heinz hatte sich auf einen Schemel zu ihren Füßen gesetzt und sah ihr traumvergessen in's Antlitz.
»Nun, und was muß ich jetzt thun?«
»Jetzt mußt Du mir ein Mährchen erzählen; aber erst mußt Du die Hände wieder unter dem Kopfe hervorheben und sie mit den meinen verschränken. So – nun kannst Du erzählen.«
»Es war einmal ein kleines, einfältiges Mädchen –«
»Nein, es muß eine kleine, kluge Prinzessin sein.«
»Gut; es war einmal eine kleine, kluge Prinzessin, die war ihres Vaters einziges Kind. Er hatte wohl auch andere Kinder gehabt, die waren aber alle jung gestorben. Da liebte denn der Vater das kleine Mädchen über alle Maßen.«
»Dann war er ein sehr lieber Mann.«
»Das war er. Er war aber auch ein sehr reicher und mächtiger Mann, darum konnte er aus aller Welt kluge und weise Frauen kommen lassen, ihm das Kind zu erziehen. Da war die Eine, eine würdige, alte Frau, die kannte die ganze Vergangenheit und wußte von Allem und Jedem, das je die Sonne beschienen. Sie wußte, wer vor viel hundert Jahren dort oben in der Burg gehaust, die jetzt von jenem Berggipfel in Trümmern auf das Königsschloß herniederschaut, und sie erzählte die schönsten Geschichten von Königen und Königskindern, von schönen Helden und edlen Frauen. Sie war immer sehr ernst und streng, was wohl daher kam, daß sie oft auch von blutigen Schlachten und wildem Aufruhr erzählte; aber die Prinzessin liebte sie doch.
»Dann war da eine andere Frau, die war ein wenig geschwätzig. Sie war weit herum gewesen in der Welt, hatte viele Länder und Menschen gesehen, kannte alle Berge und Thäler und wußte sie mit Namen zu nennen. Sie wußte, wo der Bach blieb, der an der Königsburg vorübereilte, und erzählte, wo der Reis herkam im Pudding und der Zucker auf dem Kuchen.
»Da war eine Dritte, das war eine praktische Frau. Die kannte Alles um sich her und wußte von jedem Dinge die ganze Verwandtschaft. Sie wußte, wie das Gras wuchs, wie die Vögel hießen, die in den Bäumen sangen, und die Käfer, die durch das Moos krochen. Wenn sie mit der Prinzessin im Burggarten war und diese sich eine Blume brach und sich an ihrem Dufte erfreute, dann sagte sie: »Das ist Alles noch gar nichts. Dort und dort hat diese Blume eine Cousine im sechsten Grade – wie die blüht! Wie die duftet!
»Dann war da noch eine Vierte. Die stand bei den Dreien nicht eben in großem Ansehen und wurde nicht recht für voll angesehen. Sie hatte weißes Haar, aber ein rothes, frisches Gesicht. Sie trug immer ein sehr kurzes Kleid, an dem eine schneeweiße Schürze befestigt war, und hatte die Aermel weit zurückgeschlagen. Sie backte die schönsten Kuchen und hatte immer eine ganze Menge großer Töpfe um sich, irdene und gläserne. Die stopfte sie voll bis an den Rand und band ein Tuch darüber, damit nichts heraus konnte. Sie war eine resolute Person und ein wenig kurz angebunden, aber die Prinzessin liebte sie sehr.
»Das waren die weisen Frauen, die über die Prinzessin wachten. Dann hatte sie aber noch ein paar Gespielinnen, die ihr der Vater ausgesucht hatte, damit sie nicht so gar allein erwachse.
»Die eine war ein tolles, ausgelassenes Mädchen. Was die erste der weisen Frauen erzählte, das machte sie sich auf ihre Weise zurecht und gab es dann anders wieder. Hatte die Alte von einem Helden erzählt, so wurde nun ein Halbgott daraus und aus der Schlange wurde ein gräulicher Lindwurm. Sie war nicht ganz zuverlässig und übertrieb gern ein wenig. Auch liebte sie es, die kleine Prinzessin gruseln zu machen, und malte darum zuweilen etwas in's Schwarze.
»Die zweite Gespielin war von anderer Art. Von der Vergangenheit sprach sie nie, nur von der Zukunft. Ach, wie herrlich sprach sie! Sie hatte die schönsten Bilder. Wenn die Prinzessin sie fragte: ›Wo werde ich nach zehn Jahren sein?‹ dann zeigte sie ihr ein Bild, auf dem war die Prinzessin deutlich zu sehen. Sie trug ein weißseidenes Kleid und einen Myrthenkranz im Haar und stand in einer weiten, großen Kirche. Dann fragte die Prinzessin: ›Wer wird neben mir stehen?‹ ›Der Rechte!‹ gab die Gespielin zur Antwort. ›Und woran soll ich ihn erkennen?‹ ›An drei Dingen. Daran sollst Du ihn erkennen, daß er einen Blick hat wie ein Adler, der über den Menschen schwebt; daran, daß er eine hohe Stirn hat, in der Platz ist für große Gedanken; und endlich daran, daß sein Mund so fest geschlossen ist, daß er nie nein sagen kann, wenn er einmal ja gesagt hat. Und noch an einem Umstande sollst Du erkennen, ob er der Rechte ist. Daran, daß, wenn Du in seinem Arme liegst, ich von Deiner Seite verschwinde und Du mich nicht vermissen wirst.‹
»So sprach die Gespielin oft, wenn sie allein war mit der Prinzessin; denn wenn die alten Frauen dabei waren, dann suchte sie nur zu erklären, was diese eben erzählten.
»So wuchs die Prinzessin heran und als sie ein großes Mädchen geworden war, gefiel sie vielen Männern, und die Prinzen kamen von weit und breit und freiten um sie. Unter ihnen aber war einer, den hielt sie für den Rechten; denn er hatte einen Blick wie ein Adler, der über den Menschen schwebt, und er hatte eine hohe Stirn, in der Platz war für große Gedanken, und er hatte einen Mund, der so fest geschlossen war, daß er nicht nein sagen konnte, wenn er einmal ja gesagt hatte. Da war die Prinzessin voll Jubel, schmückte sich und rüstete sich, und das ganze Schloß und seine Bewohner schmückten sich und rüsteten sich zur Hochzeit. Als aber die Prinzessin mit dem Prinzen vor dem Traualtare stand, da sah sie, daß ihre Gespielin neben ihr war. Das that der Prinzessin sehr leid, denn sie hatte den Prinzen sehr lieb. Dann freute sie sich aber auch darüber, denn sie liebte auch die Gespielin.
»Mit den Beiden zog die Prinzessin nun hinaus aus dem väterlichen Schlosse, hinein in die weite Welt. Da erfuhr sie viel Leid, und als sie in ihres Vaters Schloß zurückkehrte, da war sie wieder allein und nur die Gespielin war bei ihr. Die tröstete sie, so gut sie konnte. Da kam nach Jahr und Tag ein anderer Mann und kehrte ein im Schlosse. Der war kein Prinz, er war nur ein deutscher Student; aber als er in den Saal trat, da eilte die Gespielin auf die Prinzessin zu, küßte sie stürmisch und rief: ›Nun hast Du mich nicht mehr nöthig, das ist der Rechte!‹ Dann verschwand sie. Die Prinzessin rief sie nicht zurück und vermißte sie nicht, obgleich sie ihrer freundlich gedachte, denn Jener war der Rechte.«
Anna schwieg.
»Nun?« fragte Heinz.
»Nun ist die Geschichte zu Ende.«
»Wie schade!«
»Ja, dabei läßt sich nichts thun. Nun mußt Du mir sagen, warum ich im Lehnstuhle liegen und meine Hände in Deine verschränken und Dir ein Mährchen erzählen mußte.«
»Das will ich Dir sagen, Anna. Weil ich, als ich ein kleiner Knabe war, eine Mutter hatte, eine heißgeliebte Mutter. Sie war sehr krank und da saß ich denn oft zu ihren Füßen, wie jetzt zu Deinen, und sah ihr in's Gesicht, wie jetzt in Deines, und hörte ihr Märchen, wie jetzt Deines. Ach, meine Mutter starb. Seitdem bin ich umhergeirrt durch die weite Welt, lieblos, freudlos. Nun habe ich wieder ein Herz gefunden, Liebe gefunden, da will ich dort wieder anfangen, wo ich einst aufhören mußte.«
Anna sprang auf und umschlang seinen Hals.
»Du bist der Rechte, Heinz,« sprach sie leise; »Du läßt die Geliebte dort anfangen, wo die Mutter aufhörte.«